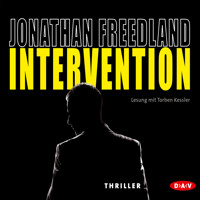9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Madison Webb, Star-Journalistin der L. A. Times, ist fassungslos, als ihre jüngere Schwester an einer Überdosis Heroin stirbt und die Polizei sich weigert, Ermittlungen aufzunehmen. Denn Abigail war ein Beispiel an Tugendhaftigkeit. Madison beginnt zu recherchieren und stößt bald auf weitere mysteriöse Todesfälle. Geht etwa ein Serienmörder um, der junge Frauen mit Drogencocktails tötet? Aber warum beharrt die Polizei so darauf, dass kein Verbrechen vorliegt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Danksagungen
Über den Autor
Jonathan Freedland ist preisgekrönter britischer Journalist. Nach Stationen bei der The Washington Post, The New York Times, der Los Angeles Times u.a. arbeitet er heute überwiegend als Chefredakteur der Meinungsseite bei The Guardian. Zudem moderiert er auf BBC Radio 4 die zeitgeschichtliche Serie The Long View. Mit seinem Thrillerdebüt Die Gerechten, welches unter dem Pseudonym Sam Bourne erschien, war er monatelang Nummer 1 der The Sunday Times-Bestsellerliste mit über einer halben Million verkaufter Exemplare.
JONATHAN FREEDLAND
DAS JAHR DER RACHE
THRILLER
Aus dem Englischen von Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Jonathan FreedlandTitel der englischen Originalausgabe: »The Third Woman«Originalverlag: HarperCollins Publishers, London, UK
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Lars Schiele, HamburgTitelillustration: © plainpicture/goZooma/Stephan JouhoffUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4054-9
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für meine Schwester Fiona (1963–2014),eine Frau voll Kraft, Weisheit, Heiterkeit und beständiger Liebe
Prolog
Es war der letzte Januartag, und Neujahr stand bevor. In Los Angeles war es seit über einer Woche ruhig. Nur am Flughafen herrschte Betrieb. Dort stiegen die Auslandschinesen an Bord von Maschinen in die Heimat und überquerten den Ozean, um aufopfernde Väter zu besuchen, vernarrte Mütter und manchmal auch eine verlassene Ehefrau. Die Büros schlossen früher: Wenn niemand angerufen und kein Geschäft unter Dach und Fach gebracht werden konnte, hatte es wenig Sinn weiterzuarbeiten. Es war die zweite Ruhepause innerhalb von sechs Wochen, aber sie erschien weniger herbeigewünscht als die erste und wirkte eher unfreiwillig, wie das Verstummen einer Stadt während eines Streiks oder an einem landesweiten Trauertag. Dennoch verliehen besonders nach Einbruch der Dunkelheit die roten Lampions an den Laternenpfählen und Bäumen dem Großraum Los Angeles einen Anstrich fröhlicher Gastfreundschaft.
Nicht dass sie das sehr tröstete. Die Nacht war nie ihre Zeit gewesen. Sie war ein Kind des frühen Morgens und stand seit ihrer Kindheit mit der Sonne auf, schon immer. Sobald der Himmel nicht länger blau war, verlor sie das Interesse an ihm. Obwohl es Winter war, blieb sie dieser Gewohnheit treu und rannte in den Morgen hinaus, kaum dass er angebrochen war.
Noch ein Grund, weshalb sie hasste, was sie tun musste. Schlimm genug, hier zu arbeiten, aber die Uhrzeit war noch schlimmer. Diese Stunden waren zum Schlafen da.
Trotzdem schaffte sie es, sich fröhlich bei den Mädchen zu verabschieden, die Klamotten in einen Stoffbeutel zu stopfen und ihn sich mit einer geübten Bewegung über die Schulter zu hängen. Auch dem Türsteher schenkte sie ein Lächeln, obwohl sich ihr Kiefer angespannt anfühlte, nachdem sie den ganzen Abend lang eine nie wankende Miene des Entzückens aufgesetzt hatte.
Während sie über den Parkplatz zu ihrem Wagen ging, hielt sie den Blick gesenkt. Diese Lektion hatte sie früh gelernt: drinnen möglichst Blickkontakt vermeiden, aber draußen auf keinen Fall irgendjemanden ansehen.
Sie richtete den Funkschlüssel auf die Autotür, aber er gab nur ein nutzloses, dumpfes Klicken von sich. Drei weitere Versuche brachten ihr bloß drei weitere leere Klicks. Die Batterie in dem verdammten Ding war so gut wie leer. Sie schloss von Hand auf, stieg in den Wagen und verriegelte die Tür sorgsam von innen.
Die Rückfahrt ging schneller als gewöhnlich, weil die Straßen wegen des Neujahrsfestes leer waren. Sie schaltete auf einen Radiosender, der Oldies spielte, und versuchte, ihren Abendjob zu vergessen. Ab und zu schaute sie in den Rückspiegel, aber außer dem Smog gab es herzlich wenig zu sehen.
Am Apartmenthaus hielt sie den Schlüssel in der Hand bereit, und die Eingangstür öffnete sich problemlos. Da sie zu müde war, sie hinter sich zuzuziehen, ließ sie sie von selbst zuschwingen. Ein weiteres Mal brachte irgendetwas sie dazu, über ihre Schulter zurückzublicken, aber sie sah nichts in der Dunkelheit. Deshalb hasste sie die Nachtarbeit: Vor jedem Schatten zuckte sie zusammen.
Als der Aufzug sich auf ihrem Stockwerk öffnete und sie den Schlüssel in die Wohnungstür einführte, war er bereit für sie. Sie hatte nichts gehört, und seine Gegenwart bemerkte sie erst, als er ihr seinen Handschuh auf den Mund presste. Sie schmeckte Leder und Schweiß. Schlimmer noch war der Atem. Der hastige, warme Atem eines Fremden in ihrem Nacken, der im nächsten Moment um ihren Hals strich, als wollte er sie einhüllen.
Sie hatte versucht, etwas hervorzustoßen. Keinen Schrei, ein Wort. Wenn das Wort nicht erstickt worden wäre, hätte sie vielleicht gerufen: »Was?«
All das war in der ersten Sekunde geschehen. Jetzt, in den Augenblicken, die darauf folgten, hatte sie Zeit, sich zu fürchten. Die Angst schoss ihr pochend vom Herzen durch die Adern ins Gehirn, das sich mit roten und gelben Blitzen zu füllen schien, und dann in die Beine, die leicht wurden und nachgaben. Aber sie stürzte nicht. Er hielt sie fest gepackt.
Sie spürte, wie er sie mit seinem Gewicht gegen die Wohnungstür drückte, die schon aufgeschlossen war, und diese so kräftig aufstieß, dass Holz vom Rahmen absplitterte. Als sie drinnen war, schloss er die Tür – er achtete sorgfältig darauf, sie nicht zuzuknallen.
Jetzt stieg der Schrei in ihr auf, versuchte sich einen Weg ihre Brust hinaus zur Kehle zu bahnen, prallte jedoch gegen die lederne Hand und schien wieder in sie zurückgedrückt zu werden. Er nahm die linke Hand von ihrer Schulter und bewegte sie, als suchte er etwas.
Instinktiv versuchte sie sich loszureißen, aber sein rechter Arm war zu stark. Er hielt sie an Ort und Stelle und verschloss ihr gleichzeitig den Mund.
Sie hörte ein reißendes Geräusch: Zerrte er ihr die Kleidung vom Leib? Ihre erste, urtümliche Angst hatte dem Tod gegolten – dass der Mann sie ermorden würde. Die zweite Angst, die der ersten auf dem Fuß folgte, bestand in der entsetzlichen Vorstellung, er könnte ihr seinen brutalen Körper aufzwingen. Sie dachte blitzschnell nach und schloss einen Handel mit sich selbst: Sie würde eine Vergewaltigung aushalten, wenn er sie leben ließ.
Aber das Geräusch stammte nicht von zerreißendem Stoff. Sie sah seine linke Hand vor ihrem Gesicht; zwischen den Fingern spannte sich ein breites Stück silberfarbenes Klebeband. Gekonnt legte er es über ihren Mund und ließ ihr dabei nicht einmal einen Sekundenbruchteil Zeit, einen Laut hervorzustoßen.
Nun packte er ihre Handgelenke und hielt sie mit einer einzigen Hand fest. Noch immer war er hinter ihr, noch immer ließ er sie nicht sein Gesicht sehen. Er schob sie mitten in den Raum vors Sofa. Mit einem Fuß räumte er den Couchtisch zur Seite, dann brachte er sie von hinten zu Fall, sodass sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Teppich lag und den Druck seines Knies auf dem Rücken spürte, das sie an Ort und Stelle hielt.
Das war’s, dachte sie. Er reißt mir die Sachen vom Leib und tut es hier, einfach so. Sie befahl sich, die Gedanken woandershin zu lenken, damit sie überleben konnte, was jetzt kam. Steh es durch, dachte sie. Das schaffst du. Sie schloss die Augen und versuchte sich innerlich abzuschalten. Steh es durch.
Doch er war mit seinen Vorbereitungen noch nicht fertig. Er legte ihr einen schwarzen Stoffstreifen über die Augen und verknotete ihn am Hinterkopf. Als Nächstes drehte der Mann – dessen Gesicht sie noch nicht gesehen, dessen Stimme sie nicht gehört hatte – sie entschlossen, aber nicht grob um. Vielleicht spürte er, dass ihre Überlebensstrategie darin bestand, sich nicht zu wehren.
Er zog eine ihrer Hände über ihren Kopf, sodass sie aussah wie ein Kind, das die Aufmerksamkeit des Lehrers suchte. Im nächsten Moment umgab das Handgelenk eine Art Armreif aus Plastik. Zuerst war er locker, doch dann hörte sie das typische Schnarren, das sie aus der Kindheit kannte, das Geräusch eines Kabelbinders, der zugezogen wird. Ihr Vater hatte damit lose Kabel gebündelt, um hinter dem Fernseher Ordnung zu schaffen; er hatte immer gesagt, dass diese Binder unzerreißbar seien. Jetzt band der Mann damit ihr rechtes Handgelenk. Sie lag am Boden, geknebelt und mit verbundenen Augen, beide Arme hochgezogen und ans Bein der Couch gefesselt.
Sie bemühte sich mit aller Willenskraft, ihr Bewusstsein woandershin zu verlagern. Doch vor Angst klapperten ihr die Zähne. Übelkeit stieg ihr aus dem Magen in den Mund. Lieber Gott, lass es vorbei sein. Lass es zu Ende sein, o bitte, Gott.
Alles geschah so schnell, so … effizient. Dem Vorgehen des Mannes war kein Zorn anzumerken, nur Zielstrebigkeit und Methodik, als wäre es eine Sicherheitsübung, bei der er wohlbekannten Abläufen folgte. Eine seiner Hände war jetzt auf ihrem rechten Arm, aber die Berührung fühlte sich nicht wie das raue Leder an, mit dem er ihr den Mund zugehalten hatte. Sie war leicht, nur eine Fingerspitze, aber sie spürte keine menschliche Haut. Ohne zu sehen, konnte sie nicht sagen, was für ein Material es war, doch die Hand war so dicht vor ihrem Gesicht, dass sie es roch. Latex. Der Mann trug Latexhandschuhe. Jetzt packte sie neues Entsetzen.
Er nahm wieder ihr Handgelenk, und dann spürte sie einen Stich: eine Nadel, die ihr in den rechten Arm gestoßen wurde. Sie schrie auf, aber sie hörte nur einen gedämpften Laut, der von ganz woanders herzukommen schien.
Im selben Augenblick schmolz ihre Angst zusammen und wich unvermittelt einem prickelnden Rausch, einer Welle seligen Behagens. Sie spürte keinen Schmerz, nur tiefes, endloses, unerwartetes Glück. Als ihr das Klebeband vom Mund gerissen wurde, schrie sie nicht. Vielleicht war es ihr gelungen, sich weit weg fortzuschicken, zum Strand von Malibu bei Morgendämmerung, wo die Sonne den Sand küsste. In einen Ozean aus reinem Blau. In eine Hängematte auf einer einsamen Insel im Südpazifik. Oder in eine Schneehütte mitten im Winter, wo bernsteingelber Lichtschein sie wärmte, während sie vor einem knisternden und prasselnden Feuer auf dem Teppich lag.
Von fern hörte sie das Knacken, mit dem der Kabelbinder zerschnitten wurde, dessen Arbeit nun erledigt war. Sie spürte, wie ihr die Binde von den Augen genommen wurde. Sie empfand keinerlei Drang, die Augen zu öffnen oder die Arme zu bewegen, obwohl sie jetzt frei war. Jeder Nerv, jede Synapse, von den Zehen zu den Fingernägeln, war damit beschäftigt, Signale der Wonne an ihr Gehirn zu senden. Ihr Kreislauf war mit guten Gefühlen überflutet; sie war eine Menschenmenge, die sich im Moment der Entrückung auf der Bergspitze versammelte, und jedes Gesicht strahlte vor Entzücken.
Sie empfand ein federleichtes, flüchtiges Gefühl zwischen den Beinen. Eine Hand zog ihre Unterwäsche beiseite. Etwas rieb sich an ihr. Es drang nicht in sie ein. Es störte sie nicht. Etwas Regloses, Glattes ruhte dort an ihrer intimsten Stelle. Seidene Blütenblätter liebkosten ihre Haut.
Eine Sekunde verstrich, und sie war in der abgeschiedenen Zuflucht, sicher vor allem, was je war, trieb in der Flüssigkeit, die sie nährte und hegte, in der niemand sie stören konnte. Sie war im Schoß ihrer Mutter, vollkommen zufrieden, und atmete nur Liebe, Liebe, Liebe.
1
Normalerweise mochte Madison Webb den Januar. Wer unter der goldenen kalifornischen Sonne aufgewachsen ist, empfindet den Winter oft als willkommene Abwechslung. Von der Kälte – nicht dass es in L.A. je wirklich kalt wurde – prickelten die Nerven, und man fühlte sich lebendig.
Aber nicht in diesem Januar. Sie hatte den Monat zwischen nackten, fensterlosen Wänden und Stahl verbracht, in einem der wenigen Winkel von L.A., wo auch während des chinesischen Neujahrsfestes Betrieb herrschte. Ob Tag oder Nacht, die Arbeit hier hörte nie auf. Drei Wochen lang hatte sie dort geschuftet, zwanzig Schichten unter den Dutzenden von Näherinnen, die sich über ihre Maschinen kauerten. Schon der Begriff der Näherin war irreführend. Wie Maddy der Öffentlichkeit von L.A. schon bald klarmachen würde, beschwor das Wort eine Vorstellung von alter Handwerkskunst herauf, während in Wirklichkeit sie und die anderen Frauen am Fließband arbeiteten und ihre einzige Aufgabe darin bestand, auf die Maschinen zu achten, den Stoff gerade in den Schlitz einzulegen und den Rest dem programmierten Roboterarm zu überlassen. Im Grunde waren sie nicht viel mehr als Rädchen in der Maschinerie.
Nur dass die Maschinen besser behandelt wurden als die Menschen. So wollte sie es in dem ersten aus einer Reihe von Undercoverberichten über das Leben in einem Sweatshop, einem Ausbeuterbetrieb mitten in L.A., formulieren. Die Menschen mussten stundenlang an ihren Plätzen stehen bleiben und hatten die Hand zu heben, wenn sie auf die Toilette wollten. Sie wurden gezwungen, bei ihrer Ankunft ihre Handys abzugeben, damit sie nicht heimlich diesen schmuddeligen Keller ohne Tageslicht fotografierten, der nur von ein paar nackten Glühbirnen erhellt wurde, die Maddys Sehvermögen mit jedem Tag merklich schlechter werden ließen.
Das Handy abgeben zu müssen war für Maddy das größte Hindernis gewesen. Sie führte eine Bahn Denimstoff so in die Rollen ein, dass die Kanten aneinander ausgerichtet waren, ehe sie der Nähnadel überlassen wurden. Denn ohne Handy keine Fotos. Mit Katharine Hu, dem Technikgenie der Redaktion, hatte sie eine versteckte Kamera ersonnen. Das Objektiv war in einem Knopf an ihrem Shirt verborgen. Ihre Bilder gelangten über ein dünnes Kabel zu einem Digitalrekorder, der mit Klebeband befestigt über ihrem Po hing. Die Kamera leistete gute Arbeit, sie erlaubte Weitwinkelaufnahmen von allem, worauf Maddy sie richtete: Wenn sie sich einmal im Kreis drehte, erhielt sie eine Panoramaaufnahme des gesamten Raums. Die Kamera nahm Fetzen der Gespräche mit ihren Kolleginnen auf, und mit Walker, dem Vorarbeiter – darunter auch den kostbaren Moment, in dem er eine Frau mit der Anrede »Schlampe« aufforderte, wieder an die Arbeit zu gehen.
Mit beinahe zweihundert Stunden Aufnahmen besaß sie genug Material für eine Reportageserie, die ernsthaft Wogen schlagen würde. Die Kamera hatte einen Vorfall vor zwei Wochen vollständig erfasst, als Walker einer von Maddys Kolleginnen trotz mehrfach wiederholter Bitten eine Toilettenpause verweigert hatte. Als ihr Flehen immer verzweifelter wurde, hatte der Vorarbeiter sie angebrüllt: »Wie oft muss ich dir das noch sagen, shǎ bī?Du hast deine Pause schon gehabt.« Er benutzte das Wort oft, aber in einem Raum voller Frauen eine Frau als dumme Fotze zu bezeichnen, stellte dennoch einen traurigen Höhepunkt dar.
Als die anderen Arbeiterinnen zu brüllen begannen, griff Walker nach dem Schlagstock, der zu seiner pseudomilitärischen, braunbeigen Polyesteruniform gehörte, der Sorte Uniform, wie sie private Wachschützer in Supermärkten trugen. Er setzte die Waffe nicht ein, aber die Drohung reichte. Die weinende Frau brach zusammen, als sie den Schlagstock sah. Im nächsten Moment breitete sich unter ihr eine Pfütze aus. Zuerst dachten alle, es wäre der Urin, den sie nicht mehr einhalten konnte, aber selbst in dem schlechten Licht war bald klar, dass es sich um Blut handelte. Eine der älteren Frauen begriff. »Das arme Ding«, murmelte sie, doch ob sie die junge Frau oder das Baby meinte, dessen Fehlgeburt sie gerade beobachtet hatten, konnte Maddy nicht sagen. Sie war nahe genug gewesen, um die ganze Szene zu filmen. Bearbeitet würde sie sie als Zusatzmaterial zum ersten Artikel online stellen.
Selbst in diesem Moment schrieb sie in ihrem Kopf, sie tippte in Gedanken das, was der zweite Abschnitt des Hauptartikels werden sollte. Dass es in Kalifornien von Sweatshops wie diesen wimmelte, war mittlerweile Allgemeinwissen. Dank der Einwanderer, die im Schutz der Nacht die mexikanische Grenze überquerten, gab es Heerscharen billiger und billigster Arbeitskräfte, ideal, um billig Waren für die US- oder lateinamerikanischen Märkte herzustellen oder zu verpacken. Das war noch keine Neuigkeit. Die Leser der L.A. Times wussten auch, wie es dazu gekommen war: Heutzutage fanden die großen chinesischen Konzerne es billiger, Waren in L.A. herzustellen als in Peking oder Schanghai, denn Arbeit in China kostete mittlerweile zu viel. Was die Leser aber nicht wussten, war, wie es in diesen Löchern wirklich zuging. Maddys Job bestand darin, ihnen das zu vermitteln. Zahlen und ökonomische Zusammenhänge überließ sie den Erbsenzählern in der Wirtschaftsredaktion. Das menschliche Element würde diese Story bekannt machen, die unsichtbaren Arbeiterinnen, die den Preis für billige Kleidung zahlten. Oh, das klang richtig gut. Vielleicht konnte sie das in der Einleitung verwenden. Die unsichtbaren Arbeiterinnen …
Sie hörte ein leises, aber beharrliches Husten. Es stammte von der Frau, die ihr am Band gegenüberstand, ein gekünsteltes Räuspern, mit dem sie Maddys Aufmerksamkeit wecken wollte. »Was?«, hauchte Maddy. Sie blickte an ihrer Maschine hoch und suchte nach einem Rotlicht, das vor einer Störung warnte. Ihre Kollegin zog die Brauen hoch und deutete auf irgendetwas an ihr.
Maddy blickte an sich herunter. Aus dem dritten Knopfloch ihres Shirts guckte eine winzige Kabelschlaufe.
Sie versuchte sie zurückzustecken, aber es war zu spät. Mit vier langen Schritten war Walker bei ihr – schwerfällig und alles andere als fit, aber groß und kräftig genug, um sie bedrohlich zu überragen und ihr den Weg zu verstellen.
»Gib das her. Sofort.«
»Was soll ich Ihnen geben?« Maddy spürte, wie ihr das Herz in der Brust pochte.
»Komm mir jetzt nicht mit so einem tàidù. Ich warne dich. Gib her.«
»Was, einen losen Faden an meinem Shirt? Sie wollen, dass ich mich ausziehe, Walker, ja? Ich glaube nicht, dass Sie das dürfen.«
»Gib einfach her, dann sag ich dir, was ich darf.«
Sein ruhiger Ton machte ihr nur umso größere Angst. Dass er brüllte, war alltäglich. Aber das hier war, wie er wusste – wie auch Maddy wusste und wie alle Frauen wussten, die ringsum standen und schweigend zusahen –, viel ernster.
Sie traf eine Momententscheidung, oder eigentlich traf ihre Hand sie, ehe ihr Gehirn sich etwas überlegen konnte. In einer fließenden Bewegung riss sie sich die winzige Kamera heraus, warf sie auf den Boden und zertrat sie sofort.
Der Vorarbeiter ließ sich auf die Knie sinken und versuchte, die Trümmer aufzulesen: keine leichte Aufgabe für einen Mann seiner Größe. Sie beobachtete ihn wie erstarrt, während er die winzigen Splitter des zermalmten Geräts auf seiner Handfläche sammelte. Er hatte eindeutig begriffen, was sie waren. Deshalb hatte er nicht gebrüllt. Er hatte Maddy in dem Augenblick verdächtigt, in dem er das Kabel zu Gesicht bekam. Ein Aufnahmegerät. Seine Anweisungen waren wahrscheinlich ganz simpel: Aufnahmegeräte waren unter keinen Umständen zu dulden.
Jetzt, wo er sich wieder hochstemmte, hatte sie einen Sekundenbruchteil zum Überlegen. Sie besaß bereits das Material von drei Wochen, das sie jeden Abend vom Digitalrekorder kopiert und mit Katharines Hilfe sicher abgespeichert hatte. Auch die heutigen Aufnahmen waren noch vorhanden, auf dem Rekorder an ihrem Rücken, daran änderte die Zerstörung der Kamera nichts. Sie hatte nichts zu gewinnen, wenn sie hierblieb und versuchte, den nunmehr zerstörten Apparat mit irgendeiner dämlichen Ausflucht wegzuerklären. Was sollte sie auch sagen? Eines wusste sie: Sie müsste sich vor jemand anderem rechtfertigen als vor Walker. Ihr blieb nur eine Möglichkeit.
Rasch griff sie nach der Ausweiskarte, die er um den Hals trug wie ein Medaillon, riss sie ab, drehte sich um und rannte los, vorbei an den Arbeitstischen zur Treppe. Sie berührte den Kartenleser mit Walkers Ausweis, wie sie es ihn hatte tun sehen, wenn er eine Arbeiterin zu einem der streng rationierten Toilettengänge aus dem Raum ließ.
»Bleib stehen, du Miststück!«, brüllte Walker. »Bleib sofort stehen!« Er kam ihr rasch hinterher, jeder Schritt donnerte lauter. Die Tür piepte. Maddy zog am Griff, aber sie öffnete sich nicht. Sie hielt die verdammte Karte noch einmal gegen das Lesegerät, und diesmal wurde die kleine Lampe endlich grün. Ein anderes kurzes, schrilles, aber freundlicheres Piepen ertönte. Sie öffnete die Tür und schob sich hindurch.
Aber Walker war schnell, und als er die Hand durch den Türspalt streckte, konnte er Maddy an der Schulter packen. Er war stark, aber sie besaß einen Vorteil. Sie schwenkte zu ihm herum, packte die Tür und schlug sie mit aller Kraft zu. Sein Arm war zwischen Tür und Rahmen eingeklemmt. Er stieß einen lauten Schmerzensschrei aus und zog den Arm zurück. Sie knallte die Tür ganz zu und hörte das beruhigende Klicken, mit dem sie sich elektronisch verriegelte.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, stürmte sie die Treppe hoch. Als sie den ersten Absatz erreichte, klammerte sie sich am Geländer fest und schwang sich daran zur nächsten Treppenflucht herum. Über sich entdeckte sie Tageslicht. Ihr blieben nur ein paar Sekunden. Jeden Augenblick konnte Walker die Wachschützer im Eingangsbereich alarmieren.
Maddy war in dem kurzen Korridor, der zum Eingang des Gebäudes führte. Von außen wirkte es wie eine billige Import-Export-Agentur. Auch das stand in ihrem Artikel. Wenn man daran vorbeiging, ahnte man nicht, was im Keller Schreckliches vor sich ging.
Sie atmete tief durch und begriff, dass sie nicht wusste, was sie als Nächstes tun sollte. Sie konnte das Gebäude nicht einfach so verlassen. Arbeiterinnen durften nur zu bestimmten Zeiten hinaus. Man würde sie aufhalten; man würde unten bei Walker anrufen; man würde im Computer nachsehen. Sie musste sich etwas einfallen lassen. Ihr dröhnte der Kopf. Hörte sie Geräusche von unten? Hatte Walker die Tür unten aufbekommen?
Sie hatte nur eine leise Vorstellung von einem Plan, nicht mehr als eine Idee. Sie stieß die Tür auf, hob die Stimme, als sei sie in Panik, und rief dem Mann und der Frau zu, die am Empfangstisch saßen: »Es ist Walker! Ich glaube, er hat einen Herzanfall. Kommen Sie schnell!«
Wie erstarrt saß das Pärchen in der gelähmten Sekunde da, die sich bei jeder unerwarteten Krise einstellt. Maddy kannte diese Reaktion. »Kommen Sie!«, rief sie. »Ich glaube, er stirbt.«
Sie sprangen auf und eilten an ihr vorbei zur Treppe. »Ich rufe einen Krankenwagen!«, brüllte Maddy ihnen hinterher.
Ihr blieb nur eine Sekunde, um hinter den Schreibtisch zu sehen, auf die Fächerwand, wo die konfiszierten Handys der Arbeiterinnen aufbewahrt wurden. Scheiße. Sie sah ihr Handy nicht. Sie überlegte, ohne weitere Umstände zu fliehen, aber sie wäre ohne ihr Handy verloren. Und wenn sie es nach ihrem Verschwinden fanden, wussten sie, wer sie war und wo sie arbeitete.
Von unten kam Lärm. Sie mussten jede Sekunde wieder hier oben sein. Maddy betrachtete die Fächer ein letztes Mal, versuchte methodisch vorzugehen, während ihr fast der Kopf platzte. Ruhig, ruhig, ruhig, sagte sie sich. Aber sie machte sich etwas vor.
Endlich entdeckte sie den vertrauten Umriss, die auffällige Farbe der Schale am Rand der zweituntersten Reihe, ganz in der Ecke. Sie packte das Handy und raste zur Tür hinaus unter den freien Himmel.
Der Freeway war laut, doch der Straßenlärm war ihr unvorstellbar willkommen. Sie wusste nicht, wie sie hier wegkommen sollte. Auf einen Bus warten konnte sie nicht. Außerdem hatte sie die Geldbörse unten gelassen, in ihrer Handtasche, die sie jetzt abschreiben konnte.
Während sie in Richtung des Verkehrslärms rannte, überlegte sie, wen sie zuerst anrufen würde – ihren Redakteur, um ihm zu sagen, dass sie die Story heute Abend bringen sollten, oder Katharine, um ihr die zertretene Kamera zu beichten. Mit einem Mal ging ihr auf, dass sie außer ihrem Handy nur eins bei sich hatte. Sie öffnete die Faust und sah Walkers Ausweiskarte, feucht vom Schweiß ihrer Hand. Gut, dachte sie. Sein Ausweisfoto wäre eine nette Ergänzung zu ihrem Artikel: »Die Fratze des Ausbeuters.«
Sieben Stunden später war die Story fertig, einschließlich zweier Absätze über ihre Flucht aus dem Sweatshop und online begleitet von mehreren Videoclips, an erster Stelle die Fehlgeburtsszene. In den Sweatshops von L.A. geht es um Leben oder Tod. Die Verwendung von Walkers Foto hatte ihr fast eine Stunde Diskussion mit dem Nachrichtenredakteur eingebracht. Howard Burke hatte Bedenken, eine Einzelperson namentlich zu nennen. »Madison, es ist okay, der Firma auf den Pelz zu rücken, aber du bezeichnest diesen Kerl als Sadisten.«
»Weil er ein Sadist ist, Howard.«
»Ja, aber selbst Sadisten können uns verklagen.«
»Soll er uns verklagen! Er wird verlieren. Wir haben auf Video, wie er bei einer Frau eine Fehlgeburt verursacht. Mann, Howard, du bist so ein …«
»Was denn, Maddy? Ich bin ›so ein‹ was? Und jetzt ganz vorsichtig, denn deine Story geht nirgendwohin, bevor ich es erlaube.«
Zwischen ihnen trat Schweigen ein, ein Patt von mehreren Sekunden, das sie schließlich beendete.
»Arschloch.«
»Wie bitte?«
»Du bist so ein Arschloch. Das wollte ich sagen. Ehe du mich unterbrochen hast.«
Der Tumult, der darauf folgte, war noch am anderen Ende des Großraumbüros zu hören.
In seinem Wutausbruch trieb Burke die Faust durch eine Trennwand. Die Redaktionshistoriker vermerkten, dass er diese Leistung damit bereits zum zweiten Mal zustande brachte – zum ersten Mal war das vor vier Jahren passiert, und auch damals war ein Streit mit Madison Webb der Auslöser gewesen.
Die Chefredakteurin musste sich einschalten, damit es zu einem Kompromiss kam. Jane Goldstein rief Maddy in ihr Büro und ließ sie warten, während sie bei Howard in der Nachrichtenredaktion den Tathergang ermittelte. Offenbar hatte sie entschieden, dass es zu gefährlich sei, beide zusammen in den gleichen Raum zu holen.
Maddy erhielt dadurch die Gelegenheit, sich die Trophäenwand ihrer Chefin anzusehen, die eine Abwechslung vom üblichen Egorelief darstellte. Statt der Fotos mit Politgrößen und Promis stellte Goldstein eine Reihe gerahmter Titelseiten der größten Storys zur Schau, über die sie – oder irgendein anderer amerikanischer Reporter seit Ed Murrow – jemals berichtet hatte. Sie war mit einem Haufen Pulitzer-Preise ausgezeichnet worden, damals, als er noch für die höchste Auszeichnung im US-amerikanischen Journalismus gestanden hatte.
Maddys Handy vibrierte. Eine MMS von einem ausgebrannten früheren Kollegen, der die Times verlassen hatte, um bei einer Firma in Encino zu arbeiten, die Lehrfilme produzierte.
Hallo, Maddy! Grüße von der Standspur. Ich hänge mein neuestes Werk an, auch wenn es nichts Besonderes ist. Ist natürlich kein Stanley Kubrick, aber ich würde mich über Feedback freuen. Richtet sich an die Mittelstufe und soll erklären, wie es zu der »Situation« gekommen ist, in so neutralem Ton wie möglich. Unvoreingenommen. Sag mir, wenn du meinst, dass etwas geändert werden muss, besonders das Skript – im Schreiben bist du der Profi.
Weil von Goldstein keine Spur zu sehen war, tippte Maddy pflichtschuldig den Abspielknopf. Aus dem kleinen Handylautsprecher quäkte der Kommentar – eine tiefe Stimme mit dem Dialekt des Mittleren Westens signalisierte Verlässlichkeit.
Die Geschichte beginnt auf Capitol Hill. Der Kongress war zusammengetreten, um die Schuldenobergrenze anzuheben, also die Summe, die die US-Regierung sich jedes Jahr leihen darf. Doch der Kongress wurde sich nicht einig.
Maddy sah den damaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, der vergebens versuchte, die Kammer mit seinem Hammer zur Ordnung zu rufen.
Auf der ganzen Welt begannen sich die Geldgeber Sorgen zu machen, dass ein Kredit an die USA ein schlechtes Geschäft bedeuten konnte. Die »Bonitätseinstufung« des Landes sank von AA+ auf AA und dann zu Buchstaben des Alphabets, von denen niemand erwartet hatte, sie jemals neben einem Dollarzeichen zu entdecken.
Eine hübsche kleine animierte Grafik zeigte, wie aus dem A ein B und dann ein C wurde.
Durch die höheren Zinsen auf die neu aufgenommenen Schulden verschärfte sich die Krise.
Auf dem Schirm erschien ein einziges Wort in dicken, schwarzen Großbuchstaben: ZAHLUNGSAUSFALL. Die Kommentarstimme fuhr fort:
Die Vereinigten Staaten mussten zugeben, dass sie die Zinsen auf das Geld, das sie unter anderem China schuldeten, nicht länger bezahlen konnten. Im offiziellen Sprachgebrauch verkündete das US-Schatzamt einen Zahlungsausfall bei einer seiner Anleihen.
Bilder vom Tian’anmen-Platz wurden gezeigt.
Peking war bereit, solch einen Vorfall ein Mal zu dulden, doch als durch den Stillstand im Kongress ein zweiter Zahlungsausfall drohte, griff die Volksrepublik zu härteren Maßnahmen.
Die damalige Titelseite der L.A. Times erschien im Bild.
Maddy tippte auf den Pause-Button und zog das Foto groß. Sie konnte gerade eben noch den Namen der Verfasserin erkennen, der jungen Jane Goldstein. Die Schlagzeile klang schroff:
CHINAS NACHRICHT AN DIE USA: »ES REICHT!«
Ein Exemplar der gleichen Titelseite hing heute gerahmt in diesem Büro an Goldsteins Wand.
Damals war die Volksrepublik China der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten, also das Land, das den USA das meiste Geld geliehen hatte. Aus diesem Grund pochte China darauf, ein Sonderrecht zu besitzen, als erster Staat das zurückgezahlt zu bekommen, was die USA ihm schuldig waren. Peking verlangte »Sicherheit«, was die US-Zinszahlung betraf, und bestand auf einem »garantierten Geldfluss«. China sagte, es sei nicht bereit, in der Schlange mit anderen Gläubigern zu warten – oder hinter anderen Etats zurückzustehen, in die amerikanische Steuerdollars fließen, wie Verteidigung oder Rüstung. Von jetzt an, sagte Peking, müssten die Zinszahlungen an China in den USA oberste Priorität genießen.
Maddy stellte sich die Kinder in der Schule vor, wie sie diese Geschichte hörten. Die Stimme, gelassen und beruhigend, führte sie durch die Ereignisse, die das Land geformt hatten, und durch die Zeit, in der sie aufgewachsen waren.
China war nicht bereit, die Zahlungsweise den USA zu überlassen. Peking verlangte das Recht, sich das Geld, das man ihm schuldete, an der Quelle zu nehmen. Die USA hatten keine andere Wahl, als einzuwilligen.
Im folgenden Clip sah man einen erschöpften US-Vertreter, der aus einer nächtlichen Sitzung kam und sagte: »Wenn China nicht bekommt, was es will, und die USA als zu riskant einstuft, wird kein Land der Welt mehr bereit sein, uns Geld zu leihen, es sei denn zu ausbeuterischen Zinssätzen.«
Experten verkündeten, dass die gesamte amerikanische Lebensweise – die seit Jahrzehnten durch Schulden finanziert worden war – in Gefahr sei. Und so akzeptierten die USA die chinesischen Bedingungen und gewährten der Volksrepublik direkten Zugriff auf ihre regelmäßigste Einkommensquelle: die Einfuhrzölle auf Güter, die in die USA geliefert werden. Von jetzt an sollte ein Teil dieses Geldes an Peking fließen, sobald die USA es empfingen.
Es gab jedoch ein Problem: Pekings Forderung nach einer chinesischen Präsenz in der sogenannten »Perlenschnur« an der amerikanischen Westküste – den Häfen von San Diego, Los Angeles, Long Beach und San Francisco. China bestand drauf, dass solch eine Präsenz unabdingbar sei, wenn es den Importverkehr effizient überwachen wolle.
Ein kurzer, synchronisierter Clip zeigte einen Vertreter der Regierung in Peking, welcher sagte: »Damit diese Zollvereinbarung funktioniert, muss die Volksrepublik sichergehen können, dass sie den Anteil erhält, der ihr zusteht – nicht mehr und nicht weniger.«
Die US-Regierung lehnte das ab. Sie bezeichnete eine physische Präsenz chinesischer Amtsträger als »rote Linie«, die nicht überschritten werden dürfe. Nach tagelangen Verhandlungen erzielten die beiden Seiten einen Kompromiss. Eine kleine Delegation von chinesischen Zollbeamten sollte auf dem Gelände der Hafenbehörden untergebracht werden – auch in Los Angeles –, aber diese Präsenz sollte, darauf bestand die US-Regierung, nur »symbolischen Charakter« haben.
Eine CBS-Nachrichtensendung berichtete ein paar Monate nach der Vereinbarung über chinesische Anschuldigungen, amerikanische Firmen würden Schmuggel betreiben, um Einfuhrsteuern und Zölle zu hinterziehen, und diese Verbrechen würden von den US-Behörden geduldet, wenn nicht gar angestiftet.
Peking verlangte eine Erhöhung der Anzahl chinesischer Inspektoren in Los Angeles und den anderen Häfen der »Perlenschnur«. Diese Forderung wurde zunächst von den US-Behörden abgelehnt – doch gaben die USA am Ende in jedem Punkt nach.
Als Nächstes kamen Bilder der berüchtigten Sommeraufstände, Aufnahmen, die man in den USA und auf der ganzen Welt schon tausendmal in den Fernsehnachrichten gesehen hatte: Eine wütende Menge aus Amerikanern umzingelte eine Gruppe chinesischer Zollinspektoren; Polizeibeamte versuchten den Mob zurückzuhalten. Ihre Reihe wankte, und schließlich riss sie. Der Erzähler nahm den Faden auf.
In dieser turbulenten Nacht brachen mehrere mit Knüppeln bewaffnete Aufrührer durch und töteten zwei chinesische Zollbeamte. Die Konsequenzen folgten auf dem Fuß. Washington musste Pekings Forderung nachgeben, der Volksrepublik China zu ermöglichen, ihre Bürger selbst zu schützen.
Der Film endete mit einem Sprecher des Weißen Hauses, der betonte, dass nicht mehr als »eine kleine Gruppe von persönlichen Leibwächtern« von China nach L.A. und in die anderen »Perlen« entsandt würde.
Maddy grinste ohne Belustigung: Jeder wusste, wie das ausgegangen war.
Sie hatte die Antwort an ihren Exkollegen halb fertig – Glaube, das deckt alles ab, gefolgt von einem blinzelnden Emoticon –, als die Chefredakteurin ins Büro stapfte.
»Okay, wir bringen das Walker-Bild morgen.«
Klein, rundlich und Mitte fünfzig mit ungefärbtem weißem Haar strahlte Jane Goldstein Ungeduld aus. Ihre Augen, ihre Körperhaltung forderten: Los, komm zum Punkt, noch ehe man ein Wort gesprochen hatte. Dennoch wagte Maddy eine überflüssige Frage: »Also heute nicht?«
»Richtig. Walkers Name bleibt heute unerwähnt. Morgen vielleicht auch. Kommt auf die Resonanz auf den ersten Artikel an.«
»Aber …«
Goldstein spähte auf eine Weise über ihre Brille hinweg, die Maddy sofort zum Verstummen brachte. »Sie haben dreißig Minuten für Ihre letzten Änderungen – und damit meine ich letzte Änderungen, Madison –, dann verschwinden Sie aus diesem Gebäude, habe ich mich klar ausgedrückt? Sie bleiben nicht hier und versuchen Ihre üblichen Tricks, capisce?«
Maddy nickte.
»Sie gucken niemandem über die Schulter, während er die Schlagzeilen schreibt, Sie diskutieren nicht über einen einzigen Zwischentitel, Sie kommen niemandem in die Quere. Haben wir uns verstanden?«
Maddy brachte ein »Ja« hervor.
»Gut. Um es noch mal zu wiederholen: Die Schleimscheißer auf Gawker halten Sie vielleicht für die größte investigative Journalistin in ganz Amerika, aber ich will Sie innerhalb von fünf Kilometern um dieses Gebäude nicht sehen.«
Maddy wollte etwas zu ihrer Verteidigung sagen, aber Goldsteins Lösung war sinnvoll: Wenn eine Story groß wurde, brauchte man für den nächsten Tag einen Folgeartikel. Walkers Namen zu nennen und sein Ausweisfoto an Tag zwei zu veröffentlichen würde beweisen, dass sie – und Maddy – nicht ihr ganzes Pulver in der ersten Salve verschossen hatten. Wie wichtig es war, dass Goldstein einer der ganz wenigen Menschen bei der L.A. Times war, die sie wirklich respektierte, gestand sie sich nicht ein. Mit einem gemurmelten »Danke« ging sie hinaus. Sie hatte keine Ahnung, dass das nächste Mal, wenn sie einen Fuß in dieses Büro setzen würde, ihr Leben und das der gesamten Stadt auf den Kopf gestellt sein würden.
2
Im Grunde war L.A. keine Stadt, um die Nächte durchzumachen, aber das Mail Room bildete eine Ausnahme. In der Innenstadt gelegen, im Grenzland zwischen Schäbig und Bohèmehaft, war es eine Zeitlang eine Schwulenbar gewesen – Katharine hatte es zum Male Room verballhornt und damit erklärt, wieso sie und ihre »Kampflesben« – ihr eigener Ausdruck – den »Männerraum« mieden. Obwohl das Lokal mittlerweile ein gemischtes Publikum anzog, hatte es noch immer ein wenig Biss. Anders als viele Restaurants in L.A. schloss die Küche nicht um acht, und man musste seinen eigenen Wagen nicht von einem Angestellten parken lassen.
Maddy fand eine Lücke zwischen einem Cabrio, dessen Verdeck selbst jetzt, im Januar, heruntergeklappt war, und einem extravaganten Sportwagen mit getönten Scheiben. Die Schickeria kam früh; vielleicht ein Filmstar, der sich einen Abend lang unters gemeine Volk mischte, plus Gefolge. Sie überlegte, Katharine per SMS vorzuschlagen, sie sollten sich woanders treffen.
Aus den Lautsprechern in ihrem Wagen – ein ramponierter, in China hergestellter Geely, der schon altersschwach gewesen war, als sie ihn bekommen hatte – spulten die Stimmen des Polizeifunks die üblichen Kombinationen von Wohnungseinbrüchen und Leichenfunden ab. Sich das anzuhören war eine alte Gewohnheit aus ihrer Zeit als Kriminalreporterin. Sie drückte den Knopf, fand einen Musiksender, drehte die Lautstärke hoch und ließ den Beat durch ihren Körper pumpen, während sie im Rückspiegel ihr Make-up vervollkommnete. Erstaunlicherweise wirkte sie trotz des ganzen Stresses nicht allzu furchtbar. Ihr langes, braunes Haar war zerzaust: Sie fuhr mit einer Bürste hindurch. Die dunklen Ringe unter ihren grünen Augen hingegen waren mit kosmetischer Hilfe nicht zu verdecken: Der Concealer, den sie auftrug, sah schlimmer aus als die Schatten.
Als sie hineinging, empfand sie das Nervenzittern, dass jeder kennt, der schon einmal allein auf eine Party gekommen ist. Sie blickte durch die Bar, suchte nach einem bekannten Gesicht. War sie zu spät gekommen? Waren Katharine und Enrica schon hier gewesen, es leid geworden und woandershin gegangen? Sie wühlte in ihrer Handtasche, tastete nach den beruhigenden Umrissen ihres Handys.
Während sie den Kopf gesenkt hielt, fasste sie jemand an der Schulter.
»Hallo!«
Sie brauchte einen Moment, dann hatte sie das Gesicht eingeordnet: Charlie Hughes. Sie hatten sich kurz nach dem College kennengelernt.
»Du sieht großartig aus, Maddy. Was machst du hier?«
»Ich wollte eigentlich etwas feiern. Aber ich sehe die Leute nicht, mit denen ich …«
»Feiern? Das klingt super. Ich bin aus genau dem entgegengesetzten Grund hier.«
»Aus dem entgegengesetzten Grund? Was ist los?«
»Du erinnerst dich doch an das Drehbuch, an dem ich schon … na ja, Jahre arbeite?« Charlie war Arzt in seiner eigenen Praxis, aber das reichte ihm nicht. Seit man ihn als Berater für eine Krankenhausserie engagiert hatte, war Charlie von dem Gedanken besessen, den Durchbruch als Drehbuchautor zu schaffen. In Los Angeles wollten selbst die Ärzte auf die Leinwand. »Das mit den Mönchen und Teufeln?«
»Devil Monk?«
»Ja! Wow, Maddy, klasse, dass du dich daran erinnerst. Na ja, an den Titel erinnert man sich eben. Das habe ich ihnen auch gesagt.«
»Wem?«
»Dem Studio. Sie haben das Projekt abgeblasen.«
»Ach, nein. Warum?«
»Das Übliche. Haben es zur ›Genehmigung‹ nach Peking geschickt. Und das heißt immer Ablehnung.«
»Was hat ihnen nicht gefallen?« Himmel, musste das jetzt sein? Sie blickte über seine Schulter und suchte verzweifelt nach einer Spur ihrer Freundinnen.
»Sie sagten, das chinesische Publikum kann damit nichts anfangen. Das ist so ein Blödsinn, Maddy. Ich habe ihnen gesagt, die ungewöhnlichsten Geschichten sind auch immer die universellsten. Wenn es dem Mainstream hier gefällt, dann gefällt es auch dem in Guangdong. Das Problem ist nur, wenn die Studios es nicht vertreiben, dann finanziert es auch niemand. Es ist immer das Gleiche …«
Sie schaute ihn mit glasigen Augen an, aber das machte keinen Unterschied. Er war auf Autopilot. Charlie war so sehr in seiner Geschichte versunken – Erzählung hätte er es genannt –, dass er sie kaum ansah, sondern auf einen weiter weg gelegenen Punkt zu starren schien, wo sich offenbar alle zusammenscharten, die sich verschworen hatten, seine Karriere zu vereiteln.
Innerlich seufzend sah sich Maddy im Barraum um. Ihr Blick blieb auf der Gruppe hängen, die die besten Plätze im Club besetzt hatte; etwa ein Dutzend von ihnen stand vor dem breiten Panoramafenster, das die hintere Wand einnahm. Sie lachten am lautesten, ihre Kleidung funkelte am hellsten. Die Frauen waren fast ausnahmslos blond – die Ausnahme bildete eine Rothaarige – und sahen, soweit Maddy es erkennen konnte, hinreißend aus. Jede hielt einen Cocktail in der Hand, und jede warf den Kopf in den Nacken, wenn sie lachte, und prahlte mit ihrem langen, mühevoll toupierten Haar. Die Männer waren Chinesen in teuren Jeans und gebügelten weißen Hemden. Ihre Armbanduhren strotzten vor Juwelen und strahlten wie die Schmuckstücke, die die Frauen trugen. Prinzlinge, folgerte Maddy.
Sie hatte nicht gewusst, dass das Mail Room jetzt Tummelplatz dieser Kreise war, der verwöhnten Söhnchen der herrschenden Elite Chinas. Sie kamen aus der Garnison und waren längst zum festen Inventar der High Society von L.A. geworden. Reiche junge Männer, Abkömmlinge der Parteielite, die es offiziell gar nicht gab, Anwärter im Offizierskorps der Volksbefreiuungsarmee. Die englische Abkürzung lautete PLA für People’s Liberation Army, und die Klatschsites nannten diese Kerle nur PLAyer.
Die Rothaarige verlor gerade das Gleichgewicht. Ein junger Mann zog sie am Handgelenk auf seinen Schoß, und sein breites Grinsen wurde dabei noch breiter. Er fuhr ihr mit der Hand den Rücken hinunter und ließ sie knapp über ihrem Po ruhen. Sie ließ lächelnd die Zähne blitzen, aber ihre Augen verrieten, dass sie es nicht komisch fand.
Maddy musterte das Bild, das sie abgaben, die Prinzlinge, deren Aston Martins und Ferraris draußen abkühlten, und ihre Möchtegernprinzessinnen. Sie war überrascht, dass dieser Club ihnen teuer genug war. Aber nun, da die PLAyer kamen, würden die Preise bald steigen.
Charlie winkte einem der Prinzlinge grüßend zu.
»Ein Investor?«, fragte Maddy überrascht.
»Schön wär’s.« Charlie seufzte. »Ein Patient. Die Sache ist die …«
Plötzlich entdeckte sie Katharine, die hochaufgerichtet in einer Ecke stand, den Mund zu einem entzückten O verzogen, und sie herbeiwinkte. Maddy gab Charlie ein Abschiedsküsschen auf die Wange, murmelte »Viel Glück« und floh geradezu zu ihren Freundinnen, Katharine und Enrica, die in einer kleinen Gruppe um einen winzigen, hohen Tisch voller Cocktailgläser standen.
Sie ging langsamer, als sie ihn sah. Was machte er denn hier? Sie hatte geglaubt, es werde ein Abend mit den Mädels oder wenigstens mit Männern, die sie nicht kannte und die idealerweise schwul waren. Ein freier Abend. Sie sah Katharine finster an. Aber es war zu spät. Da war er schon, ein Glas in der Hand, sein typisches Embryo-Lächeln im Gesicht. Der Bart war neu. Als sie noch zusammenlebten, hatte sie gegen Gesichtsbehaarung stets ihr Veto eingelegt. Aber das war jetzt fast neun Monate her, und jetzt, wo sie ihn mit Bart sah, musste sie zugeben, dass er ihm stand.
»Leo.«
»Maddy, du siehst wie immer umwerfend aus.«
»Hör auf zu schleimen. Schleimen passt nicht zu dir.«
»Ich war charmant.«
»Na gut, charmant zu sein passt auch nicht zu dir.«
»Wie hättest du mich denn gern?«
»Körperlich abwesend?« Sie senkte die Stimme. »Ernsthaft, Leo, wir hatten uns darauf verständigt, einander in Ruhe zu lassen.«
»Komm schon, Maddy. Wir wollen dir doch nicht deinen großen Abend verderben.«
»Woher weißt du davon?«
Er zeigte mit einem Nicken auf Katharine, dann nahm er einen Schluck aus seinem Glas. Ein knospendes Lächeln war in seinen Augen aufgeblüht, deren Blick Maddy nie verließ. Sie waren von einem warmen Braun. In der richtigen Stimmung, wenn sein Interesse oder besser noch seine Leidenschaft geweckt war, schienen sie Lichtfunken zu enthalten, die die Iris umtanzten und voneinander abprallten. Sie leuchteten jetzt auf.
»Was hat sie dir gesagt? Kay, was hast du …«
Er griff nach ihrem Handgelenk. »Keine Sorge, sie hat mir nichts verraten. Nur dass du einen großen Fisch an Land gezogen hast. Groß genug, um einen Huawei zu gewinnen.«
»Katharine weiß nicht, wovon sie redet«, erwiderte Maddy, aber sie ließ zum ersten Mal, seit sie in den Club gekommen war, die Schultern sinken. Sie konnte es nicht verbergen: Von Anfang an, noch bevor ein Wort geschrieben war, hatte sie geglaubt, dass sich mit dieser Story ein Huawei-Preis gewinnen ließ. Sie hatte alles, was die Preisrichter schätzten: Ermittlung, Risiko, ein korruptes Ziel auf genau der Ebene, auf der seine Bloßstellung die ganz großen Fische nicht bedrohte. In mehr als einer schlaflosen Nacht hatte sie die imaginäre Dankesrede formuliert.
»Aber du, Maddy. Und dein Gesicht verrät mir, dass ich recht habe. Dir ist der große Wurf gelungen.«
»Glaub bloß nicht, dass ich dir etwas verrate, weil du mir schmeichelst. So läuft das nicht.«
»Wieso nicht?«
»Weil ich dich kenne, Leo Harris. Ich kenne alle deine Tricks. Meinen Exklusivbericht vorher auszuplaudern, sodass er verpufft …«
»Nicht das schon wieder.«
»Keine Sorge. Ich lasse nicht zu, dass du den Abend verdirbst. Ich bin guter Laune, und jetzt will ich …«
»Okay, verrate mir nur eine Einzelheit.«
»Nein.«
»Betrifft es in irgendeiner Weise den Bürgermeister?«
»Nein.«
»Muss ich mir deswegen in irgendeiner Weise Sorgen machen?«
»Nein.« Sie zögerte. »Eigentlich nicht.«
»Eigentlich nicht? Und das soll mich beruhigen?«
»Ich meine, nur in der Hinsicht, dass es in dieser Stadt geschieht. Und« – sie senkte das Kinn auf die Brust und sprach um zwei Oktaven tiefer – »alles, was in dieser Stadt geschieht, betrifft …«
»… betrifft den Bürgermeister. Siehst du, Maddy, du erinnerst dich doch an mich.«
Sie sagte nichts, aber sie sah ihm fest in die braunen Augen, die warm wie ein Kaminfeuer waren. Als sie sein Vergnügen sah, seine geschmeichelte Eitelkeit, kam ihr unwillkürlich über die Lippen, was sie dachte. »Du bist so ein Arschloch, Leo.«
»Ich hol dir einen Drink.«
Er wandte sich ab und ging zur Theke. Maddy ließ er unter dem fragenden und zugleich tadelnden Blick Katharines zurück. Ihre Freundin und Kollegin, kleiner, älter und in diesen Dingen stets weiser, fragte wortlos, was zum Teufel sie da tat. Allein mit Hilfe ihrer Augen sagte sie: Ich dachte, wir hatten darüber geredet.
Leo kehrte zurück und reichte Maddy ein Glas. Whisky, keinen Wein. Ich kenne dich. Sie nahm einen großen Schluck, und das Glas war leer.
»Also«, fing er wieder an, als ziehe er einen Schlussstrich unter das vorherige Thema, »ich sage dir, womit du auf der Stelle einen Huawei gewinnen würdest.«
»Und womit?«
»Mit einem Insiderbericht aus dem Wahlkampf des nächsten Gouverneurs unseres großen Staates Kalifornien. Noch nie dagewesener Zugang, das Ohr immer an der Wand. Bei allen Besprechungen mit im Raum.«
»Du bietest mir Zugang zu Bergers Wahlkampagne?«
»Nein. Ich sage dir, was du haben könntest, wenn du dich nicht von mir getrennt hättest.«
»Leo.«
»Schon gut. Wenn du nicht entschieden hättest, dass wir ›Abstand‹ brauchen.«
»Das haben wir beide entschieden.«
»Wenn du meinst. Die Sache ist die, der Bürgermeister wird gewinnen, Maddy. Er ist der beliebteste Bürgermeister in der Geschichte von Los Angeles.«
»Na, damit muss ich dann wohl einfach leben, oder?«
Er zuckte mit den Achseln. Dein Verlust.
Zu ihnen gesellte sich eine unglaublich große, schlanke Frau auf Zehnzentimeterabsätzen in einem Kleid, das bis zur Taille ausgeschnitten wirkte. Ihre Haut war gebräunt und makellos. Sie war, entschied Maddy, entweder ein professionelles Model oder dreiundzwanzig Jahre alt. Womöglich auch beides. Als sie sprach, redete sie mit einem Akzent, der verriet, dass sie eine teure Schule besucht hatte.
»Möchtest du mich nicht vorstellen, Leo?« Ihr Lächeln war breit und strahlend weiß. Sie bedachte Maddy mit einem warmherzigen Blick, als wäre es ihnen bestimmt, lebenslang Freundinnen zu sein.
»Das ist Jade«, murmelte Leo.
Ein langer Moment verging, dann streckte Madison die Hand vor und nannte, als sie begriff, dass Leo sie nicht vorstellen würde, ihren Namen. Alle drei lächelten einander stumm an, dann drehte sich Madison schließlich um und sagte leise: »Gute Nacht, Leo.«
Er flüsterte zurück: »Geh mir nicht auf die Nüsse, Maddy.«
»Ich will deinen Nüssen nie wieder zu nahe kommen, Leo. Hab einen schönen Abend.«
Es war nach ein Uhr, als Enrica verkündete, dass sie langsam ins Bett müsse, und wenn Katharine nicht mit einer Frau gesehen werden wolle, die nicht mehr wisse, was sie tue, dann müsse sie sie nach Hause fahren. Als Maddy ihnen die beiden Treppenfluchten hinunter folgte, musste Katharine ihre Ehefrau bei jedem Schritt stützen. Madison malte sich aus, was Leo aus diesem Anblick machen würde: das lesbische Ehepaar, die eine Sino-Amerikanerin, die andere Latina, beide überzeugte Angelenos. Ein Wunder, dass er sie nicht schon vor ewigen Zeiten in einer Wahlkampfwerbung für Berger eingesetzt hatte.
Jetzt, mitten in der Nacht, erlebte Maddy etwas für sie sehr Ungewöhnliches: das Gefühl, getan zu haben, was von ihr verlangt wurde. Sie war weggefahren und nach Hause gegangen und hatte nicht ein Mal in der Redaktion angerufen. Sie hatte Howard nicht behelligt, sie hatte sich nirgendwo beklagt. Sie hatte nicht versucht, hier und da noch an einem Satz zu feilen. Sie hatte auch nicht ausgenutzt, dass sie alle relevanten Passwörter kannte, um online zu gehen und selbst Änderungen vorzunehmen – etwas, das eindeutig zu dem gezählt hätte, was Goldstein als ihre »üblichen Tricks« bezeichnet hatte. Sicher, sie hatte die Website ein Dutzend Mal aufgerufen, sie hatte in Weibo nachgesehen – der chinesische Bloggingdienst überschlug sich schon mit ihrer Story. Aber nach ihren Standards hatte sie sich bemerkenswert zurückgehalten.
Sie stand unter der Dusche, ohne sich zu bewegen, ohne sich zu waschen, und ließ sich nur vom Wasser einschließen. Vielleicht war es die Wärme, jedenfalls bekam sie eine Gänsehaut, und die Bewegungen ihrer Hände wurden zu Liebkosungen. Ungebeten trat Leo in ihr Gedächtnis – nicht so sehr sein Äußeres, sondern mehr das Gefühl seiner Anwesenheit. Und die Erinnerung, wie er sich angefühlt hatte, wenn er ihr so nahe gewesen war, genau hier in dieser Duschkabine.
Trotzdem fehlte ihr die Energie für das, was als Nächstes käme. Sie ersehnte sich nichts mehr als einen tiefen, erholsamen Schlaf. Gab es sonst etwas Neues?
Das Wasser wurde kalt. Sie trat aus der Kabine, nahm sich ein Handtuch und ging langsam ins Wohnzimmer. Oder eher »Wohnzimmer« mit dicken Anführungszeichen, wie sie es formulieren würde, wenn sie über jemanden schreiben müsste, dessen Wohnung so aussah. Sie betrachtete das »Wohnzimmer« mit dem Auge eines unbeteiligten Beobachters. Draußen lag Echo City, eine Gegend, die zu einem Drittel flippig und zu zwei Dritteln heruntergekommen war. Drinnen stand ein großer Tisch, an dem sechs oder acht Leute Platz fanden, vollkommen bedeckt mit Papierstößen, zwei Laptops und einem Stapel vollgeschriebener Notizbücher. Nichts davon war nach einem Prinzip geordnet, das sich irgendjemand anderem außer ihr selbst erschlossen hätte. Eine Couch, auf beiden Seiten von Zeitschriften und noch mehr Papieren überhäuft, sodass darauf nur eine Person sitzen konnte.
Zu einer Seite ging es durch einen offenen Bogen zu einer Küche, die täuschend sauber war – nicht weil Maddy so pingelig gewesen wäre, sondern weil sie sie so selten benutzte. Selbst von hier konnte sie die Staubschicht sehen, die den Herd bedeckte. Die Erklärung fand sich im Mülleimer, der fast komplett mit Mitnahmeverpackungen diverser Schnellrestaurants gefüllt war. Es waren täglich neue dazugekommen, seit sie an dieser Story arbeitete – und, gab sie vor sich selbst zu, lange vorher auch schon.
Einen Augenblick lang stellte sich Madison die Wohnung vor, wie sie gewesen war, als sie mit Leo zusammen darin gewohnt hatte. Nicht ordentlicher, aber geschäftiger. Voller. Sie genoss die Erinnerung, bis dieser geschliffene Akzent sie unterbrach. Das ist Jade.
Sie blickte auf ihr Handy. Den ganzen Nachmittag bis hinein in den Abend war sie dermaßen beschäftigt gewesen, dass sie es wiederholt ignoriert hatte, als es klingelte. Sie hatte nicht einmal nachgesehen, welche Anrufe ihr entgangen waren. Aber da war die Liste: zwei von Howard, einer von Katharine; die hatten sich erledigt. Sechs von ihrer älteren Schwester Quincy, einer von Abigail, ihrer jüngeren Schwester.
Augenblicklich drückte sie mit dem Daumen auf Abigails Namen und ließ ihn über dem Anrufbutton schweben. Es war spät, und Abigail war kein Nachtmensch. Andererseits war sie Grundschullehrerin, also mit einem Job gesegnet, der ihr gestattete, ihr Handy auszuschalten, wenn sie zu Bett ging. Es bestand kein Risiko, sie aus dem Schlaf zu reißen, egal, wie spät es war. Maddy hockte sich auf die Sofakante, noch immer in ihr Handtuch gewickelt, und tippte auf die Schaltfläche. Es klingelte sechsmal, dann meldete sich die Voicemail; ihre Schwester klang so viel jünger, so viel heller und unbeschwerter als sie.
Niemand spricht mehr auf diese Dinger. Aber nur zu, du bist schon so weit gekommen. Lass mich hören, wie du klingst.
Maddy brach das Gespräch ab, als sie den Piepser hörte. Sie sah die anderen an, Quincys sechs Versuche. Sechs Versuche deuteten eher auf unterschwelligen Groll als auf rasenden Zorn hin. Maddy fragte sich, womit sie ihre ältere Schwester diesmal wütend gemacht hatte, welche Regel oder Konvention oder angeblich selbstverständliche Schwesternpflicht sie verletzt oder nicht begriffen hatte. Sie würde sich die Voicemail nicht anhören, sie wusste auch so, was Quincy ihr sagen wollte.
Da sie nun trocken war, folgte sie dem Versprechen des Schlafes ins Schlafzimmer. Sie ließ das Handtuch an sich herabgleiten, schlüpfte zwischen die Laken und genoss die Kühle. Dunkel war ihr bewusst, dass sie wenigstens zwei wichtige Ratschläge gegen Schlaflosigkeit befolgte – eine gute warme Dusche und sauberes Bettzeug. Solche Ratschläge gab es ohne Ende. Im Laufe der Jahre war sie damit überschüttet worden. Früh ins Bett, spät ins Bett. Lieber ein Vollbad als eine Dusche. Brühheiß oder, noch besser, lauwarm. Iss herzhaft, Nudeln eignen sich besonders, um neun Uhr abends, oder um sechs, oder mittags oder in einer Version sogar um sieben Uhr morgens. Eine Tasse warme Milch. Keine Milch, sondern Whiskey. Kein Alkohol, keine Weizenprodukte, kein Fleisch. Hör mit dem Rauchen auf, fang zu trinken an. Fang zu rauchen an, hör mit dem Trinken auf. Treibe mehr Sport, treibe weniger Sport. Hast du es mit Melatonin probiert? Den Kopf klar bekommt man am besten, wenn man vor dem Zu-Bett-Gehen als Letztes eine To-do-Liste schreibt. Schreib bloß niemals eine To-do-Liste: Sonst geht sie dir die ganze Nacht durch den Kopf. Menschen sind keine Uhren: Sie brauchen vor dem Schlafengehen nicht aufgezogen zu werden, sie müssen sich entspannen. Denken vor dem Schlafengehen war gut, denken vor dem Schlafengehen war sehr schlecht. Eines wusste sie mit Sicherheit: Über die unzähligen, einander widersprechenden Methoden, um einzuschlafen, nachzudenken konnte sie die ganze Nacht wachhalten.
Hier lag sie nun, erschöpft, ihre Arme, Hände, Augen, ja, ihre Fingerspitzen lechzten nach Schlaf – und dennoch war sie hellwach. Nichts wirkte. Nichts hatte je gewirkt. Tabletten konnten sie ausknipsen, aber der Preis war zu hoch: Am nächsten Tag wäre sie groggy und apathisch. Und sie hatte Angst, davon abhängig zu werden: Sie kannte sich zu gut, um das Risiko einzugehen.
Seit zwanzig Stunden war sie auf den Beinen und wünschte sich nur ein paar Stunden Erholung. Wenn es nur ein paar Minuten wären. Sie schloss die Augen.
Etwas wie Schlaf stellte sich ein, ein Wirbel von halbbewussten Bildern, die bei den meisten normalen Menschen dem Schlaf vorausgehen, ein Teiltraum wie eine Ouvertüre zu der eigentlichen Vorstellung. Sie erinnerte sich an so vieles aus ihrer Kindheit, von damals, als sie mühelos ruhen konnte und in dem Augenblick in Schlaf sank, in dem ihr Kopf das Kissen berührte. Doch die Stimme in ihrem Kopf wollte nicht Ruhe geben. Hier war sie jetzt und sagte ihr, dass sie noch wach war, beharrlich und unerträglich präsent.
Sie griff nach ihrem Handy und seufzte mürrisch auf. Na gut, du hast gewonnen. Erneut rief sie die Website der L.A. Times auf; ihre Story war noch immer »am häufigsten gelesen«. Dann rief sie ein weiteres Mal die Polizeifunk-App auf und hörte so lange zu, bis sie mehrere Meldungen von Leichenfunden überall in der Stadt vernommen hatte. Eine war nicht weit von hier entdeckt worden, in Eagle Creek, die andere in Nord-Hollywood.
Als Nächstes hörte sie sich einen langen außenpolitischen Artikel an, Yang auf großer Fahrt, der sich mit der jüngst zu Ende gegangenen Reise des Mannes in den Nahen Osten befasste, der den meisten Gerüchten zufolge der nächste chinesische Staatspräsident sein würde. Der Beitrag analysierte detailliert, was diese Reise für die kurz- und langfristigen Ziele des Landes bedeutete. Der Artikel war hinreichend mühselig zu verfolgen und schaffte es beinahe, sie einnicken zu lassen; ihr mentales Gesichtsfeld hinter ihren geschlossenen Augen verdunkelte sich an den Rändern wie bei einem alten Stummfilm. Der dunkle Rand wurde breiter, das Bild, das ihr geistiges Auge sah, immer kleiner, bis sie nur noch Schwärze erkannte …
Aber sie betrachtete es zu eingehend, sie wollte es zu sehr. Ihr war immer noch bewusst, wie sie in die Bewusstlosigkeit sank, und daher geschah es nicht. Sie war, verdammt noch mal, nach wie vor wach. Kapitulierend schlug sie die Augen auf.
Und vielleicht zum tausendsten Mal öffnete sie die Nachttischschublade und nahm das Foto heraus.
Sie betrachtete es und schaute als Erstes ihre Mutter an. Sie musste achtunddreißig, neununddreißig gewesen sein, als das Foto aufgenommen wurde. Himmel, keine zehn Jahre älter, als Maddy jetzt war. Ihre Mutter hatte braunes, untoupiertes Haar. Sie trug eine Brille von der unmodischen Sorte, als versuchte sie, sich unattraktiv erscheinen zu lassen. Was in gewisser Weise einleuchtete.
Quincy war auf dem Bild siebzehn und groß; der Ernst hatte sich ihrem Gesicht bereits eingeprägt. Sie war auf strenge Weise schön. Abigail war natürlich niedlich mit ihrem zahnlückigen Lächeln; sie war sechs und saß auf Maddys Schoß. Was Maddy selbst betraf, die auf dem Foto vierzehn war, so lächelte sie ebenfalls, aber sie wirkte dabei nicht fröhlich; ihre Miene enthielt zu viel Wissen über die Welt und über das, was das Leben einem manchmal antut.
Sie streckte die Hand aus, um ihr früheres Ich zu berühren, kam aber an den rechten Rand des Fotos, der noch immer scharf war, obwohl sie es vor so vielen Jahren schon beschnitten und den Teil entfernt hatte, den sie nicht sehen wollte.
Später konnte sie nicht sagen, wann sie eingeschlafen war – oder ob überhaupt. Kurz nach zwei Uhr morgens summte jedenfalls das Handy und brachte den Nachttisch zum Zittern. Sie erkannte den Namen, aber zu dieser späten Stunde war sie doch verblüfft: Detective Jeff Howe. Maddy kannte Howe aus ihrer Zeit als Kriminalreporterin; er war eine alte Quelle und hatte außerordentlich großen Wert darauf gelegt, auf ihrer Kontaktliste zu bleiben. Ein bis zwei Mal im Monat rief er sie an: Gewöhnlich tat er, als hätte er eine Story für sie, manchmal war er aber auch offen und bat sie frei heraus um ein Treffen. Sie hatten ein paarmal zusammen zu Mittag gegessen, aber sie hatte nie zugelassen, dass mehr daraus wurde. Und ganz gewiss hatte er sie noch nie mitten in der Nacht angerufen. Eine Erklärung kam ihr sofort in den Sinn: Die Fabrik hatte sie wegen Körperverletzung angezeigt, und Jeff wollte sie vorwarnen. Merkwürdig, sie hätte angenommen, die Fabrik würde jede weitere Öffentlichkeit vermeiden, besonders nachdem …
»Madison, bist du das?«
»Ja. Jeff? Alles in Ordnung?«
»Mit mir schon. Ich bin unten. Du musst mich reinlassen. Deine Klingel ist kaputt.«
»Jeff, wir haben zwei Uhr morgens. Ich bin im …«
»Weiß ich, Madison. Lass mich einfach rein.« Betrunken war er nicht, so viel konnte sie sagen. Etwas an seiner Stimme verriet ihr, dass es nicht um das ging, was sie kurz befürchtet hatte. Er würde ihr keine Szene machen, ihr nicht seine Liebe erklären, sie nicht anflehen, ihn in ihr Bett zu nehmen. Sie drückte auf den Türöffner und wartete.
Als er vor ihrer Tür stand, wusste sie es. Schon sein Gesicht verriet es ihr: Gewöhnlich sah er gut aus mit seinem kurz geschnittenen ergrauenden Haar, jetzt wirkte er ausgezehrt. Sie begrüßte ihn, doch ihre Worte kamen ihr fremd vor und stockten; ihr Mund war trocken. Sie bemerkte, dass ihr kalt war. Bei seinem Anblick schien ihre Körpertemperatur um ein paar Grad gefallen zu sein.
»Es tut mir so leid, Madison. Aber ich hatte Dienst, als ich davon hörte, und habe darum gebeten, es selbst übernehmen zu dürfen. Ich dachte, es wäre besser, wenn du es von mir hörst.«
Sie erkannte den Ton. Ihr wurde schwindlig, das Blut wich aus ihrem Kopf und floss zurück in ihr Herz. »Wer?«, mehr brachte sie nicht hervor.
Jeffs Augen nahmen einen feuchten Glanz an. »Deine Schwester. Abigail. Sie ist tot.«
3
Jeff wartete, während sie sich die erstbesten Kleidungsstücke überzog, die sie fand, dann führte er sie zu seinem Auto. Er redete die ganze Zeit, sagte ihr, was sie wissen musste, doch bei ihr kam so gut wie nichts davon an. Sie hörte nur die Worte, die sich immer wieder in ihrem Kopf abspulten: Deine Schwester. Abigail. Sie ist tot.
Bilder von Abigail als Kind suchten sie heim. Ganz gleich, wie sehr sie sich anstrengte, sie konnte ihre Schwester nicht als Erwachsene sehen. Ein Bild tauchte häufiger auf als alle anderen: Abigail im Alter von fünf oder sechs, wie sie die Puppe festklammerte, mit der Maddy früher gespielt hatte und die wie alles andere auch von einer Schwester an die andere weitergereicht worden war. Und durch den Kopf schossen ihr Fetzen eines Satzes, der sich einfach nicht zusammensetzen wollte: Ich habe dich im Stich gelassen, Abigail. Ich habe zugelassen, dass es wieder passiert. Es hätte niemals wieder passieren dürfen.
Sie waren keine zehn Minuten lang unterwegs, als Maddy sich plötzlich kerzengerade aufsetzte. Ihr Herz hämmerte. Sie brauchte einen Augenblick, um zu begreifen. Wenn auch nur für wenige Sekunden – sie war eingeschlafen. Sekundenschlaf nannte man so etwas. Sekundenschlaf traf jeden, der an Schlaflosigkeit litt. Sie wusste, dass sie nach einem Schock besonders anfällig war; ihr Kreislauf konnte kollabieren. Das war ihr einmal im College passiert, nachdem ein Mistkerl, in den sie verliebt war, sie abserviert hatte. Damals hatte sie vor Schmerz das Bewusstsein verloren.
Im Polizeipräsidium anzukommen half ihr zu funktionieren. Fast wie aus dem Muskelgedächtnis wusste sie, wie sie hier zu gehen und zu reden und sich zu benehmen hatte. Sie schüttelte Jeffs Versuche ab, sie mit der Hand an der Taille zu führen, als wäre sie eine Verletzte, die noch aus eigener Kraft gehen könnte. Sie schritt zum Eingang, entschlossen zu funktionieren wie Madison Webb, Reporterin.