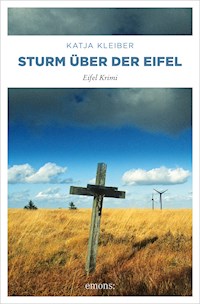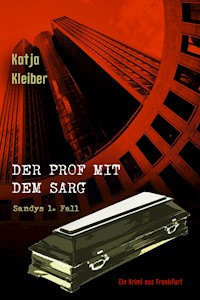4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Bei einem Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Frankfurt stirbt ein kleiner Junge. Sein Bruder ist fest entschlossen Rache zu üben und taucht unter. Dann fällt ihm eine Knarre in die Hände. Eng auf dem Fersen ist ihm Privatdetektivin und Ex-Punkerin Sandy. Sie soll den vermissten Jungen zur Aufgabe überreden. Als sie ihn bei einem Überfall auf ein Kampfsportstudio von Skinheads erwischt, eskaliert die Situation. Kann Sandy den Rachefeldzug des erbitterten Afghanen stoppen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Kind mit der Knarre
Sandy ermittelt in Frankfurt
Katja Kleiber
Inhalt
Widmung
1. Chaos
2. Flammen
3. Pitbull in Aktion
4. Am Krankenbett
5. Zeugen gesucht
6. Schlechte Nachrichten
7. Blumenkind
8. Allein
9. Ein Steinwurf und seine Folgen
10. Familienbande
11. Bedroht
12. Feuervogel
13. Abgängig
14. Ein Problem mehr
15. Keine Antworten
16. Jugendamt
17. Das Stammesgesetz
18. Auge um Auge
19. Freya unter Druck
20. Schönes Deutschland
21. Eine Rune
22. Heiße Ware
23. Die Aktenlage
24. Gottesfürchtiger Hehler
25. Luxusprobleme
26. Das Tattoo
27. Hände an die Wand
28. Kampfsportler
29. Aufgegriffen
30. Ähnlichkeiten
31. Paragrafen
32. Photoshop
33. Neue Mitbewohner
34. Küchendienst
35. Doppelblitz
36. Weinprobe
37. Provokation
38. Blaue Flecke
39. Abgeblitzt
40. Das Alibi
41. Schrauberwissen
42. Der Plan
43. Die Alarmanlage
44. Antifa in Aktion
45. Niederlage
46. Tarnung
47. Aus dem Spiel genommen
48. Die Beerdigung
49. Zeugenaussage
50. Rausschmiss
51. Erleichterung
52. Im Gym
53. Der Superbulle
54. Spaziergang im Park
55. Hartnäckig
56. Überraschender Fund
57. Haftbefehl
58. Die Rache ist nah
59. Das Oi-Konzert
60. Der Schuss
61. Flucht
62. Entsorgt
63. Verdächtiger Irokese
64. On the road
65. Bargeld
66. Ausgleich
67. Gerettet
Danksagung
Über die Autorin
Bücher von Katja Kleiber
Copyright © 2021 by Katja Kleiber
c/o easy-shop
Kathrin Mothes
Schloßstraße 20
06869 Coswig (Anhalt)
www.katja-kleiber.de
Lektorat: Nadine Buranaseda, typo 18
Coverdesign: Juliane Schneeweiß
Dieses Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erstellt mit Vellum
Widmung
Ohne Verwandte kann man leben, ohne Freunde nicht.
Afghanisches Sprichwort
Chaos
Ein Gefühl beherrschte mich, das mir fremd war: Angst. Und ich hörte ein dumpfes Trommeln, das ich nur zu gut kannte. Die Bullen schlugen mit ihren Knüppeln rhythmisch auf die Schilde. Eines der Rituale auf Demos, die nichts Gutes verhießen.
Ich klammerte mich an Wombel. Mein riesiger Punkerkumpel überragte die Menschenmenge, die ich nicht überblicken konnte, weil ich mit meinen ein Meter sechzig zu klein war.
„Ich bin nichts, ich kann nichts, gebt mir eine Uniform!“, schrie ich aus vollem Hals, um meine Angst zu vergessen. Die Demo dauerte schon einige Zeit an, meine Stimme war heiser.
Die Leute neben mir hüpften im Takt auf und ab.
Ich hüpfte mit, schon allein, weil ich untergehakt bei Wombel nicht anders konnte. Er riss mich einfach mit.
Vom Main her drängten die Faschos auf den Römer. Ihr Aufmarsch auf dem historischen Platz in der Mitte der Frankfurter City war in letzter Sekunde gerichtlich erlaubt worden. Gleichzeitig strömten von der anderen Seite, von der Einkaufsmeile Zeil kommend, immer mehr Antifas auf den Römer, der diese Masse an Menschen nicht fassen konnte.
Verstärkt wurde das Gedränge durch mehrere Hundertschaften, deren Aufgabe es war, die beiden Demozüge auf keinen Fall aufeinandertreffen zu lassen. Komme, was da wolle, sonst drohte ein Massaker.
Unmengen an Bullen waren unterwegs. Bei der Fahrt zu unserem Treffpunkt hatten wir in einer Nebenstraße geparkte Mannschaftswagen gesehen. Es waren so viele, dass wir nach einer Weile zu zählen aufgehört hatten.
Die Bullen bildeten enge Reihen, ihre Schutzschilde klebten aneinander, ohne jeden Zwischenraum.
Dann kamen die Peaceniks, und alles ging schief. Eine Gruppe bunt gekleideter Frauen mit riesigen Blumensträußen drängte sich seitlich in die Demo. Sie sangen We shall overcome. Nicht tonsicher, aber laut.
Neben der Antifa hatten auch Gewerkschafter, Kirchengemeinden, Schülervereinigungen und eine Menge anderer Initiativen zum Protest gegen die Neonazis aufgerufen. Zu einer dieser Organisationen gehörten vermutlich die bunt gewandeten Frauen, die sich jetzt zur Polizeikette vordrängten und jedem Beamten eine rote Nelke überreichten. Einige wehrten sie unwirsch ab, andere steckten die Blume irgendwo an ihre schwarze Plastikrüstung.
Die Faschos erkannten ihre Chance und bewarfen die Einsatzkräfte mit Flaschen.
Die Reihe der Bullen geriet durcheinander. Sie wandten sich um, weil die Attacke der Skins sie unter Druck setzte. Ihre Kette wies auf einmal Lücken auf.
Wir drückten uns an einer Frau mit offener grauer Haarmähne und lilafarbener Batikpluderhose vorbei.
Jetzt lag die Polizeikette in unserem Rücken.
Dafür standen uns Naziglatzen direkt gegenüber.
„Auf die nächsten tausend Jahre!“
Ich versuchte zu erkennen, wer geschrien hatte. Wenn ich die Stimme richtig zuordnete, war es ein Brecher von einem Typen, Schultern wie Rammböcke, mindestens so groß wie Wombel, der über zwei Meter maß. Er trug eine Flecktarnjacke. Am Hals blitzte ein Tattoo hervor, ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf eine SS-Rune.
Ein Typ in Lederklamotten mit einer Kamera sprang vor mich. Auf einer Warnweste, die er über seine Jacke gestreift hatte, stand in weißer Leuchtfarbe Presse, darunter etwas kleiner in blauer Schrift dpa. Er hielt Wombel den Apparat direkt unter die Nase, löste anscheinend mehrfach aus, doch das Klicken war in dem Lärm nicht zu hören.
Wombel hielt ihm das Objektiv zu.
Der Typ trat einen Schritt zurück, drehte sich um und machte jetzt Aufnahmen von den Faschos. Er hielt auf den Typen mit der Doppelrune drauf. Diesmal meinte ich, das Klicken hören zu können.
„Ein Ast, ein Strick, ein Pressegenick!“, schrie ihm der Skin ins Gesicht. Er hob einen Fuß und trat dem Fotografen mit Schwung vors Schienbein.
Der kippte nach vorne, konnte sich nicht abfangen, weil er die Kamera umklammerte, die aufs Pflaster knallte. Etwas zerbarst mit einem hässlichen Geräusch. Glassplitter knirschten unter meinen Füßen.
Ich ließ Wombel los, griff mit beiden Händen die Presseweste und zerrte den Journalisten hoch. Er kam taumelnd auf die Beine, wobei er seinen Fotoapparat weiter festhielt.
Der Skin schrie uns etwas entgegen. Zum Glück verstand ich nicht, was er von sich gab. Es war sicher kein Lob für meine gute Tat des Tages.
Bullenknüppel prasselten auf uns nieder. Ich riss einen Arm hoch, fing einen Schlagstock ab. Schrie auf. Der Schmerz durchzuckte meinen Arm.
Wombel zerrte mich mit sich, rannte. Ich stolperte hinter ihm her.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Freya ihr Handy hoch über den Kopf in Richtung der Bullen hielt. Ihre roten Haare standen wie zornige Flammen ab.
Dann war sie an meiner Seite, wir hasteten über den Platz, weg von den prügelnden Bullen.
Nach einigen Schritten blieb Wombel stehen, stoppte auch uns.
„Ketten bilden!“ Er hakte mich unter und brüllte aus vollem Leib: „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten!“
Andere griffen den Slogan auf. Die Menge kam zum Stehen, wir wandten uns um. Schlossen die Ketten wieder.
Rechts hielt mich Wombel fest, links Freya.
„Deutsche Polizisten schützen die Faschisten!“ Der Slogan hörte sich jetzt lauter, fester an.
Wir gingen alle gemeinsam zurück zum Naziaufmarsch.
Die Polizisten wandten sich um, alle gleichzeitig, anscheinend auf ein Kommando hin, das sie durch ihre Ohrhörer empfingen. Sie schlossen den Ring um die Faschodemo wieder, die Gesichter den Antifas zugewandt.
„Faschopack!“, grölte ein junger Antifa in der Kette vor uns. Er trug eine Baseballkappe mit dem Schirm nach hinten gedreht. „Zieht ab!“ Seine Stimme überschlug sich. Er bückte sich, hatte auf einmal einen Schraubenschlüssel in der Hand und hebelte mit einer schnellen Bewegung einen Pflasterstein aus.
Ich blieb abrupt stehen, um ihn nicht umzurennen.
Er richtete sich auf, holte aus und warf den Stein auf die Nazis. Der flog gegen ein Verkehrsschild. Es dröhnte blechern.
Als wäre die Aktion ein Kommando gewesen, prasselten auf einmal mehrere Steine auf die Nazis und die Bullenkette ein. Die Bullen kriegten mehr ab, weil die meisten Würfe zu kurz gerieten. Die Robocops hoben abwehrend ihre Schilde.
Chaos brach aus. Die Bullen stürmten auf die Antifas zu, die Nazis hinterher.
Unsere Ketten gerieten ins Wanken. Jeder rannte in eine andere Richtung. Alle schrien durcheinander. Ich verlor Wombel erst aus dem Griff, dann aus dem Blick.
Drei Polizisten stürmten von der Seite heran, drängten mich zurück und packten den Jungen mit der Baseballcap, der eben das Verkehrsschild getroffen hatte. Sie nahmen ihn in den Polizeigriff, die Arme auf dem Rücken.
Er schrie auf. Beugte sich weit vor, um den Druck auf Arme und Schultern zu mindern.
„Achtung, Kameramann!“, ertönten mehrere Rufe.
Anscheinend fokussierte sich einer der Bullen mit seiner Videokamera auf die Aktion vor mir. Ich zog meinen Schal schnell hoch bis über die Nase.
„Wer bist du?“, kreischte Freya neben mir den Jungen an.
Ich klammerte mich an ihren Arm. Wombel tauchte aus dem Nichts auf und schnappte mich auf der anderen Seite.
„Dein Name!“, rief Freya.
Endlich reagierte der Typ.
„Dennis“, keuchte er. „Dennis Brumm.“
„Geburtsdatum?“
Bevor er etwas sagen konnte, legte ein Bulle ihm die behandschuhte Hand auf den Mund. Er schleppte ihn weg, zu der langen Reihe geparkter Wannen, immer noch einen Arm auf den Rücken gedreht.
Einer der Robocops packte meine Schulter. Er zerrte an mir.
Ich klammerte mich an Freya.
Wombel ließ mich los.
Panisch griff ich nach seiner Jacke. Wieso ließ er mich jetzt in Stich?
Der Bulle verdoppelte seine Anstrengungen, mich einzukassieren. Ich fühlte mich wie auf einer mittelalterlichen Streckbank.
Wombel riss einem anderen Demonstranten eine Fahne aus der Hand. Die Fahne hing an einem eigenartig kurzen, dicken Holzstück.
Wombel drehte es herum und donnerte den Knüppel dem Robocop auf den Kopf.
Trotz seines Helms zuckte der zusammen.
Ich nutzte die Schrecksekunde und befreite mich.
Freya zog mich fort.
Böller knallten.
Vom Lautsprecherwagen her knarzte eine Stimme. „Die Demo ist hiermit offiziell beendet.“
Wenige Schritte vor mir explodierte etwas.
Sofort brannte meine Kehle. Ich schnappte nach Luft. Meine Augen fingen an zu tränen.
„Tränengas!“, schrie Freya überflüssigerweise.
Sie zerrte mich weg.
Ich presste meinen Schal vor den Mund, atmete stoßweise. Überließ mich ganz Freya, die an meinem Arm zog. Auf der anderen Seite spürte ich die riesige Gestalt Wombels. Dann sah ich vor lauter Tränen nichts mehr.
Flammen
Wahid wischte sich über die Augen. Er schnippelte Zwiebeln und versuchte, die Würfel möglichst klein und gleichmäßig zu schneiden. Die Konzentration auf die Küchenarbeit nahm ihn ganz gefangen. Zu seinem eigenen Erstaunen hatte er festgestellt, dass es ihm Spaß machte zu kochen. Im Wohnheim, in dem sie untergekommen waren, wechselten sie sich damit ab. Dabei war Kochen Frauenarbeit. Kurz dachte er an seine Mutter, verdrängte dann gewaltsam das Bild. Ersetzte es durch das der großen Schwester, die schon früh die ganze Hausarbeit hatte übernehmen müssen. Ihre Hände waren immer rau von der Arbeit.
In diesem Land kochten Männer, traten damit sogar in Fernsehen auf. Die Shows mit den Köchen in stahlglänzenden Küchen schienen beliebt zu sein, jedenfalls gab es mehrere Sendungen dieser Art, wie er beim Zappen bemerkt hatte.
In Afghanistan hatten Männer anderes zu tun. Höchstens an Feiertagen standen sie am Grill, wenn ein Lamm oder Zicklein geschlachtet worden war. Er erinnerte sich an das intensive Aroma des Kebabs, ein wenig schmeckte man immer den Rauch der Kochstelle.
Lebenspraktische Maßnahmen nannten die Sozialarbeiter das, was er und die anderen Jugendlichen hier lernen sollten. Musste man kochen können, um zu überleben? In Deutschland anscheinend schon. In Afghanistan hatten die Frauen gekocht, geputzt und aufgeräumt, das sollte er jetzt tun. Dabei war er in einigen anderen lebenspraktischen Maßnahmen gut geschult, er konnte Tiere hüten, schlachten und zerlegen, er konnte den Acker pflügen, Waren verkaufen, ohne übers Ohr gehauen zu werden, und auch mit der Kalaschnikow kannte er sich aus. Er nahm sie auseinander, reinigte und baute sie wieder zusammen in weniger als drei Minuten. Noch auf zweihundert Meter traf er den Stein, den er anvisiert hatte.
In diesem Land behandelten sie ihn wie ein Kind. Am liebsten hätte er jetzt eine Zigarette gehabt, den Rauch tief in die Lunge gezogen und die Luft eine Weile angehalten. Aber sein Vorrat war alle. Er hackte auf die Zwiebeln ein, bis sie sich in sehr kleine Würfel verwandelten, fast zu Brei wurden.
Draußen schepperte etwas. Bestimmt brachte Abdel den Müll raus. Auch das war hier Männersache. Es hatte sogar eine Reihe von Witzen über Männer aufgeschnappt, die Müll rausbrachten. Die Witze hatte er nicht verstanden, dafür musste er noch mehr Deutsch lernen.
Er guckte aus dem Fenster. Alles, was er in der Dunkelheit erkannte, war sein eigenes Spiegelbild – kurze schwarze Haare, durch die sich ein weißer Streifen zog. Die weiße Strähne war eines Morgens einfach da gewesen. Nachdem sie einen Jungen hatten sterben sehen, einfach so, an einer Lappalie wie Durchfall. In Bosnien war das gewesen, in dem Lager aus improvisierten Zelten, mitten im Wald. Die Mutter des Kleinen, eine junge Frau aus Syrien, hörte nicht auf zu schreien. Sie hatte geschrien und geschrien.
Er biss in seine Faust. Es schmeckte nach Zwiebeln.
Forschend betrachtete er das Gesicht in der dunklen Scheibe. Teerschwarze Augen, die Brauen immer etwas ärgerlich zusammengezogen. Seine Tante hatte gesagt, er werde früh Falten kriegen, wenn er immer so zornig gucke.
Falten machten einen Mann würdevoller, fand er.
Der Geruch nach Rauch stieg ihm in die Nase. Er warf einen Blick auf den Herd. Die Pfanne stand da, noch unbenutzt. Alle Herdplatten waren ausgeschaltet, oder nicht? Der Geruch wurde stärker.
Auf einmal schrillten Rauchmelder.
Getrampel auf dem Flur.
Rufe.
„Feuer!“
„Help!“
„Fire!“
„Yalla, yalla, alle raus!“
Wahid stürzte aus der Küche, rannte zur Treppe.
Dicker Rauch quoll ihm entgegen.
Sozialarbeiter und Kids hasteten aus dem Haus.
Wahid sprang die Treppe hoch.
Barış und Abdel kamen ihm entgegen, zerrten ihn Richtung Tür.
Wahid riss sich los.
„Djalil!“ Seine Stimme trug nicht, der Rauch kratzte in seiner Kehle, er konnte einfach nicht lauter rufen.
Djalil würde ihn nicht hören. Er stürmte die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal nehmend, durch den Rauch, der immer dichter wurde.
Jemand packte ihn eisenhart von hinten und zog ihn zurück.
Wahid wand sich im festen Griff des Feuerwehrmanns. „Djalil! Er ist da oben!“
Pitbull in Aktion
„Mein Name ist Freya von Buckow, Rechtsanwältin, ich möchte wissen, wann mein Mandant Dennis Brumm dem Haftrichter vorgeführt wird.“
„Dennis Brumm? Ham wir hier nicht.“
Freya bedankte sich höflich. Zu höflich, meiner Meinung nach, für die Antwort des Polizeibeamten.
Sie seufzte frustriert. „Die müssen mir Auskunft geben, verdammt. Irgendwo muss er doch stecken.“
Wombel ließ die Bierdose aufpoppen, die er in meinem Kühlschrank gefunden hatte. Ich richtete mich auf der Matratze auf und nuckelte an meiner Cola. Musste meine Lebensgeister erst einmal wecken. Es wunderte mich kein bisschen, dass die Bullen Freya auflaufen ließen. War einfach nicht deren Priorität. Zumal wir nur den Namen kannten, nicht das Geburtsdatum des Jungen, der gestern bei der Demo geschnappt worden war.
Ich rieb mir die Augen. Sie brannten immer noch vom Tränengas. Auch Wombel und Freya hatten rotgeränderte Lider.
Die gestrige Nacht hatte in einem Fiasko geendet. Einige Typen aus unserer Demo zogen später am Abend die Kaiserstraße hinunter und entglasten an einer Bankfiliale die Scheiben. War das noch Widerstand gegen Nazis?
Die Faschos sammelten sich währenddessen an einer Autobahnraststätte Richtung Ostdeutschland und schlugen einen Schwarzen zusammen. Der hatte dort nichts anderes getan, als zum falschen Zeitpunkt sein Auto aufzutanken.
Dennis Brumm war nicht der Einzige, dem diese Nacht unvergessen bleiben dürfte.
Ich schmiegte mich näher an Wombel. Es war gut, seine vertraute Nähe zu spüren. Er roch nach Schweiß und Bier. Mir war klar, dass der riesige Punk nicht wegen mir aus Hamburg angereist war, sondern wegen der Demo. Trotzdem hatten wir nachts aneinander gekuschelt auf meiner Matratze geschlafen. Ich wäre auch einem Quickie am Morgen nicht abgeneigt gewesen, aber bevor ich überhaupt fit genug dafür gewesen war, hatte Freya schon Sturm geklingelt und unsere traute Zweisamkeit gestört.
Jetzt tippte sie wie wild auf ihrem Handy herum. Sie versuchte es bei den kleineren Polizeidienststellen, zum x-ten Mal. Freya hatte dem Ermittlungsausschuss angeboten, sich um den Jungen zu kümmern, dessen Festnahme wir beobachtet hatten. Die Rechtsanwälte, die ehrenamtlich das Telefon des Ermittlungsausschusses besetzten, waren nach den ganzen Festnahmen gestern überlastet und dankbar, dass Freya ihnen eine Aufgabe abnahm. Die wenigen Linksanwälte der Stadt hielten eben zusammen.
Nur gestaltete sich die Rechtshilfe für Dennis schwerer als gedacht. Er schien wie vom Erdboden verschluckt.
„Incommunicado? Sie halten ihn in einer geheimen Folterzelle versteckt?“ Wombel rülpste.
Freya tippte sich an den Kopf. „Wir sind doch nicht in Chile oder so.“
„Ruf einfach deinen Schnulli an, der lügt uns wenigstens nicht an.“ Wombel zupfte spielerisch an meinem Ohrläppchen.
Ich streckte ihm die Zunge raus.
„Keine schlechte Idee“, meinte Freya. „Wir haben einfach zu wenig Daten, um konkret nachzufragen.“
„Mattu ist Chef der Mordkommission, der hat mit Demofestnahmen nichts zu tun.“ Ich sagte es nicht, aber ich war ganz schön stolz auf meinen Freund, der das K11 leitete und damit für Gewalt-, Brand- und Waffendelikte zuständig war.
„Aber er kann in den Computer gucken, was mit diesem Dennis passiert ist“, sagte Wombel. „Man verschwindet in Deutschland nicht einfach so von der Bildfläche.“
Vor Freya und meinem Gelegenheitslover Wombel mit Mattu zu telefonieren, war mir peinlich. Aber was blieb mir anderes übrig? Er steckte sowieso im Polizeipräsidium, auch am Sonntag. Ich bekam ihn in letzter Zeit kaum mehr zu Gesicht.
„Überstunden“, hatte er lakonisch gesagt.
Zwar hatte die Zahl der Kapitaldelikte, wie Mattu sie nannte, in Frankfurt nicht zugenommen, doch es wurden immer mehr Beamte eingespart, gleichzeitig nahm die Bürokratie zu. Mattu stöhnte, dass er mehr Zeit mit dem Ausfüllen von Formularen verbringe als mit Mordermittlungen.
Ich nahm einen großen Schluck Cola und wählte Mattus Durchwahl.
Er war anscheinend ebenfalls nicht allein, denn er sparte sich das Süßholzraspeln. Nur am dunklen, warmen Ton seiner Stimme erkannte ich, dass er sich freute, mich zu hören. Ich erklärte, wen wir suchten und weshalb.
„Warst du etwa …?“ Er brach ab. Wahrscheinlich wurde ihm bewusst, dass er Zuhörer hatte.
„Mir geht es gut und dir?“ Ein bisschen Höflichkeit schadete nicht. Mattu konnte sich ausrechnen, dass ich nicht zu Hause blieb, wenn eine Antifa-Demo angesagt war. Warum reagierte er so entsetzt?
„Danke, beschissen.“
„Was ist los?“ Normalerweise mied er Flüche.
„Kollege verletzt.“ Er stöhnte gequält. „Der Typ hat zwei kleine Kinder, Mann! Hast du was beobachtet gestern?“
Verletzt? Die einzigen Verletzten, die ich gesehen hatte, waren Demonstranten mit Platzwunden gewesen.
„Es war ein totales Chaos“, antwortete ich diplomatisch. „Jetzt sag schon, wieso finden wir Brumm nicht? Deine Kollegen haben ihn verhaftet, das habe ich gesehen.“
„Moment mal.“ Eine Tastatur klapperte. Mattu räusperte sich. „Freya hätte mehr Glück, wenn sie nach einem Deniz Brum fragen würde. Ich buchstabiere D-E-N-I-Z und dann Brum, Berta-Richard-Ulrich-Martha, wiederhole Martha, nur ein M. Das habt ihr nicht von mir.“
„Geboren am zweiundzwanzigsten Mai zweitausendeins, oder?“ Ich nannte aufs Geratewohl ein Datum.
„Neunzehnhundertachtundneunzig, am fünfzehnten Juli.“ Mattu wusste genau, dass ich ihn aushorchte. „Wir sprechen uns später, ich melde mich bei dir.“
Ich schickte ihm einen dicken Schmatz durchs Telefon, bedankte mich und legte auf.
„Der Typ heißt Deniz mit einem N und Z am Ende, nicht Dennis. Und Brum mit einem M.“ Wir hatten falsch verstanden, was Deniz uns bei seiner Festnahme zugerufen hatte.