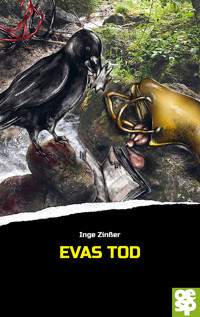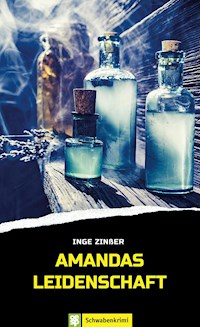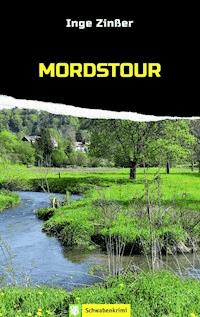Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cafébesitzerinnen Fine, Elfi, Babsi und Luise
- Sprache: Deutsch
Fine hat eine Vision: Das kleine Haus am Dorffriedhof wäre ein wunderbarer Treffpunkt für Friedhofsbesucher. Gemeinsam mit drei Freundinnen beginnt sie, das alte Häuschen liebevoll zu renovieren. Als die ersten Blumen blühen, feiert das „Seelencafé“ Eröffnung. Jede der vier Frauen hat ihre eigene Geschichte, nicht alles läuft glatt, aber sie halten fest zusammen, und bald wird das kleine Cafè zum Seelenwärmer für viele - eine Geschichte über Freundschaft, Miteinander und Trost.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inge Zinßer
Das kleine Seelencafé
ROMAN
Zum Buch
Reden, Plaudern, Schwätzen »Der Seele tut der Austausch gut und auch eine Tasse Kaffee.« Geraume Zeit war es still, dann sprang Luise vom Stuhl. »Das ist es!«, rief sie aufgeregt. »Seelencafé!«
Fine, eine Frau im besten Alter, beschließt, dass sie in ihrem Leben noch etwas Besonderes leisten will. Beim Pflegen des Grabes ihrer Schwiegereltern kommt ihr ein Gedanke: Wieso gibt es keinen Ort, um nach dem Friedhofsbesuch Körper und Seele aufzuwärmen? Das muss sich ändern. Kurzerhand überzeugt sie ihre Familie und Freundinnen, die weltliche und die kirchliche Gemeinde von ihrer Idee, in dem niedlichen alten Haus direkt neben dem Friedhof ein Café zu gründen – das »Seelencafé«. Sie krempelt die Ärmel hoch und zahlreiche Leben um, damit ihr Traum wahr wird. Klar, dass auch einiges schiefgeht. Doch am Ende werden in dem kleinen Café nicht nur Seelen gewärmt, sondern auch miteinander verbunden …
Inge Zinßer, Jahrgang 1954, ist Buchhändlerin in Rente. Sie lebt im schwäbischen Hochdorf und hat bereits mehrere Regionalkrimis mit schwäbisch heiterer Note veröffentlicht, die eine wachsende Fangemeinde haben. Wenn man einmal nicht weiß, wo sie gerade ist, findet man sie mit Sicherheit in der nächsten Buchhandlung. Durch ihren Ehemann, der jahrzehntelang Gräber gebaggert hat, ist sie mit dem lokalen Friedhofswesen und seinen Eigenheiten bestens vertraut. Kein Wunder, dass zwei ihrer vier Kriminalromane auf schwäbischen Friedhöfen spielen, so auch ihr neuester Roman »Das kleine Seelencafé«.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Daria Ustiugova / istockphoto.com; miko2 / shutterstock.com; Chitrogiri / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7654-9
1
Ein rauer Wind wehte über dem kleinen Friedhof, der auf einer Anhöhe lag. Nicht ungewöhnlich für Oktober, er fegte die Blätter von den Bäumen und Tausende von Eicheln dazu, die das Grab unter einem dicken Baum fast vollständig bedeckten. Am und eigentlich schon im Grab kniete eine nicht mehr junge Frau und sammelte die Eicheln in einen Eimer. Dieser war im Handumdrehen voll und es war auch nicht der erste Eimer, sondern der vierte. Fine, so hieß die Frau, rappelte sich stöhnend hoch, mit Anfang sechzig ging das nicht mehr ganz so schwungvoll wie vor zehn Jahren. Als sie vollends in der Senkrechten angekommen war, dehnte sie sich erst einmal ausgiebig. Der Schmerz in ihrem Rücken verflüchtigte sich und sie sah prüfend auf das Grab. Wie viele Eimer würde sie wohl noch füllen? Dann fiel ihr Augenmerk auf ihre mit Erde verschmutzte Hose, beide Knie waren braun eingefärbt und ziemlich feucht. Die Jeans gehörte in die Waschmaschine. Vor dem Einkaufen musste sie wohl erst noch mal nach Hause und sich umziehen. Mit der »Dreckshose« konnte sie nicht zum Supermarkt. Na ja, vielleicht doch, wen interessierte es schon, ob sie Flecken auf der Hose hatte oder nicht? Schließlich kamen die von körperlicher Arbeit, kein Grund also, sich dafür zu schämen. Wem das nicht gefiel, der konnte ja weggucken. Fine beschloss, das Einkaufen gleich anschließend zu erledigen. Die Hände konnte sie sich auch hier auf dem Friedhofsklo ordentlich schrubben, das würde genügen. Auf dem Dorf war man nicht allzu pingelig. Allerdings traf man seltsamerweise immer genau dann auf einen Menschen, der einen nicht unbedingt in einem schlampigen Zustand sehen sollte, wenn man sich in einem befand.
Von hinten näherte sich inzwischen eine andere Friedhofsbesucherin mit einer Gießkanne in der Hand. Bei jedem Grab blieb sie stehen und musterte ausführlich, was zu ihren Füßen lag.
»Guta Morga, so, dent Sia s’Grab richta?« Die nun wirklich alte Frau blieb vor Fine stehen und begutachtete das vor ihr liegende Doppelgrab kritisch. Der skeptische Blick war durchaus angebracht, hatte Fine sich doch in letzter Zeit etwas rargemacht auf dem Friedhof. Die Bepflanzung bestand hauptsächlich aus Unkraut, verziert mit besagten Eicheln. Fast bekam sie ein schlechtes Gewissen, aber immerhin sagte sie sich dann: Heute bin ich bei der Arbeit, es passiert also was.
»Guten Morgen, Frau Richter. Ja, Sie sehen, dass es mehr als nötig ist. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und jetzt noch die ganzen Eicheln. Was man alles bedenken muss, wenn man eine Grabstelle aussucht – nie mehr eine unter einer Eiche, das sag ich Ihnen! Als Wilhelms Eltern damals gestorben sind, dachte natürlich keiner von uns an Eicheln, aber nun haben wir sie, und zwar in Unmengen. Wenn die erst mal aufgehen im Frühjahr und sich im Boden verwurzeln, dann kriegt man sie kaum noch raus.«
»Des isch wirklich a Plogerei. Aber hinterher freut’s einen, wenn älles wieder schee ordentlich isch, gell? Und Sie sind ja no jung und könnet sich bucka. I will ja nix saga, es sieht schon ziemlich grausig aus. Ihr Schwiegermutter dreht sich jo im Grab rum.«
Fine kam sich vor wie ein kleines Schulmädchen, das ausgeschimpft wurde. Sie schluckte eine ärgerliche Antwort hinunter und dachte nur bei sich, dass es die alte Frau Richter nun wirklich überhaupt nichts anging, wie es auf den Gräbern anderer Leute aussah. Und dass die Schwiegermutter sich im Grab umdrehte, war auch nicht zu beweisen.
Die alte Frau war inzwischen weitergegangen bis zur nächsten Wasserstelle und füllte dort ihre Gießkanne. Auf dem Rückweg hielt sie noch einmal an und setzte die Kanne ab.
»Hen Sie g’merkt, dass Ihr Buchs do an Schädling hot? Des isch eindeutig der Zünsler. Wahrscheinlich müsset Sie die ganze Boscha rausreissa! Da müsstet Sie schnell was unternehma, der breitet sich sonst auf älle Nachbargräber aus und des gibt Ärger! I sag’s Ihne halt, wie’s isch.« Mit dieser sich übel anhörenden Verkündigung hob sie die Gießkanne wieder an und ging weiter.
Fine schaute sich besagtes Buchsherz an, das seit Jahren mitten auf dem Grab wuchs. Ja, da waren etliche braune Stellen, das sah nicht gut aus, Frau Richter hatte wohl recht. Aber jetzt im Spätherbst war Fine das vollends egal. Im Frühjahr würde sie weitersehen.
Sie schnappte sich ihren Eimer und lief zum Kompostcontainer. Dort leerte sie mit Schwung die Eicheln hinein, ein sehr befriedigendes Geräusch. Und weil sie sich laut Frau Richter ja noch so gut bücken konnte, tat sie das und füllte den Eimer erneut. Ein Blick hinauf in die ausladenden Äste des großen Baumes ernüchterte sie. Nie im Leben könnte sie das Grab eichelfrei halten, dort oben hingen immer noch Massen. Und so viele Eichhörnchen gab es hier auch gar nicht, die das alles aufsammeln und als Wintervorrat verstecken konnten. Nun ja, Fine würde noch ein paarmal zum Auflesen kommen, dann war es aber auch gut.
Auf dem Friedhof herrschte heute reger Betrieb, hauptsächlich Frauen waren am Werkeln. Die Gräber wurden für Allerheiligen und Totensonntag neu bepflanzt, überall sah man Erika und andere Heidegewächse. Die Pflanzen sollten über den Winter halten und ein wenig Farbe in das triste Braun bringen.
Nicht zum ersten Mal dachte Fine, dass es schön wäre, zwischendurch ein Ruhepäuschen einzulegen und sich mit den anderen Friedhofsbesuchern hier zusammenzusetzen. Aber alle wirkten so geschäftig und umtriebig. Auf dem Friedhof nur herumsitzen und reden, wie sah das denn aus? Grade so, als hätte sie nichts zu tun.
Andererseits ging es im ganzen Dorf nicht mehr so streng zu wie früher. Beim Bäcker saßen tatsächlich am helllichten Vormittag Leute und tranken Cappuccino. Auch das Eiscafé war immer voll. Die Leute hatten mehr Zeit und wohl auch mehr Geld, sie gönnten sich etwas.
Fine, die eigentlich Josefine hieß, leerte den Eimer abermals. Dann nahm sie Kutterschaufel und Kehrwisch und fegte rund ums Grab. Bepflanzen würde sie es die nächsten Tage, für heute war genug getan und außerdem spürte sie ihr Kreuz. Zudem war sie sich sicher, dass es morgen hier wieder ganz genauso aussehen würde. Der Wind, der inzwischen immer kälter wurde und dunkle Wolken vor sich hertrieb, würde das Seine dazu beitragen und es Eicheln regnen lassen. Etliche davon hatten sie bereits beim Aufsammeln fast schon höhnisch auf den Kopf getroffen.
Josefine Eichinger lebte schon immer in Steiglingen. Sie war hier zur Schule gegangen, hatte in der Dorfkirche geheiratet und ihre Kinder taufen lassen. Nur ein paar kurze Jahre vor der Familiengründung hatte sie in Stuttgart gewohnt und gearbeitet. Sie war damals im Vertrieb eines Schulbuchverlags angestellt gewesen, was ihr großen Spaß bereitet hatte. Aber immer war da diese Sehnsucht nach dem Dorf und der Gemeinschaft gewesen. Ihr Mann Wilhelm war auch ein Hiesiger und sie kannten sich schon ewig. Nachdem sie aus der Stadt wieder hierher zurückgezogen war, liefen sie sich erneut über den Weg, und bald wurde geheiratet. Als Susanne geboren wurde, hörte Fine auf zu arbeiten und war ab da eine sogenannte »Nur-Hausfrau«. Zwei Jahre später kam noch ein kleiner Junge dazu – Andreas. Eigentlich war die Familienplanung damit perfekt, dachten sie jedenfalls. Allerdings machte ihnen die Natur einen Strich durch die Rechnung in Gestalt einer kleinen Tochter, die acht Jahre später geboren wurde. Sie wurde Bettina getauft, aber alle nannten sie Betty. Im Spaß erzählte Fine oft, dass das nur passiert sei, weil sie entgegen dem weisen Rat ihrer Mutter den Kinderwagen nach Andreas’ Kleinkindzeit verkauft hatte. Betty war ein richtiger kleiner Sonnenschein. An Arbeiten war danach nicht mehr zu denken gewesen. Fine hatte es nie bereut, wegen der Kinder zu Hause geblieben zu sein. Wilhelms Gehalt reichte und sie kamen gut zurecht. Die Zeiten waren auch noch etwas einfacher damals – niemand flog für einen Urlaub in exotische Länder, das ganze Leben schien bescheidener. Und im Dorf fühlten sie sich wohl. Kein Vergleich zum viel bewegteren Alltag heutzutage.
Sie kannte die meisten Leute im Dorf, aber natürlich nicht alle. Im Lauf der Zeit waren viele her- oder auch weggezogen. So wie ihre eigenen Kinder, die lebten inzwischen zwar im näheren Umkreis, aber nicht mehr in Steiglingen.
Fine und Wilhelm wohnten in einem kleinen Häuschen und waren rein theoretisch Rentner. Allerdings wurstelte Wilhelm ständig mit irgendwelchen Handwerkerarbeiten vor sich hin und war fast mehr beschäftigt als während seines aktiven Berufslebens. Er hatte eine Ausbildung als Schlosser gemacht, kannte sich aber bei so gut wie allem aus, da er lange Jahre als Technischer Hausmeister in einem Krankenhaus gearbeitet hatte. Er war ein richtiger Tausendsassa in allen Bereichen. Im Ruhestand erwies sich das als sehr nützlich. Die Wiesen, die sie geerbt hatten, wollten gemäht werden, am Häusle gab’s eh immer etwas zu reparieren und zu richten, so blieb Wilhelm immer in Bewegung. Ihm wurde nie langweilig. Und Fine auch nicht.
Sie war eine vom alten Schlag, die jeden Tag frisch kochte, auch noch selbst Marmelade machte und sich mit Gemüse und Heilpflanzen auskannte. Und Lesen – Lesen war ihre ganze Leidenschaft! Davon profitierten auch die vier Enkelkinder, die mit Büchern und Geschichten nur so gestopft wurden. Obwohl, seit die meisten von ihnen selbst lesen konnten, wollten sie nicht mehr so häufig vorgelesen bekommen. Aber die Jüngeren waren noch zu begeistern. Sie kuschelten sich mit der Oma aufs Sofa, und dann wurde vorgelesen, bis Fine nicht mehr konnte. Leider wohnten sie nicht im Ort, und so kam es nicht allzu oft zu diesen ausgedehnten Lesestunden.
Fine hatte jetzt wieder mehr Zeit für sich, und vielleicht keimte deshalb das zarte Pflänzchen einer neuen Idee in ihr auf.
Ein erster Gedanke hatte sie an diesem Tag auf dem Friedhof überkommen, als sie eine kleine Pause machen wollte und sich nach einer heißen Tasse Kaffee sehnte.
So viele Leute kamen jeden Tag hierher. Bestimmt hatten es nicht alle eilig und der eine oder die andere würde sich über einen Ort freuen, wo man beieinandersitzen und reden konnte.
Da gab es die Redseligen, die immer gleich Kontakt suchten und anderen Ratschläge gaben. So wie die Frau Richter, die wohl ihren Zweitwohnsitz auf dem Friedhof hatte. Manchmal war das auch lästig, Fine fühlte sich ab und an beobachtet und leicht unter Druck gesetzt, wenn das Grab nicht gepflegt war. Aber das konnte sie gut aushalten.
Dann gab es die ganz Pflichtbewussten, da war alles immer tipptopp. Der Grabstein wurde einmal im Jahr mit der Wurzelbürste abgeschrubbt, die Grabränder waren akkurat von Gras befreit und kein Krümelchen Erde flog auf das Nachbargrab. Wenn der Baggerfahrer neben dem Grab, das sie pflegten, ein neues aushob, waren sie zur Stelle. Beobachteten genau das Geschehen, damit nur ja nichts beschädigt wurde und kein Dreckbollen auf ihre Seite fiel. Der arme Baggerfahrer brauchte gute Nerven und Geduld, um nichts Unbedachtes zu sagen. Es gab sogar Leute, die die Plattenwege wischten. Wilhelm hielt das für ein Gerücht, aber Fine schwor, dass sie es selbst gesehen hatte.
Manche erschienen auch nur im Morgengrauen oder am späten Abend, diese Angehörigen waren offensichtlich nicht auf Kontakt aus und wollten lieber niemandem begegnen.
Ja, und dann natürlich die frisch Trauernden. Die mussten sich erst eingewöhnen und Fine achtete genau auf die Signale, die sie aussandten. Wollten sie lieber allein sein und nicht gestört werden, hielt sie genügend Abstand. Manchmal suchten sie aber auch Augenkontakt und waren froh über ein kurzes Gespräch, ein paar unverfängliche, freundliche Worte. Die erste Zeit kamen die »Neuen« häufig, sie brauchten die Nähe zu ihren Angehörigen, das gab ihnen ein wenig Trost. Nach Monaten wurde es dann meist weniger und sie wandten sich wieder dem Leben zu, alles ganz normal.
Wie wäre es, überlegte Fine, wenn wir so eine Art kleines »Friedhofscaféle« hätten? Offen für jedermann, für Trauernde und Nicht-Trauernde.
Beim Mittagessen besprach sie ihren Einfall mit Wilhelm. Der brummelte etwas von »da geht ja eh kein Mensch hin«, aber so schnell ließ sich Fine nicht aus ihrem Traum reißen. Wilhelm war mit seinen Gedanken woanders, genauer gesagt bei Ersatzteilen für den Rasenmäher. Daher hatte er seiner Frau nicht richtig zugehört. Fine kannte das, an manchen Tagen machte es ihr nichts aus, an anderen reagierte sie beleidigt. Heute war sie so in ihre Idee vertieft, dass ihr seine mangelnde Begeisterung gar nicht erst auffiel.
Gleich morgen führe ich so etwas wie eine Umfrage auf dem Friedhof durch, nahm sie sich vor. Sie musste sowieso hin, die Pflanzen warteten darauf, eingesetzt zu werden.
Gesagt, getan. Punkt neun am nächsten Morgen erschien Fine mit Pflanzen, Hacke, Eimer und sonstigem Zubehör an der Grabstelle und machte sich an die Arbeit. Das Wetter war heute besser, der Wind hatte nachgelassen und die Sonne blitzte durch die letzten Reste der bunten Blätter. Sie hatte richtig Freude daran, an der frischen Luft zu arbeiten. Wie zu erwarten, lag das Grab bereits wieder voller Eicheln, man konnte meinen, sie wären über Nacht zurückgekommen. Das war natürlich Quatsch, der ganze Segen kam von oben, und es würde noch mehr kommen. Nach drei Eimern war das Gröbste geschafft und Fine wandte sich dem Bepflanzen zu.
Da erschien auch schon Frau Richter. Wie immer praktisch angezogen mit festen Halbschuhen, knielangem Rock und einem Anorak. Sogar eine Strickmütze trug sie auf den kurzen Locken.
»Schee machet Sie des!«, lobte sie ausnahmsweise. Offensichtlich hatte die alte Frau heute gute Laune, denn so etwas hörte man selten von ihr. Fine beschloss, die Gunst der Stunde zu nutzen.
»Guten Morgen, Frau Richter. Sie sind ja schon wieder früh unterwegs! Immer fleißig, gell?«
»Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es ja, und ehrlich g’sagt hält mich auch nichts im Bett. Da isch nix los und hier treff ich doch wenigstens a paar Leut!«
»Genau. Da haben Sie vollkommen recht. Wäre es nicht schön, wenn man noch ein bissle länger bleiben könnte?«
»Wia au? Für immer, moinet Sie? Des han i no net vor, i leb ganz gern no a Weile!«
Fine lächelte über den trockenen Humor der alten Frau.
»Nein, so hab ich das natürlich nicht gemeint! Ich hoff doch, Sie bleiben uns noch ganz lang erhalten! Ich hab mir gedacht, man könnte hin und wieder ein wenig zusammensitzen, bei einem Tässle Kaffee vielleicht und Hefezopf … Würde Ihnen das gefallen?«
»Mir zwoi? Warum net, des könnt scho schee sei.«
»Ich dachte eher an ein kleines Café für alle hier, wer Zeit und Lust hat, kann kommen.«
Frau Richter wog bedenklich den Kopf. Und sagte dann genau das, was Fine erwartet hatte.
»Wie sieht denn des aus? Grad wie wenn ma nix zum Schaffa hätt. Des hätt’s früher net geba.«
Aber dann schien sie doch darüber nachzudenken und nickte bedächtig.
»Na ja, schlecht wär’s net. Wenn jetzt der Winter kommt, dann könnt ma sich a halbs Stündle aufwärma. Wenn’s kalt isch, ganget immer älle so schnell hoim, da hot ma gar niemand zum Schwätza.«
»Genau, das meine ich, Frau Richter. Man muss ja nicht ewig hocken bleiben, aber wie gesagt, eine Tasse Kaffee oder Tee und eine Brezel oder auch nicht, und schon hat man etwas Gesellschaft und der Tag ist für viele freundlicher. Denken Sie mal an die ganzen Leute, die daheim niemanden haben!«
»Des stimmt, Sie hend recht. Aber wie soll des ganga?«
»Ich hab mir das schon durch den Kopf gehen lassen. Gegenüber steht doch seit längerer Zeit das Haus leer, ich glaub, es gehört inzwischen der Gemeinde. Vielleicht könnte man unten im Erdgeschoss zwei, drei Räume mieten und dort ein kleines Café einrichten. Muss ja nichts Großartiges werden. Und ein paar Frauen aus dem Dorf könnten das miteinander machen, ich mein, abwechselnd Kuchen backen oder bedienen und den Raum ein wenig gemütlich herrichten. Was halten Sie davon?«
»Ja, des könnt mir schon g’falla. Wisset Sie was, Frau Eichinger, i frag mol a bissle rum bei de Leut, und wenn andere des au gut findet, dann wär des doch vielleicht wirklich a prima Sach!«
»So machen wir’s, Frau Richter. Ich frag auch im Bekanntenkreis. Und bei der Gemeinde wegen des Hauses.«
Fine freute sich, dass ihre Idee bei der alten Frau Richter so gut ankam, das hatte sie nicht erwartet. Die sonst so brummige Alte war heute richtig aufgeblüht und schien eindeutig interessiert.
Mit neuem Schwung brachte Fine noch schnell die restliche Herbstbepflanzung ins Grab und malte sich dabei in Gedanken das gemütliche Café aus.
Wieder daheim, machte sie sich sofort an die Arbeit. Zuerst kochte sie sich eine Kanne Früchtetee, denn sie war doch ziemlich durchgefroren vom Friedhof. Dann griff sie zu Schreibblock und Stift und schrieb eine Liste mit allem, was ihr in den Kopf kam und was zu tun wäre.
Als Erstes galt es natürlich, das mit den Räumen zu klären. Also ein Termin auf dem Rathaus mit dem Bürgermeister, um diesbezüglich vorzufühlen. Sie musste das diplomatisch angehen, am besten so, dass er anschließend meinte, die Idee stammte von ihm selbst. Diese Vorgehensweise beherzigte sie, seit sie in ihrer Jugend »Tom Sawyer« gelesen hatte. Die Stelle, an der Tom einem Freund die ungeliebte Arbeit des Zaunstreichens so schmackhaft machte, dass dieser sich darum riss, fand Fine ungeheuer einleuchtend. Und es hatte bereits einige Male funktioniert, vor allem bei ihren Kindern – warum sollte das nicht auch beim Bürgermeister funktionieren?
Der zweite Punkt waren die Kirchengemeinden. Wenn sie die Pfarrer begeistern konnte, dann hatte sie einen starken Rückhalt.
Fine griff zum Telefon und ließ sich beim Rathaus einen Termin für die Bürgermeistersprechstunde geben, gleich morgen früh um zehn, das war perfekt.
Anschließend machte sie sich an ihr Tagewerk und war in Gedanken immer wieder mit der Umsetzung ihres Plans beschäftigt. Mehr und mehr Vorschläge kamen zusammen. Sie lächelte vor sich hin – wenn das Wirklichkeit wurde!
*
Auch Hedwig Richter ging die Sache nicht aus dem Kopf. Immer wieder dachte sie an Fine Eichingers Worte: so etwas Verrücktes, Waghalsiges, Unerhörtes! Soviel sie wusste, hatte Fine Eichinger keine Erfahrung in der Gastronomie, zumindest hatte sie nichts dergleichen erwähnt. Und doch stürzte sie sich mit Feuereifer auf dieses Vorhaben, das fand Hedwig Richter mutig. Ihre Gedanken schweiften zurück in ihre Jugend. Früher hätte man nicht einmal im Traum daran gedacht – ein Café, um darin herumzusitzen und nichts zu tun. In Stuttgart vielleicht und anderen großen Städten, aber nicht auf dem Dorf. Außerdem war das höchstens etwas für die feineren Leute gewesen, aber nicht für Bäuerinnen. Ihr Leben war ein ganz anderes gewesen. Ab frühester Kindheit hatte sie arbeiten müssen, den Eltern helfen, wo es nur ging. Mit Müh und Not konnte sie die paar Jahre Volksschule beenden und stieg dann sofort ins Arbeitsleben ein, damit sie mit dem kümmerlichen Lohn ihre Eltern unterstützen konnte. Erst als Haushaltshilfe bei einem Lehrerehepaar und ein paar Jahre später in der Spinnerei. Dort war sie geblieben, bis sie geheiratet hatte und ihre Tochter auf die Welt kam. Wehmütig dachte sie an die wenigen glücklichen Jahre zurück, die so schnell vorbei gewesen waren, dass sie ihr inzwischen fast unwirklich erschienen. Ihr Mann August war nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt und Tochter Lieselotte war mit Anfang dreißig an Krebs gestorben. Aber die Eltern waren recht alt geworden und sie hatte sie bis zum Tode versorgt.
Nein, sie hatte nicht viel Glück gehabt im Leben und sie war viel zu viel allein. Wahrscheinlich besuchte sie deshalb so oft den Friedhof. Hedwig Richter wusste, dass sie manchen auf die Nerven fiel, wenn sie sich in die Grabpflege einmischte, aber das war ihr egal. Ihr ging es einfach ums Gespräch, sie hatte ja sonst niemanden zum Reden und irgendwelchen kirchlichen Kreisen oder der Seniorengymnastik wollte sie nicht beitreten. Dazu war sie zu eigenbrötlerisch.
Aber so ein Café … Da konnte sie hin und jederzeit wieder gehen, wenn sie genug hatte. Die Vorstellung gefiel ihr immer besser, je länger sie darüber nachdachte. Sie beschloss, Fine Eichinger zu unterstützen, aber natürlich nicht zu sehr. Wer weiß, wenn man der den kleinen Finger reichte, nahm sie vielleicht gleich die ganze Hand. So gut kannte sie die Frau nicht und Hedwig war ein vorsichtiger Mensch, der sich anderen nur zögerlich annäherte. Nur auf dem Friedhof fühlte sie sich sicher und sprach Menschen direkt an.
2
Pünktlich am nächsten Morgen stand Fine vor der Bürotür des Bürgermeisters. Die Sekretärin hatte sie bereits angekündigt.
»Frau Eichinger, kommen Sie rein, was kann ich für Sie tun?« Bürgermeister Kohl winkte Fine zu sich an den Schreibtisch und bot ihr den Stuhl davor an.
»Grüß Gott, Herr Kohl. Ich habe da so eine Idee und wollte von Ihnen hören, was Sie davon halten.«
Fine legte los, und zwar mit so viel Schwung, dass der Bürgermeister keine Chance hatte, irgendetwas zu fragen. Sie hatte vor lauter Begeisterung ihre Vorsätze von einer diplomatischen Vorgehensweise ganz vergessen. Als endlich alles aus ihr herausgesprudelt war, blieb sie still und sah Kohl abwartend an.
Der Bürgermeister brauchte ein Weilchen, um die vielen Worte seines Gegenübers zu sortieren. Das war doch eine ganze Menge auf einmal gewesen.
»Äh, Frau Eichinger, das ist wirklich sehr interessant. Und Ihre guten Absichten in allen Ehren, allerdings, so einfach, wie Sie sich das vorstellen, ist es nicht. Wenn ich da nur an die Versicherungen denke, Haftpflicht beispielsweise, dazu noch die ganzen Auflagen, die ein Bewirtungsbetrieb erfüllen muss. Hygienekonzept, sag ich nur. Ein riesiger Aufwand – wollen Sie sich das wirklich zumuten? Und wer soll das alles bezahlen?«
Das ließ Fine nicht gelten. Sie rutschte auf der Stuhlkante ganz nach vorne und wurde noch etwas lauter und bestimmter.
»Man muss es nicht übermäßig kompliziert machen. Wissen Sie, genau das ist das Problem. Den Ehrenamtlichen werden tausend Hürden aufgebaut. Heutzutage kann man auf dem Weihnachtsmarkt nicht einmal selbst gemachtes Gsälz verkaufen oder Waffeln anbieten – da muss man vorher zu einer Schulung! Ach, Sie sind ja au net von hier, hätte ich Marmelade sagen sollen? Einerseits will man engagierte Bürger, die sich ehrenamtlich einbringen. Oder kleine Unternehmer, die unsere Welt vielfältig machen. Aber diesen Leuten werden doch immer Riesensteine in den Weg gelegt! Da gibt es das Finanzamt, die Krankenkassen, das Gewerbeaufsichtsamt, das Gesundheitsamt und noch einige mehr. Kaum versucht jemand, etwas auf den Weg zu bringen, sofort gibt es Vorschriften, Bürokratie und zahlreiche Bedenken. Und weshalb? Nicht nur wegen der Sicherheit oder Hygiene, nein, vor allem wollen wieder irgendwelche Institutionen daran verdienen.«
Kohl wollte etwas erwidern, kam aber nicht zum Zug, denn Fine war jetzt richtig in Fahrt.
»Überlegen Sie einmal, ob es wirklich ein Problem gibt. Die Gemeinde braucht das Haus momentan nicht und ich glaube zu wissen, dass auch demnächst nichts damit geplant ist. Wenn das Haus beziehungsweise ein Teil davon genutzt wird, ist das nur gut. Häuser müssen bewohnt werden und geheizt, sonst verkommen sie. Und es muss ja nicht für immer sein. Ein Versuch über zwei Jahre wäre doch möglich, oder? An unsere Kirchengemeinden würde ich mich auch wenden, die könnten doch sozusagen die Schirmherrschaft über das Projekt übernehmen. Es könnte eine neue Gruppe entstehen, die sich abwechselnd um das Friedhofscafé kümmert.«
Von diesem langen Monolog war Fine nun regelrecht erschöpft. Sie legte eine Pause ein. Und der Bürgermeister war froh, endlich auch mal zu Wort zu kommen.
»Und wer soll das Haus so herrichten, damit dort überhaupt etwas stattfinden kann? Frau Eichinger, ich glaube, Sie wissen nicht, was da alles auf Sie zukommt! Es gibt Etliches zu renovieren, Sie können dort nicht einfach einziehen und Kaffee kochen.«
»Ganz so naiv bin ich dann doch nicht, Herr Bürgermeister«, entgegnete Fine leicht angesäuert. »Ich bin sicher, es gibt genug Freiwillige, die bei der Renovierung helfen. Lassen Sie es uns doch einfach probieren, bitte!«
Bürgermeister Kohl schwieg eine Weile und sah dabei auf seine Schreibtischplatte. Dann räusperte er sich und sagte: »Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, so, wie Sie sich hier ins Zeug legen! Wer weiß, ob Sie mich nicht durch den Wolf drehen, wenn ich Ihnen nicht helfe. Na gut, ich werde den Vorschlag aber zuerst mit unseren Gemeinderäten besprechen. Und wir machen einen Ortstermin, damit wir wissen, von welchen Arbeiten wir reden.«
»Einverstanden! Wann immer Sie wollen!«, sagte Fine und strahlte bereits wieder zuversichtlich. Sie vereinbarte einen Termin für den übernächsten Tag und verabschiedete sich.
So schlecht war das gar nicht gelaufen, immerhin hatte der Bürgermeister nicht sofort Nein gesagt. Aber sie hatte ihn auch richtiggehend zugeschwallt, wie sie sich eingestehen musste.
Ihr nächstes Ziel war das evangelische Pfarrhaus. Pfarrer Huber war in seinem Büro und hatte Zeit. Fine wiederholte, was sie dem Bürgermeister gesagt hatte, und stieß diesmal gleich auf offene Ohren.
»Ganz toll, Frau Eichinger, wirklich! Ich halte das für eine grandiose Idee! Und ich glaube, die Zeit ist reif dafür. Wenn Sie mir den Vorschlag vor zwanzig Jahren gemacht hätten, hätte ich gesagt: so ein Quatsch. Kein Mensch setzt sich am helllichten Tag in ein Café hier bei uns. Aber die Zeiten haben sich geändert. Viele sind allein und haben niemanden zum Reden. Und so eine Art Bürger-Café kommt ganz bestimmt gut an.«
»Das meine ich auch, Herr Pfarrer. Ich stell mir das ganz einfach vor, wissen Sie. Es muss gar nicht so ein perfektes Café sein. Es reichen ein Kuchen am Tag und ein paar Brezeln und Kaffee oder Tee. Wie zu Hause, da braucht es keine teuren Automaten. Es soll einfach ein Ort zum Reden und Ausruhen sein.«
»Ja. Und den Bürgermeister werden wir schon überzeugen, mitsamt den Gemeinderäten. Ich spreche auch gleich mit den anderen Kollegen aus der Kirchengemeinde, ich hoffe, Sie sind damit einverstanden?«