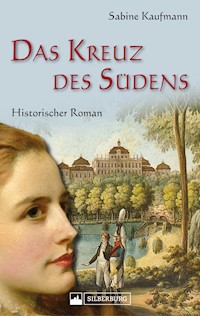
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
1786: Herzog Karl Eugen von Württemberg lebt in Saus und Braus. Um den Bau neuer Schlösser und seine Mätressen finanzieren zu können, verkauft er seine Untertanen als Soldaten. 3000 Unglückliche werden landauf, landab mit allen Tricks gepresst und schließlich per Schiff nach Südafrika verfrachtet. Darunter Lotte, eine junge Magd. In ihrer Not lässt sie sich, als Mann verkleidet, in Ludwigsburg anwerben. Ein gefährliches Unterfangen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Kaufmann
Das Kreuz des Südens
Historischer Roman
Sabine Kaufmann wuchs am Bodensee auf, studierte Neuere und Neueste sowie Alte Geschichte. Von Karlsruhe aus war sie viele Jahre als Journalistin unterwegs, drehte und produzierte Filme fürs Fernsehen mit den Schwerpunkten Geschichte und Gärten. Heute lebt und arbeitet sie in Zürich.
1. Auflage 2018
© 2018 by Silberburg-Verlag GmbH,Schweickhardtstraße 5a, 72072 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,unter Verwendung des Kupferstichs»Schloss Ludwigsburg: Nordgarten mit altem Corps de Logis«und des Gemäldes »Alice« von Henry Tanworth Wells.Lektorat: Gertrud Menczel, Böblingen.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.
ISBN 978-3-8425-2084-4eISBN 978-3-8425-1790-5
Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfaltunseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Für Veronika
Inhalt
1 Mundelsheim, Mai 1786
2 Im Garten von Schloss Hohenheim
3 Ludwigsburg
4 Mundelsheim
5 Mundelsheim
6 Auf freiem Feld
7 Garnison in Ludwigsburg
8 Ludwigsburg
9 Schloss Ludwigsburg und seine Gärten
10 Ludwigsburger Garnison
11 Unterwegs nach Durlach
12 Fort Louis
13 Unterwegs durch Frankreich
14 Fort Rammekens
15 Vlissingen
16 An Bord der Fortuna
17 An Bord der Fortuna
18 Zwischendeck der Fortuna
19 Südlicher Atlantik
20 Die Tafelbay
21 Zederberge
22 Fort de Goede Hoop
23 Ludwigsburg
24 Fort de Goede Hoop
25 Krankenstation
26 Kapstadt
27 Ludwigsburg
28 Kapstadt
29 Fort de Goede Hoop
30 Im Hafen von Kapstadt
Anhang
Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir unsVielleicht zum letzten Mal,So denkt, nicht für die kurze Zeit,Freundschaft ist für die Ewigkeit,Und Gott ist überall.
Aus dem »Kaplied« vonChristian Friedrich Daniel Schubart
1
Mundelsheim, Mai 1786
Aufmerksam musterte Lotte Morell ihr Spiegelbild im Hofbrunnen, dabei strich sie sich eine widerspenstige Haarsträhne aus dem Gesicht und klemmte sie schnell hinters Ohr. Könnte ich jemals eine andere sein? Die Gedanken geisterten unaufhörlich in ihrem Kopf herum. Wie fühlt es sich an, in die Haut eines andern zu schlüpfen, einen neuen Namen zu tragen, Leben gegen Leben zu tauschen? Ist es nur ein Versteckspiel mit Kleidern, Gesten und Gewohnheiten oder verändern sich eines Tages sogar die Bewegungen, die Gefühle, das eigene Ich?
Sie tauchte ihre Hände in das kalte Wasser des Hofbrunnens. Durch die fein gekräuselten Wellen, die sie dabei aufwarf, verzerrte sich ihr Gegenüber. Zwillinge konnten mühelos den Platz der Schwester oder des Bruders einnehmen. Andere, die sich eine fremde Rolle einverleibten, blieben Schauspieler. Bei Hofe, das hatte sie gehört, liebte man die Maskerade, die absichtliche Verwechslung. Sie zog ihre Hände, die vor Kälte kribbelten, aus dem Wasser, schüttelte sie und schlug den Weg zur Obstwiese ein.
Der Frühling hatte dieses Jahr lange auf sich warten lassen. Dann war er mit aller Kraft und Verschwendungslust gekommen. Anfang Mai war die Natur explodiert. Violette und gelbe Farbtupfer flammten in den Wiesen auf, zartes Grün durchflutete die Welt und verdrängte das Wintergrau. Es war, als würde sich die Natur häuten, eine andere werden.
Lotte setzte sich ins Gras, über ihr spannte sich eine Kuppel aus weißen Blüten, sie waren so dicht und üppig, als läge Schnee auf den Ästen. Ein Summen, Brummen und Surren erfüllte die Luft, die Kirschbäume spielten ihre eigene Frühlingsmusik. Sie streckte sich aus und genoss die wenigen Augenblicke, die sie für sich allein hatte. Nicht mehr lange, und der Bauer, bei dem sie in Diensten war, würde sie aufscheuchen und drangsalieren. Das ganze Jahr hindurch, von früh bis spät, bürdete er ihr die schwersten Arbeiten auf, den Schweinestall ausmisten, die Tiere füttern, hinter dem Pflug stehen oder die Garben dreschen. Doch das Schlimmste war, dass er sie bei jeder Gelegenheit begaffte. Und die Bäuerin schlich argwöhnisch hinter ihnen her, beobachtete jeden ihrer Schritte, getrieben von der Furcht, Lotte habe ein Auge auf diesen Grobian geworfen. Verkehrte Welt.
Entfliehen, dem eigenen Schicksal entkommen, Geschlecht und Herkunft ablegen und sich ein anderes Ich, wie eine zweite Haut, überstülpen, diese Gedanken waren wohl das Wunschbild eines blendenden Frühlingstages. In ihrem eintönigen Leben würde sich nichts ändern, sie blieb Lotte Morell, eine Bauernmagd.
2
Im Garten von Schloss Hohenheim
Nichts, er sah überhaupt nichts, durch seine schwarze Augenbinde drang kein Licht, er fühlte sich hilflos, fast ein wenig kläglich. Mit ausgestreckten Armen trippelte er vorwärts, lief ins Leere, seine Fußspitze ertastete den kiesbedeckten Weg – eine Mulde, über die wäre er beinahe gestolpert. Von hinten spürte er eine Berührung an der Schulter, er drehte sich hastig danach um, hüpfte von einem Bein aufs andere, wieder eine Berührung, noch eine, er drehte sich im Kreis, schneller und schneller. Ihm wurde schwindlig, Schweißperlen standen auf seiner Stirn, dass er nichts erkennen konnte, machte ihn ärgerlich. Fast hätte es ihm die Spielerei verleidet, als er samtweiche Haut spürte; er ertastete volle, geöffnete Lippen, die auf der Innenseite feucht waren. Hatte er soeben die Spitze einer Zunge berührt? Oder war es nur eine wunderbare Täuschung? Seine Hände glitten abwärts, streiften ein weites Dekolleté, der üppige Busen und die schmale Hüfte darunter erregten ihn. Obwohl blind, sah er ihr Antlitz genau vor sich. Ihrem lockigen, braunen Haar, der hohen Stirn, die Klugheit ausstrahlte, dem lieblichen Kinn, ihrer natürlichen Schönheit war er verfallen. Als er den weichen Leib an sich zog, durchfuhr ihn ein Beben. In dem Moment löste jemand die Augenbinde und sein Franzele strahlte ihn an. Eine unbestimmte Zahl Hofdamen stand im Halbrund um sie herum, kicherte und applaudierte. Herzog Karl Eugen stieß einen langen, tiefen Seufzer aus, seine Arme fielen schlaff an ihm herunter.
»Ich bin so neugierig, sehen wir uns die Arbeiten am Schloss an? Wie weit sind sie wohl seit unserem letzten Besuch vorangekommen?« Franziska von Leutrum sprühte vor Lebendigkeit.
Der Herzog nickte ihr wohlwollend zu und gewann seine innere Fassung zurück. Franziska war sein Augenstern und der Neubau des Schlosses Hohenheim ein tatkräftiger Beweis seiner Liebe. Er ergriff ihre Hand und zusammen schlenderten sie die Jägerallee des jüngst angelegten Schlossparks hinauf. Von den italienischen Pappeln, die man hier erst vor kurzem eingepflanzt hatte, ging eine wohltuende Kühle aus. In der Ferne hüteten Hirtenmädchen eine Herde Merinoschafe. Welch grandioser Einfall, in dem weitläufigen Landschaftspark ein württembergisches Dörfle errichten zu lassen. Wie oft hatte er sein Franzele zu dieser originellen Idee beglückwünscht? Die bäuerliche Idylle war perfekt, die Gipser und Maurer hatten ganze Arbeit geleistet. Inmitten strohgedeckter Fachwerkhäuser stand ein Dorfbrunnen, aus dem Mägde Wasser schöpften. Eine Meierei bot winzige Becher mit vergorener Milch feil, die säuerlich roch. Käselaibe türmten sich vom Boden bis zur Decke und hübsch bemalte Butterfässchen zierten die Auslage. Im Rathaus residierte ein Schultheiß und an einem künstlich angelegten Wasserlauf war sogar eine Mühle in Betrieb.
Franziskas Lieblingsort war die etwas abseits gelegene Köhlerhütte, die von außen einem Bretterverschlag glich, innen aber mit gelben Seidentapeten ausgestattet war und ihr als Bibliothek diente. Überall wimmelte es von Bauersleuten, die Rechen oder Sensen geschultert hatten, eine Magd trieb eine Schar Gänse vor sich her. Sobald die Bauern seiner Durchlaucht gewahr wurden, zogen sie ihre Kappe und verbeugten sich tief, die Bauersfrauen machten einen Knicks und verharrten mit gesenktem Blick, bis der Herzog an ihnen vorübergeschritten war. Kein Zweifel, als einziger deutscher Landesfürst konnte er mit Versailles, seinen Gärten und dem Hameau de la Reine von Marie-Antoinette wetteifern.
»Wie schön wäre es doch, wenn das Dörfle jeden Tag mit Leben erfüllt wäre«, sagte Franziska.
»Dein Wunsch ist mir Befehl, die Bauern der Umgebung sollen sich täglich im Dörfle einfinden, oder besser noch: Die Damen und Herren am Hofe verkleiden sich als Müller, Magd, Bauer oder Hirtenmädchen und tun hier Dienst.« Bei diesem Einfall huschte ein Lächeln über sein Gesicht.
Sie schlugen einen schmalen Weg ein, der durch ein schattiges Wäldchen führte. Unter Ahornbäumen erhoben sich antike Ruinen. Moosbewachsene korinthische Säulen stellten einen verfallenen Jupitertempel dar. Selbst das Grab Kaiser Neros, ein Gefängnis und ein römisches Bad hatte er errichten lassen. Der Park war eine Melange aus pittoreskem Dorf und römischer Ruinenlandschaft, er versinnbildlichte den Sieg der Tugendhaftigkeit über den Sittenverfall Roms.
Durch die Blätter einer Rotbuche erspähten sie den noch unvollendeten Westflügel des Hohenheimer Schlosses. Es sollte größer, schöner, moderner werden als jeder Bau, den der Herzog je zuvor in Auftrag gegeben hatte. Entsprechend der zeitgenössischen Mode favorisierte er klare Linien statt barocken Pomps, was nicht bedeutete, auf Bequemlichkeit zu verzichten. Das Landgut hatte er bereits vor Jahren Franziska geschenkt und das neue Schloss sollte ihrer beider Zuhause, ihre gemeinsame Zuflucht werden.
Doch so schön er sich das neue Schloss mit Säulen und einer gläsernen Kuppel auch erträumte, die Sache hatte einen Haken, einen gewaltigen Haken. Die Landstände weigerten sich, die aufgelaufenen Rechnungen zu bezahlen. Diese vermaledeiten Landstände, dachte er, dauernd rieben sie ihm unter die Nase, dass sein Hofstaat, vom einfachen Lakaien bis zum Oberhofmarschall, seine Reisen, Schlösser, seine luxuriösen Extravaganzen und nicht zu vergessen seine Liebschaften horrende Summen verschlangen.
Karl Eugen setzte sich auf eine Schaukel, die auf einem Spielplatz vor der Schlossbaustelle stand. Das Franzele berührte ihn an der Schulter und gab ihm von hinten einen leichten Schubs.
Selbst wenn das Volk ihn dafür verachtete: Seine rauschenden, zur Legende gewordenen Feste hatte er bis ins Letzte ausgekostet. Die herrlichsten Bilder stiegen in ihm hoch. Zu seinem fünfunddreißigsten Geburtstag hatte der Sprengmeister vierzehntausend Raketen entzündet, die als Palmen, Pfauenschwänze und Pyramiden den Himmel illuminiert hatten. Opern, Theaterspektakel, Soireen, eine Festivität hatte die andere gejagt. Meist ersann er die Abläufe seiner Vergnügungen selbst, darin war er meisterlich, unübertroffen. Die Maskenbälle und mittelalterlichen Reiterspiele, denen der Hofadel jedes Mal entgegenfieberte, waren spektakulär, ausgeklügelt bis ins Detail. Nicht umsonst hatte Casanova seinen Hof als den brillantesten von ganz Europa gerühmt. Er schaukelte höher und höher, kam dem hellblau leuchtenden Himmel, den dieser heiße Junitag hervorzauberte, immer näher. Ein Glanzstück seiner Vergnügungen war eine Schlittenfahrt gewesen, die er mitten im Sommer arrangiert hatte. Den Weg von Schloss Solitude nach Ludwigsburg ließ er damals mit Salz bestreuen. Schiffsladungen voller Salz hatten seine Kammerdiener aus italienischen Salinen herbeigeschafft. Den Schlitten, in dem er mit einer Mätresse saß, zogen vier weiße Hirsche vorbei an einer Allee blühender Orangenbäume. Die Raffinesse seines Einfalls beflügelte ihn immer wieder aufs Neue, ließ seinen Puls auch jetzt nach oben schnellen. Er fühlte sich, als könnte er fliegen. Beim Auf- und Abschwingen sah er das treuherzige Lächeln seiner Begleiterin, die etwas zur Seite getreten war und ihm mit ihren Blicken folgte. Die Landstände sollten seiner großen Liebe auf immer dankbar sein, schließlich hatte sie durch ihr geduldiges, liebreizendes Wesen sein gieriges Blut besänftigt, seine Leidenschaften gezähmt. Plötzlich erkannte er etwas weiter entfernt zwei Gestalten, die sich langsam dem Spielplatz näherten, und sein Glücksgefühl endete abrupt.
Er ließ die Schaukel ausschwingen, stieg herab und noch außer Atem murmelte er: »Ich hatte Sie völlig vergessen.« Karl Eugen zog die Falten seines Rocks glatt, der beim Schaukeln in Unordnung geraten war, und mit einer Geste deutete er dem ersten Minister des Staates und dem Generalmajor an, ihm zu folgen.
Vor dem »Wirtshaus zur Stadt Rom«, den Namen hatte Karl Eugen sich für die Lokalität in seinem Park selbst ausgedacht, war bereits alles für die Audienz unter freiem Himmel arrangiert. Der Schaumwein, der in langen Gläsern perlte, die kleinen Häppchen aus Wildpastete und geräuchertem Saibling konnten ihn nicht darüber hinwegtrösten, dass er sich lästigen Amtsgeschäften widmen musste. Erhitzt ließ er sich auf die samtenen Polster eines goldlackierten Sessels fallen. Diener in Livree eilten umher und versuchten in vorauseilendem Gehorsam die Mimik seiner Gesichtszüge, jede Bewegung seines Körpers zu deuten.
»Geld, immer fehlt es an Geld.« Karl Eugen blies die Backen auf, seine spröde Haut wölbte sich nach außen wie bei einem quakenden Frosch. Er hielt die Luft an, dabei stach das Weiß seiner Augen hervor, dann presste er die Luft mit einem leisen Pfeifton heraus. »Jedes Mittel ist mir recht, wenn es nur frisches Geld in meine Kasse spült.«
Staatsminister Eberhard von Kniestedt, der es ohne Aufforderung nie gewagt hätte, sich an die lange, gedeckte Tafel zu setzen, zwinkerte mit den Augen.
»Geld aus Papier, das man unbegrenzt drucken könnte, und meine Schulden würden sich in Luft auflösen!« Der Herzog grinste verwegen und trank ein Schlückchen Schaumwein.
»Durchlaucht, ich verstehe nicht?«, antworte von Kniestedt.
»Meine Herren, ich habe Sie rufen lassen, denn im Staatshaushalt klaffen tiefe Löcher.«
Das ist ja nun nichts Neues, dachte von Kniestedt. Seit der Thronbesteigung Karl Eugens, seit drei Jahrzehnten, herrscht Dauerebbe in der Staatskasse.
»Die Lage ist ernst, wir brauchen eine neue …«
»Eine neue Steuer?«, unterbrach ihn von Kniestedt. »In Württemberg gibt es über vierhundert verschiedene Abgaben, Durchlaucht. Bereits jetzt beschweren sich die Landstände über die drückende Steuerlast. Es wird schwer werden, ihnen eine weitere Steuer abzuringen.«
Karl Eugen hätte seinen Staatsminister am liebsten zum Teufel gejagt. Mit welch unermüdlicher Hartnäckigkeit er ihm ständig die Klagen der Landstände vorheulte!
Der Herzog erwiderte: »Aber nein, wie wäre es etwa mit einer Staatslotterie? Städte, Gemeinden, Zünfte und besonders die Klöster sollen sich an einem Glücksspiel beteiligen, und am Ende gewinnt immer der Herzog?« Karl Eugen lachte auf.
Eberhard von Kniestedt, der vom Äußeren, seiner Körpersprache und dem hellen Ton seiner Stimme dem Typ eines vertrockneten Gelehrten entsprach, räusperte sich laut und hielt dem Blick Karl Eugens länger stand als gewöhnlich.
»Spaß beiseite.« Der Herzog deutete mit einer leichten Kopfbewegung Richtung Baustelle. »So schön und weitläufig das neue Schloss auch wird, es verschlingt Unsummen und die Landstände weigern sich zu zahlen.«
Die Finanzen sind das Rückgrat eines Staates, warum hat er nur nie gelernt, mit Geld umzugehen, dachte von Kniestedt und zog die Stirn in Falten.
»Gnade meiner Geburt habe ich beschlossen, ein Söldnerheer auszuheben, damit ließen sich die finanziellen Engpässe des Landes auf einen Schlag lösen.« Der Herzog schob sich genüsslich einen Bissen Wildpastete in den Mund.
»Wie damals 1757, als unsere Kompanien an der Seite der Franzosen in den Krieg gezogen sind?« Der Generalmajor Ferdinand Friedrich von Nicolai meldete sich nun zu Wort. Trotz seiner sechzig Jahre hatte er eine athletische Figur, sein volles weißes Haar verlieh ihm die Würde eines Diplomaten. Dass er vier Sprachen, neben Deutsch, Englisch und Französisch auch Russisch sprach, dazu hervorragende Kenntnisse in Latein und Griechisch besaß, verheimlichte er selten.
»Sie verstehen, was ich meine«, sagte der Herzog, der den Generalmajor wegen seines blendenden Aussehens insgeheim verachtete. Um seinen Verdruss hinunterzuspülen, griff er nach seinem Glas, das ein Diener wieder mit Schaumwein gefüllt hatte.
Was war das damals für ein Husarenstück, dachte der Herzog, als er im Siebenjährigen Krieg sechstausend Mann an die Franzosen verkauft hatte. Seine Untertanen kämpften in der Schlacht bei Leuthen gegen die Armee Friedrichs des Großen. Leider hatten seine Württemberger keinen guten Ruf. Sobald sie in der Nähe eines Schlachtfeldes auftauchten und Rauchschwaden über sie hinwegzogen, bekamen diese Feiglinge weiche Knie und türmten. Dann die Schmach vor zehn Jahren. Die Engländer hatten sein Verkaufsangebot einfach ausgeschlagen. Seine Männer seien keinen Schuss Pulver wert. Damals, während des Unabhängigkeitskrieges, hatte der Landgraf von Hessen-Kassel das dicke Geschäft gemacht und siebzehntausend Soldaten an die Briten verschachert. Jeder Zweite der Unglücklichen ruhte nun in amerikanischer Erde. Im Grunde war Karl Eugen jegliches Gemetzel zuwider, die blutige Realität konnte es nicht mit seinen Feldlagern aufnehmen, in denen er als junger Herzog Schlachten nachgestellt hatte. Gefahrlos konnte er dort in der Rolle des wagemutigen Helden posieren und hinterher sogar fürstlich tafeln.
»Durchlaucht, wer soll die Gnade Ihrer Gunst empfangen?«, fragte von Kniestedt, der sich noch immer vor der gedeckten Tafel seine Beine in den Bauch stand.
»Ich habe eine Anfrage von den Holländern erhalten.« Der Herzog zog einen Brief aus der Innentasche seines Rocks hervor.
»Den Holländern?«
»Genau genommen ist es die Vereinigte Ostindische Kompanie. Und ich habe bereits meine Geneigtheit signalisiert.« Karl Eugen wedelte mit dem Umschlag.
»Weihen Sie uns in die Hintergründe ein?«
»Wie Sie wissen unterhält die edle Kompanie am Kap der Guten Hoffnung eine Handelsniederlassung. Es ist eine Art Zwischenstation auf dem Weg nach Batavia. Die holländischen Kaufleute sind beunruhigt. Sie befürchten, dass die Engländer ihren Handelsposten erneut angreifen werden.«
»Wenn ich mich recht entsinne, haben englische Schiffe die Kapkolonie schon einmal vor fünf Jahren bombardiert«, sagte von Nicolai.
Der Herzog nickte. »Zu unserem Glück hat die edle Kompanie einen unersättlichen Hunger nach Soldaten.«
»Zur Verstärkung ihrer eigenen Garnison?«
»Und zur Sicherung des Seeweges nach Ostindien, wenn ich die Holländer richtig verstanden habe.«
Von Kniestedts Magenwände zogen sich zusammen, nicht etwa, weil der Herzog inzwischen eine Flasche Schaumwein geleert, alle Häppchen der Wildpastete verschlungen hatte und sich nun über die Süßigkeiten hermachte, die ein Diener servierte. Ihn beschlich ein großes Unbehagen, wenn er daran dachte, dass beim letzten Soldatenhandel Hunderte von Württembergern auf den Schlachtfeldern im Herzen Europas ihr Leben gelassen hatten. Und jetzt sollte es nach Afrika gehen, das war ein sicheres Todesurteil.
»Wie werden wir die Truppen ausheben?«, fragte von Nicolai.
»Ich denke an die übliche Vorgehensweise: Versprechen Sie den Rekruten einen großzügigen Sold. Niemand soll denken, ich sei ein Unmensch.«
»Sie meinen, jemand wird sich freiwillig melden.«
Der Herzog fixierte sein Gegenüber scharf. »Freiwillig, gut zugeredet, ein wenig nachgeholfen, wo ist da der Unterschied. Sie sind der Militärexperte. Seien Sie erfinderisch. Auf keinen Fall möchte ich mich bei den Holländern blamieren.«
»Sicher, Durchlaucht.«
»Sorgen Sie dafür, dass so viele junge Männer wie möglich angeworben werden.«
»Wir werden keine Mühe scheuen.«
»Diese zimperlichen Holländer ließen mich wissen, sie wollten keine Kinder in Soldatenröcken. Dabei ist doch allen klar, dass man mit sechzehn längst erwachsen ist. Senken Sie die Altersgrenze von achtzehn auf sechzehn Jahre.« Karl Eugen schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. »Meine Herren, die Zukunft Württembergs lastet auf ihren Schultern. Von Kniestedt, überprüfen Sie, ob der Soldatenverkauf außenpolitische Turbulenzen heraufbeschwören kann. Außerdem ringen Sie den Landständen eine wohlwollende Antwort für dieses Unternehmen ab.«
Diesmal wollte der Herzog in keinem schlechten Licht erscheinen, sein Ansehen als gütiger Landesvater dürfe keinen Schaden nehmen. Niemand solle Gelegenheit bekommen, ihn zu verhöhnen, schon gar nicht dieser elende Friedrich Schiller. Der vermaledeite Schreiberling hatte ihn in seinem jüngsten Stück »Kabale und Liebe« öffentlich diffamiert. Anstatt seiner fürstlichen Durchlaucht auf ewig dankbar zu sein, in der Hohen Karlsschule eine erstklassige Ausbildung zum Medikus genossen zu haben, verunglimpfte er ihn als grausamen Menschenhändler. Karl Eugen glaubte, kochendes Blut schieße durch seine Adern, wenn er an Schillers Unverschämtheiten dachte: Der Herzog habe mit dem Elend seiner Untertanen die Gunst einer Mätresse erkauft, behauptete dieser Schuft. Sollte es Schiller noch einmal wagen, württembergischen Boden zu betreten, dann blühte ihm dasselbe Schicksal wie seinem Intimfeind Christian Friedrich Daniel Schubart. Jahrelang hatte der Dichter seinen Spott mit dem Herzog getrieben. Schließlich hatte Karl Eugen diesen Grobian im Staatsgefängnis Hohenasperg außer Gefecht gesetzt. Wenn es nach ihm ginge, könnte Schubart bis zum Ende aller Tage in dem finsteren Loch schmoren. Wirklich, das schreibende Halunkenpack machte ihn rasend. Gift und Galle könnte er spucken. Minuten vergingen, bis der Herzog sich wieder gefangen hatte. Dann lächelte er und sagte: »Herr von Nicolai, Ihnen habe ich eine besondere Aufgabe zugedacht. Machen Sie Urlaub.«
Der Generalmajor schaute verblüfft.
»Reisen Sie in die Niederlande und treffen Sie sich mit dem Abgesandten der Kompanie, ich will Resultate sehen.«
»Durchlaucht, ich habe kein größeres Verlangen, als mich der Gunst seiner Durchlaucht würdig zu erweisen.«
Beide Herren schlugen die Hacken ihrer Lederstiefel aneinander, verbeugten sich vor der Tafel und verließen rückwärts mit gesenktem Kopf das »Wirtshaus zur Stadt Rom«.
Mein Gott, durchfuhr es den Herzog, wie lange hatte er sein Franzele schon warten lassen, hoffentlich war sie nicht ungehalten mit ihm. Er zog seine Serviette aus dem Kragen, an der braune Essensreste klebten, und eilte zum Langen See. Franziska erwartete ihn bereits am Steg. Sie bestiegen eine venezianische Gondel, ein Hochzeitsgeschenk, das er für sie in der Lagunenstadt erworben hatte.
Langsam entspannten sich seine Gesichtszüge, im Grunde war er mit sich zufrieden. Durch den Soldatenhandel mit den Holländern konnte Schloss Hohenheim nun endlich fertig gebaut werden. Er ließ seine Hand durchs Wasser gleiten, samtig und weich fühlte es sich an. Gekräuselte Wellen plätscherten gegen die Bordwand der Gondel, Schlangenlinien folgten ihnen.
Wie befohlen fuhr Generalmajor Ferdinand Friedrich von Nicolai in Urlaub. In Arnheim traf er auf einen Herrn de Knecht, Bevollmächtigter der Kompanie, mit dem er schnell handelseinig wurde. Selbst die lästige Frage der Altersgrenze ließ sich zügig regeln. Die Herren kamen sich bei einem Alter von siebzehn Jahren entgegen.
Drei Monate später, im September 1786, hielt Karl Eugen den Vertrag mit der Vereinigten Ostindischen Kompanie in Händen. Zufrieden stellte er fest, die Kasse stimmte. Pro Soldat würde der Herzog einhundertsechzig Gulden von den Holländern erhalten. Die Passage, in der sich die Kompanie das Recht herausgenommen hatte, die Soldaten in jeden Winkel der Welt verschicken zu können, überlas er. Ausländische Reibereien seien durch den Handel nicht zu befürchten und selbst die Landstände würden ihm diesmal keine Knüppel zwischen die Beine werfen.
»Ich wusste es doch: Nichts ist unmöglich.« Karl Eugens Leitspruch bewahrheitete sich auch diesmal.
3
Ludwigsburg
Es war ein herrlicher Sonntagnachmittag im September. Der Spätsommer zeigte sich von seiner schönsten Seite. Der Tag war warm und mild, ein leichtes Lüftchen wehte von West und die Welt des Oberstleutnants durchströmte ein sattes goldgelbes Licht – es war genau so, wie Theobald von Hügel das Leben liebte. Er saß am runden Esstisch seiner mit Teppichen, Kommoden und Lüstern überfüllten Stube. Samtkissen türmten sich neben ihm auf dem Kanapee und ein schwerer Moschusduft erfüllte den Raum. In seiner Hand hielt er eine breite Porzellantasse, gefüllt mit Kaffee, den er langsam schlürfte, dabei stöhnte er genüsslich. Eine Wildkatze, sein Fräulein Kayser war eine Wildkatze. Ihren Geruch hatte er noch in der Nase und ihre festen Hände mit den langen, scharfen Nägeln würde er selbst Stunden später noch auf seinem Körper spüren.
Marianne Kayser war seine Verlobte, die zukünftige Mutter einer hoffentlich großen Kinderschar und die einzige Schwäche, die der Oberstleutnant besaß. Es störte ihn nicht, dass sie morgens spät aufstand, ihre Kleider und Schminkdöschen in der gesamten Wohnung liegen ließ und nur wenig Interesse zeigte, sich dem Einerlei des Haushalts zu widmen. Wozu auch? Schließlich gab es Dienstboten. Meisterhaft war sie, wenn es darum ging, eine Gesellschaft zu organisieren, lustvoll und ausgelassen konnte sie feiern, in Württemberg wohl nur übertroffen von den Vergnügungen des Herzogs, die er leider nur vom Hörensagen kannte.
Die weiten Seidenärmel des aprikosenfarbenen Negligés, nur eines seiner zahllosen Geschenke, die ihre Schränke bis zum Rand füllten, flatterten, als Marianne hereinrauschte. Sie setzte sich auf seinen Schoß und wischte ihm zärtlich den Kaffeeschaum vom Mund. Wenn sie ihre langen, dunkelbraunen Haare nach oben gesteckt hatte, kam der unwiderstehliche Schwung ihres Nackens zum Vorschein. Der Linie ihres Halses war der Oberstleutnant verfallen. Oder war es ihre alabasterweiße Haut, die ihm den Verstand raubte? Ihre Augen mit den auffallend langen Wimpern hatten denselben Farbton wie ihre Haare, an den Hüften besaß sie barocke Rundungen. Sie war genau zweiundzwanzig Jahre jünger als der Oberstleutnant.
»Ich finde es furchtbar, wenn du mich alleine lässt, viel lieber würde ich mit meinem süßen Hamster …«, dabei wiegte sie den Kopf in Richtung Schlafzimmer.
»Mein süßer Hamster!« – Hügel wäre vor Scham im Boden versunken, wenn sein Kosename unter den Soldaten die Runde gemacht hätte. Inständig bat er seine Verlobte, ihn nicht wie dieses Wühltier zu nennen, was Fräulein Kayser nach Herzenslust ignorierte. Er konnte ihr nichts verübeln, ihr nicht widerstehen, in ihrer Nähe war er butterweich. Jede freie Minute verbrachte er am liebsten mit ihr.
Seinen Spitznamen führte Hügel, so ehrlich war er zu sich selbst, auf die Physiognomie seines runden Gesichts mit den vollen Pausbacken zurück. Dazu hatte er eine niedrige Stirn und wulstige Lippen. Seine dünnen, aschblonden Haare trug er in der Mitte gescheitelt. Das Einzige, was ihm einen markanten männlichen Zug verlieh, war eine tiefe Furche im Kinn. Seine Figur glich, wie er sich zugutehielt, der des Herzogs. Die Paradeuniform, die er erst seit vier Monaten besaß, klemmte bereits wieder unter den Achseln. Als er seine militärische Ausbildung begonnen hatte, war er drahtig, sportlich, ein begnadeter Fechter gewesen. Die Zeit war unbarmherzig gegen seinen Körper.
»Dienst ist Dienst, so leid es mir tut.«
»Wieso Dienst? Ich denke, du bist der Chef und kannst kommen und gehen, wann du willst?«
»Generalmajor von Nicolai hat seinen Besuch angekündigt.«
»Was kann er wollen?«
»Nur so viel: Es muss eine wirkliche große Sache sein, andernfalls würde der alte Halunke nicht sonntags seine Knochen in die Kaserne schleppen.«
»Spann mich nicht zu lange auf die Folter, ich zerspringe vor Neugier.«
»Wie könnte ich.«
»So ist es brav.«
»Und du, mein Goldkäfer, werde mir ja nicht untreu, solange ich weg bin.« Hügel ließ seine Hand sacht über ihre Haut gleiten. Seinen Kopf drückte er tief in ihr Dekolleté.
»Niemals, versprochen.« Sie lachte laut auf.
Marianne Kayser hatte Hügel in einem anrüchigen, schummrigen Kabarett kennengelernt, in dem sie auftrat. Jeden Abend war er gekommen, um sie zu hören. Alleine saß er an der Theke, starrte sie mit offenem Mund und nach vorne gestülpten Lippen an, als wolle er den Klang ihrer Stimme, jede Bewegung ihres Körpers in sich aufsaugen. Erst wenn sie hinter der Bühne verschwunden war, begleitet von lautem Klatschen und unter dem frivolen Gejohle der Gäste, wandte er seine Augen ab.
Ihr erstes festes Engagement im »Roten Salon« war, wie sie selbst fand, der hoffnungsvolle Versuch gewesen, ihrer Karriere als Sängerin und Tänzerin Schwung zu verleihen. Da sie sich dabei der Missgunst ihres Vaters sicher sein konnte, legte sie sich umso mehr ins Zeug. Sie flirtete mit den Soldaten, verteilte Handküsse und zeigte freimütig die nackte Haut ihrer Beine. Sie unternahm alles, um ihrem Vater zu missfallen.
Als Marianne noch ein kleines Mädchen war, hatte ihre Mutter in aller Stille die Koffer gepackt und das Haus in Ludwigsburg verlassen. Angeblich sei sie mit einem Franzosen durchgebrannt und lebe in Paris, hieß es. Ihr Vater hatte die Kränkung nie überwunden, er zog sich zurück, wurde von Jahr zu Jahr mürrischer und wortkarger, es schien, als spreche er nur noch mit seinen geliebten Pferden. Seiner Tochter gegenüber war er streng und unerbittlich, ihren Wunsch zu singen und Klavier zu spielen missachtete er, schickte sie stattdessen zwei Jahre lang zu Nonnen, die ihr Gehorsam und Anstand beibringen sollten. Marianne war es, als ließe er sie für die Verfehlungen ihrer Mutter büßen. Doch ihren Willen konnten weder er noch die Nonnen brechen. Je mehr man sie drangsalierte, einsperrte oder bestrafte, desto unbändiger und aufsässiger wurde sie. Mit neunzehn tat sie es ihrer Mutter gleich, packte die Koffer, tingelte von Etablissement zu Etablissement und landete schließlich im »Roten Salon«.
Wochen vergingen, bis Hügel sie nach einer Vorstellung endlich ansprach. Er lud sie ein und hielt eine Stunde lang ihre Hand. Dann wartete er jeden Abend auf sie, überhäufte sie mit Geschenken, Blumen oder Pralinen. Dass er wesentlich älter war, störte Marianne nicht. Irgendwann gab sie seinem Drängen nach und zog bei ihm ein. Ihren Vater ließ sie wissen, dass sie ihre Gesangskarriere unterbrochen habe und ohne Trauschein mit einem zweiundzwanzig Jahre älteren Mann zusammenlebe. Marianne genoss den Luxus und die Freiheiten, die Hügel ihr bot. Sie lebte das Leben einer Müßiggängerin, gab sich beschaulichem Nichtstun hin, ohne einen Gedanken an morgen zu verschwenden.
An diesem fabelhaften Spätsommertag schlenderten verträumte Sonntagsmenschen durch die Straßen von Ludwigsburg. Verliebte Paare schmiegten sich dicht aneinander, saßen auf Parkbänken und schauten sich tief in die Augen. Mütter versuchten vergeblich, ihre schreienden Kinder zu beruhigen. Man sah stattliche Herren, bekleidet mit Frack, Zylinder und schwarzen Kniebundhosen, sowie Damen in langen Kleidern, mit auffallend pompösen Hüten. Versonnen flanierten sie durch die Alleen entlang des Residenzschlosses.
Spazierengehen, diesem Zeitvertreib für Weichlinge konnte Hügel nichts abgewinnen. Sinn- und ziellos die Füße plattdrücken, wozu sollte das gut sein? Ein richtiger Mann ging auf die Jagd oder liebte eine Frau, dazwischen gab es nichts. Er durchquerte die Lindenstraße, am Holzmarkt bog er in die Fasanenstraße ein und erreichte schnellen Schrittes die Kaserne.
Theobald von Hügel war der Abkömmling eines unbedeutenden elsässischen Adelsgeschlechtes, dessen Stammsitz, eine einsturzgefährdete Burg, in der Nähe von Hagenau lag. Sein Vater und Großvater hatten als Generäle in der französischen Armee gedient. Die militärische Laufbahn war ihm somit in die Wiege gelegt worden. Mit einundzwanzig Jahren trat er in die Dienste Karl Eugens. In Kürze kämpfte er sich nach oben, erst Rittmeister, dann Major und schließlich Oberstleutnant. Dieser militärische Titel zierte ihn seit vierzehn Jahren, oder anders gesagt: Seit vierzehn Jahren trat er auf der Stelle. Seine Mutter, eine Baroness aus Franken, lag ihm ständig in den Ohren, ob der Rang eines Oberstleutnants schon das Ende seiner Karriere sei, er müsse ehrgeiziger sein und sich ein Vorbild an seinem Vater und Großvater nehmen. Er ließ das Gerede seiner Mutter über sich ergehen, schließlich hatte sie ihm bereits einen Vorschuss auf sein Erbe ausgezahlt, ohne den er sein Fräulein Kayser unmöglich verwöhnen konnte.
Am Kasernentor salutierten die wachhabenden Soldaten, als ihnen Hügel entgegenkam. Ein wenig verschwitzt betrat er schließlich sein Arbeitszimmer. Es blieben ihm nur wenige Augenblicke, bis der Generalmajor eintreffen würde. Ohne dass er eine Antwort auf die Frage gefunden hatte, was dieser Besuch eigentlich bezweckte, klopfte es bereits an der Tür und Nicolai trat ein.
»Stehen Sie bequem, stehen Sie bequem, nur keine unnötigen Verrenkungen.«
Hügel war aufgesprungen und hatte Nicolai soldatisch, mit der flachen Hand an der Stirn gegrüßt. Langsam lockerte er Muskel für Muskel seines Körpers. Der joviale Tonfall seines Vorgesetzten verriet ihm, dass es sich um etwas Außergewöhnliches handeln musste.
»Hören Sie, Hügel, ich war in Holland.«
»In Holland?«
»Offiziell im Urlaub.«
»Und inoffiziell?«
»Die Sache ist völlig geheim, außer dem Herzog, dem Staatsminister, mir und ab heute auch Ihnen weiß niemand etwas davon.«
Jetzt wird es tatsächlich spannend, dachte Hügel.
»Der Herzog will ein neues Regiment ausheben und braucht dafür selbstverständlich einen neuen Kommandanten.«
Hügel nickte eifrig.
»Freuen Sie sich, die Wahl seiner Durchlaucht fiel auf Sie, mein lieber Oberst.«
»Oberst?«
»Ja, ich gratuliere Ihnen, Sie werden zum Kommandanten des neuen Regiments Württemberg ernannt und sind ab heute Oberst.«
»Das ist eine große Ehre.«
»Seien Sie nicht so bescheiden. Aus meiner Sicht war es längst überfällig, Sie zu befördern.« Von Nicolai näherte sich Hügel und klopfte ihm auf die Schulter.
»Ich versichere dem Herzog meinen untertänigsten Gehorsam, meine absolute Treue und Beflissenheit zu jeder Zeit.« Ein kaum sichtbares Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Ich habe nichts anderes erwartet.«
»Sie erwähnten Holland?«
»Ja, kommen wir zum Kern der Sache. In Holland habe ich erstklassige Bedingungen für seine Durchlaucht ausgehandelt.«
Hügel sah ihn mit offenem Mund an.
»Die Vereinigte Ostindische Kompanie braucht Soldaten, sehr viele Soldaten, genau genommen ein Infanterieregiment, das aus zwei Bataillonen zu je fünf Kompanien besteht. Außerdem sind wir vertraglich verpflichtet, eine Artilleriekompanie, die über acht Kanonen und vier Haubitzen verfügt, aufzustellen. Insgesamt sprechen wir von dreitausend Grenadieren.«
»Wo werden wir stationiert sein, in Holland?«
Mit einem spöttischen Unterton lachte Nicolai kurz auf: »Holland, etwa Muscheln sammeln am Nordseestrand? – Mann, wovon träumen Sie?«
Hügel wartete ab, jetzt durfte er keinen Fehler mehr machen, sonst war er das Kommando schneller los, als er es bekommen hatte.
»Es geht nach Afrika, ans Kap der Guten Hoffnung.«
Hügel verzog keine Miene: Afrika. Außer dass es dort heiß sein sollte, sehr heiß sogar, wusste der frisch gekürte Oberst nichts von diesem Land.
»Die Holländer wollen am Kap eine Artillerieschule aufbauen, nur mit den besten Köpfen, versteht sich. Der Abmarsch des Bataillons ist auf Mitte März 1787 geplant.«
»Es ist demnach allerhöchste Eile bei der Aufstellung des Regiments geboten, wenn ich das bemerken darf.«
»Sie dürfen. Aber keine Sorge, wir haben einen erfahrenen Rekrutenwerber verpflichtet. Er versteht es, schnell und vor allem geräuschlos zu agieren.«
Kein Aufsehen zu erregen war für den Erfolg einer Anwerbungstour ausschlaggebend, das war Hügel bewusst. Mit verstörten Ehefrauen, Geliebten oder Schwestern, die vor dem Kasernentor zeterten, musste man immer rechnen. Aufrührerisch, gar zersetzend waren diese elenden Schreiberlinge, die ihre Federn zückten, ihre verqueren Ergüsse ausschwitzten, um dann Militär und Krone seitenweise durch den Dreck zu ziehen. Wenn es ihnen gelang, mit ihren aberwitzigen Hasstiraden den gemeinen Mann aufzuhetzen, war der Schaden irreparabel. Den Dichter Friedrich Schiller würde Hügel nie verstehen. Warum brauchte man die Freiheit des Geistes, wenn es eine Dienstvorschrift gab?
»Was ist mit der Ausrüstung?«
»Dafür hat jeder Offizier selbst zu sorgen. Bevor ich es vergesse, der Kommandant erhält fünfhundert Gulden im Monat, ab sofort.«
Hügel war, als würde er an diesem Septembertag von einer Welle des Glücks getragen. Er übersah sogar die Spaziergänger, die sich mittlerweile auf dem Nachhauseweg befanden. Was für ein Triumph, man hatte ihn zum Oberst befördert und ihm ein Kommando in Afrika anvertraut. Mit siebenundvierzig würde er nochmals in den Ring steigen und allen zeigen, welch ein Teufelskerl in ihm steckte. Sein Fräulein Kayser würde ihn dafür lieben. Im Grunde war es völlig gleichgültig, wo sie ihre Sonntage miteinander verbrachten, allein auf das Wie kam es an. Und tatsächlich, nachdem Marianne die Neuigkeiten gehört hatte, liebte sie ihn erst leidenschaftlich, dann innig.
4
Mundelsheim
»Verschwinde, wir können dich hier nicht gebrauchen.« »Ich wollte nur fragen, ob …«
»Es interessiert mich nicht, hast du verstanden?«
Lotte, die am Tresen stand, drehte sich um und ließ ihren Blick durch die Wirtsstube streifen, die bis auf den letzten Platz besetzt war. Die weintrinkenden Gäste gestikulierten mit Händen und Armen, schlugen sich auf die Schultern und grölten ein wenig zu laut. Dicker Tabakrauch waberte wie frühmorgendlicher Nebel durch den Raum.
Das »Gasthaus zum Wilden Mann« war ihr vielgeliebtes, elterliches Zuhause gewesen. Hier hatte sie eine endlose Reihe glücklicher Tage verbracht, die Erinnerung an ihre Kindheit bewahrte sie wie einen Schatz. An Feiertagen hatte ihre Mutter die Tische in der Gaststube mit gestärktem Leinen und feinem Geschirr eingedeckt. Die kantigen Bügelfalten wölbten sich über dem Holz und formten akkurate Rechtecke. Das Leinen wurde von rotleuchtenden Blumenbordüren gesäumt und in den hauchdünnen Tellern verfing sich das Sonnenlicht. Immer freitags zog der Duft von frisch gebackenem Hefezopf aus der Küche und erfüllte das ganze Haus. Lottes Mutter stammte aus bürgerlichen Kreisen und hatte viel Wert darauf gelegt, dass ihre beiden Töchter außer kochen und nähen auch rechnen, lesen und schreiben lernten.
Ihr Vater, Küfer und Bürgermeister des Ortes, durchstreifte mit Lotte die heimischen Wälder und Wiesen. Schon als Kind konnte sie das Getreide bestimmen, noch bevor es reif war, die Formen der Blätter verrieten ihr die Namen der Bäume. An Sommerabenden saßen sie lange im Hof und erzählten sich Geschichten oder lauschten dem Zirpen der Grillen. Damals hatte Lotte geglaubt, die Zeit würde stillstehen, Gegenwart und Zukunft seien aus demselben kostbaren Material gewoben.
»Mein Dienstherr hat mich vor die Tür gesetzt. Er …«
»Geschieht dir wahrscheinlich ganz recht.«
»Ich will doch nicht viel, nur essen und trinken.«
»Wir können niemanden durchfüttern, schlimm genug, dass uns deine Schwester ständig zur Last fällt.«
»Ich bin hartes Arbeiten gewöhnt.«
»Hartes Arbeiten? Das wüsste ich aber.« Lottes Stiefmutter schnaubte und stemmte ihre Hände in die Hüften.
»Der ›Wilde Mann‹ ist auch mein Zuhause, es ist mein gutes Recht, hier zu sein.«
»Was fällt dir ein, dein Vater und deine Mutter sind seit einer Ewigkeit tot. Das Wirtshaus gehört mir allein, mir und meinen Söhnen.«
»Das ist …«
»Das ist was? Schon vergessen, dein Vater lief mir hinterher, kurz nachdem eure Mutter gestorben war. Wie ist er mir um den Hals gefallen, als ich ihn getröstet und den Dreck weggeputzt habe.«
Lotte senkte ihren Kopf. »Ich weiß nicht weiter.«
»Such dir woanders eine Bleibe, wir können dich hier nicht gebrauchen«, sagte ihre Stiefmutter bestimmend.
»Ich, es ist schrecklich, …«
»Hau ab, oder soll ich den Hund holen?«
Ihre Stiefmutter besaß das Naturell eines Schlachtrosses, sie war einfältig und gierig, darüber hatte sich Lotte nie getäuscht. Aber dass man sie eines Tages aus ihrem Elternhaus hinauswerfen würde, lag völlig außerhalb ihrer Vorstellungskraft.
Lotte erschrak, als sie in die Gesichter der Gäste sah. Erst jetzt bemerkte sie, welch Gesindel im »Wilden Mann« ein- und ausging: Jede Menge Soldaten und Tagelöhner in schmutzigen Kleidern hockten zusammen. Besinnungslos schütteten sie Wein in sich hinein, spielten Würfel oder stritten miteinander, jemand spuckte auf den Boden. Ein junger Kerl mit wilden, pechschwarzen Haaren lag besoffen auf einer Tischplatte und schnarchte. Der Dielenboden war fleckig, die Stühle knarrten. Es roch nach Vergorenem. Der »Wilde Mann« hatte seine Seele verloren. Es war, als würde ein Teil von ihr sterben.
»Hast du noch immer nicht verstanden?«
»Warum sind so viele Soldaten hier?«
»Der Herzog lässt anwerben.«
»Ist Krieg?«
»Nein, für Afrika, erzählt man sich.«
»Afrika?«
»Die Männer werden nach Ludwigsburg gebracht.«
»Sind es viele, die anheuern?«
»Was schert es dich?«
Lotte zuckte mit den Schultern.
»Hau endlich ab und komm ja nicht wieder«, schrie ihr die Stiefmutter hinterher.
Wie eine geprügelte Bettlerin trat Lotte hinaus in die sternenlose Oktobernacht. Sie machte ein paar Schritte und blieb in der Dunkelheit stehen. Von weitem hörte sie das Kläffen eines Hundes. Konnte man sich einsamer und verlorener fühlen? Es war erst zwei Tage her, dass der Bauer sie verprügelt hatte. Die Beule oberhalb der Schläfe war blau angelaufen und schmerzte höllisch. Sie spürte, wie das Blut in immer heftigeren Stößen durch ihre Adern rauschte. Achtzehn Monate hatte sie bei diesem Grobian als Magd geschuftet, achtzehn Monate, davon war er ihr den Lohn eines ganzen Jahres schuldig geblieben. Als sie diesen einforderte, kam es zum Streit. Plötzlich hatte der Bauer nach einer Zange gegriffen und sie ihr über den Kopf geschlagen. Dann wurde ihr schwarz vor Augen, sie konnte sich an nichts mehr erinnern. Als Lotte wieder aufwachte, lag sie mit zerfetzten Kleidern und blutverschmierten Schenkeln in einem Graben.
Unbändige Wut und Verzweiflung schnürten ihr die Kehle zu, sie schluchzte, dann schossen Tränen aus ihren Augen. Sie heulte wie nie zuvor in ihrem Leben. Ihr Körper schüttelte sich vor Erregung. Es war hoffnungslos, im Winter würde sie keine neue Stelle finden. Was sollte nur aus ihr werden, ohne Geld, ohne Dach über dem Kopf? Gott schien sie vergessen zu haben, sie könnte auch sterben, es machte keinen Unterschied.
»Lotte, Lotte, komm hierher.« Sie erkannte eine vertraute Stimme, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und drehte sich um. Vom angrenzenden Brennhaus winkte ihr aufgeregt eine schmächtige Gestalt zu.
»Los, beeil dich! Es darf uns niemand sehen.«
Es war ihre kleine Schwester Marie.
»Ich habe beobachtet, wie du ins Wirtshaus gegangen bist und habe hier auf dich gewartet.«
»Du hast mich gesehen?«, fragte Lotte.
»Zufall, ich war gerade im Hof.«
So, Seite an Seite, hätte niemand die beiden Frauen für Schwestern gehalten. Lotte besaß einen braunen Teint, eine drahtige Figur und aus ihren lebendigen Augen funkelte ein scharfer Verstand. Ihre schmalen, langen Hände, die in ein feines Handgelenk mündeten, hatten gelernt zuzupacken. Sie schreckte vor keiner Arbeit zurück. Zum Verdruss ihrer Mutter war Lotte lieber an den Fluss zum Angeln gegangen, anstatt zu Hause Stickarbeiten anzufertigen. Als kleines Mädchen streunte sie mit Vorliebe durch die Streuobstwiesen und war wie eine Wilde in den Bäumen herumgeklettert. Marie dagegen war die Zarte und Blasse, die man schonen musste.
»Eine Nacht kannst du bei mir bleiben, hörst du.«
»Danke.«
»Morgen bist du wieder weg, versprochen?«
»Sicher, ja.«
Unbemerkt stiegen die beiden Frauen die Holztreppe nach oben, die das Brennhaus von der Wirtsstube trennte. Parterre befanden sich die Kammer des Knechts, der Brennofen und das Lager für die Schnapsflaschen. Im ersten Stock links des Korridors schlief Marie, ein Zimmer weiter ihre Stiefbrüder. Die rechte Seite war das Refugium ihrer Stiefmutter.
»Ich riskiere Kopf und Kragen, dich hier übernachten zu lassen«, sagte Marie, als sie in die Kammer eintraten.
Sie ist kränklich und ängstlich, aber immerhin hat sie ein weiches Herz, dachte Lotte.
Das Zimmer war schlicht eingerichtet: ein Bett, ein Stuhl und eine Holzkommode, auf der eine Tonschüssel und ein Wasserkrug standen, in einer Linie daneben lagen ein Kamm und eine Schere. Die Schwestern setzten sich aufs Bett und zogen eine schwere Wolldecke über ihre Beine. Das flackernde Kerzenlicht warf ihre Umrisse an die Wand.
»Wie konnte Vater nur diese Hexe heiraten?«
»Sie war jung und sie half ihm, als Mutter gestorben ist.«
»Angebiedert hat sie sich, die ordinäre Person, und ständig war sie besoffen. Hast du die leeren Flaschen hinter den Kellerregalen nie bemerkt?«
»Du übertreibst.«
»Natürlich, ich übertreibe. Es ist sicherlich auch übertrieben, dass wir schuften mussten wie die Tiere. Jede Drecksarbeit hat sie uns aufgehalst. Wer wischte die Böden, säuberte die Latrinen? Und als Dank verteilte sie Schläge.«
»Auf dich hatte sie es besonders abgesehen.«
»Ein Hundeleben hatten wir und ihre beiden Taugenichtse hat sie verhätschelt.« Lotte machte eine Pause. »Bis Vater vor Gram gestorben ist.«
»Er war krank.«
»Er hat den Tod unserer Mutter nie verschmerzt. Die Zeit heilt keine Wunden.«
Stumm saßen die Schwestern nebeneinander, wie zwei Fremde, die sich nichts zu sagen hatten, obwohl noch so vieles ungesagt geblieben war. Sie wagten nicht, sich anzuschauen. Als Lotte die Stille nicht mehr ertrug, fragte sie: »Hast du dir jemals gewünscht, ein anderer zu sein?«
»Du meinst, wie es wäre, in der Stadt zu leben oder am Hofe des Herzogs?«
»Würdest du gerne einmal in eine andere Rolle schlüpfen?«
»Als Schauspieler?«
»Nein, im wirklichen Leben.«
»Ich verstehe nicht.«
»Hast du dir schon einmal überlegt, wie es ist, ein Mann zu sein?«
»Du hast vielleicht verrückte Ideen!«
»Männer sind frei, ungebunden, können einfach auf und davon gehen. Frauen müssen heiraten und sind dazu verdammt, Kinder zu kriegen. Sieben, acht, bis sie im Wochenbett sterben.«
»Hör auf, was redest du da.«
»Ein Mann müsste man sein.«
»Ich will mir das gar nicht vorstellen, Männer riechen schlecht, fluchen, kauen diesen scheußlichen Tabak und spucken überallhin.«
»Als Mann kann man sogar Medizin oder Theologie studieren.«
»Davon verstehe ich nichts.«
»Eben. Frauen werden dumm gehalten, sparen für die Aussteuer und bleiben an der Scholle kleben oder müssen sich als Magd verdingen.«
»Das war schon immer so, warum sollte sich daran etwas ändern?«
»Männer können Handwerker, Ärzte, Pfarrer oder Richter werden. Uns bleibt die Wahl zwischen einem Dutzend heulender Plagen, Betteln oder …«, Lotte zögerte.
»Oder was?«
»Stehlen.«
»Nein, nein, wenn dich Vater und Mutter hören könnten.«
»Egal, wie arm ein Kerl ist, er hat immer noch die Wahl, Soldat zu werden.«
»Aber was willst du jetzt machen?«
»Nicht betteln und nicht stehlen.«
Marie löste ihre Spange und schüttelte ihr dichtes, braunes Haar. »Ich bin müde, lass uns schlafen, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
»Da könntest du recht behalten.«
Marie löschte die Kerze, wickelte sich in die Decke und schlief mit dem Gesicht zur Wand ein. Lotte legte sich daneben, zog ihren Schal bis zum Kinn und hörte auf das leise Atmen ihrer Schwester. Sie spürte, wie der Schlaf langsam in ihr hochkroch. Gegen die Müdigkeit in ihrem Körper konnte sie sich nicht wehren. Immer wieder fielen ihr die Augen zu, sie krallte ihre Fingernägel in den nackten Unterarm, wollte sich zwingen, wach zu bleiben, vergeblich, sie schlummerte ein. Als Lotte plötzlich wieder aufschreckte, hatte sie das Gefühl für die Zeit verloren. Wie spät war es? Auf keinen Fall durfte sie den richtigen Augenblick verpassen. Marie neben ihr atmete tief und gleichmäßig wie zuvor. Gespannt lauschte Lotte auf jedes Geräusch von draußen, nichts, Minuten vergingen, noch immer nichts. Eine unheimliche Stille hatte das Haus erfasst.
Es war so weit. Sanft, fast unmerklich strich Lotte ihrer Schwester über das Haar: »Lebe wohl, kleine Marie.« Dann stand sie auf, griff den Beutel, steckte die Schere hinein und verließ auf Zehenspitzen Maries Zimmer.
Im Treppenhaus schlich sie nach unten, die Stufen knarrten leise unter ihren Tritten. Sie hatte Glück, die Tür zur Kammer des Knechts stand einen Spalt offen, schnell huschte sie hinein. Max schnaubte wie ein altes Maultier. Seine Sachen, Jacke, Hose, Hemd und Hut hingen an einem Holzhaken neben dem Eingang. Darunter standen seine Stiefel. Er wird sich morgen schwarz ärgern, wenn er seine Kleider nicht findet, und meine Stiefbrüder verdächtigen, sie gestohlen zu haben. Geschieht ihnen ganz recht, diesen Tölpeln. Sie schmunzelte in sich hinein. So hart würde es Max nicht treffen, sie wusste, er besaß eine zweite Garnitur.
Auf einmal wurde die Haustüre aufgerissen. Lotte hörte lautes Poltern und Grölen, das sich ihr näherte. Sie erkannte die Stimmen ihrer Stiefbrüder.
»Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver Mann, wer seinen Durst mit Achteln labt, fang lieber gar nicht an«, krächzte der Ältere.
»Bravo, du könntest im Kirchenchor mitsingen«, applaudierte der andere.
»Lass uns noch eine Flasche Schnaps köpfen, meine Kehle ist schon wieder ganz trocken.«
»Einen können wir uns noch genehmigen.«





























