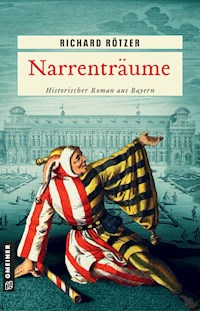4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München 1320: Zur Kirchweih strömen Gaukler in die geschäftige Stadt und ziehen das Publikum in ihren Bann. Da geschieht plötzlich ein grauenhafter Mord, dem bald weitere folgen. Die beiden Freunde Peter und Paul machen sich daran, die Verbrechen aufzuklären. Bei ihren Nachforschungen erhärtet sich allmählich ein schrecklicher Verdacht. Am Ende werden sie Zeugen einer wahrhaft teuflischen Verschwörung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Richard Rötzer
Das Labor des Alchemisten
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Richard Rötzer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-207-8
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Das Buch
München 1320: Zur Kirchweih strömen Gaukler herbei und ziehen mit einem gewagten Seiltanz hoch über dem Markt das Publikum in ihren Bann. Für Wiltrud, die eigensinnige Hafnerin, die kurz vor einer Verheiratung gegen ihren Willen steht, hat das Schauspiel seinen eigenen Reiz, denn Siegfried von Hohenau, einer der Spielleute, macht ihr ungeniert den Hof. Dem Hohen Rat dagegen ist das sittenlose Treiben der Spielleute ein Dorn im Auge. Wenig später wird die kopflose Leiche eines Priesters gefunden, und Angst breitet sich in der Stadt aus. Als sich die rätselhaften Vorgänge mehren, sind der junge Landpfleger Peter Barth und sein lebenskluger Freund Paul heilfroh um ihre Kenntnisse in Schadenzauber und Magie.
Prolog
Wenn Unschuld ein Verbrechen war, dann wurde an jenem kalten Februartag des Jahres 1300 nach Christi Geburt dem Recht auf schreckliche Weise Geltung verschafft. Andernfalls war der grausame Tod, zu dem ein gnadenloser Richter die Kreatur verurteilt hatte, himmelschreiendes Unrecht.
Kaum einen der Gaffer, die dicht gedrängt, mit harten und selbstzufriedenen Gesichtern die Gassen der Stadt München säumten und schon gar keinen der großspurigen Burschen, die lärmend und Zoten reißend den Armesünder-Karren umsprangen, plagte auch nur der geringste Zweifel. Zu eindeutig schienen die Fakten, zu offensichtlich die Schuld.
Der Zug wälzte sich stockend unter dem Klang der Malefizglocke und dem Geschrei der aufgewühlten Menge durch die Kaufingergasse nach Westen. Die Pforten zu Unserer Lieben Frau standen nach altem Brauch weit offen. Aber die Richtersknechte hatten an diesem Tag mehr damit zu tun, übermütige Rohlinge von einem kecken Sprung auf den Karren abzuhalten, als dafür zu sorgen, daß nicht die Malefizperson ins Kirchenasyl entwich.
Die Wachshändler auf dem Kirchplatz reckten die Hälse und brachen ihre Schragentische ab, um dem Schauspiel zu folgen. Für heute war das Geschäft ohnehin gelaufen, und morgen würde sich hier eine ganz andere Prozession bewegen, würden dieselben mitleidlosen Bürger gemessenen Schritts und mit Kerzen in den Händen zur Feier der Reinigung Mariens schreiten, denn an Lichtmeß gedachten die Gläubigen des Mysteriums, daß die allerreinste Jungfrau sich nach Geburt ihres Kindes dem Gesetz unterwarf und ein Paar Tauben opferte, um vom Priester wieder als rein für den Tempel des Herrn erklärt zu werden.
Heute aber dürsteten die Verehrer Mariens nach einem anderen Opfer und forderten erbarmungslos die Sühne unglaublichen Frevels. »Kindsmörderin! Verfluchte Brut!« schrien sie wütend, und am lautesten schmähten die Gattinnen und ehrbaren Mütter die gefallene Jungfrau: »Dreckige Dirn!« und: »Fort mit der schamlosen Buhle! Verbrennt das Weib!«
Die Rechtschaffenen sahen ein Ungeheuer auf dem Karren, eine mörderische Bestie. In Wahrheit war es noch ein Kind, ein halbwüchsiges Mädchen in erbärmlichem Zustand, das zusammengekauert auf dem Leiterwagen hockte und verängstigt wie gestelltes Wild den gröbsten Nachstellungen seiner Peiniger zu entgehen suchte.
Es hieß, sie sei die Tochter des Fuhrknechts, der bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Brutale Hände hatten jetzt ihre kindlichen Locken erst grob mit der Schere abgefranst, danach ihren schmalen Kopf kahl geschoren. Das schlackernd weite Büßerhemd aus Grobleinen, in das die Frau des Schergenstubenhüters den schmächtigen Körper gesteckt hatte, ließ die zarten Rundungen einer jungen Frau noch nicht einmal erahnen. Und doch hatte sie schon geboren. Geboren und getötet!
Bei Gott, es war nicht ungewöhnlich, daß junge Mütter ihr Neugeborenes töteten, und in den meisten Fällen trieb sie noch nicht einmal Angst ums kärgliche Brot zur Verzweiflungstat, sondern die Angst vor Schande und Ehrlosigkeit.
Natürlich zeterten die Pfaffen und drohten mit Verdammnis. Es war auch leicht, wenn man nicht selbst einen Haufen hungriger Bälger durchbringen mußte und eigene Fehltritte unbemerkt im Findelhaus verstecken konnte. Zwar sprachen auch weltliche Richter von homicidium, also Mord, aber viele waren geneigt, zumindest beim ersten delictum einen bedauerlichen Unfall anzunehmen und der Beteuerung Glauben zu schenken, das Würmchen sei nächtens im Bett versehentlich erdrückt worden. Auch Wahnsinn entschuldete und ersparte den Müttern gleichfalls die Strafe. Warum also, in Gottes Namen, hatte dieses erbärmliche Wesen auf dem Karren in seiner Not keinen milden Richter gefunden?
Der Zug hatte sich inzwischen durchs Kaufingertor gezwängt und schwoll immer mehr an, während er den jüngst mit Mauer und Graben umfriedeten Teil der Stadt durchzockelte. Etliche Meister ließen ihre Lernknechte das Tagwerk beenden und sich einreihen, denn wo ein Zeichen unerschütterlicher Gerechtigkeit und abschreckender Strafe aufgerichtet wurde, da sollte dies die Jugend belehren und heilsames Beispiel sein.
Die Richtersknechte hatten Mühe, das aufgebrachte Volk zurückzudrängen. Unrat und Steine flogen. Diejenigen, die es schafften, sich zum Karren vorzukämpfen, bespuckten die Todgeweihte und schrien gehässig: »Kneift das Luder! Brennt ihr endlich den sündigen Leib!« Zuhinterst auf dem Karren stand ein Becken mit glühenden Kohlen, aus dem heraus die langen Griffe eiserner Zangen das Opfer bedrohten. Aber merkwürdigerweise machten die Schergen davon keinen Gebrauch.
Das Mädchen krümmte sich wimmernd. Seine vor Entsetzen geweiteten Augen fanden keinen Halt in der rasenden Menge, stierten ins Leere und verkündeten die Nähe des Wahnsinns.
Nachbarn hatten sich vor Gericht erinnern wollen, daß ihnen das stille und zerbrechlich wirkende Kind von jeher sonderbar, aber nicht wirklich verrückt erschienen war, bis es heranwachsend vor zwei, vielleicht auch drei Jahren urplötzlich aufgehört hatte zu reden: von einem Tag auf den anderen! Einfach das ohnehin kärgliche Sprechen eingestellt, als habe es der Welt in alle Ewigkeit nichts mehr zu sagen. Bald hieß es: »Ein Dämon hat sie ergriffen, der ihr das Sprechen verbietet!«
Heute war jedermann klar, daß der verkommene Lasterbalg mit dem Leibhaftigen brünstig verkehrt hatte. Wie anders wollte man sonst erklären, daß die Besessene nicht in der Lage war, einen Vater für ihre verdorbene Frucht zu benennen. Nicht, daß es für die Frage der Schuld auch nur entfernt von Bedeutung gewesen wäre, wem sie den Fehltritt anlasten wollte. Abtreibung und Kindsmord waren sündhafte Vergehen der Weiber – und nur der Weiber!
Am Weihnachtsmorgen, noch halb zur Nacht, war die alte Magd durch widerwärtige Geräusche aus dem Schlaf geschreckt. Sie folgte dem unheilvollen Stöhnen, Stampfen und Scharren in den Stall, wo ihr die Sünderin von kaltem Schweiß überströmt, auf allen vieren und mit wirrem Blick entgegenkroch. Ihr Kittel war blutgetränkt, an Händen und Schenkeln klebten dunkle Krusten, und aus dem Schoß baumelte die abgerissene Nabelschnur. Das Mädchen stammelte, gebärdete sich wie wild, und mit der ersten Dämmerung offenbarte sich den Herbeieilenden ein grausiger Fund: Im Stroh zwischen den ängstlich scheuenden Pferden lag ein blutiger Klumpen Fleisch, von Hufen zermalmt.
Der Frevel war greifbar und offensichtlich: Während die Christenheit die Geburt des Erlösers feierte, warf die Verruchte einen Balg ins Stroh, der in jenen Tagen gezeugt worden war, in denen die Ehrfurcht vor dem Leiden des Herrn strenges Fasten auferlegte und jegliche Fleischeslust verbot. Die Frucht der Sünde war daher so sicher verflucht wie vom Satan als Inkubus gezeugt, und um seiner Buhle die Schande zu ersparen, zertrat er den Wurm sogleich, wie es die Jungfrau mit der Schlange tat.
»Kneift sie endlich mit den Zangen! Verbrennt das stinkende Fleisch! Glüht das Loch aus, aus dem das Unheil kroch!« Immer haßerfüllter forderte die Menge Taten, gierte nach Blut und verbranntem Fleisch.
Ihr Haß gründete in der Furcht, durch die Frevlerin um eine große Hoffnung betrogen zu werden, denn es verdichteten sich Gerüchte, daß Papst Bonifaz zu Rom erwog, dieses Jahr zu einem heiligen Jahr auszurufen, in dem allen reuigen Pilgern in der heiligen Stadt ein vollkommener Ablaß zeitlicher Sündenstrafen gewährt werden sollte. Natürlich würde der Flickschuster oder der hungernde Weber die beschwerliche und kostspielige Reise niemals antreten. Um so mehr hegte man weithin die Hoffnung, daß dieses heilige Jahr dennoch allen zum Segen gereichen und eine friedvolle Zeit bescheren würde.
Nach der Zählung der römischen Kurie begann aber das Neue Jahr schon mit der Menschwerdung Christi, und in ebendieser Heiligen Nacht hatte nun in München das verruchte Weib zum Hohn und wider alle Hoffnungen der Stadtbewohner des Satans Balg im Stroh geboren.
Wenn aber Adams Fehltritt dem gesamten Menschengeschlecht als Erbsünde anhaftete, war da nicht solche Verfehlung eines einzelnen auch Angelegenheit aller Mitglieder der Gemeinde? Nur der Tod konnte angemessene Sühne dafür sein! Daher drängte an diesem Tag jedermann, der irgendwie laufen und sich von den Geschäften freimachen konnte, zu der Hinrichtung, als könne er allein schon dadurch den großen Ablaß erringen.
Es war noch ein gutes Stück Weg auf der Straße nach Landsberg bis zum Galgenhügel am Rande des Burgfriedens, und trotz des Tauwetters der letzten Tage und einiger Sonnenstrahlen, war es noch immer ziemlich kalt. Die Delinquentin fror erbärmlich in ihrem dünnen Hemd. »Seht nur, wie sie erregt ist und ihren höllischen Buhlen erwartet!« verhöhnten grausame Witzbolde ihr Zähneklappern und Bibbern. Rotz und Tränen strömten ihr ungehemmt über die Wangen. Sie keuchte rauh und stieß unverständliche Laute aus.
»Sie ruft ihn! Die Dämonen sprechen aus ihr!« verbreitete ein Kleriker vorwitzig, denn durch die Offenbarungen des Abtes Richalmus war ihm geläufig, daß die Teufel sich jedweder Geräusche bedienten und sich selbst durch den Husten, mit dem sie die Menschen plagten, miteinander unterhielten.
Daß die Verworfene nicht längst gerichtet war, lag am dauerhaften Frost und dem Umstand, daß der Rat noch immer am Sold für einen stadteigenen Henker knauserte, wenngleich wohlhabende Pfeffersäcke diesen lautstark forderten, seit mit dem Wachsen der Stadt auch ständig mehr Gesindel Einlaß fand. So hatte man erst Boten ins Schwäbische nach einem tüchtigen Scharfrichter ausgeschickt, und sein Eintreffen hatte Weile. Zudem war es dem Abdecker erst während der letzten Tage gelungen, den frostharten Boden mühsam aufzubrechen.
Am Galgenberg übernahm der Stadtrichter wieder das Kommando und postierte seine Leute so, daß sie die Menge mit gezogenen Schwertern in Schach halten konnten. Es gab heftiges Gerangel um die besten Plätze, denn jeder wollte zuvorderst stehen, aber eine bestimmte, wie von magischer Hand gezogene Grenze wurde nicht überschritten. Keiner wollte ihm ohne Not zu nahe kommen.
Der Henker stand schweigend inmitten der Richtstatt, umgeben von einer Aura aus Schrecken und Blut. Er war in einen weiten roten Mantel gehüllt, das Haupt von einer roten Gugel umschlossen, deren gezaddelter Rand auf Schultern und Brust fiel. Sein Alter war kaum zu schätzen. Ein Gerücht besagte, daß er noch nicht lange ausgelernt, aber andernorts schon Proben seiner grausigen Kunstfertigkeit gegeben hatte. Die Gugel bedeckte auch sein Gesicht zur Hälfte, und nur durch zwei Schlitze musterte er das heutige Werkstück seines blutigen Handwerks, das einer der Knechte nun roh vom Karren zerrte.
Die Zuschauer waren noch nicht zur Ruhe gekommen. Ein Zimmerer rief forsch: »Das Holz! Wo habt ihr das Holz? Die Tölpel haben noch nicht mal den Scheiterhaufen aufgerichtet.« Da fiel es auch den anderen auf, und Gelächter mischte sich mit Mißfallen.
»Ruhe!« forderte der Fronbote wiederholt und nachdrücklich. Als er endlich Gehör hatte, verkündete er Sicherheit und freies Geleit für den Scharfrichter, selbst im Falle einer Mißrichtung.
Der Henker legte bedächtig seinen Mantel ab und zerrte das zitternde Mädchen vor die Grube, an deren Rand es wimmernd auf die Knie fiel. Die Menge wurde unruhig. Was hatte dieser Bastard vor? Wollte er sie um das ersehnte Schauspiel betrügen?
Doch der ging seelenruhig zu dem Korb neben der Grube und entnahm ihm ein paar Stricke. Allmählich dämmerte den Zuschauern, daß die Sünderin ganz offensichtlich nicht zu Pulver verbrannt werden sollte, wie es Ketzern und Teufelsbuhlen gebührte. Murren erhob sich. »Sie ist verflucht! Sie muß brennen!«
Der Henker drehte dem hilflosen Mädchen die Arme auf den Rücken und fesselte seine Hände mit einem rauhen Strick.
»Er gräbt sie ein!« rief einer enttäuscht. »Jawohl, er will das Weib lebendig begraben!« Aufgeregtes Tuscheln folgte, halblaute Proteste. Doch es war hierzulande noch immer das Recht des Henkers, die Todesart zu bestimmen. Einer Kindsmörderin drohte in der Regel Ersäufen oder Lebendigbegraben. Aber wer wollte so närrisch sein, bei dieser Kälte mit einem Floß die Mitte der eisigen Isar anzusteuern, um dort den Sack mit der eingenähten Mörderin in den Fluß zu werfen?
Der Henker ergriff einen langen, zugespitzten Pflock und einen schweren Hammer und zeigte beides der brummenden Menge.
»Er wird sie pfählen... ja, gut! Das ist gut so. Da wird ihr das Nachzehren vergehen.«
Die Zuschauer beruhigten sich, waren zufrieden und jetzt schon wieder gespannt, denn solches bekamen sie weit seltener zu sehen, als den Tod im Feuer. Wie lange wird sie nach Luft ringen, sich aufbäumen? Gibt ihr der Dämon Kraft? Mein Gott, wie wird er wohl ausfahren? Wo ist der Pfaffe? »Holt einen verdammten Pfaffen!« Jetzt rächte sich womöglich, daß man der Unglücklichen den kirchlichen Trost verweigert hatte.
Der Züchtiger ging auf die Verurteilte zu und riß das zitternde Bündel hoch. Er schien auf sie einzureden. Wozu? Was hatte dies zu bedeuten?
Das Mädchen heulte, bäumte sich auf, schrie wie ein Ferkel beim Schlachter. Er schlug sie zweimal hart ins Gesicht, und ihr Heulen ging in hilfloses Schluchzen über. Er packte sie derb am Arm, schüttelte sie. »Sei nicht blöde!« zischte er kaum vernehmbar. »Du wirst leben und wieder Kinder haben. Andernfalls …«
Der Henker erhob die Hand, worauf das gebeutelte Publikum gehorsam verstummte. Breitbeinig verkündete er mit rauher Stimme: »Hört! Ich will dieses Weib zu meiner Frau. Es ist mein Recht und Wille!«
Nach einem Augenblick jähen Entsetzens brach ein Sturm der Entrüstung los, und sich genarrt fühlende Zuschauer schickten sich an, die Richtstatt zu stürmen. Die Knechte hielten sie mit Schwertern und Spießen drohend in Schach.
Heinrich Küchel und Herr Rudolf, die nächststehenden Ratsherren, ruderten mit den Ellbogen auf den Richter zu und bestürmten ihn. Der Richter beugte sich eine Weile hinab, schüttelte mehrmals energisch den Kopf, riß schließlich sein Pferd herum und trieb das ängstliche Tier an die Seite des wahnwitzig scheinenden Henkers. »Meiner Seel«, rief er ihm zu, »Ihr seid ein verdammter Narr! Betet, daß Er mit Euch ist!« Dann brüllte er ins Volk: »Ruhe! Gebt endlich Ruhe! Es ist Recht seit alters her und wird es bleiben, solange ich Richter bin. Wer sich widersetzt, wird’s büßen. Seid still! Bei Gott, ich befehle euch, still zu sein!«
Nachdem das Geschrei wie eine versiegende Quelle zum Stillstand gekommen war, fragte er das Mädchen angewidert: »Willst du das Weib dieses Mannes werden und ein Leben in Unehre führen, oder wählst du den Tod und nach Sühne deiner Sünden ein ehrbares Angedenken?«
Das Mädchen starrte mit wäßrigen, weit aufgerissenen Augen bald auf den Richter, bald auf den Henker und lallte Unverständliches.
»Entscheide dich!« drängte der Hüter des Gesetzes.
»Sei nicht blöde!« zischte der Diener des Todes und verstärkte den Griff. »Du weißt …« Zaghaft und willenlos nickte sie mit dem Kopf. »Sie willigt ein. Sie sagt ja. Sie sagt deutlich ja, Ihr seht es alle …«
Der Richter, dem die arge Posse zuwider war, erklärte kurz und bündig: »So sei es!« und forderte das Volk auf: »Geht! Er hat freies Geleit, wohin ihm beliebt. Geht nach Hause!... Ihr aber«, wandte er sich an den Halsabschneider, »verlaßt noch heute diese Stadt und kehrt niemals mehr wieder!«
Es dauerte lange, bis sich die Bürger zerstreuten, ratlos, entsetzt, zornbebend oder still hadernd. So manchen beschlich an diesem Tag eine dunkle Ahnung, die ihn für lange Zeit nicht mehr verließ. Aber nur wenige kannten die ganze schreckliche Wahrheit und wußten, daß dies erst der Anfang allen Übels war.
1. Kapitel
»Ihr werdet alt, Freund Hafner«, stichelte der Nachbar mit aufgesetzter Besorgnis.
»Ist bloß die verdammte Gicht«, knurrte der Gehänselte. »Sonst wollt’ ich Euch schon zeigen, wer mehr vom Roten verträgt und die Baderstöchter juchzen läßt.«
»Schon gut«, wiegelte der Nachbar ab. Er kannte die Prahlerei zur Genüge. »Aber Ihr habt Euren Hausstand nicht mehr im Griff.«
»Was soll das heißen, häh?« brauste der Hafner auf.
»Daß Euch die Weiber im eigenen Haus auf der Nase herumtanzen. Das war früher anders.«
»Hol’s der Teufel«, fluchte der Hafner grimmig, »Ihr könnt leicht reden. Ihr habt ein Weib, das zupackt, und einen tüchtigen Sohn, während ich mit einer Tochter geschlagen bin, die ein Esel werden sollte, so störrisch ist das Biest. Von der verrückten Ahn will ich gar nicht reden.«
»Ein guter Stock hat noch jeden Esel zum Laufen gebracht.«
»Das denkt Ihr. Und von wegen alt – pah! – Ihr seid auch nicht mehr der Jüngste.«
»Wohl wahr, Meister Hafner. Eben deshalb bin ich dabei, mein Haus zu bestellen, und Ihr solltet dies auch beizeiten tun.«
»Ich kenn’ Euch, Drexl, seid ein abgefeimter Bursche. Euch geht’s nicht um die Schrullen meiner Tochter und schon gar nicht um mich. Auf Haus und Hofstatt habt Ihr’s abgesehen.«
»Was Ihr nur wieder argwöhnt«, wehrte sich der Ertappte entrüstet und dachte im stillen: Der Kerl versäuft seinen Verstand und sieht aus wie einer von den Siechen vor der Stadt, aber gerissen ist er wie eh und je.
Arnold Hafner besaß ein bescheidenes Haus an der Hinteren Angergasse gegenüber dem Roßmarkt, und das Verlockende daran war, daß der rückwärtige Hof und Garten an das Grundstück des Besuchers grenzte, dessen Behausung an der Mühlgasse lag, nahe dem Kloster der Klarissen und unweit vom Angertor.
Ainwich Drexl war besessen von der Idee, daß mit des Hafners Herd und Boden sein Anwesen von der einen Gasse zur anderen reichte, was allerhand Vorteil böte, aber er war auch gewitzt genug zu wissen, daß er das Grundstück dem sturen Hafner nicht einfach abschwatzen konnte, selbst wenn der zunehmend gebrechlich wurde und sein Sparstrumpf an Auszehrung litt. Er setzte daher auf die seit alters bewährte Taktik einer vorteilhaften Heirat.
»Ihr versteht Euch doch auf die Annehmlichkeiten des Lebens«, fuhr er einschmeichelnd fort. »Ihr könntet Eure alten Tage um so mehr genießen, wenn Ihr endlich Eure Tochter meinem Sohn zur Frau versprecht. Glaubt mir, er weiß sie zu nehmen.«
»Übergeben, nimmer leben«, knurrte Arnold.
»Dann kauft Euch eben als Pfründner ins Spital ein.«
»Freilich! Und augenblicklich könnt’ ich mich von Wein und Würfel verabschieden, um nur noch auf den Knien rumzurutschen. Das tät’ Euch so passen«, giftete der Hafner. »Hab’ lang genug den verfluchten Trübsinn meiner Alten und den Starrsinn meiner Tochter um mich gehabt. Ich will guten Trunk und Spiel und lustige Gesellschaft auf meine alten Tage. Ist das zuviel verlangt?«
»Ohne Pfennig in der Tasche ist schwer fröhlich sein«, konterte der andere ungerührt. »Ihr habt die Wahl zwischen dürftigem Auskommen und einem guten Angebot.«
»Pah! Das Luder müßt’ nur besser spuren«, erwiderte der Hafner trotzig. »Ich werd’ ihr die Flausen schön austreiben, damit sie wieder anständiges Geschirr fertigt.«
»Macht Euch nichts vor, Hafner!« tat Ainwich von oben herab. »Euer Betrieb ist so lebendig wie der Käfer auf dem Rücken, der strampelt, aber nicht mehr auf die Beine kommt.«
»Und Ihr wollt jetzt der schlaue Vogel sein, der zupickt.«
»Himmel, nein, so versteht doch! Ein schwaches Weib allein kann Euer Werk nicht fortsetzen. Und wer fragt schon nach irdener Ware? Wer sich’s leisten kann, stellt lieber den Kupferkessel übers Feuer, und Eß- und Trinkgeschirr fertigen wir Drechsler allemal billiger. Warum in Gottes Namen wollt Ihr an der schlüpfrigen Kneterei festhalten, die mancher nicht mal für ehrbar hält. Habt Ihr was gegen meinen Sohn?«
»Unsinn! Mir wär’ der Eure so recht wie jeder andere. Nur, sie sträubt sich und ist stachlig wie eine Distel. Aber vielleicht habt Ihr ja recht«, lenkte er mürrisch ein, »doch erst will alles besprochen sein und glaubt nur nicht, Ihr könnt den alten Arnold übers Ohr hauen!«
Er drohte mit seiner Krücke und versuchte sich aufzurichten, fiel aber sogleich wieder mit einem langgezogenen Seufzer auf die Bank zurück. »Verfluchtes Bein! Wiltrud!«
Er stöhnte mit schmerzverzerrter Miene und drosch jähzornig auf den Boden. »Wirst du wohl kommen! Da seht Ihr’s.W-i-l-t-r-u-d!«
»Was brüllst du so, als säß’ der Leibhaftige auf deinem Bein?«
Die beiden Männer wandten sich fast gleichzeitig der jungen Frau zu, die in der Türöffnung stand.
Sie ist nicht unbedingt eine Schönheit, taxierte sie der väterliche Freier unverhohlen, aber sie wird Söhne gebären. Ihre in den Hüften leicht schwellende Gestalt versprach Fruchtbarkeit. Sie war barfuß und trug nur ihr leinenes Unterkleid, das die kräftigen Arme freiließ. Um die Taille hatte sie zum Schutz ein grobes Tuch gebunden, an dem sie sich bedächtig die Hände abrieb. Lehmfarbene Sprenkel auf Kleidung, Armen und selbst noch im Gesicht zeugten von eifriger Arbeit und sprühender Lebendigkeit. Und zugleich erweckten sie einen Hauch unfreiwilliger Komik.
»Na endlich! Bring uns Wein!« fuhr der Hafner seine Tochter an.
»Der Bader hat’s verboten«, widersprach sie trocken und stopfte eine widerspenstige Haarsträhne unter das Tuch zurück, das sie um den Kopf geschlungen hatte.
»Hört Ihr’s? Habt Ihr das gehört?« wandte sich der Hafner schwer atmend an Drexl. »Sie hat weder Respekt vor ihrem Vater noch vor einem Gast, und ich wette, sie wird selbst dem Teufel das Maul anhängen. Dabei hab’ ich nicht mit Schlägen gegeizt.«
»Weiß Gott nicht«, bestätigte ihn die Tochter verächtlich.
»Bring endlich Wein, oder …« Er fuchtelte mit seiner Krücke.
»Wenn du dich unbedingt totsaufen willst«, maulte sie, ging achselzuckend hinaus und kehrte gleich darauf mit einem Bügelkrug und zwei tönernen Bechern wieder.
Während sie ihrem Vater eingoß, drehte Ainwich Drexl den Becher prüfend in der Hand. Er mußte zugeben, daß er vorzüglich gearbeitet, die Wandung so ebenmäßig hochgezogen und von so erstaunlicher Feinheit war, wie er es selten zuvor gesehen hatte. Vielleicht konnte er sich darüber einen Zugang zu seiner künftigen Schwiegertochter verschaffen.
»Ihr habt geschickte Hände, Jungfer Wiltrud. Wirklich, eine hübsche Arbeit.«
»Seid Ihr gekommen, mir das zu sagen?« fragte sie schroff.
»Nun ja, ich …« – der Drechsler räusperte sich verlegen – »so setzt Euch doch ein wenig zu uns.«
Sie widerstand der Aufforderung und hielt statt dessen, wie zum Schutz, den Krug mit beiden Armen vor der Brust umklammert.
»Wir... ich meine... Euer werter Vater und ich sind uns einig, daß es an der Zeit wäre, Euch vorteilhaft zu verheiraten und …«
»... da dachtet Ihr an Euren prachtvollen Herrn Sohn«, fiel sie dem Gast unhöflich ins Wort. Doch der zeigte sich eher erfreut ob ihrer scheinbaren Zugänglichkeit.
»Jaaa... ja, genauso.« Sein Gesicht ging grinsend in die Breite. »Ihr beide wärt ein schickliches Paar. Ihr paßt zusammen wie …«
»... Holz und Ton«, vollendete die Hafnerstochter unwirsch. »Schlagt’s Euch aus dem Kopf!«
»Das schließt sich doch nicht aus«, versuchte der Drechsler mit gewinnendem Lächeln die Situation zu retten. »Ihr könntet …«
»... einen Haufen Bälger großziehen, Eurem Sohn das Haus führen und die Spindel drehen«, fiel Wiltrud abermals patzig ins Wort. »Ich liebe aber meine Handwerk, und es reicht mir.«
Auf dem Gesicht des Gastes begann sich Empörung abzuzeichnen. »So könnt Ihr nicht mit mir reden. Außerdem seid Ihr schutzlos ohne Mann, und es ist schweres Brot.«
»Ich komm’ zurecht.«
»Du hast in dieser Sache nichts zu entscheiden!« platzte endlich der zornbebende Hafner heraus und fixierte seine Tochter von unten herauf mit finsterem Blick. »Du wirst den Sohn des Drechslers heiraten, aus und amen!«
»Eher geh’ ich ins Kloster!« schrie Wiltrud, knallte den Krug auf den Tisch, daß der Wein überschwappte, und rauschte erbost hinaus.
»Du wirst des Drechslers Weib!« krächzte der Alte, gefolgt von einem Hustenschwall.
»Niemals!« tönte es trotzig von draußen.
Arnold der Hafner stieß wütend seine Krücke auf den Stubenboden. »Totschlagen könnt’ ich das Miststück, jawohl, totschlagen! Aber ich schwör’s Euch, sie wird ihn heiraten. Sie wird Euern Sohn übers Jahr heiraten. Bei meinem Leben.«
»Beruhigt Euch!« suchte der Nachbar zu beschwichtigen. »Sie wird sich schon besinnen, wenn sie erst ihren Vorteil sieht.«
»Ihr kennt meine Tochter nicht!«
Gerold, der Wächter bei Unseres Herrn Tor, das Richtung Schwabing führte, rieb sich verwundert die Augen. Den ganzen Vormittag über hatten nur einige Heuwagen und Reisende den nördlichen Zugang zur Stadt passiert, so daß er eben sogar ein wenig eingenickt war. Aber das hier versprach Aufregung und ließ ihn von seiner Bank unter dem Torbogen aufspringen.
Ein Pferdekarren mit merkwürdig hohem Aufbau rollte auf ihn zu. Der Kasten war bunt bemalt und an den vier oberen Ecken mit flatternden Bändern geschmückt. Ein bärtiger Hüne lenkte das Gefährt. Hinterdrein tapste ein zotteliger Bär, mittels einer Kette durch den Nasenring an den Karren gebunden. Ihm folgten zu Fuß junge Männer in grellbunter Kleidung und diesen zwei gutmütige Maultiere, vor einen vollbepackten Planwagen gespannt. Obenauf saß die glutäugige Frau Sünde und schwatzte lebhaft mit der rothaarigen Wollust. Zuhinterst hockte auf einem schmalen Brett ein blondgelockter Jüngling, ließ die Beine baumeln, fiedelte vergnügt und sang dazwischen spaßige Reime.
Eine Schar rotznäsiger Kinder lief aufgedreht hinterher und lachte kreischend über das Äffchen, das bald vom Karren sprang und – soweit es die dünne Kette zuließ – nach Freßbarem heischte, bald sich mit seiner Beute wieder hinaufschwang und die zugeworfenen Apfelbissen und sauren Trauben gierig verschlang.
Der Torhüter bremste achtunggebietend den Zug. »Wer seid Ihr und was wollt Ihr hier?«
»Sieht man das nicht?« brummte der Hüne. »Wir sind Spielleute, kommen von da« – er zeigte mit dem Daumen gelangweilt nach hinten – »und wollen nach dort.« Er hatte das Spiel schon Hunderte Male gespielt und war seiner überdrüssig.
Gerold runzelte die Stirn. Er war gewiß gutmütig, aber so ließ er nicht mit sich umspringen, schließlich...
»Verzeiht diesem ungehobelten Klotz, Meister des Tores!« Der pfiffig aussehende Bursche neben dem Hünen sprang behende vom Wagen und direkt vor den verblüfften Torhüter hin.
»Er ist... wie soll ich sagen... er ist mehr unter Wölfen und Bären aufgewachsen, wild, ungebärdig, fast wie ein Tier. Seht ihn Euch nur an. Kreuzritter haben ihn zu Zeiten des seligen Barbarossa aus tiefsten Tiefen slawischer Wälder herausgezerrt und gezähmt. Er ist – unter uns gesagt – beinahe kein Mensch.«
Der Schalk gestikulierte wild mit den Händen und vollführte urplötzlich eine galante Verbeugung. »Gestattet, daß ich mich vorstelle: Ich bin Doktor Honorius Pomodorius Strotzvoll-von-Kokolorius, gewesener Leibarzt der Kaiserin aller Pomeranzen, Stravanzen und Extravaganzen, Heilkundiger des Orients, Erfinder des Spekulatius und Kenner aller Kräuter und Tinkturen – du liebe Güte, was seh’ ich da …«
Er strich mit den Fingern tastend über die Wangen des Torhüters und zog erst links, dann rechts die Augenlider prüfend nach oben. »Meiner Seel’, Ihr habt zwei gänzlich verschiedene Augen: ein Triefauge und ein Glanzauge. Das sagt mir, daß Eure Säfte ganz arg durcheinander fließen. Seid ehrlich: Wie steht’s mit der Verdauung? Plagen Euch nicht dann und wann …«
Er betastete mit der Linken das gewölbte Bäuchlein, während der verschreckte Gerold unsicher Zustimmung nickte.
»Auweia! Hier ist’s überdeutlich zu spüren. Ihr seid ein Glückspilz, denn durch die Weisheit Aesculaps führe ich den Wunderbalsam Theriak mit mir.« Er wandte sich um und schnipste mit den Fingern, worauf ihm der Hüne ein kleines Döschen zuwarf. »Er wird Euch augenblicklich kurieren. Steckt nur, so Ihr geplagt seid, zwei Finger voll in den … na, Ihr wißt schon, und Eure flatulae, Eure übelriechenden Winde, werden wie zarter Weihrauch mit einem Duft von Myrrhe und Rosenöl verstreichen. Nehmt nur. Von Euch fordere ich kein Geld, da Ihr uns so großmütig Einlaß gewährt.«
Beinahe hätte der verblüffte Gerold schon den Weg freigegeben, erinnerte sich aber gerade noch seiner Pflicht.
»Was führt Ihr da mit Euch?« fragte er streng.
Da sprang der blonde Jüngling vom Karren, legte die Fiedel beiseite und winkte den Wächter heran. Während der sich unschlüssig näherte, nestelte er einen Beutel vom Gürtel. »Psst, guter Mann, wir führen einen streng geheimen Auftrag durch. Man munkelt, daß unser Herr König trübsinnig geworden ist, seit ihn das Schlachtenglück verlassen hat. Ein weiser Mann hat entdeckt, daß es an den Miasmen liegt, den üblen Essenzen in der Luft. Man hat uns daher ausgesandt, von allen Wohlgerüchen des Reiches etwas einzufangen für die Gesundheit unseres Königs.«
Der gutmütige Gerold starrte offenen Mundes auf den Wagen, von dem der Sänger nun leicht die Plane anhob.
»Seht her, dort in dem Krug ist feiner Rebenduft aus der Pfalz. In jenem Ballen da ist der Weihegeruch von der Stätte seiner Wahl und Krönung zu Frankfurt eingefangen. In der großen Kiste bringen wir ihm die würzigen Schwaden von Pfefferkuchen aus Nürnberg. Ach ja, und in dem Beutel hier hat mir der Herr Bischof zu Freising einen Hauch vom ewig frischen Atem Sankt Korbinians für des Königs Kräftigung mitgegeben. Wollt Ihr ihn schmecken?«
Er öffnete vor den staunenden Augen des Wächters blitzschnell den schmalen Beutel und stülpte ihn um, wobei ein schrilles Pfeifgeräusch ertönte. »Gütiger Himmel, er ist weg. Riecht Ihr’s? Zurückgepfiffen nach Freising. O Unglück! Wollt Ihr vielleicht noch die Kiste oder den Ballen... meinetwegen. Bleibt er eben trübsinnig, unser Herr König, wenn Ihr es so wollt. Aber bitte, bitte, öffnet ruhig …«
»Um Gottes willen, laßt zu!« flehte der Torhüter. »Ich will an seinem Unglück nicht schuld sein. Fahrt zu! Los, fahrt zu!«
»Wie Ihr wünscht, edler Herr« – der Sänger verneigte sich höflich –, »wir werden Euch lobend erwähnen.«
Die Spielleute setzten unter dem Gejohle der Kinder ihren Weg in die Stadt fort. Gerold kratzte sich am Kopf und starrte ihnen nach. Für alle Fälle schickte er seinen Beisitzer zum Fronboten.
Die Gaukler platzten derweil schier vor Lachen. Durch den Spaß hatten sie eben die Erfahrung gemacht, daß selbst ein leerer Beutel von Nutzen sein konnte.
»Wohin nun?« fragte die Sünde, und der Hüne, der der Anführer war, entschied nach Gefühl: »Eines Spielmanns Weg ist selten gerade, laßt uns die Gasse zur Linken nehmen.«
Beim Heumarkt vor dem Kloster der Barfüßer gab es ziemliches Gedränge, und noch ehe die Spielleute in des Dieners Gasse Einzug hielten, folgte ihnen schon ein Rattenschwanz an Gaffern und Belustigten.
»Haltet an!« rief der Blonde plötzlich. »Dort drüben, das wird des Königs Burg sein. Ich muß euch jetzt verlassen.«
»Wie, augenblicklich? Einfach so?« fragte die junge Frau auf dem Planwagen enttäuscht: »Kannst es wohl kaum erwarten, eine neue Liebschaft zu finden, du treuloses Ungeheuer.«
»Es geht um die Kunst, meine Teure, nicht um der Liebe Freuden.«
»Aaah, das sagen sie alle«, keckerte die nicht mehr taufrische Rothaarige und offenbarte dabei eine Zahnlücke zwischen ihren vollen Lippen. »Erst schwafeln sie von Minnen und edler Kunst, dann grapschen sie unters Linnen in geiler Brunst. Seht Euch vor, ihr braven Bürgerstöchter!«
Der Hüne unterbrach ihr Gelächter und fragte in väterlicher Besorgnis: »Warum hast du’s so eilig? Die Burg läuft dir nicht davon.«
»Hast ja recht. Es ist nur... ach, ich hab’s mir eben in den Kopf gesetzt und kann’s nun kaum erwarten. Aber auf ein, zwei Tage kommt’s nicht an. Hüah!«
Auf dem großen Marktplatz inmitten der Stadt empfing sie kräftiger Fischgeruch und dichtes Treiben. Abgesehen von den Mägden und Hausfrauen, die sich mit Forellen und Stockfisch eindeckten, nahm an diesem Tag der Salzhandel den größten Teil des freien Platzes vor der jüngst vom Ritter Gollir gestifteten Kapelle ein. Und die Salzlader und Aufleger waren eben dabei, die schweren Scheiben und die Fässer mit gekörntem Salz wieder auf die Plachenwägen zu verladen. Die vorgeschriebene Zeit für Stapelzwang und Niederlegung auf dem Münchner Markt war fast verstrichen, und die Händler spornten ihre Fuhrleute an, damit sie bald die Stadt verlassen und nach Westen weiterziehen konnten.
»Ihr Tagediebe habt gerade noch gefehlt. Aus dem Weg! Seht ihr nicht, daß hier gearbeitet wird?« Die Fuhrknechte versuchten schimpfend und fluchend die Neuankömmlinge zu verdrängen.
Zum Glück durften an diesem lauen Donnerstag im September des Jahres 1320 nicht auch noch die auswärtigen Händler und Bauersleute ihr Schmalz und ihre Eier feilbieten. So hielten die Spielleute ungeniert vor den Gaden der Tuchhändler neben dem Eingang zum Rindermarkt ihre Karren an. Sie klappten eine Seitenwand des Kastenwagens herunter, stützten sie auf zwei kräftige Balken, und fertig war die Bühne.
Während der Blonde die Fiedel strich, ein anderer die Flöte blies und ein dritter das Tamburin schlug, vollführte das junge Spielweib einen wilden Tanz, um die Zuschauer zu locken, und die strömten auch sogleich in Scharen herbei. Das Äffchen schlug einen Salto nach dem anderen und applaudierte sich zum Gaudium der Gaffer zwischendurch selbst mit gefletschten Zähnen.
»Hochverehrtes Publikum!« lenkte der Hüne die Aufmerksamkeit auf sich. Er hielt fünf lange, gefährlich scharfe Messer in der Hand und erklärte, daß er diese mit Wucht und in höchster Konzentration nach der zierlichen Dame zu seiner Rechten werfen wolle. Die ältere der beiden Spielmannsfrauen knickste dabei artig und zeigte tapfer ein breites Lächeln.
»Er nimmt erst die Alte, falls er daneben wirft«, juxte einer der Umstehenden. »Einen Zahn hat’s die Hübsche schon gekostet.«
Zwei der Gaukler hielten eine senkrechte Tafel fest, auf die mit Kreide die seitlichen Umrisse einer Frau gezeichnet waren. Die Rothaarige stellte sich mutig davor.
»Seid still! Ruhe, sag’ ich! Silentium!«
Aufreizender Wirbel auf dem Tamburin, während der Werfer sich konzentrierte. Dann nahm der Hüne Maß und schleuderte blitzschnell das Messer nach der Frau. Es fuhr um Haaresbreite an ihrem Hals vorbei und steckte zitternd im Holz der Tafel.
»Aaah …« In das Raunen und die spitzen Aufschreie hinein ertönte störend ein energischer Ruf: »Aufhören! Sofort aufhören!«
Zwei Männer bahnten sich einen Weg durch die unwillig zurückweichenden Zuschauer.
»Das könnte euch so passen. Wer seid ihr?« fragte der Amtsträger barsch und ein wenig atemlos, nachdem er sich bis zum Karren durchgekämpft hatte.
»Er ist Samson, der Bär«, flunkerte ein dürres Kerlchen vorwitzig, »weil er mit Meister Petz ringt und alle Ketten zerreißt und neugierige Frager wie eine Laus im Pelz zerquetscht.«
»Sei ruhig, Benjamin!« Der Hüne fuhr dem Schwätzer mit der gespreizten Linken ins Gesicht und wischte ihn grob zur Seite. Er wußte aus langer Erfahrung, wann Späße nicht angebracht waren. »Man nennt mich Fridlieb, den Gaukler«, antwortete er ruhig, »und wer seid Ihr?«
»Ich bin Ulrich und meines Zeichens« – der Störenfried fuchtelte mit dem Amtsstab – »der Fronbote dieser Stadt.«
»Aha«, bemerkte Fridlieb lakonisch und besah sich den gestrengen Amtmann mit seinem roten Hut genauer. Der hatte sich zu seiner Unterstützung gleich einen der Richtersknechte mitgebracht, der die Hand schon bedrohlich auf den Schwertknauf legte.
»Du bist wohl toll, daß du hier mit langen und spitzen Messern herumwirfst! Weißt du nicht, daß Waffentragen in der Stadt verboten ist und Messerwerfen gleich gar? Gib sie sofort dem Knecht hier, wenn du nicht deine Hand mit verlieren willst.«
»Wichtigtuer... Spielverderber!« murrten etliche der Umstehenden. Aber mit den beiden Herren war nicht zu spaßen.
»Wir wollten nur eine kleine Vorstellung geben«, erklärte der Hüne ruhig, »um damit …«
»Nichts da!« unterbrach ihn Ulrich rüde. »Hier kann nicht jeder einfach hereinspazieren und mitten auf dem Markt freche Reden halten und dumme Späße zum besten geben. Nein, nein, Freundchen! Hier hat alles seine Ordnung.«
»Die sind ja noch humorloser als die Nürnberger«, raunte die Tänzerin dem blonden Sänger zu. »Und in dieser Stadt willst du dich niederlassen?«
»Von wo kommt ihr?« forschte der Fronbote weiter.
»Wir haben zuletzt beim Bischof in Freising gespielt«, gab Fridlieb wahrheitsgemäß Auskunft, »und kommen, um Euch zu Kirchweih Spaß und Kurzweil zu bieten. Wir sind in vielerlei Künsten bewandert und Hein Wackel« – er deutete auf einen jungen Burschen in buntem Kittel und mehrfarbigen Beinkleidern, der sich geschmeidig verbeugte –, »ist der größte Seiltänzer im Reich, der zwischen den höchsten Kirchtürmen spaziert.«
Zur Bekräftigung breitete er beide Arme aus, als könne er dadurch St. Peter mit den Türmen von Unserer Lieben Frau verbinden. Und Benjamin stieg gewitzt in den Karren, zerrte das Ende eines dicken Taus hervor und schlang es sich um die Schulter. Ein Jongleur tat es ihm gleich, und Hein Wackel sprang elegant auf das durchhängende Seil, schaukelte verwegen und warf übermütig Kußhände ins Publikum.
Die Menge johlte begeistert und forderte lauthals und vielstimmig: »Wir wollen ihn auf dem Seil sehen! Los, spannt das Seil!«
Ulrich gebot humorlos mit beiden Händen Einhalt und entschied: »Das will alles erst genehmigt sein. Darüber hat der Rat zu befinden. Gebt jetzt den Markt frei und geduldet euch!«
»Wie lange dauert das?« fragte die Tänzerin vorlaut.
»Mit Glück bis morgen. Morgen tritt der Rat wieder zusammen.«
Die Spielleute fügten sich ins Unvermeidliche, und da es ganz offensichtlich nichts mehr zu sehen gab, zerstreute sich die Menge in der Hoffnung auf ein Spektakel am kommenden Tag des Herrn.
Nur der Fronbote stand nach einer Weile noch immer unschlüssig neben dem Karren der Gaukler, so daß Fridlieb fragte: »Gibt’s noch irgendwas?«
»Ihr... ihr habt da so ein Mittel …«, druckste der Amtmann herum, »das gewisse Unpäßlichkeiten beseitigt. Du weißt schon. Möglicherweise …«
»... könnte es auch andere Unannehmlichkeiten beseitigen«, ergänzte Fridlieb mit wissendem Grinsen, »verstehe.« Er kramte aus dem Wagen ein Döschen Wunderbalsam hervor und drückte es dem Fronboten mit besten Wünschen in die Hand. »Eins noch: Wo können wir lagern?«
»In der Stadt auf keinen Fall. Draußen, auf der Spielwiese vor dem Angertor, da könnt ihr eure Zelte aufschlagen.«
Wütend rannte sie aus dem Haus. Die Sonne stand tief im Westen und ließ die hölzernen Giebel in warmen Farben aufleuchten. Aber Wiltrud hatte keinen Blick dafür und dies nicht nur, weil das linke Auge sichtlich anschwoll, obwohl sie einen Lappen mit Schafgarbe dagegen hielt. Sie hatte genug, ein für allemal. Diesmal war er zu weit gegangen. Sie wünschte ihren jähzornigen Vater zum Teufel und erschrak nicht mal bei dem Gedanken.
»Wiltrud!«
O nein! durchfuhr es sie. Das hatte gerade noch gefehlt.
»Wiltrud! Komm schnell, bitte!«
Was blieb ihr anderes übrig. Das aufgeregte Stimmchen gehörte Margret Polmoser, der Tochter der Beutlerin von nebenan, die ihre einzige Freundin war. Ergeben machte sie kehrt und ging die paar Schritte zurück.
»Die Nahterin war eben da. Ich muß es dir unbedingt zeigen«, sprudelte Margret vor Glück. »Komm rein!« Erst in der Stube nahm sie das Pech ihrer Freundin wahr. »Oh, Wiltrud, was ist mit deinem Auge? Was ist passiert?«
»Hab’ mich gestoßen«, wehrte die Hafnerin ab.
»Sieht ja schlimm aus. Soll ich …«
»Nein, laß nur! Es geht schon.«
Die quirlige Margret war auch schon bei der Truhe und entnahm ihr fast weihevoll einen Packen feinsten Stoffes. Sie entfaltete das obere Teil und hielt es sich vor den schlanken Körper: Ein Kleid im frischen Grün der jungen, hoffnungsvollen Liebe, das an den Seiten eng geschnürt wurde und über der Brust schon fast verwegen ausgeschnitten war. Die bauschigen Ärmel in strahlendem Weiß trugen am Unterarm eine enge Knopfleiste.
»Na, was sagst du?« Margret strahlte übers ganze Gesicht und erwartete nicht wirklich eine Antwort in der Gewißheit, der Welt wundervollstes Brautkleid zu besitzen.
»Sieh nur, es hat eine kleine Schleppe. Und jetzt: aufgepaßt!« Sie hob das andere Stück hoch. Es war ein waidgefärbter Surkot in tiefem Blau, das trefflich mit der Farbe des Kleides harmonierte.
»Schau dir den Schnitt an!«
»Etwas wenig Stoff«, bemerkte Wiltrud spröde. »Die Nahterin hat entweder gespart oder dich übers Ohr gehauen. Bist ja auch schier blind vor Glück.«
»Aber das ist es doch gerade«, klärte Margret die schwerfällige Freundin auf. »In Frankreich sollen alle vornehmen Damen schon so gekleidet sein.«
Wiltrud faßte widerstrebend den Stoff an. Das Überkleid war nicht nur ärmellos, sondern seitlich so weit ausgeschnitten, daß nur noch mittig ein schmaler Steg das Oberteil mit dem Rock verband.
»Für die Pfaffen sind’s Teufelsfenster«, kicherte Margret frivol. »Aber den Burschen werden sie den Kopf verdrehen, und das ist gut so bei meinem letzten Auftritt als Jungfer.«
»Ich wollt’ mir die Burschen lieber vom Leib halten«, erwiderte die Hafnerstochter griesgrämig.
»Was ist los mit dir?« fragte die angehende Braut sichtlich enttäuscht. »Du bist in letzter Zeit so … ach, ich weiß nicht.«
»Verzeih mir, Margret! Hab’ heut einen schlechten Tag, tut mir leid.«
»Schon gut«, beschwichtigte die Freundin und strahlte bereits wieder. »Ich freu’ mich so auf den Tanz. Vielleicht entdeckst du deinen Zukünftigen, wie ich damals. Solltest auch ans Heiraten denken. Du …«
»Sicher, Margret, sicher«, unterbrach Wiltrud das Geplapper. »Ich muß jetzt wirklich gehen. Hab’ noch was zu besorgen, ehe es dunkel wird. Nimm’s nicht übel.«
Unter der Türe stieß sie mit dem Lernknecht zusammen.
»Ah, die Frau Nachbarin«, neckte er sie. »Habt wohl auch schon das Brautkleid probiert.« Als Wiltrud ihn unverständig anstarrte, fügte er grinsend hinzu: »Hab’ nur so was läuten hören«, und verschwand.
Wiltrud war zorniger denn je. Posaunte etwa der Drechsler seine unerwünschte Werbung schon überall herum? Er sollte sich vorsehen. Sie war dabei, ihm einen dicken Strich durch seine windige Rechnung zu machen. Mit wehenden Röcken bog sie in die Gasse beim Tegernseer Klosterhof ein und stürmte vorwärts.
Sie ärgerte sich über Margret, die sich manchmal noch wie ein Kind benahm. Ist schließlich ein paar Jahre jünger als du, schoß es ihr durch den Kopf. Gut, gut, aber dies Gegacker und Getue mit den Burschen – es stand ihr bis zum Hals.
Und sie war wütend auf sich selbst, weil sie sich so sehr darüber ereifern konnte und – ja, zugegeben –, weil sie selbst so wenig damit anfangen konnte. Es mangelte ihr nicht an Gelegenheit, oho, keineswegs. Schließlich kam sie durch ihren Beruf unter die Leute. Und hübsch … nun, zumindest war sie nicht häßlich, oder?
Aber was waren das auch schon für Kerle, die sich bisher für sie interessiert hatten: hochnäsig und nur auf ein schnelles Abenteuer aus; oder dumm wie Stroh und langweilig wie ein Klumpen Ton, dafür laut, ungeschlacht und ständig betrunken – nein, vielen Dank! Oder war am Ende doch nur sie selbst schuld daran? War sie wirklich so schwierig? Pah! Es würde alles und immer so enden wie bei ihrem Vater. Und sie wollte nicht leiden wie ihre Mutter all die Jahre. Nein! Niemals! Das Joch der Ehe war nichts für sie. Ihr Entschluß stand fest.
Es war schon spät, als sie vor dem Angerkloster stand und beherzt an die Pforte der Klarissen pochte. Endlos erschien es ihr, bis erst das Guckloch und schließlich die Türe selbst geöffnet wurde. Die alte Pförtnerin, der Wiltrud aufgeregt den Grund ihres späten Klopfens vortrug, verständigte sich mit einer Mitschwester durch eigenartige Zeichen, worauf die Nonne den Besuch schweigend durch lange, stille Gänge führte.
Wiltrud empfand die Ruhe wohltuend und malte sich bereits aus, wie diese Mauern ihr Zufluchtsort sein würden. Das schlichte Ordenskleid unterschied sich kaum von ihrem weltlichen Gewand. Sie hatte sich bislang wenig um die Torheiten ihres Geschlechts geschert und wollte auch künftig gerne darauf verzichten.
Die Äbtissin Kunigunde geruhte Wiltrud noch zu empfangen, da deren Anliegen dringlich erschien. Und sie ging auch sogleich auf die Geschlagene zu und besah sich das schwellende Auge. »Gütiger Himmel! Wer hat dir das angetan?«
Ohne darauf einzugehen ergriff Wiltrud die Hand der Äbtissin, fiel auf die Knie und flehte: »Ehrwürdige Mutter, ich bitte um den Schutz Eures Klosters. Ich will den Schleier nehmen und Euch in allem gehorsam sein. Stoßt mich nicht zurück! Ihr seid meine einzige Hoffnung …«
»Na, na«, unterbrach die Äbtissin sanft, »nun beruhige dich erst mal.« Sie wies ihr einen Schemel an und reichte einen Becher Wasser, ehe sie Wiltrud um ihre Geschichte bat.
Die schilderte lebhaft und erregt den Jähzorn ihres Vaters und das widerwärtige Los, das er ihr zugedacht hatte.
»Und deshalb willst du dich auf der Stelle ins Kloster flüchten?« fragte die Äbtissin ungläubig, und Wiltrud konnte nicht unterscheiden, ob es belustigt oder eher schon ärgerlich klang.
»Jaha …«, bestätigte sie zögernd und schluckte trocken.
»Mein liebes Kind«, hob die Ehrwürdige Mutter an, »wie hast du dir das nur gedacht? Weil dein Vater streng ist und du deinen Willen nicht bekommst, willst du flugs ins Kloster und dich vor der bösen Welt verstecken. Es ist aber nicht der Hafen der Mühseligen und derer, die ein sorgenfreies Leben wünschen. Laß dir gesagt sein, daß du in diesen Mauern zunächst eher Schmerz und Einsamkeit finden wirst, und Honorius von Regensburg hat unser Klosterleben zu Recht mit Kerker und Fegefeuer verglichen. Vor den Freuden eines Lebens in Entsagung stehen große Prüfungen. Der heilige Franziskus legt uns humilitas, die Demut, ans Herz als stärkste Waffe gegen den Dämon und sein Laster Hochmut. Ein zweites ist docilitas, der Gehorsam. ›Siehe, ich bin die Magd des Herrn‹, sprach die selige Jungfrau Maria, ›und sein Wille geschehe also!‹ Dich aber, so scheint mir, haben eher Aufbegehren und Trotz hierher geführt.«
Wiltrud starrte die Äbtissin entgeistert an, und erst jetzt besah sie sich das Gesicht der frommen Frau unterm Schleier näher: Es war hager, kantig und in Stein gemeißelt wie die Zehn Gebote.
Ihrer selbst nicht mehr sicher, rang sie nach Worten: »Aber … es ist doch … ich will es ja versuchen. Ich möchte nur nicht heiraten müssen. Niemals. Und was bleibt mir da …«
»Wie töricht du bist, mein Kind«, unterbrach die Äbtissin, und fast schien ein Lächeln den Stein zu erweichen. »Gott sucht in jedem Stand mehr den Geist als das Kleid, belehrt uns das speculum virginum. Du fliehst jetzt vor einem Mann, aber meidest du deshalb schon alle? Und die Abwesenheit von Männern allein bewahrt uns noch keineswegs vor Sünde, denn auch in Herz und Gesinnung können wir die Jungfräulichkeit verlieren. Die bekehrte Sünderin übertrifft die Nonne, deren Gedanken noch nach Unkeuschheit und Ehe trachten, und eine Witwe in Demut steht vor Gott allemal höher als eine stolze Jungfrau. Hast du dies etwa bedacht?«
»N...nein«, räumte Wiltrud kläglich ein.
»Geh nach Hause und füge dich«, schlug die Äbtissin begütigend vor. »Eine Ehe ist nicht das schlechteste Los, rühmt doch schon der heilige Ambrosius, daß schließlich jede Jungfrau einer Mutter ihr Leben verdankt. Stille in demütiger Mutterschaft deine Kinder, wie Maria ihren Sohn, dann wirst du immerhin dreißigfache Frucht ernten.«
»Aber Maria blieb trotzdem unberührt …«, widersprach Wiltrud.
»Nun, so dir daran gelegen ist«, lenkte die Ehrwürdige Mutter mit hochgezogener Braue ein, »dann prüfe dich erst und kehre in freier Entscheidung wieder. Denn Jungfernschaft bedeutet nicht Flucht vor der Knechtschaft der Ehe, sondern freie Wahl eines höheren Gutes.«
»Und dann nehmt Ihr mich?« fragte Wiltrud erleichtert.
»Hm, da ist noch eine Schwierigkeit«, erläuterte die strenge Kunigunde. »Wir können nicht in der Welt für unser Brot sorgen, und es bedarf einer entsprechenden Mitgift. Wenn also dein Vater … aber nein, ich vergaß. Wenn du nach dem Ableben deines Vaters, was in der Hand unseres Herrn liegt, über ein gewisses Erbe verfügen solltest, dann …«
»... dann wird es zu spät sein«, platzte Wiltrud enttäuscht heraus. »Gibt es gar keine andere Möglichkeit? Ich kann arbeiten und für mich sorgen.«
»Für uns sorgen«, korrigierte die Äbtissin nachdenklich und fixierte die erwartungsvolle junge Frau vor sich. »Unsere Zahl ist zwar klein, aber von Zeit zu Zeit besteht Bedarf an einer Laienschwester.«
»Ich kann töpfern«, erklärte Wiltrud strahlend, »ja, ich kann es ziemlich gut und ich …«
»Das wird nicht gefragt sein«, bremste die Ordensfrau jäh die Begeisterung. »Es würde nur deinem Stolz dienen. Du müßtest waschen, kochen, Böden schrubben … neben den regelmäßigen Gebeten, natürlich.«
»Natürlich«, wiederholte Wiltrud monoton und fing soeben an zu begreifen.
Die Hafnerstochter stand auf der Angerwiese, sog tief die frische Abendluft ein und erwachte langsam aus ihrer Betäubung.
Was bin ich für eine Närrin, schalt sie sich. Mein Gott, was habe ich erwartet? Es kam ihr plötzlich selbst wie törichtes Weglaufen vor. Das Zwielicht der untergehenden Sonne paßte gut zu ihrer Stimmung, als sie sich auf den Heimweg machte: enttäuscht, niedergeschlagen und ein wenig ängstlich, aber zugleich verärgert, aufgebracht und... ja, sie wollte kämpfen.
Die Äbtissin hatte in all ihrer Unnahbarkeit sogar recht. Sie war einer Aufwallung gefolgt, hatte die Sache nicht zu Ende gedacht. Wie auch? Was wußte sie schon vom Kloster. Aber jetzt hatte sie das sichere Gefühl, daß sie dort nur eine Unterdrückung gegen eine andere tauschen würde.
Wiltrud hingegen wollte ungebunden sein: frei von der Bevormundung ihres übellaunigen Vaters, aber ebenso vom drohenden Joch der Ehe und frei für ihre Arbeit. War dies überhaupt möglich? War nicht schon der Gedanke daran Sünde, wo doch einem jeden sein Platz in Gottes gerechter Ordnung vorgegeben war?
Noch stand alles gegen sie. »Wenn nach dem Ableben deines Vaters …«, vertröstete die Äbtissin. Alles eine Frage der Zeit! Und vielleicht konnte man den Lauf ja etwas beschleunigen.
Es mußte etwas geschehen, und es würde etwas geschehen.
2. Kapitel
Ein frischer Wind wehte an diesem Morgen von Osten her über die Untere Isarlände, und Peter Barth war deshalb nicht unzufrieden, daß er gut zu tun hatte. Eben noch stritt er sich mit dem Bäcker, der sein Brennholz erst nach Michaeli aufhacken wollte, hinter ihm wurde ein Fuhrknecht ausfällig, weil das Kaufmannsgut blockiert war, und vorne standen schon die Kistler- und Schäfflerknechte an. Erst fiel sein Blick nur flüchtig auf den Karren, der den Weg von der Straße zu den Holzstößen einschlug, dann stutzte er und wurde neugierig. Tag für Tag strömten unzählige Leute zur Floßlände, aber Frauen fanden selten den Weg hierher, denn Holz für den Hausbrand wurde reichlich in der Stadt feilgeboten.
Die junge Frau führte ein Maultier am Zügel, das einen einachsigen Karren zog. Sie stand eine Weile unschlüssig, dann sah sie ihn und steuerte direkt auf ihn zu.
Kannte er sie nicht? Sie hatte von weitem nichts Auffälliges an sich, bloß ihr schmuckloses braunes Leinenkleid schien von Lehmpritzern übersät – natürlich, sie war die Töpferin, die gelegentlich neue Humpen und Krüge in den Maenhartbräu lieferte, wo er zur Miete wohnte.
Sie trug das flachsblonde Haar heute nicht geflochten; nur ein schmales Band umschloß die Lockenfülle im Nacken und – mein Gott, was war mit ihrem Gesicht, ihrem linken Auge? Es war geschwollen und tiefviolett umrahmt.
Er ging besorgt auf sie zu. »Habt Ihr Euch gestoßen? Seid Ihr verletzt?«
Sie verneinte kopfschüttelnd und sah ihn dabei so eigenartig an, als habe er Unschickliches gefragt. Er verscheuchte den lästigen Bäcker, der ihn erneut bedrängen wollte und wandte sich verunsichert wieder der jungen Frau zu: »Was kann ich denn für Euch tun?«
»Ich bin Wiltrud, die Tochter des Hafners und …«
»Ich weiß«, preschte Peter vor. »Ich sah Euch im Gasthaus. Agnes, die Wirtin, schätzt Eure Krüge.«
»Soso, ja … das freut mich. Ich bereite gerade wieder einen Brand vor und da wollte ich …«
»Ihr sucht Holz.« Es war mehr Feststellung als Frage. »Aber warum bemüht Ihr Euch selbst? Ihr solltet Euch ausruhen.« Peter deutete vielsagend auf das gezeichnete Auge. »Das Brennholz besorgt doch gewöhnlich Euer Lernknecht.«
»Der gewöhnlich nicht da ist, wo man ihn braucht«, erwiderte sie achselzuckend und rang sich ein Lächeln ab.
»Läßt sich Euer Meister das bieten?«
»Oh, der prügelt gern und viel. Ich bin ja schon froh, wenn es ein Lernknecht mehr als ein paar Wochen bei uns aushält.«
In Peter keimte ein Verdacht, den er nicht auszusprechen wagte in der Befürchtung, ihr erneut zu nahe zu treten.
»Ja, also, dann wollen wir …« Er griff ins Zaumzeug, führte das Maultier zu den Lagern für den Brennbedarf der Handwerksbetriebe und rief zwei Auflader herbei. Nachdem die Hafnerstochter die Gebühr fürs Holz entrichtet hatte, sollte für ihn der Vorgang erledigt sein, denn als Pfleger der Lände warteten anderswo genügend Aufgaben auf ihn. Aber er umschlich unschlüssig das Gefährt, prüfte die Radnabe hier, den Halt der Seitenwände dort …
Wiltrud schien es erst gar nicht zu bemerken, denn sie warf selbst Scheite auf den Karren, und was wollte einer noch hier, wenn er nicht zupackte?
In seiner Verlegenheit kam Peter schließlich aufs Wetter zu sprechen. »Ob’s zum Tag des Herrn wohl schön bleibt?«
»Wieso?« Die Hafnerin richtete sich auf und wischte den Schweiß von der Stirn.
»Na, wegen der Kirchweih. Es ist doch Tanz.«
»Oh! Ich mach’ mir nichts draus«, erwiderte sie geringschätzig, »und mit dem Auge gleich gar …«
»Aber das macht doch nichts, so erkenn’ ich Euch wieder.« Er hätte sich die Zunge abbeißen mögen für den mißglückten Scherz.
Die Hafnerin klopfte den Staub von ihren Händen und streifte sie gedankenverloren am Kleid ab. Urplötzlich trat sie ganz nahe heran, und ihr blutunterlaufenes Auge verstärkte bizarr ihren forschenden Blick: »Warum fragt Ihr?«
»Ich … ich dachte … vielleicht sehen wir uns dort und dann könnten wir doch …«
Sie wandte sich abrupt um, griff wortlos ins Geschirr und wendete langsam den Karren. Und ebenso unvermittelt schaute sie noch einmal zurück: »Vielleicht …«
Ihr Lächeln schien ihm hintergründig und amüsiert zugleich. Er starrte ihr nach und fragte sich plötzlich selbst: Warum eigentlich? Sie war gewiß nicht die Maienkönigin, und besonders zugänglich schien sie auch nicht. Aber irgend etwas an ihr … oder war es nur sein Beschützerinstinkt, der auf Veilchenblau ansprang?
»Ich dachte, die Balzzeit ist längst vorüber.«
Peter fuhr herum und blickte in das unverschämte Grinsen seines fast doppelt so alten und beleibten Freundes Paul. »Alter Narr«, brummte er kleinlaut.
»Kennst du nicht das Märchen von der Prinzessin?« zog der lebenslustige Paul den errötenden Galan noch weiter auf. »Sie stellt ihren Freiern unlösbare Rätsel und führt sie dann mit Wonne dem Henker zu? An die Hafnerin ist noch keiner rangekommen. Wo deine Agnes bloß energisch ist, da hat die Haare auf den Zähnen. Glaub mir, die bleibt entweder Jungfer oder sucht sich selbst den Richtigen. Das ist nichts für grüne Bengel.«
»Woher willst du das wissen?« trotzte Peter.
»Lebenserfahrung«, prahlte Paul.
»Hurenweisheit!«
»Pah!«
Ludwig Küchel eilte durch die Rosengasse. Wollte er die Freitagssitzung des Rates noch vor dem dritten Ausläuten erreichen, so mußte er sich sputen. Wegen der morgendlichen Kühle hatte er sich den pelzbesetzten Nuschenmantel reichen lassen. Die Gugel aus weichem Rotsamt verdeckte das schüttere Haar. Sie war aber nicht einfach übergezogen, sondern kunstvoll um den Kopf geschlungen in der Art, daß der gezaddelte Kragen wie ein Hahnenkamm nach oben stand. Und wie der reiche Weinhändler leicht vornübergebeugt so dahinstakste, erweckte er unfreiwillig das Bild eines Pfaus.
Dabei war er nicht wirklich eitel, sondern wetterte im Gegenteil – darin den Predigern ähnlich – immer häufiger gegen die Putzsucht der Evastöchter. Gediegen sollte das Äußere sein, gediegen und vornehm, und sich dadurch sowohl von der Ärmlichkeit niederen Standes als auch vom geschmäcklerischen Firlefanz der Emporkömmlinge unterscheiden.
Manchmal fühlte sich Ludwig Küchel nicht mehr so recht heimisch in dieser Stadt, in der die alte Ordnung und Beschaulichkeit gefährdet schienen wie Wolle im Mottenfraß. Mit dem rasanten Wachstum vergangener Jahre hatte zwar der Wohlstand Einzug gehalten, aber das Leben war auch lauter, hektischer geworden, bald dieser Neuerung, bald jener Torheit nachjagend – kurz: Es war schwieriger kontrollierbar geworden, und das bereitete ihm Sorge.
Am großen Marktplatz verstellte eine dichte Traube Schaulustiger seinen Weg. Die Gaukler nutzten mit Duldung des Fronboten die frühe Stunde, um den Beifall der Marktgänger und möglichst auch deren silberne Pfennige einzuheimsen.
Eben noch hatte der bärenstarke Samson das Publikum verblüfft, indem er armdicke Eisenstangen gebogen und faustgroße Isarkiesel mit den Zähnen zermalmt hatte. Jetzt schickte sich der wendige Balthasar an, mit Keulen und Bällen zu jonglieren.
Ludwig Küchel mißbilligte das Treiben, nicht nur weil ihn das Gewühl am Fortkommen hinderte, sondern aus tiefstem Herzen. War solches etwa die Arbeit eines rechtschaffenen Mannes? Wer wollte ihm weismachen, daß der gestrenge Gottvater derart liederliche Talente vergab. Dem Teufel, ja, dem standen Nichtstun und Hokuspokus gut an. Und die zwei dort waren fette Beute für ihn, der dralle Rotschopf und die Schwarzhaarige, die die Röcke unzüchtig schürzte, um die Beine zu werfen und radzuschlagen.
Ludwig Küchel drängte murrend vorwärts und wurde seinerseits von unwillig weichenden Gaffern geschoben. Und auf einmal stand er zuvorderst, und schallendes Gelächter erhob sich rundum. Er wandte sich um, konnte aber den Grund allgemeiner Belustigung nicht ausmachen. Dort stand nur der Gaukler und jonglierte seelenruhig seine Bälle. Worin lag da der Witz?
Der feine Herr suchte wieder in die Menge einzutauchen und sie zu durchdringen, aber die Wand aus hüpfenden Leibern und feixenden Gesichtern ließ ihn jedesmal abprallen und warf ihn zurück. Und wieder dies abscheuliche Gelächter.
Er fuhr herum, und diesmal sah er gerade noch, wie der Jongleur mitten in der Bewegung erstarrte und sein unschuldigstes Grinsen aufsetzte. »Verdammter Narr!« blaffte er ihn verärgert an.
Aber der Gaukler hatte sich durch seine freche Pantomime den Beifall der schaulustigen Menge erworben und die johlte begeistert und entließ den mürrischen Spielverderber mit Pfiffen.
Der Ratsherr winkte verächtlich ab und teilte nun schimpfend und mit energischen Stößen die Reihen der Müßiggänger.
Ott, der Bürgerknecht, riß beflissen die Türe zur Ratsstube auf, aber Heinrich Rudolf, der erste Kämmerer, der gegenwärtig auch als Redner den Vorsitz führte, hatte soeben die Sitzung eröffnet.
Während Küchel so unauffällig wie möglich seinem Platz in den Reihen des Äußeren Rates zustrebte, begleitete ihn allseits spöttisches Grinsen wie das Gelächter des Dämons den Gerechten.
»Nachdem uns nun auch Bürger Küchel die Ehre gibt«, hob der Redner süffisant nochmals an, »darf ich die heutige Sitzung mit der Feststellung eröffnen, daß wiederholt Klage an den Rat gerichtet wurde bezüglich allgemeiner Sittlichkeit und ein Einschreiten des Rates geboten sei. Es bezieht sich insonderheit auf das Treiben im Henkerhaus sowie allfällige Winkeldirnen, daneben auf Unzucht in den Badstuben und aus gegebenem Anlaß auf Bettler, landstörzerisches Gesindel und Spielmannsunwesen. Ich erteile hierzu das Wort dem Bürger Sendlinger.«
Die schlichte Anrede war Untertreibung, aber sie waren stolz darauf, Bürger dieser Stadt zu sein und wußten auch ohne hochtrabende Titel um ihr persönliches Ansehen. Die feinen Tuche, Pelzverbrämungen und Siegelringe waren augenfälliger und hätten der Kollektion jedes fahrenden Händlers zur Ehre gereicht.
Hans Sendlinger verwies geschickt darauf, daß seine Familie den Bettelorden der Stadt große Unterstützung zukommen lasse und diese dazu beitrügen, den Bewohnern ins Gewissen zu reden.
Damit sei’s nicht getan, ereiferte sich Pötschner, aber wie solle man dem Recht Geltung verschaffen, wenn schon der Henker eine äußerst zwielichtige Person sei.
Ludwig Tichtl erinnerte, daß schließlich die Mehrheit des Rats der Bestallung erleichtert zugestimmt habe, nachdem der vorige Halsabschneider mit zwei Dirnen und einem Beutel Silber über Nacht getürmt sei. »Und was schadet’s«, gab er zu bedenken, »wenn er verwahrloste Hübscherinnen etwas härter anfaßt und der heimlichen Unzucht den Garaus macht?«
Es sei doch merkwürdig, stichelte der junge Ligsalz mit sichtlichem Vergnügen, daß die Klagen über dreiste und sittenlose Weiber und über nächtliche Umtriebe von Knechten und Lehrlingen in erster Linie aus den Gassen um den Anger herum kämen, wo der doch zum Rindermarktviertel gehöre, in dem die ehrbaren Bürger dieser Versammlung überwiegend ihre Behausung hätten.
Die flapsige Bemerkung war ein Stich ins Wespennest.
Der junge Herr möge gefälligst zwischen der inneren und äußeren Stadt unterscheiden, empörte sich Heinrich Ridler. Und als Hauptmann der Quarta fori peccorum cum suis adherentiis, des gesamten Rindermarktviertels, mäkelte er: »Soll ich vielleicht höchstpersönlich jede Nacht hinter den Zirkern herrennen und Gassen und Gelichter oder die Badstuben der Emporkömmlinge kontrollieren?«
Der Kämmerer, der selbst am Anger wohnte, hatte alle Mühe, den aufkommenden Tumult und umherfliegende Schmähworte im hohen consilium zu unterbinden.
Als endlich die Frage anstand, wie mit den Gauklern und Spielleuten zu verfahren sei, da war Ludwig Küchel nicht mehr zu halten und ließ als Kirchpropst und frommer Bürger seinem Unmut freien Lauf: »Von St. Peters Turmspitzen führt kein Seil, wohin auch immer! Das wäre noch schöner, daß die Kirche diesen Mesnern des Teufels auch noch das Seil spannen soll, auf dem sie ihre Possen treiben. Aus der Stadt jagen sollte man sie oder besser gar nicht erst einlassen.«
»Jawohl«, pflichtete Pötschner bei, »der Nürnberger Rat hat letztes Jahr einen Haufen Falschspieler und Ruffiane mitsamt ihren Dirnen der Stadt verwiesen. Und Spielleut’ und Lumpen, die wachsen auf einem Stumpen.«
»Was habt Ihr gegen sie?« fragte Ligsalz ganz unbedarft.
»Das will ich Euch sagen, junger Freund«, knurrte Küchel angriffslustig. »Ihr Treiben ist lasterhaft und nicht gottgewollt. Die Kerle sind aufdringlich, betrügerisch und spielwütig, und ihre schamlosen Weiber pflanzen Begierden in die Herzen rechtschaffener Bürger. Ihre Verderbtheit hat noch zu keiner Zeit den Glauben gestärkt, aber sie schleppen ketzerische Ideen mit sich wie die Krätze, und so sie nicht den Manichäern, den Jüngern des Waldes oder gleich gar den verruchten Luziferianern angehören, hängen sie zumindest alten Bräuchen und heidnischen Gedanken an. Oder handeln ihre Lieder etwa nicht von Zauberern und verbotenen Göttern oder anderen Chimären? Und wo sie nicht gleich den Herrgott lästern, da machen sie sich über die Kirche und ihre Diener lustig und spotten über die Hölle. Und zuletzt gießen sie ihren Unflat selbst über die Hand, die sie in Verblendung nährt. Sie sind wie Ungeziefer, das immer mehr nach sich zieht.«
»Dann nährt manch frommer Bischof eine Laus im Pelz«, erwiderte Ligsalz spöttisch. »Obwohl sie die Fahrenden von der Kanzel herab schelten, sind diese an den Höfen zum Zeitvertreib wohl gelitten. Warum sollen wir’s anders halten?«
Dieser Meinung schlossen sich andere an, denn die Erfahrung hatte gelehrt, daß die Menge sich durch gelegentliche Zugeständnisse leichter regieren ließ, so wie ein tänzelnder Hengst seinen Auslauf braucht und ein brodelnder Topf seine Öffnung. Warum also sollte man den Bürgern zu Kirchweih nicht ein bescheidenes Vergnügen gönnen, wo es schon wieder auf die dunkle, für Körper und Gemüt harte Jahreszeit zuging.