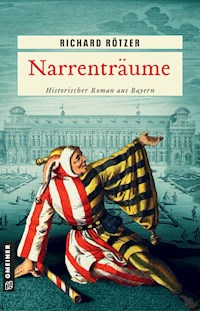4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München, im Jahr 1319: Eine Serie grausamer Morde erschüttert die Bürger. Gerüchte von Wiedergängern und schändlicher Zauberei verbreiten Angst und Schrecken. Zwei junge Isarflößer gehen den dubiosen Mordfällen auf eigene Faust nach und stoßen dabei nicht nur auf rätselhafte Psalmen und eine unheimliche Wachsfigur, die von Nägeln durchbohrt ist - sie erkennen auch, dass König Ludwig in höchster Gefahr schwebt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Richard Rötzer
Der Wachsmann
Historischer Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Richard Rötzer
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-208-5
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25.Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Das Buch
München, 1319: Über der aufstrebenden Stadt braut sich großes Unheil zusammen. Eine Reihe grauenvoller Morde an Isarflößern erschüttert die Bürger. Rätselhafte Fluchpsalmen, ein geheimnisvolles Siegel und eine seltsame Wachsfigur scheinen auf den Mörder zu deuten. Angst und Schrecken verbreiten sich mehr und mehr. Manche behaupten gar, Geister gesehen zu haben und verhext worden zu sein. Zunächst werden die Juden dafür verantwortlich gemacht. Zwei Flößer gehen den dubiosen Mordfällen schließlich auf eigene Faust nach: der junge, aufgeweckte Peter und sein dickköpfiger Freund Paul. Ihr Verdacht konzentriert sich auf die fluchbeladene Kaufmannsfamilie Pütrich, doch auch ein Schuster und ein verrückt erscheinender Pfaffe verhalten sich höchst merkwürdig. Auf ihrer Suche erfahren die beiden Rätselhaftes über Psalmen, Zauber und dramatische Geschehnisse aus der Vergangenheit der Stadt. Doch plötzlich erkennt Peter, dass König Ludwig selbst in höchster Gefahr schwebt…
Prolog
Dem Äußeren, ihrer Herkunft und ihres Standes nach hätten die beiden Männer, die sich kurz vor Mitternacht in dem feuchten, muffigen Kellergewölbe einfanden, kaum verschiedener sein können. Was sie dennoch verband, waren gefährliches Wissen über den jeweils anderen und der Vorsatz, Gottes Gerechtigkeit aus ihrer trägen Duldsamkeit aufzurütteln, indem sie sich anmaßten, an ihrer Statt zu rächen und zu strafen.
Der Größere von beiden wirkte trotz des schweren, pelzbesetzten Mantels hager, und soweit die tief ins Gesicht gezogene Kapuze und das flackernde Licht dreier Kerzenstummel ein Urteil überhaupt zuließen, schien er auch der ältere von beiden und schon ein gutes Stück über der Lebensmitte zu sein. Er wirkte entschlossener und befehlsgewohnt und herrschte seinen unscheinbaren Begleiter an: »Hast du alle Utensilien besorgt, wie ich dir aufgetragen habe?«
Erschreckt vom Widerhall im alten Gewölbe kam die Antwort beinahe flüsternd und mit leicht zittriger Stimme: »Ja, Herr, wie Ihr befohlen habt.«
Der Vornehme verzog angewidert das Gesicht: »Du hast wieder getrunken! Dein Atem übertrifft noch den fauligen Modergeruch dieses Ortes.« Warum nur mußte ich mich dieser Kreatur bedienen. Wie tief bin ich gesunken. Ich muß mich seiner entledigen, sobald diese Sache zu einem Ende gekommen ist.
»O nein! Nein, Herr – das heißt, einen… vielleicht auch zwei Becher Roten zum Nachtmahl, um die Unruhe und das Zucken in meinen Gliedern zu beruhigen. Immerhin mag Euer Vorhaben fürchterliche Folgen haben und ich bin, wie Ihr wohl wißt, nicht für mutige Taten geschaffen.« Dabei sank sein Kopf noch tiefer zwischen die gebeugten Schultern, was ihm irgendwie das Aussehen einer gekränkten Schildkröte verlieh. Gütiger Gott, ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Er will nur Rache, und mein Lohn wird ewige Verdammnis sein. Ich muß fort! Doch wohin?
»O ja!« schnaubte der andere verächtlich. »Das weiß ich wohl, daß du nicht den Weltenlauf veränderst. Doch reiß dich zusammen. Es war schließlich deine Idee, und du kannst jetzt nicht mehr zurück. Du steckst zu tief mit in dieser Sache. Und warst nicht du es, der vorgab, das ruchlose Verhalten des Frevlers zutiefst zu verabscheuen und der mich darin bestärkte, den Lauf der Gerechtigkeit zu beschleunigen?«
»Ihr, Ihr habt ja recht«, stammelte die Schildkröte, »es ist nur, ich meine… die Kirche weiß hart zu strafen, insbesondere beim Vorwurf der Zauberei, und ich tauge nun einmal nicht zum Märtyrer.«
»Und ebensowenig zum Heiligen«, spottete sein vornehmes Gegenüber. »Doch zeig nun, was du besorgt hast!«
Ein paar rohe Bretter, die zwei leere Fässer überspannten, bildeten den Tisch, auf dem der ängstliche Gehilfe die Paraphernalien für den teuflischen Plan aufreihte, die er aus der Weite seines groben Wollmantels hervorkramte: Ein Stück Holzkohle und drei eisenschwarze Blutsteine, rechtschaffen angewandt ein probates Mittel gegen Blutungen, doch in der Umkehrung der Schwarzmagie der Blutgerinnung geradewegs abträglich; eine frisch geweihte Osterkerze und eine kleine Phiole geweihten Wassers, versetzt mit ein paar Tropfen Urin eines Gehenkten; drei gekrümmte, rostige Sargnägel vom Kirchhof der Minderbrüder und ein kleines braunes Säckchen, das sich zu bewegen schien.
Als der Meister der bevorstehenden Zeremonie mit spitzen Fingern den Rand des Säckchens etwas lüpfte, glotzte ihn eine fette, giftige Kröte mit großen Kulleraugen an, was er lächelnd und befriedigt zur Kenntnis nahm.
»Wir haben noch zu warten, bis der Türmer Mitternacht kündet«, entschied er. »Nutzen wir die Zeit zu innerer Sammlung, damit wir rechten Geistes sind, auf daß der Zauber seine Wirkung entfalte!«
***
Der Chronist schrieb das Jahr 1319 seit der Geburt unseres Herrn, und die gottgewollte Ordnung des Abendlandes schien in Auflösung begriffen. Wo in früheren, besseren Zeiten ein jeder seinen Platz gekannt und der Bauer durch seiner Hände Arbeit für das Brot gesorgt, der Rittersmann seinen Schutz gewährleistet und der geistliche Stand das Seelenheil aller vermittelt hatte, da schien nunmehr ein jeder eifersüchtig auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein. Immer mehr Bauern wollten der seit Evas Verderbtheit und Adams Schwäche auferlegten Mühsal entfliehen, verließen ihre Grundherren und Äcker und flohen in die aufstrebenden Städte, um im Schutze deren wehrhafter Mauern nach Jahr und Tag frei zu sein. Zwar blühten dort Handel und Handwerk, mit ihnen aber auch Habgier und Hoffart nebst Armut und bitterer Not. Jetzt kleidete sich der Kaufmann in kostbare Pelze und putzten sich reiche Bürger mit bunten Tuchen wie Pfauen heraus, während sich mancher Adelige unter dem löchrigen Dach seiner kalten Burg in einen schäbigen Mantel hüllte. Der freie Geist an den Schulen und Universitäten Frankreichs, Spaniens und Italiens gebar bislang unerhörte Ideen und säte vielerorts Zweifel. Obwohl tausendfach abgeschlagen oder von läuterndem Feuer vernichtet, erwuchsen der Hydra der Ketzerei unaufhörlich neue Häupter. Und wo schon der Heilige Vater der Zauberei bezichtigt wurde, da wollte auch der gemeine Mann seine Furcht vor Dämonen und seinen Aberglauben nähren. Daneben gab es freilich auch tiefe Frömmigkeit und inbrünstiges Beten, die ihren schönsten und sichtbaren Ausdruck in den hochragenden und lichtdurchfluteten Kathedralen fanden. Aber war dieser neue, so schwerelos erscheinende und in die Ewigkeit weisende Baustil nicht zugleich auch Zeichen einer ganz dem Irdischen verhafteten Maßlosigkeit, wie der Einsturz der Kathedrale von Beauvais und die vielerorts stockende Bautätigkeit befürchten ließen? Und Maßlosigkeit war auch – in krassem Gegensatz zur Armut seines göttlichen Herrn und Meisters – die hervorstechendste Tugend des geistlichen Führers der Christenheit. In einem Alter, in dem der Fromme gemeinhin nur noch in der hoffnungsvollen Erwartung lebt, seinen Herrn und gnädigen Richter bald von Angesicht zu Angesicht zu schauen – in einem Alter von gut siebzig Jahren also –, da hatte der Bischof von Cahors eben erst den Stuhl Petri als Papst Johannes XXII. bestiegen. Und zählten Hochmut und Habgier in den Augen der Kirche zu den größten Lastern, so wußte Johannes diese Tugenden des Teufels aufs schönste in sich zu vereinen. Er war arrogant und unerschütterlich in seinem absoluten Herrschaftsanspruch über den römisch-deutschen König beziehungsweise Kaiser als den Schutzherrn des Reiches und Träger des weltlichen Schwertes. Und er war geldgierig und korrupt bis auf die Knochen und besaß ganz offenbar die Gabe des Midas, denn er wußte selbst Dreck noch zu versilbern. Daneben wähnte sich der Hüter des wahren Glaubens zeitlebens von Magiern und Dämonen umgeben, und er ließ alle, die er des Bildzaubers für schuldig hielt, hinrichten.
Im Buche Genesis steht geschrieben, daß vor Zeiten der Herr sah, wie groß die Bosheit der Menschen war, und er sandte eine gewaltige Flut, um sie mitsamt der Erde zu vernichten. Als sei der Herr in diesen Tagen aufs neue der Ruchlosigkeit der Menschen und insbesondere seiner gesalbten Diener überdrüssig, hatte er es in den Sommern der vergangenen drei Jahre nahezu unaufhörlich regnen lassen, so daß die Ernte vernichtet worden war und die Menschen vielerorts schrecklichen Hunger litten und wie die Fliegen starben. Und es ging das Gerücht von blutigem Regen und hellen Schweifsternen. Wer nur recht die Zeichen zu deuten wußte, sah Joachim von Fiore bestätigt, der das Nahen der Endzeit angekündigt hatte, in der der siebenköpfige Drache sein Haupt erheben und die Herrschaft des Antichrist beginnen werde.
Angesichts der Schrecken der Zeit, in der von den Paulinischen Tugenden der Glaube durch Zweifel ersetzt und die Liebe der Habsucht gewichen war, da blieb den Menschen nur noch wenig Hoffnung: Hoffnung auf ein Plätzchen am Tisch des Herrn in der Ewigkeit und Hoffnung auf Frieden und das täglich Brot, solange der mühselige Kampf im Diesseits währte. Doch danach sah es in diesem Jahr 1319 am allerwenigsten aus. Es roch vielmehr penetrant nach Krieg, und wie meistens, ging es bei den Streitigkeiten um Besitz, Ansehen und Macht.
Im fünften Jahr schon wogte der Kampf um die Krone des römisch-deutschen Königs unentschieden hin und her zwischen den stolzen Habsburgern aus Österreich und dem Hause Wittelsbach, das zudem durch einen unseligen Bruderzwist zerrissen war. Als nämlich 1294 der Bayernherzog Ludwig der Strenge – ein merkwürdiger Beiname für die Ermordung seiner ersten Gattin in eifersüchtiger Raserei – von seiner Residenz zu Heidelberg ins reinigende Fegefeuer übersiedelte, da hinterließ er nebst zwei Töchtern den älteren Sohn Rudolf und dessen minderjährigen Bruder Ludwig sowie die lebenslustige Witwe Mechthild aus dem Hause Habsburg, die mit ihren vierzig Jahren noch keineswegs gewillt war, sich am Stickrahmen vom Herbst des Lebens überraschen zu lassen.
Rudolf, damals gerade neunzehn Jahre alt und volljährig, voller Tatendrang und ehrgeiziger Pläne, machte sich sogleich ans Regieren, beanspruchte die Vormundschaft über Ludwig und versuchte, die rührige Mutter ins höfische Leben abzudrängen. Anfangs regierte er keineswegs ungeschickt, und die ebenfalls noch junge Stadt München verdankte ihm unter anderem ihr ältestes Stadtrecht, das Rudolfinum. Mit den Jahren aber übte er sich in der Kunst, aufs falsche Pferd zu setzen, und brachte es darin zunehmend zur Meisterschaft. So überwarf er sich alsbald mit Mutter, Bruder und Verwandten aus Österreich und verlor dabei beträchtlich an Ansehen und Besitz.
Nachdem Ludwig die Volljährigkeit erlangt hatte, mußte er feststellen, daß der ältere Bruder eine recht eigenwillige Vorstellung vom Teilen hatte, selbstherrlich über das gemeinsame Erbe verfügte und die Regierung weitgehend für sich beanspruchte. Darüber kam es zum offenen Streit, der freilich niemandem zum Nutzen gereichte außer der Zunft der Waffenschmiede. »Der Bruder zog nun das Schwert wider den Bruder«, vermerkte der Chronist bitter. Die feindlichen Parteien überboten sich im Plündern und Brandschatzen als wäre es der Brüder erklärtes Ziel, Könige einer Wüstenei zu werden, und Ludwig tat sich dabei mit jugendlichem Eifer hervor, als gelte es, nach den ritterlichen Lehrjahren die Gesellenprüfung im Mordhandwerk abzulegen. Bald jedoch, ob nun aus Einsicht oder Ermüdung, gesellte sich Besonnenheit zu seinen zahlreichen guten Anlagen, und er verlegte sich aufs Regieren. Er reichte Rudolf die Hand zur Versöhnung und bewies diplomatisches Geschick bei der ihm angetragenen Vormundschaft über die niederbayerischen Vettern. Doch hiermit brachte ungewollt nun er die österreichische Verwandtschaft gegen sich auf, die um ihren Einfluß in Niederbayern fürchtete.
Folgerichtig für die streitlustige Stimmung jener Tage kam es zum Scharmützel bei Gammelsdorf, wo Ludwig obsiegte. Sein Ansehen stieg dadurch in den Augen seiner Zeitgenossen so gewaltig, daß er nach dem unerwarteten Tod des römisch-deutschen Königs plötzlich als aussichtsreicher Kandidat für die Königswürde erschien. Die Habsburger allerdings forderten vehement den Thron für Vetter Friedrich. Die Kurfürsten wiederum, mehr am Erhalt ihrer Macht als an einem starken Königtum interessiert, waren sich zwar einig im Bestreben, ihre Börsen durch Handsalben, das heißt fette Schmiergelder zu füllen, konnten sich aber auf keinen Kandidaten einigen. So erfolgte im Jahre 1314 eine verhängnisvolle Doppelwahl.
Den jungen Friedrich nannte man allgemein den Schönen. Inwieweit dies zutraf und mehr noch, inwieweit der Mensch überhaupt äußerer Schönheit Rechnung tragen soll, wo doch schon der heilige Bernhard schreibt, daß nur innere Schönheit wahren Glanz hervorbringt, das sei hier dahingestellt. Zweifellos aber erfüllte ihn beträchtlicher Ehrgeiz, und so dachte er keinesfalls an Verzicht, sondern suchte seine Wahl mit dem Schwerte zu bekräftigen. Mehrfach lagen sich in der Folgezeit die feindlichen Heere gegenüber, ohne daß es zur entscheidenden Schlacht kam. Doch nun im Jahre 1319, in dem die schrecklichen Ereignisse, von denen wir berichten wollen, sich zutrugen, deutete vieles darauf hin, daß die königlichen Gegner – des abwartenden Taktierens, der Entbehrungen und der finanziellen Aufwendungen müde – endlich die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchten.
Herzog Rudolf, der bei der Königswahl natürlich gegen seinen ungeliebten Bruder gestimmt hatte und damit plötzlich zum Parteigänger der Habsburger geworden war, hatte inzwischen resigniert, weitgehend auf seine Herrschaftsrechte verzichtet und sich kränkelnd und schmollend auf seine Burg zu Wolfratshausen zurückgezogen. Seine ehrgeizige Gemahlin indes wollte sich damit nicht so einfach abfinden, und wie der Waidmann um die Gefährlichkeit einer verletzten Wölfin weiß, so fürchtet der Umsichtige die Rache eines enttäuschten Weibes.
Auch die Münchner Bürgerschaft war unweigerlich in den Konflikt der fürstlichen Streithähne hineingezogen worden, hatte aber letztlich wie der lachende Dritte im gefährlichen Spiel davon profitiert, daß die Brüder mit immer neuen Privilegien um die Zuneigung und Unterstützung der Bürger gebuhlt hatten. Inzwischen waren die Parteiungen in der Stadt aufgelöst, Ludwigs Gegner vertrieben und die Bewohner froh darüber, wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen zu können.
Dem ahnungslosen Besucher bot sich so ein friedlich erscheinendes Durcheinander von reger Bautätigkeit und lebhaftem Handel. Doch im verborgenen hegte manch enttäuschter Anhänger Rudolfs noch dumpfen Groll und schmiedete finstere Pläne. Und war auch die Frage der Herrschaft im Reich noch nicht entschieden – eines war gewiß: Es regierte der Haß!
***
Obwohl in der Tiefe des Gewölbes nur schwach vernehmbar, riß der Ruf des Turmwächters von St. Peter die beiden Männer aus ihren Gedanken: den einen aus der Erinnerung über das Unrecht und die Demütigung, die man ihm angetan hatte, den anderen mehr aus Befürchtungen über schreckliche Strafen, falls ihr verbotenes Tun offenkundig und vor einen Richter getragen würde.
»Laß uns beginnen!«
Der Ältere entrollte ein Pergament auf der rohen Brettertafel, ergriff die Holzkohle und skizzierte mit festem Strich ein schwarzes Dreieck als Symbol für den Schöpfer. Darüber ein Dreieck, das auf der Spitze stand, Symbol für alles Irdische und damit Unvollkommene, für das Böse und sündhaftes Menschenwerk. Zusammen bildeten sie ein magisches Hexagramm, das Siegel Salomons: Einheit der beiden Prinzipien des Guten und des Bösen, männlich-weibliche Vereinigung und Sinnbild des Kosmos.
Während des Zeichnens rief der Alte dreimal den Höllenfürsten Baal-Beryth an, ehemals mächtiger Fürst der Cherubim, jetzt Großmeister aller infernalischen Zeremonien, der die Pakte zwischen Sterblichen und Dämonen besiegelte. Schließlich umschrieb er das Siegel noch mit einem magischen Kreis als Symbol für den Ring Salomons, mit dem dieser die Dämonen beherrscht hatte. An drei Stellen kritzelte er die Buchstabenfolge AGLA und murmelte jedesmal dazu: »Ata Gibor Leolam Adonai«, was bedeutete: »Deine Macht währt ewig, Herr.« Den oberen drei Spitzen des Hexagramms, Zeichen der Dreieinigkeit, ordnete er die drei Kerzen zu, während er die Blutsteine auf den unteren drei Spitzen verteilte.
Der Gehilfe hielt nun mit zitternden Händen die geweihte Osterkerze über die Flammen, damit das Wachs weich und formbar wurde. Dabei beobachtete er ängstlich die tanzenden Schatten an den Wänden ringsum, die ihm einen höllischen Reigen feixender Dämonen vorgaukelten. Die Schweißperlen auf seiner Stirn flossen zusammen, bildeten kleine salzige Rinnsale und vereinigten sich zu Strömen kalten Schweißes, Sturzbächen der Angst, die sich über Gesicht und Hals ergossen. Er war erleichtert, als ihm sein Gegenüber die Kerze abnahm, sie auf das Hexagramm legte und in frevlerischer Absicht das Wachs zu kneten und zu formen begann. Die ungelenken Finger bildeten eine grobe Puppe, einen Atzmann als Abbild dessen, dem der Schaden zugefügt werden sollte. Es kam nicht darauf an, ein wahres Ebenbild zu schaffen. Entscheidend war vielmehr, daß die Figur durch Zauberspruch und Taufe in eine sympathetische Beziehung trat zu demjenigen, den sie darstellen sollte. So vermochte man Macht über ihn zu gewinnen, sei es, um Liebesglut zu entfachen, sei es, um Tod und Verderben zu bringen.
»Halt die Kröte bereit!«
Die Aufforderung jagte erneut kalte Schauer über den Rücken des unfreiwilligen Zauberlehrlings, während er das Säckchen öffnete, die schleimige Kröte packte und das spitze Messer zückte.
Unter unverständlichem Gemurmel, das sowohl Psalmen als auch Flüche beinhalten konnte, bespuckte der Herr des Unternehmens die Wachsfigur dreimal und entleerte die Phiole mit Weihwasser und Urin über ihr.
»Nun du!«
Mit erstaunlicher Gewandtheit, als hätte er dies schon wiederholt praktiziert, schlitzte der Gehilfe mit dem Dolch Kehle und Bauch der Kröte auf, hielt die verendende Kreatur über den Atzmann und drückte der Kröte Blut darüber aus.
»Ich taufe dich im Namen der Dreieinigkeit und Luzifers auf den Namen Ludwig!«
Zweifellos wäre Menschenblut weit wirkungsvoller gewesen, um Dämonen herbeizulocken, doch auch Krötenblut war dem Zwecke dienlich. Kaum hatte der Gehilfe die Formel beendet, warf er das tote Tier angewidert ins Kellereck, als habe ihm ein leibhaftiger Dämon die Hand versengt. Am liebsten hätte er auch fluchtartig das Gewölbe verlassen, doch der bohrende Blick seines Gegenübers ließ ihn erstarren.
»Gib mir die Nägel!«
Wie in Trance und über den imaginären Feind triumphierend, ritzte die knochige Hand des Hageren ein großes L in den wächsernen Körper und rammte anschließend die drei Sargnägel hinein, während seine eiskalte Stimme das Opfer verfluchte: »Mächte der Finsternis, erhört mein Flehen im Namen Salomons und seiner Heerscharen, seiner Macht und Weisheit. Verflucht sei Ludwig ob seiner frevelhaften Taten. Nehmt ihm Willen und Kraft! Sein Verlangen gebäre ihm Unheil, sein Handeln bringe ihm Tod und Verderben! Amen!«
»Amen!«
»Sprich mir nach: Nostrae mortis hora in et nunc…«
Nachdem sie drei Ave Maria und drei Pater noster rückwärts aufgesagt hatten, war die grausige Zeremonie beendet.
Der Alte lächelte zufrieden in sich hinein. Nun mochte alles so werden wie früher und falls nicht, so würde ihm zumindest Genugtuung widerfahren. Er wickelte den Wachsmann vorsichtig in ein schwarzes Tuch, rollte das Pergament zusammen und drückte zwei der Kerzen aus. Im flackernden Schein der dritten geleitete er den wankenden Gehilfen aus dem Gewölbe, dessen kalte Mauern nun ein schreckliches Geheimnis bargen. Er entließ ihn in das unheimliche Dunkel der schlafenden Stadt mit der scharf gezischten Warnung: »Kein Wort darüber oder ich werde dafür sorgen, daß du baumelst!«
Als hätte es dieses freundlichen Rates bedurft. Eher würde der Gehilfe sich die Zunge abbeißen, als sich selbst an den Galgen liefern wollen. Sich angstvoll immer wieder umblickend, hastete er durch die dunklen Gassen, als sei der Leibhaftige schon jetzt hinter ihm her. Es roch nach Schwefel. Ja, ganz sicher. Oder war es doch nur der gewohnte Gestank der Abfälle und Kloaken, den seine überreizten Sinne als die persönliche Duftnote des Höllenfürsten wahrnahmen? Er stolperte, flog über einen Haufen lebender Lumpen, der sich fluchend bewegte, rappelte sich auf, jagte weiter. Herr im Himmel, vergib mir! Ich wollte doch nur… ich mußte… er hat mich gezwungen. Oh, verflucht, wenn nur eine dieser verdammten Schenken noch offen hätte. Gott sei Dank bin ich gleich zu Hause.
Im gleichen Augenblick, als er mit lähmendem Entsetzen die glühenden Lichter auf dem Holzstoß vor ihm wahrnahm, erfolgte auch schon der Angriff: Ein gräßliches Fauchen… ein Schrei… stechende Schmerzen. Taumelnd fuhr er mit der Hand über die rechte Wange: Blut. Der Hieb war nur um Zentimeter am rechten Auge vorbeigegangen. Die Krallen hatten tiefe Furchen in die Backe gerissen. Er haßte des Nachbarn Katze von jeher. Doch diesmal war sie vom Teufel besessen. Jesus, Maria!… Verfluchtes Biest!… Ich hätte dir schon längst den Hals umdrehen sollen… Herr, gütiger Gott, vergib mir meine Gedanken… ich bin verwirrt… ich steh’ das nicht mehr durch! Gib mir ein Zeichen, wenn du mir den Frevel vergibst!
»Kruzifix, jetzt fällt mir der Schlüssel in den Dreck!«
Am ganzen Leib zitternd, von Schmutz und Angstschweiß verklebt, schleppte sich der Geplagte in seine Kammer, der ewigen Verdammnis gewiß. Er stürzte auf den Tonkrug zu, der den Rest des roten Tirolers barg und ließ das Labsal in großen Schlucken durch seine Kehle rinnen, als vermöchte er damit das bevorstehende Höllenfeuer zu löschen. Erst als die Trunkenheit zunahm, kehrte allmählich trügerische Erleichterung ein, die ihn auf sein Lager und in unruhigen Schlaf fallen ließ.
Die Gerechtigkeit des Herrn aber schlummert nie.
»Ist der christ tag an einem eritag, so wirt der wintter groß vnd schneibt, vnd flatig der lencz, vnd der sumer feucht, der augst trukken. Vnd daz chorn wirt lieb. Das vich stirbt, Honick wirt vil. Vnd vil prandes wird in eczleichen landen. Vnd vil vngewitters wirt. Kraut und garten frucht verdirbt. Ols wirt vil. Vnd ettwas betrubnuss geschieht den romern. Vnd die frawen sterben gern an den chinden, vnd die chunig sterben gern in dem jar.«
(Esdras’ Weissagung)
1. Kapitel
Das schwache Licht, das durch die schmale Öffnung in der Holzwand auf den festgestampften Erdboden fiel, kündete bereits die Morgendämmerung an, als Jakob Krinner erwachte. Amseln und Lerchen trällerten schon die wiederholte Strophe ihres Morgenliedes und – wie Jakob deutlich zu vernehmen glaubte – lauter und munterer als noch beim gestrigen Tagesanbruch. Der Dauerregen der letzten Tage, der die Gemüter der Menschen zermürbt und die Natur beinahe ertränkt hatte, schien aufgehört oder zumindest nachgelassen zu haben.
An Jakobs Rücken schmiegte sich der warme Leib seines jungen Weibes. Ihr Atem ging schnell und heftig. Sie mußte schon wach sein oder schwer träumen. Ihr rechter Arm umfing ihren Mann fest, beinahe verkrampft, als wolle sie ihn für ewige Zeiten festhalten. Jakob entwand sich vorsichtig der Umklammerung und drehte sich ihr zu. Zwei große dunkle Augen blickten ihn liebevoll und zugleich voller Besorgnis an.
»Liegst du schon lange wach? Du hättest mich wecken sollen.«
»Ich hab’ dich einfach noch spüren wollen und hab’ geglaubt, du hast den Schlaf nötig.«
»Ich möcht’ ja auch noch nicht fort, aber es muß sein.«
Sie legte ihren Kopf auf seine Brust, drückte ihn wieder fester.
»Jakob!«
»Ja.«
»Ich hab’ schreckliche Angst!«
»Aber, Lies, wovor denn?«
Seine Stimme sollte beruhigend klingen, obwohl er selbst Beklemmung verspürte und ahnte, daß die Besorgnis seines Weibes diesmal ernster zu sein schien.
Elisabeth Krinner war im Grunde nicht von ängstlicher Wesensart, sondern beherzt, geradeheraus und zupackend. Sie versorgte umsichtig den kleinen Hof, obwohl sie häufig damit allein gelassen war. Drei gesunde und kräftige Söhne hatte sie ihrem Jakob geboren, der jüngste gerade drei Jahre alt. Doch Lies hatte noch eine weitere Gabe, Segen und Fluch zugleich: Sie spürte oftmals bevorstehende Ereignisse, sah freudige Entwicklungen voraus und ahnte Unheil und Tod.
»Jakob, ich hab’ eine schreckliche Nacht gehabt. Mir war, als säß’ die Drud auf meiner Brust. Ich konnte kaum atmen, und der Alp hat nicht mehr aufgehört. Vom Wasser hat mir geträumt. Hoch angeschwollen war’s, reißend und voll tückischer Strudel. Und ein Haufen kleine Fische ist immer wieder aus dem Wasser gehüpft.«
»Das ist doch ein gutes Zeichen. Von Fischen träumen heißt, daß Geld ins Haus kommt. Und wenn es schlecht kommt, dann bedeutet es höchstens etwas Regen.«
»Nein, Jakob, hör mir zu! Plötzlich sind sie alle aufs Land gesprungen und auf einem Fleck mit weißem Sand verreckt. Grausig hat das ausgeseh’n, wie sie so gezappelt haben. Und die toten Fischaugen haben mich angeglotzt, vorwurfsvoll, als hätt’ ich sie umgebracht. Das bedeutet Streit und Unheil.« Und kaum mehr hörbar fügte sie hinzu: »Und vielleicht auch Tod.«
»Lies, Lies, du hörst zuviel auf das Geschwätz der alten Weiber.« Er lachte, aber es klang nicht wie sein gewohntes, herzliches Lachen, mit dem er auch in schwierigen Augenblicken seine Frau immer wieder zu trösten und aufzuheitern verstand. Diesmal war ihm selbst unwohl zumute, und er versuchte sich Mut zu machen, indem er sich seine Fähigkeiten und gut überstandene Wagnisse ins Gedächtnis rief.
»Jakob, ich weiß, du bist nicht leichtfertig. Aber es sind zu viele Zeichen. Ich hab’ seit Tagen die Raben gehört. Und der gestrige Johannitag war völlig verregnet. Der Gewittersturm hat in der Nacht die Feuer gelöscht, und kaum einer hat sich hinausgetraut, um die Kräuter zu holen, die wir für ein gutes Jahr brauchen.«
Am Vorabend des 24. Juni wurden allerorts hohe Holzhaufen aufgeschichtet, und wer das lodernde Feuer übersprang, der konnte sich Schutz gegen allerlei Krankheit erwerben. Die Feiernden bekränzten sich mit gelben Johanniskräutern, und hängte man sie nach dem Tanz ums Feuer, zu Büscheln gebunden unters Dach, so waren Haus und Bewohner geschützt vor Blitz- und Hagelschlag, aber auch vor den Nachstellungen böser Geister und dem Schadenzauber übler Nachbarn. Die Kirche, obwohl der Zauberei und dem Aberglauben abhold, verbot das Sammeln der Kräuter nicht, sofern es in frommer Gesinnung und nicht unter dem Gemurmel von Zaubersprüchen geschah.
»Jakob, geh nicht, nur dieses eine Mal! Ich bitt’ dich, beim Leben unserer Kinder!«
»Lies, du weißt, ich steh’ im Wort und in der Schuld. Ich kann nicht anders. Du weißt auch, was ich ihm verdanke. Hätt’ er sich nicht für mich verwendet, dann hätten wir vielleicht schon nichts mehr zum Beißen.«
»Aber du hast dir doch gar nichts zu schulden kommen lassen. Vielleicht war alles nur ein Versehen oder gar ein abgekarteter Betrug.« Ihr Tonfall wurde vorwurfsvoll und bitter. »Wer wird’s dir danken, wenn jetzt etwas passiert? Was kümmert denn den Kaufmann dein und unser Leben wirklich? Einen Dreck, sag’ ich, wenn er auch nur einen Pfennig verliert. Sei doch nicht immer so gutgläubig! Vielleicht benutzt er dich nur. Du setzt dein Leben aufs Spiel, während er sich die Hände reibt.«
Ihr Gesicht glühte jetzt fast, und er fühlte sich heftig zu ihr hingezogen ob der Leidenschaft, mit der sie um ihn kämpfte. Aber zugleich spürte er, wie die eigene Unsicherheit in ihm wuchs und die Oberhand zu gewinnen drohte, bis er in seiner Entscheidung gelähmt wäre. Er durfte dies nicht zulassen.
»Schluß jetzt! Kein Wort mehr! Es wird schon höchste Zeit für mich.« Er schlug die wollene Decke zurück und schickte sich an, das harte Strohlager zu verlassen, als sie seine Hand ergriff und ihn flehentlich ansah. Er hatte ungewöhnlich heftig reagiert, und sie wußte, daß dies nicht seinem eigentlichen Wesen entsprach. Aber sie wußte nun auch, daß es ihr nicht möglich war, ihn umzustimmen. Er hielt den Blick von ihr abgewandt. Während sie langsam seine Hand aus der ihren entließ, spürte sie immer deutlicher, wie sich zur Angst tiefe Traurigkeit gesellte.
Jakob schlüpfte in die Beinlinge und trat vor die Tür. Der Boden war feucht, und es tropfte noch überall von den Bäumen. Aber der Regen hatte tatsächlich aufgehört. Düstere Wolken ließen zwar noch keine ungehemmte Freude aufkommen, aber ein frischer Wind trieb sie bereits nach Osten. Hier und da riß die Wolkendecke schon kräftig auf und gewährte im Dämmerlicht des anbrechenden Tages einen Blick auf den langersehnten, blauen Himmel. Das Wetter hatte sich eindeutig gebessert.
Jakob war froh darüber und sandte einen kurzen Dank zum Himmel, der sein Vorhaben ganz offensichtlich mit Wohlwollen begleitete. Allmählich gewann er seine alte Sicherheit und Entschlossenheit wieder. Er ging die wenigen Schritte zum Brunnen, zog sich einen Eimer frischen Wassers herauf und verscheuchte damit die restliche Müdigkeit aus Gesicht und Gliedern. Das wollene Hemd, das er daraufhin anlegte, schützte ihn gut gegen die morgendliche Kühle auf seinem Rundgang durch das kleine Anwesen. Er schaute nach den wenigen Schafen, begrüßte die Ziege, die ihn verspielt mit dem Kopf anstieß und freute sich über den Hahn, der seine Hühner schon wichtigtuerisch über den Hof scheuchte. Es schien alles wohlgeordnet, wenn er sich nun für ein paar Tage fortbegeben mußte.
Als er ins Haus trat, spürte er sofort wieder die beklemmende Stimmung. Lies hatte inzwischen das karge Frühstück bereitet: etwas Brot, Haferbrei und ein Becher lauwarmes Bier. Sie selbst verspürte noch keinen Hunger oder brachte keinen Bissen hinunter, während ihr Mann schweigend seinen Brei löffelte. Beide hingen ihren Gedanken nach.
Jakob Krinner war Flößermeister und seit vielen Jahren der Zunft der Wolfratshauser Loisachflößer zugehörig. Die Loisach war wie eine kleine Schwester zur wilden Isar und als solche auch nicht ganz so ungebärdig. Der Schöpfer hatte der Isar von Anbeginn größere Hindernisse in Gestalt mächtiger Felsbarrieren in den Weg gelegt, während das Kindbett der Loisach friedfertiger verlief.
Die Flößer von München nahmen dies gelegentlich zum Anlaß, etwas mitleidig und überheblich auf die »Loisachpatscher« herabzuschauen, obwohl Graf Berthold aus dem mächtigen Geschlecht der Andechser den Wolfratshauser Flößern schon 1159 das Zunftrecht verliehen hatte, als München gerade erst gegründet war und von einer großen Zukunft noch gar nichts wußte.
Jakob fochten diese Sticheleien nicht an. Er hatte im Laufe der Jahre auch die Isar in ihrer ganzen Länge befahren und kannte daher ihre Tücken und Gefahren nur zu gut. Um so schwerer wogen für ihn die Vorwürfe, die man wenige Wochen zuvor gegen ihn erhoben hatte. Er hatte für den Kaufmann Pütrich eine Ladung Südtiroler Wein übernommen und sich verpflichtet, sie vollständig und unbeschadet in München abzuliefern. Nachdem er das Kaufmannsgut wohlbehalten dem Pfleger der Weinlände übergeben hatte, hatte er sich in die nahe gelegene Wirtsstube begeben, um sich für den Rückmarsch nach Hause zu stärken. Bei seiner Rückkehr zur Lände wurden ihm statt des wohlverdienten Lohnes heftigste Vorwürfe zuteil. In mehreren Fässern hätten etliche Maß Wein gefehlt, und er habe die Ladung sträflich veruntreut. Nun wußte ein jeder, daß die Flößer ein trinkfreudiges Völkchen waren, und der Münchner Rat hatte darob harte Bußen verfügt. So waren für unerlaubtes Trinken sechzig Pfennige Strafe an Stadt oder Stadtoberrichter zu zahlen, und bei leerem Beutel ersatzweise eine Hand oder mindestens ein Ohr zu opfern. Jakob beteuerte verzweifelt, er und sein Floßknecht hätten die Fässer nicht angerührt, doch man glaubte ihm trotz seines guten Leumunds nicht. Er verwies darauf, daß schließlich eine Reihe von Leuten mit dem Wein zu schaffen hätten, so auch Transportleute, Unterkäufel, Weinkoster und Anstecher. Damit schaffte er sich freilich keine Freunde, und nicht zuletzt fiel dadurch auch ein gewichtiger Verdacht auf Konrad Peitinger, den Pfleger der Weinlände. Der war ein vierschrötiger, mürrischer Kerl, dem der Wein aus den Augen sah. Und wer es nicht von Berufs wegen mußte, der mochte mit ihm keinen engen Umgang pflegen. Glücklicherweise trat Ludwig, der jüngere Bruder des alten Pütrich, in dessen Auftrag der Wein nach München geflößt worden war, für den arg bedrängten Jakob ein. Es seien den Flößern etliche Maß Trinkwein zugebilligt worden, so beteuerte er gegenüber den herbeigerufenen Richtersknechten, und der Schwund entspräche wohl ziemlich genau dieser Menge, so daß niemand einen Schaden davontrüge. Sie verfolgten daraufhin den Zwischenfall nicht weiter.
Jakob dankte dem Kaufmann für seine noble Haltung, fragte sich aber zugleich, was ihn wohl dazu bewogen habe.
»Dankt nicht mir, dankt dem Herrn dafür, daß er mich im rechten Augenblick zur Stelle sein ließ, um Euch vor einem Unrecht zu bewahren. Ihr habt unserem Handelshaus bisher recht zuverlässig gedient, was man beileibe nicht von jedermann sagen kann.« Er warf einen geringschätzigen Blick auf den Pfleger. »Ich glaube nicht an ein Verschulden Eurerseits. Vielleicht könnt Ihr Euch ja eines Tages in anderer Weise erkenntlich zeigen.«
Jakob war noch einmal davongekommen und fühlte sich seither den Pütrichs in besonderer Weise verpflichtet. Mit seinem Verdacht auf Konrad Peitinger aber hatte er sich grimmige Feindschaft eingehandelt. Er mußte vor ihm auf der Hut sein.
Während er nun gedankenverloren seinen Brei löffelte, saß Lies ihm schweigend gegenüber. Sie dachte an die Kinder, die in dem abgetrennten Verschlag noch selig ruhten und nichts von der quälenden Unruhe verspürten, die ihrer Mutter Herz fast zum Zerreißen plagte. Plötzlich schoß ihr in den Sinn, daß die Buben ihren Vater vielleicht nie mehr zu Gesicht bekämen, daß es nie mehr so sein würde wie jetzt… Sie durfte nicht weiterdenken, mußte sich ablenken. Ihre nervösen Finger prüften noch einmal die zum Mitnehmen vorbereitete Brotzeit – verschoben den Bierkrug, rückten die Becher zurecht, gossen nach – und warfen mit einer fahrigen Bewegung das Salzfaß um. Sie unterdrückte gerade noch den Schrei, schlug die Hände vor den Mund, lähmendes Entsetzen in den Augen. Nun auch noch das Salz. Jakob sah auf und gewahrte den Schmerz und die Tränen in ihren Augen. Er legte wortlos den Löffel beiseite, stand auf, ging um den Tisch herum. Er strich ihr übers Haar, während sie ihn noch im Sitzen umklammerte und nun, am ganzen Körper geschüttelt, den Tränen ungehemmt ihren Lauf ließ. Nach einer Weile wurde sie ruhiger, stand auf, wischte sich über die Augen, versuchte ein Lächeln: »Verzeih mir!«
»Ist gut.« Mehr vermochte er nicht zu sagen. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt und staubtrocken. Er mußte jetzt ganz schnell fort. Dies war für beide das beste. Er nahm den Rucksack von der Wand, den er am Abend zuvor schon gepackt hatte und legte noch Brot und Käse hinein. Er öffnete vorsichtig die Tür zur Kammer, warf einen liebevollen und stolzen Blick auf die schlafenden Knaben, stieg danach in die festen Bundschuhe, umgürtete sich mit der Geldkatz und schulterte Rucksack und Floßhacke. Lies begleitete ihn vor die Türe.
»Schau, das Wetter wird gut. In Gottes Namen bin ich in ein paar Tagen zurück. Sorg dich nicht mehr! Und geh zum Nantwein und steck ihm eine Kerze auf! Er weiß, wie es unsereinem ergeht und zumute ist.«
Es war noch nicht so lange her, da hatten Neider den seligen Nantwein auf seiner Pilgerfahrt nach Rom wegen des Geldes, das er bei sich trug, falsch bezichtigt, und der herzogliche Richter, Ganterus zu Wolfratshausen, hatte ihn am Hochufer der Isar verbrennen lassen. Seither wurde er dort verehrt und seine Hirnschale wie eine Reliquie aufbewahrt. Und jeder, der sich falsch beschuldigt glaubte, konnte bei ihm Trost suchen.
»Jakob, bitte trag dies! Es ist noch von meiner Mutter, und sie hat was davon verstanden.« Sie hängte ihm das Amulett um den Hals: ein kleiner, dunkelrot schimmernder Karfunkel, in Silber gefaßt. Er konnte seinen Besitzer vor allen Gefahren auf Reisen schützen. Man erzählte sich, er verlöre seinen Glanz, wenn Unheil bevorstünde. Darüber hinaus hatte er die hübsche Eigenschaft, Trübsal zu vertreiben, den Träger froh zu stimmen und bei seinen Mitmenschen Beliebtheit zu erwecken. Lies hatte sich während der Nacht, als sie nicht schlafen konnte, auch kurz vor die Tür gestohlen und etwas Beifuß gepflückt. Zusammen mit ein paar Körnchen Salz hatte sie das Kraut in Jakobs Schuhe gestreut, um ihn vor Ermüdung und bösem Zauber zu schützen. Sie hatte somit alles getan, was in ihrer Macht stand. Nun lag es am Herrgott, das Seine zu tun.
Jakob dankte ihr gerührt, zog sie noch einmal fest an sich, küßte sie und verließ dann schnellen Schritts das kleine Anwesen in Richtung Loisach. Fast schon außer Hörweite drehte er sich noch einmal um, schwenkte den spitzen Hut und rief ihr übermütig zu. »Ich bring dir Bänder mit aus der Stadt, die schönsten und teuersten!« Er sah noch ihr schwaches Winken; den Schmerz in ihren dunklen Augen mußte er dank der Entfernung nicht mehr mitansehen.
Dann schritt er weit aus und legte ein gehöriges Tempo vor, denn er hatte einen weiten Weg vor sich.
Reisen war in jenen Tagen allgemein gefährlich, gleich ob zu Wasser oder auf dem Landweg. Den Flößern aber, zumeist am Fluß aufgewachsen und mit ihm vertraut, erschien der Wasserweg allemal sicherer. Nur stromauf ging es halt nicht anders als auf Schusters Rappen. Manchmal war es möglich, ein Stück des Weges auf einem Pferdefuhrwerk oder Ochsenkarren eines Handelsreisenden, der sich über Gesellschaft freute, zu überbrücken. Doch bei dem schlechten Zustand der Wege und Straßen, insbesondere nach dem Sauwetter der letzten Wochen, war ein flotter Wanderer gewiß nicht langsamer. Ein häufiges und unleidiges Problem, das freilich allen zum Verhängnis werden konnte, war die Begehrlichkeit der Mitmenschen, durchaus nicht immer nur Galgenvögel und Habenichtse. So mancher edle Rittersmann, durch Fehden oder großspurigen Lebensstil ständig abgebrannt, sah im Reisenden nicht den Schutzbefohlenen, wie es das hehre Ritterideal verlangte, sondern die güldene Gans, die er zu rupfen und manchmal gar zu schlachten gedachte. Jakob vermied gerne die öffentlichen Wege und Straßen und folgte den Pfaden entlang des Flusses, mußte aber oft auch durch Felder und lichte Waldstücke die Abkürzung suchen, wenn der Fluß sich gar zu verspielt immer neue Windungen leistete.
Nach etwa zweistündigem Fußmarsch passierte er die Iringsburg, die Herr Wichnand mit seiner Schwester Kunigunde bewohnte. Der Rittersmann war zu keiner Zeit mit einem Weibe gesegnet und Jakob, der seine Elisabeth hatte, hätte nicht um die Burg mit ihm tauschen wollen. Wenn er es recht bedachte, so hatte er doch viel Glück gehabt in seinem bisherigen Leben. Er stand in der Blüte der Jahre – ob er dreiunddreißig oder fünfunddreißig Lenze zählte, er wußte es selbst nicht so genau – und war bisher gottlob von schweren Schicksalsschlägen und Krankheiten verschont geblieben. Mit seiner tüchtigen Frau hatte er drei prächtige Söhne durch strenge Winter und Hungerszeiten gebracht. Er war nie dem Schlachtenlärm gefolgt, weder freiwillig noch gezwungen, und verlangte auch nicht danach. Sein Vater hatte ihn früh ins Flößerhandwerk eingeführt. Es war ein ehrbares Gewerbe, das zwar keine Reichtümer einbrachte, aber seinen Mann trotz wetter- und krisenbedingter Ausfälle redlich nährte. Zusammen mit der Mitgift seiner Frau hatte es gereicht, einen Flecken Erde beim Markt Wolfratshausen zu erstehen, dessen bescheidene Gaben genügten, um keine allzu große Not aufkommen zu lassen. Und seine Behausung war immerhin besser als die wackeligen und strohgedeckten Hütten der ärmeren Bauersleut und Tagelöhner. Zusammen mit einem befreundeten Zimmerer hatte er dreiseitig behauene Fichten im Blockbau aufeinandergeschichtet zu einem standfesten Geviert, an zwei Seiten etwas überhöht zu einem kleinen Giebel. Auf einem stabilen Gerüst von Firstpfette, Rafen und Querlatten waren Schindeln aus haltbarem Lärchenholz überlappend ausgelegt und mit großen Feldsteinen beschwert. Als Fensteröffnungen dienten schmale, aus dem Balken gestemmte Schlitze, die je nach Witterung mit Fellen verhängt oder ganz abgedichtet wurden. Im Inneren sorgten Zwischenwände aus Flechtwerk und ein eingezogener Dachboden für Raumaufteilung, so daß auch die Lagerung der Feld- und Gartenfrüchte und im Winter die Unterbringung des Viehs möglich waren. Ein offener Herd brachte bescheidene Behaglichkeit, solange er nicht durch beißenden Rauch die Familie an den Rand des Erstickungstodes trieb. Die Behausung war klein, aber ordentlich und sein eigen, worüber Jakob berechtigten Stolz verspürte.
Um die dritte Stunde des Tages erreichte er das Augustiner-Chorherrenstift Beuerberg. Die Söhne Otto, Eberhard und Konrad von Iringsburg hatten es einst als Sühne für ihren Vater gestiftet, der im Investiturstreit als treuer Gefolgsmann des Kaisers unter den Bannfluch des Papstes gefallen war. Jakob kehrte in der Klosterschenke ein, um sich mit einem Becher Wein zu erfrischen und einen Bissen zu sich zu nehmen. Während des Mahles kam ihm in den Sinn, daß wohl so manches Kloster seine Entstehung einer Sühneleistung verdankte. Hatte nicht auch der Vater des jetzigen Königs nach der Bluttat an seinem Weibe zu Fürstenfeld beim Markte Bruck ein Kloster gestiftet? Er überlegte, ob das Ausmaß der Sühne in einem Verhältnis zur Abscheulichkeit des Verbrechens stand oder nach Rang und Vermögen des Missetäters bemessen wurde. Wahrscheinlich beides, denn sonst käme manch Großer bei leerer Kasse glimpflich davon, während andererseits doch der Fürsten Verfehlungen als besonders verwerflich gelten mußten. Und in gewisser Weise waren sie das auch, denn hatte sie nicht der Allmächtige zu seinen weltlichen Vertretern auf Erden bestimmt und damit zu untadeligem Lebenswandel und besonderem Vorbild verpflichtet? Aber schon David und Salomon waren ja in all ihrer Pracht und Herrlichkeit auch große Sünder vor dem Herrn gewesen, und die Heilige Schrift räumte in weiser Erkenntnis ein: »Der Geist ist zwar willig, doch das Fleisch ist schwach.«
Jakob fragte sich, was man von einem wie ihm wohl als Sühne verlangen könnte. Zumindest die Forderungen weltlicher Gerichtsbarkeit hatte er ja ums Haar schon am eigenen Leibe erfahren müssen. Nein, er wollte die ihm bemessene Zeit auf Erden lieber rechtschaffen verbringen, wie er es bisher versucht hatte und wie es ihm seiner Meinung nach auch leidlich gelungen war. Freilich, wenn man einem der immer häufiger anzutreffenden Bußprediger ins Netz ging, die das große Strafgericht erflehten und Armageddon ankündigten, dann mochte sich auch der Frömmste noch für einen verdammten Sündenkrüppel halten, der dereinst, anstatt das immerwährende himmlische Mahl zu genießen, nur die von Luzifer vorgeworfenen Knochen abnagen durfte. Mit dieser Vorstellung verschwand auch Jakobs Appetit, und er machte sich wieder auf den Weg.
Obwohl er schon seit Tagesanbruch auf den Beinen war, verspürte er keinerlei Müdigkeit. Im Gegenteil, die kurze Rast hatte ihn erfrischt, und er fühlte sich leicht und beschwingt. Wahrscheinlich war es der Wein, der die drückende Stimmung des Morgens und dunkle Ahnungen vertrieb. Zumindest wenn das Sprichwort »Sauer macht lustig« zutraf, tat der Wein unzweifelhaft seine Wirkung. Oder sollte es schon die Kraft des Karfunkels sein? Jakob griff mit der Hand nach dem Amulett. Er lächelte, dachte an Lies und fühlte sich merkwürdig sicher. Was sollte ihm schon widerfahren? Er kannte den Weg und die rechten Herbergen, ging zwielichtigen Situationen aus dem Weg, so gut er konnte, und wenn es wirklich einmal sein mußte, dann konnte er schon mal kräftig hinlangen, obwohl er gewiß kein Raufbold war. Zu holen gab es nichts bei ihm. In der Geldkatz, die er um den Bauch trug, waren ein paar Pfennige fürs Trinken und ein Nachtlager bei schwerem Wetter sowie für die Bezahlung der Floßknechte. Die Ladung mußte er einfach nur übernehmen, kein Geld vorstrecken, und seinen Lohn würde er ohnehin erst nach zuverlässiger Ankunft in München bekommen. Der Rucksack enthielt neben ein paar Holzkeilen und einem Seil, einem Mantel und einem trockenen Hemd zum Wechseln kaum Brauchbares. Freilich wurden schon arme Teufel für weniger umgebracht.
Jakob wollte die gute Stimmung nicht schon wieder in Düsternis verkehren und versuchte daher, sich angenehme Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen oder sich Vorfreuden auszumalen. Wenn er weiter so ausschritt und durch nichts aufgehalten würde, dann könnte er am frühen Nachmittag Benediktbeuern erreichen. Im fernen Dunst konnte er schon die schroffen Felsen und dunklen Tannenwälder der majestätisch aufragenden Wand ausmachen, die zu Ehren des heiligen Benedikt seinen Namen trug. Unweit davon erhob sich das Kloster, eines der ältesten und ehrwürdigsten in diesem Raum. Auch die Mönche lebten nach der Regel des großen Ordensgründers: Ora et labora – bet und arbeite! Sie befolgten dies, indem sie neben den vorgeschriebenen Stundengebeten weite Gebiete des Loisachtales rodeten und urbar machten und dörfliche Siedlungen und Kirchen errichteten. Im Scriptorium des Klosters entstanden wertvolle Handschriften, in der Schule wurden die Söhne der Vornehmen und manchmal auch begabte Bauernburschen der Umgebung unterrichtet, im Garten wurde mit Kräutern und Feldfrüchten experimentiert, um die Heilkunst zu fördern und die Erträge des Bodens zu verbessern.
Die Kirche war nach dem Einsturz der alten Basilika in der neuen, noch ungewohnten Bauart errichtet worden mit einer hohen, lichtdurchfluteten Halle, schlanken Pfeilern und spitzbogigen Fensterrahmen. Jakob war jedesmal aufs neue in Bann geschlagen und konnte sich kaum satt sehen am Reichtum der schmückenden und belehrenden Figuren, freute sich aber noch aus einem anderen Grund auf diesen Ort der Erbauung. Denn in und um Benediktbeuern war oft wundersame Musik zu hören. Nicht nur die Ehrfurcht gebietenden, von andächtigen Stimmen getragenen Choräle der Mönche bei Meßfeiern und Stundengebeten, die ihm jedesmal einen frommen Schauer über den Rücken jagten, hatten es ihm angetan, sondern vor allem die frechen Lieder, die man in der Schenke von Laingruben neben dem Kloster oder in den nahen Dörfern von Zeit zu Zeit hören konnte. Sie handelten von Minne und Liebesleid, von Bettlern und Spielleuten, von Trinkspielen und derben Streichen, von Glück und Vergänglichkeit. Sie priesen überschwenglich den Frühling, besangen die Arbeit des Landmannes, stellten satirisch die Welt auf den Kopf und spiegelten überschäumende Daseinsfreude wider. Zwar verstanden nur die wenigsten Zuhörer den Wortlaut der Verse, denn sie waren überwiegend lateinisch verfaßt. Aber die Musik war so mitreißend und die Sänger und Spielleute ließen durch kurze Erklärungen, lebhafte Mimik und Gesten einen so lebendigen Bilderreigen entstehen, daß jedermann die Handlung verstand und lachend und schenkelklopfend folgen konnte. Nicht, daß nun die Mönche die frivolen Verse ersonnen und erdichtet hätten – Gott bewahre! Aber sie hatten sie gesammelt und aufgezeichnet. Es hieß, der selige Abt Ortolf selbst habe vom Konzil in Lyon eine reiche Sammlung von Versen in der Tradition der südfranzösischen Troubadours mitgebracht, und die Mönche hätten diese nach und nach mit heimischen Gesängen und Singspielen ergänzt.
Es war ein merkwürdiges Zusammenwirken: Frivole Lieder von Vaganten und Spielleuten, die zu den unehrenhaften und oft geschmähten Gruppen der Bevölkerung zählten, wurden von ehrenwerten und heiligmäßigen Mönchen gesammelt und bewahrt. Vielleicht baute der Abt darauf, daß auch der größere Teil seiner Brüder nur eingeschränkt des Lateinischen mächtig war. Und wie viele aufrichtige Schreiber mochten tatsächlich sogar die Weisheiten des Aristoteles Buchstabe für Buchstabe kopieren, ohne auch nur ein Wort davon zu verstehen. Vielleicht war es auch nur eine seltene Haltung von bewundernswerter Toleranz, getreu dem Worte des Herrn im Gleichnis vom Sämann: »Laßt beides wachsen bis zur Ernte, damit ihr nicht, wenn ihr das Unkraut sammelt, mit ihm zugleich den Weizen herausreißt!« Jedenfalls mochte es um eine Schöpfung, in der das Sündhafte neben dem Heiligen existieren durfte, bis daß dereinst der Herr selbst und nicht schon zuvor seine eifernden Knechte es voneinander schieden, nicht gar zu schlecht bestellt sein.
Jakob verließ die Landstraße, die nach Südwesten abzweigte und folgte einem schmalen Pfad entlang der Loisach, bis er an eine Stelle kam, an der ihn ein alter Fischer nach gehörigem Zureden für einen Obolus übersetzte. Von dort aus hatte er nur noch eine knappe Wegstunde bis zum Kloster. Es war ein Umweg, aber Jakob nahm in gerne in Kauf um der Verlockungen willen, die der Ort für ihn bereithielt.
Zwischen der Sext und der Non erreichte er schließlich Benediktbeuern und begab sich am Bruder Pförtner vorbei als erstes in die Kirche, wo er eine Weile stille Andacht und innere Zwiesprache hielt, dem Herrn dankte und sich seinem Schutz für den weiteren Weg empfahl.
Der Hunger ließ sich allmählich nicht mehr unterdrücken. Dieser leiblichen Aufforderung wollte er jetzt gerne Folge leisten und lenkte seine Schritte zielstrebig zum Gästehaus, wo der Bruder Hospitarius ihm sogleich einen Teller Graupensuppe und einen Becher Wein vorsetzte und sich danach wieder zurückzog. Der junge asketische Mönch wirkte ein wenig streng und selbstgerecht, ganz so, als ob er eisern die Regel befolgte.
Jakob hielt während des Essens eifrig Ausschau. Er hoffte und freute sich auf eine Begegnung mit Bruder Franziskus. Die beiden kannten sich von klein auf und hatten im Dreieck zwischen Isar und Loisach manchen Schabernack getrieben. Franziskus hatte es in seiner Klosterkarriere zum Amt des Cellerars gebracht, das er nun mit Leib und Seele ausfüllte. Der heilige Benedikt hatte um die Fallstricke auf dem Weg zu innerer Läuterung wohl gewußt und daher in seiner Regel vorgeschrieben, der Inhaber dieses Amtes dürfe nicht überheblichen Wesens und nicht der Eß- und Trunksucht verfallen sein, dürfe nicht knausern, aber auch nicht verschwenderisch sein. Franziskus bemühte sich nach Kräften um die Einhaltung der Regel. Doch wer vermag stets einem hohen Ideal gerecht zu werden, es sei denn, er wandle schon zu Lebzeiten auf dem schmalen Pfad der Heiligkeit.
Und so hatte das Cingulum, das über der gewaltigen Wölbung des Leibes den schwarzen Habit des Bendiktiners zusammenhielt, fast die Funktion eines eisernen Reifens. Würde Franziskus dereinst im Keller bei der Ausübung seines Amtes vom Schlag getroffen werden, dann konnte man ihn prima vista für ein umgefallenes Weinfaß halten und seiner Abwesenheit erst zur Komplet gewahr werden.
Franziskus war es auch, der Jakob von den herrlichen Bildern in der Liedersammlung erzählt hatte. Sie war zwar selbst dem Mönch nicht offen zugänglich und aus wohlweislichen Gründen die meiste Zeit unter Verschluß gehalten. Aber eine Extraration Speck und Käse hatte ihm einmal einen kurzen Blick in die prächtige Handschrift beschert. Von all den feinen Zeichnungen, golddurchwirkten Initialen und bunten Rankenornamenten hatte sich ihm besonders eine Abbildung des großen Glücksrads nachhaltig eingeprägt. Göttin Fortuna thronte als Herrscherin im Zentrum eines mächtigen Rades und hielt dieses immerwährend in Schwung. Linksseitig wurden, an Rad und Speichen geklammert, Jünglinge und Männer nach oben getragen, wo die Gestalt eines Herrschers saß. Auf der rechten Seite ging es bereits wieder steil hinab, für manchen ein jäher Sturz. Und unten fiel eine Figur vom Rad, Opfer des wankelmütigen Glücks. Obwohl nie gesehen, kannte auch Jakob dieses Bild sehr genau, denn die Prediger schilderten es häufig in flammenden Reden, um damit Stolz und Hochmut der Menschheit zu geißeln und an die Vergänglichkeit zu erinnern: Sic transit gloria mundi! – So vergeht die Herrlichkeit der Welt!
Wie viele Kaufleute, durch Wagemut, Glück und häufig auch Wucher zu Reichtum gelangt, wurden darob stolz und hartherzig und protzten schamlos mit ihren Gütern, um dann oft durch einen einzigen Mißerfolg oder die Laune Fortunas – die Prediger nannten es freilich Gottes Vorsehung und Strafe – alles wieder zu verlieren. Oder die jungen Männer, die im Dienste eines weltlichen Herrn durch Tapferkeit und Kühnheit aufstiegen und zu Ansehen und Ehren gelangten, die dann machtbesessen und grausam wurden und in ihrer Verblendung die mörderische Intrige übersahen, die sie ihren Platz und nicht selten auch das Leben kostete.
Aber mit einem wie Jakob hatte dies nichts zu tun. Sein und aller kleiner Leute Leben verlief gleichförmig, eingebettet in den Rhythmus der Jahreszeiten und das Wechselspiel der Natur. Und doch, auch bescheidenes Dasein und Glück mochten ein jähes Ende erfahren. Wußte der Landmann im Frühjahr bei der Aussaat, ob er reiche Ernte einfahren oder ob ihm Blitz- und Hagelschlag Hunger bescheren würden? Wußte der Reisende, ob er wohlbehalten ans Ziel gelangen oder unterwegs den Räubern in die Hände fallen sollte? Und wußte schließlich Jakob, wenn er morgens frohgemut aufbrach, ob ihm nicht schon mittags ein nasses Grab beschieden sein würde? Nein, in dieser Hinsicht waren sie alle gleich: Ritter und Kaufmann, Handwerker und Bauer.
»Ja, der Jakob, so eine Freud’. Gott zum Gruß!« schallte es plötzlich durchs Gästehaus.
Der Flößer sah von seiner Suppe auf und schaute in das runde, gutmütige Gesicht von Bruder Franziskus, das durch die verantwortungsvolle Aufgabe des Weinkostens und die Anstrengung, die seine Leibesfülle mit sich brachte, kräftig gerötet war.
»Ich hab’ schon befürchtet, heute wird’s nichts«, erwiderte Jakob, »und den knochigen Heiligen, den wollt’ ich nicht nach dir fragen.«
Der Mönch lachte schallend, während er seine massige Gestalt auf die Bank fallen ließ. »Du meinst Bruder Tobias. Ja, der ist ein Muster an Pflichterfüllung und will als Jüngling schon schaffen, wozu unsereinem wahrscheinlich das ganze Leben nicht reicht. Dafür versteht er nichts von Speis und Trank. Und es wär’ doch auch eine abscheuliche Sünd’, aus den Gaben des Herrn nichts Rechtes zu machen.«
Plötzlich kam Leben in die bedächtigen Bewegungen des Mönchs. Er beugte sich fast verschwörerisch über den Tisch, winkte sein Gegenüber näher heran und offenbarte ihm verschmitzt: »Du, Jakob, ich hab’ was Besonderes für dich. Mußt es unbedingt probieren. Wart einen Augenblick.«
Er verschwand fast im Laufschritt und obwohl etwas tapsig, behende wie ein Wiesel. Bruder Tobias nutzte einstweilen die Gelegenheit, wie eine entrückte Gestalt aus dem Chor der Seligen durch den Raum zu gleiten. Nur der Gesichtsausdruck hatte noch nichts von jener überirdischen Abgeklärtheit, die fern aller leidenschaftlicher Regungen über den Dingen steht, und seine säuerliche Miene brachte deutlich die Mißbilligung über das Schwatzen der Freunde zum Ausdruck.
Kurz darauf kehrte Franziskus zurück und stellte einen großen Humpen mit frischem Bier vor ihn hin. »Da, probier!«
Während Jakob ein paar Schlucke nahm und sie genießerisch zwischen den Backen hin und her spülte, bevor er sie durch die Kehle laufen ließ, hing Franziskus förmlich an seinen Lippen und fragte ganz aufgeregt: »Und, was sagst?«
»Vorzüglich, guter Freund! Wenn das der Papst bekäme, dann würd’ er’s zum Fasten gar erlauben.«
Der klösterliche Braumeister strahlte, und Jakob, der wußte, wie stolz sein Freund auf seinen kräftigen, dunkelbraunen Sud war, mit dem er immer wieder experimentierte, hätte das Lob auch ausgesprochen, wenn er statt dessen Galle getrunken hätte.
»Ich geb’ jetzt etwas mehr Hopfen dazu. Das macht das Bier haltbarer und nicht ganz so süß. Aber ich red’ nur von mir und mit unchristlichem Stolz. Sag, wie geht es deiner Lies und den Kindern?«
»Dank dir. Die Buben gedeihen prächtig. Der älteste schnitzt mir schon immer die Hackerpfeil zum Länden und will unbedingt auch Flößer werden. Und die Lies wird jeden Tag hübscher. Aber sie macht sich zuviel Sorgen. Alleweil plagen sie irgendwelche Ahnungen und Träume und lassen sie dann nicht mehr los. Ich hab’ manchmal Angst, daß der Gram sie nicht alt werden läßt. Und ich brauch’ sie so sehr und natürlich auch die Kinder.«
»Jetzt bist du selber schon ganz trübsinnig. Trink noch einen Schluck, wird dir guttun. Weißt du, wenn die Lies nicht so gottesfürchtig wär, dann tät’s mich auch sorgen. Aber so, es ist oft auch eine große Gnad’ vom Herrn, zu ahnen, was er in seiner Weisheit Ratschluß für uns bereithält. Manche ahnen es ja nicht einmal, wenn’s schon passiert ist. Und glaub mir, Jakob, der Herr gibt uns auch die nötige Kraft und lädt einem nicht mehr auf, als man tragen kann.«
»Schon recht, Franziskus. Du und dein süffiges Bier, ihr könnt einen schon aufrichten. Aber ich muß weiter und will heut noch bis in die Näh’ von Murnau. Was hört man denn so von den Straßen in der Gegend und im Freisingischen? Ist’s ruhig oder muß man sich vorsehen?«
»Bis Murnau bist du allemal sicher. Die Gerichtsbarkeit unseres Herrn Abtes ist wirksam, und die Herren von Lichteneck am Riegsee, die sind unserem Kloster gewogen. Es gibt neuerdings gar einen Vertrag, daß ihre und des Klosters Leibeigene heiraten dürfen. Geh zum Seifried, dem Torfstecher. Das ist ein kreuzbraver Mann und steht in unseren Diensten. Bei ihm kannst du sicher und für Gotteslohn übernachten. Und vom Werdenfelser Land des Bischofs, da hab’ ich zuletzt weder Gutes noch Schlechtes gehört. Die Zeiten scheinen ruhig zu sein oder des Herren Fluten haben in den letzten Wochen auch das Gesindel weggespült.«
Der Mönch stand auf, um trotz Jakobs halbherziger Proteste den Krug noch einmal zu füllen.
Als er zurückkehrte, wirkte auch er etwas nachdenklich und berichtete ergänzend: »Mir kam gerade in den Sinn, was vor ein paar Tagen ein fahrender Ritter bei seiner kurzen Rast hier im Kloster erzählte. Er witterte Schlachtenglück und befand sich auf dem Weg nach München, um König Ludwig seine Dienste anzubieten. Zuvor hatte er bis Garmisch einen Kaufmannszug geleitet, der aus dem Welschland über Scharnitz Gewürze und allerlei kostbaren Tand herbeischaffte, um sie nach Augsburg weiter zu transportieren. Auf dem Weg durch Tirol hat er immer wieder Gerüchte aufgeschnappt, die Österreicher würden jetzt endlich die Entscheidung suchen. Leopold, der Haudegen, weil ihn der unbefriedigte Haß auf Ludwig zu zerfressen droht, und Friedrich, weil er befürchtet, daß die ungezählten Verpfändungen und finanziellen Verpflichtungen das Haus Habsburg bald in den Ruin stürzen werden. Die beiden haben zwar mit ihrer prunkvollen Doppelhochzeit nach der Königswahl und der dabei zur Schau gestellten Pracht das Volk geblendet, aber das Schauspiel lief gewissermaßen schon auf Pump. Man erzählt sich, daß die Gemahlin Friedrichs, Isabella von Aragonien, kurz darauf ihr gesamtes spanisches Gefolge bis auf eine Hofdame zurückschicken und sogar ihren persönlichen Beichtvater entlassen mußte. Wie muß es um ein Haus bestellt sein, das beim Seelenheil anfängt, den Gürtel enger zu schnallen? Und jetzt, so munkelt man, gedenken die feinen Brüder, den Herrn Ludwig endlich auszuschalten, dem Schönling Friedrich die Krone zu sichern und sich am Bayernland schadlos zu halten, wofür, wie wir alle wissen, das Volk wieder bluten muß. Der Friedrich soll einen Zug entlang der Donau vorbereiten und dann wahrscheinlich wieder einen Haufen Ungarn mit sich führen, diese leibhaftigen Teufel, während Leopold angeblich in den Stammlanden ein Aufgebot sammelt und aus dem Schwäbischen vorzudringen gedenkt. Dann wird’s bald wieder Mord und Totschlag geben. Ich glaub’ zwar nicht, daß der Krieg auch in unseren friedlichen Winkel vordringen wird, aber München, Jakob, München könnte es schon erwischen, und dann gibt’s auch für die Flößerei Probleme. Aber ich will dir keine Angst machen und geh’ jetzt lieber, um für den Seifried ein Päckchen zu richten.«
Sollte an den Gerüchten doch etwas dran sein? Jakob fiel wieder ein, daß man in diesem Jahr schon mehrere Flöße auf der Isar mit Mann und Ladung als verschollen gemeldet hatte. Nun kam es freilich fast jedes Jahr vor, daß sich der wilde Gebirgsfluß ein oder mehrere Opfer holte. Aber irgend etwas war dabei immer noch angespült worden, sei es Ferg oder Styrer, zerschmettert oder grad noch lebendig, seien es schwimmende Fässer oder die auseinandergerissenen Floßbäume selber. Aber bei den besagten Unglücken war nichts mehr aufgetaucht, so als hätte der gefräßige Fluß alles hinabgezogen und verschlungen. Es war wie verhext und gab natürlich Anlaß zu Gerüchten, die von altem Aberglauben bis zu bösen Verdächtigungen reichten. An Flußgeister wurde erinnert und daran, daß man vor nicht allzu langer Zeit diesen noch geopfert habe. Und weil dies jetzt die Pfaffen bei Androhung von Höllenqualen verboten, müßten sich die Flüsse eben selbst versorgen. Deshalb stiegen auch am Auffahrtstag nur Narren, Selbstmörder oder Betrunkene ins Wasser, denn jedermann wußte, daß der Fluß an diesem Tag ein Opfer verlangte. Die Münchner, über die geheimnisvollen Vorkommnisse besorgt und verärgert zugleich, warfen den Oberländern vor, sie hätten Flöße betrügerisch zurückbehalten oder gar nicht erst abgeschickt. Diese konterten erbost: »Es waren doch eure Floßleut’, die entweder besoffen oder ahnungslos waren und ihre Flöße in Grund und Boden gefahren haben.«
Zwischendurch wurden auch die Wolfratshauser verdächtigt, sie würden Flöße aufhalten und beschlagnahmen, um damit ihrem Herzog Rudolf gegenüber seinem ungeliebten Bruder in München einen Vorteil zu verschaffen. Und endlich hieß es gar, die Habsburger hätten ihre Hand im Spiel. Erst mochte Jakob dies am allerwenigsten glauben. Aber jetzt, wo die Zornbinkel wieder an Krieg dachten? Schließlich waren die Flüsse in Friedens- und Kriegszeiten wichtige Verbindungswege für Versorgung, Nachschub und Nachrichten. Und eine Residenzstadt hatte enormen Bedarf an Holz und Waren aller Art.
Franziskus riß Jakob aus seinen Überlegungen: »Ich hab’ dir eine feine Brotzeit eingepackt für dich und die Familie des Torfstechers. Grüß ihn von mir und bring ihm meinen Segen.«
Jakob erhob sich und umarmte seinen Freund zum Abschied. »Dank dir von Herzen, Franziskus. Du bist ein echter Freund geblieben. Wenn alle dem Herrgott so dienten wie du, die Welt säh’ besser aus.«
»Vorsicht, Jakob, zuviel Lob ist der Feind der Demut, und dann verfolgt mich wieder der strafende Blick des Tobias.«
Lachend verließen sie das Gästehaus, und Franziskus begleitete seinen unerwarteten Gast noch bis zur Pforte.
Jakob kehrte zur Loisach zurück, und bald hatte er die Stelle erreicht, an der die Saumtiere, die von Traunstein und Tölz her Salz und andere Kostbarkeiten weiter ins Schwäbische transportierten, die Loisach überquerten. Normalerweise gab es dort eine Furt, aber in diesen regenreichen Tagen konnte man froh sein, wenn einen ein Fährmann für ein kleines Entgelt überholte. Oder man mußte warten, bis die Flut abgelaufen war. Jakob hatte Glück.
Der Moorboden zu beiden Seiten des Weges war durch die Regenfälle und das Übertreten der Loisach noch feuchter und schlüpfriger geworden als gewöhnlich, und manchem Wanderer erschien das sumpfige Gelände nicht recht geheuer. Jakob spürte jetzt auch deutlich die Nachwirkungen des Bieres: Die Gedanken waren zwar erleichtert, die Beine dafür um so schwerer. Er summte ein fröhlich Lied vor sich hin und zog zielstrebig seines Weges, wobei er das lebhafte Spiel der Wolken aufmerksam beobachtete, die sich mittlerweile wieder ungestüm übereinander türmten, als müßten sie sich um die besten Plätze auf ihrer wilden Fahrt gen Osten raufen. Und nicht lange darauf gossen die eifrigsten zuvorderst auch schon ihr Wasser aus, um noch schneller und leichter im Wettstreit zu sein. Glücklicherweise unterließen sie es, ihren Spaß noch mit Blitz und Donner zu erhöhen, so daß Jakob sich einfach in seinen Mantel hüllte, den Hut fest in die Stirn zog und unverdrossen weitermarschierte.
Am frühen Abend erreichte er das Murnauer Moos, und schon die zweite, schilfgedeckte Hütte erwies sich als die richtige. Seifried und seine Frau baten Jakob freundlich herein, wobei sie sich entschuldigten, daß sie ihm außer einem Strohlager und einer kargen Mahlzeit kaum etwas bieten konnten.