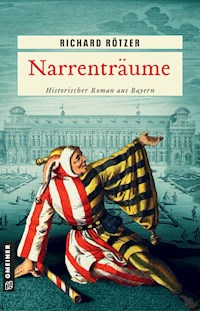
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michel Witz träumt von einem Leben als Hofnarr, wie es sein Vater führt. Es gelingt ihm, eine Anstellung am fürstlichen Renaissancehof Herzog Wilhelms zu erhalten. Dieser feiert erst auf Burg Trausnitz in Landshut rauschende Feste und fördert später in München Künste und Jesuiten. So kommt es unweigerlich zur finanziellen Katastrophe. Um den Bankrott zu verhindern, lässt sich Wilhelm mit dubiosen Goldmachern ein, und Michel versucht es sogar mit Magie. Am Ende landet er unter dem Vorwurf der Zauberei im Gefängnis und muss um sein Leben fürchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Rötzer
Narrenträume
Historischer Roman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buch_-_Erlustierend_Augenweide_-_Diesel_-1015.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1500-1550,_German._-_065_-_Costumes_of_All_Nations_(1882).JPG
Gemälde Beginn: Der Münchner Hofnarr Mertl Witz, Inv.-Nr. L 77/330, Foto Nr. D28233; Leihgabe des Historischen Vereins von Oberbayern © Bayerisches Nationalmuseum München
ISBN 978-3-8392-7392-0
Widmung
Gewidmet allen ernsthaften Narren und heiteren Melancholikern
Der Hofnarr Mertl Witz
Hofnarr Mertl Witz
Hans Mielich 1545
Zitate
»Wenn wir geboren werden, weinen wir, dass wir die große Narrenbühne der Welt betreten müssen.«
Shakespeare: König Lear
*
»Den Narren zu spielen, und das geschickt, erfordert ein’gen Witz:
Die Launen derer, über die er scherzt, die Zeiten und Personen muss er kennen,
und wie der Falk auf jede Feder schießen, die ihm vors Auge kommt.
Das ist ein Handwerk so voll Arbeit als des Weisen Kunst,
denn Torheit, weislich angebracht ist Witz,
doch wozu ist des Weisen Torheit nütz?«
Shakespeare: Was ihr wollt.
Erstes Kapitel
Die Nacht war grauenvoll. Und genau genommen war es noch immer Nacht, denn in das finstere Loch drang von außen kein Lichtstrahl, es sei denn, die Klappe in der eisenbeschlagenen Türe wurde für einen Augenblick geöffnet, um eine dünne Brühe und trockenes Brot zu reichen. Unter der Türe fiel ein handbreiter Schimmer herein, solange die Fackel im Vorraum brannte. Und wenn in quälend langen Abständen die Türe aufgestoßen wurde, dann bedeutete dies nur, dass die Schergen einen armen Tropf in die jetzt schon überfüllte Keuche stopften oder einen der Insassen zum Verhör zerrten oder gar zur Folter.
Ich hatte bereits jegliches Zeitgefühl verloren und mir taten sämtliche Glieder weh, dabei war ich nicht einmal angekettet. Das Liegen wurde zur Qual, nicht nur wegen des feuchten und kalten Bodens, sondern wegen der drangvollen Enge. Bald stieß mir der Leinweber von links das Knie in die Rippen, bald wurde die Strohschütt feucht, weil einer der Umliegenden unter sich gelassen hatte, sei es aus Angst oder Notdurft. Der einzige Luxus dieser Herberge war ein rostiger Kübel, den in der Dunkelheit zu finden und nicht umzustoßen ein Glücksspiel war.
Ich kauerte an der rauen Wand in der Hocke, den Kopf auf die Arme gelegt, und versuchte, den üblen Gestank von Angstschweiß, Urin und Erbrochenem zu ignorieren und die Schreie und das Stöhnen der armen Teufel, die schon durch die Folter gegangen waren, so gut es ging auszublenden.
Das Schlimmste von allem aber war die Ungewissheit. Was überhaupt würde man uns zur Last legen, und was würde die Strafe sein? Schon Fluchen konnte einem ja in diesen Tagen zum Verhängnis werden.
Ich fragte mich, ob es Vor- oder Nachteil war, dass ich nicht mehr im herzoglichen Dienst stand, denn als Angehöriger des Hofs unterläge ich jetzt nicht städtischer Gerichtsbarkeit. Man hätte mich nicht hier in der Keuche unter dem Rathaus einsperren können, sondern vermutlich nur im Falkenturm nahe der herzoglichen Residenz.
Doch andererseits bedeutete die Inhaftierung im Falkenturm meist die Anschuldigung des Hochverrats oder der Hexerei, und das ging in der Regel nicht gut aus.
Mein Leben zog in Gedanken an mir vorbei in teils prachtvollen, teils düsteren Bildern. Ich hatte als Narr am Hof des bayerischen Herzogs viele Freiheiten gehabt, nahm Teil an rauschenden Festen, hatte zu jeder Zeit Münzen in der Tasche und fand ein gewisses Ansehen und Beachtung. Aber ich war auch beteiligt an Ränkespielen und Intrigen und jagte in eitler Selbstgefälligkeit vielen Dingen vergeblich nach. Auf der verblendeten Suche nach trügerischem Narrengold war ich augenblicklich dem Henker näher als erhofftem Ruhm und Erfolg. Sollte dies nun das schäbige Ende sein?
Es war alles ganz schnell gegangen. Montags – es war ein Maientag – hatte ich noch in guter Erfüllung meiner Christenpflicht in Sankt Peter die Pfingstmesse gehört, tags darauf forderten die Schergen ungestüm Einlass in das Haus des Prokurators Alexander Secundus Freisinger …
Doch gemach und alles der Reihe nach.
Es ist erst wenige Monate her, da hatte ich genug von all dem Blenden mit hohlen Worten und Lügen, war meines elenden Daseins überdrüssig und dachte ans Sterben. Und das im Heiligen Jahr – welch böser Witz!
Papst Clemens hatte es in Rom und aller Welt mit großem Pomp verkündet, doch es verlief genau so erbärmlich wie der Zeiten Lauf davor. Wenn einer in diesem Gnadenjahr 1600 nach Christi Geburt sein irdisches Dasein rechtschaffen beende, so war die vollmundige Verheißung, dürfe er sogleich an der ewig währenden himmlischen Jubelfeier mit Christus dem Herrn teilnehmen. Doch mir war diese Gnade offensichtlich nicht beschieden – ich bin verdammt zum Leben.
Als die aufgeblasene Zeitenwende zu Ende ging, verblieb zwar in Rom die Fülle der gespendeten Dukaten, in mir dagegen nur die Leere meines unseligen Daseins. Ich will aber nicht ungerecht klagen, und keiner soll sagen, Michel Witz, Sohn des Mertl Witz und ehemals fürstlicher Narr in Ehren und Brot, könne sich wegen seines persönlichen Grams nicht mehr ergötzen an den Absonderlichkeiten menschlicher Natur im Allgemeinen und der von Gott bestellten Obrigkeiten im Besonderen.
An einem schönen Februartag dieses Heiligen Jahres gaben sich beispielsweise die Römer alle Mühe, dem neuen Säkulum mit einer lebenden Fackel den rechten Glanz zu verleihen, indem sie den lästigen Mahner Giordano Bruno auf dem Campo di Fiori zu Asche verbrannten. Er mag ein trotziger Wirrkopf gewesen sein, aber ich stimme seiner Vermutung zu, dass die Welt und die Menschheit ein einmaliger Unfall sind. Untröstlich finde ich allerdings seine Vorstellung, dass das Weltall unendlich sei, weil dann ja auch der Himmel keinen gebührenden Platz darin fände, was selbst mir der Narretei zu viel erscheint.
Und in der hiesigen Residenzstadt München setzte man jüngst ebenfalls ein leuchtendes Zeichen, indem der Henker und seine Knechte am Festtag der heiligen Martha die landfahrende Familie der Pappenheimer aufs Grausamste hinschlachteten, nachdem eifernde Hofräte sie unerbittlich der Hexerei beschuldigt hatten.
»Seht ihr nicht die Zeichen, die sich mehren«, schallt es von den Kanzeln. »Der Allmächtige wendet sich von seiner Schöpfung ab und ihre Tage sind gezählt, denn kein Jahrhundert zuvor hat solche Fülle an Mirakeln und monströsen Abnormitäten gesehen, seien es Schweifsterne, blutiger Regen, Verfinsterung der Gestirne oder Erdbeben, Fluten und missgestaltete Homunculi.«
Die Sternkundigen und Unheilspropheten hatten vor Jahren schon eine große Konjunktion der Planeten Mars, Jupiter und Saturn im feurigen Dreieck angekündigt und gedroht: »Sie wird das letzte große Feuer entzünden, mit dem der Allmächtige die Welt verbrennt.«
Es muss ein elend schwaches Flämmchen gewesen sein, denn als einzig beklagenswert erinnere ich nur die maßlose Verteuerung von Brot und Bier. Überhaupt will mir scheinen, dass es mit den Weissagungen oft sehr wunderlich zugeht, denn unter einer großen Konjunktion wurde schließlich auch Christus geboren und Karl der Große gekrönt, und ein anderes Mal schwemmte die große Sintflut das Menschengeschlecht hinweg. Es ist also merkwürdig unbestimmt, ob das Wirbeln der Gestirne zum Guten oder zum Schlechten ausschlägt.
Dagegen besteht kein Zweifel, dass die Schöpfung ihrem Verfall durch schleichende Altersschwäche entgegengeht, verspüre ich’s doch schmerzlich am eigenen Leib.
»Seht doch«, mahnen die Sterndeuter, »die Sonne scheint oft blutrot und öfter noch ungewöhnlich trüb. Die Gestirne verlieren zusehends ihren Glanz und ihr klares Licht. Das Himmelsgewölbe ist kurz vor dem Einsturz.«
Man könne die Schwäche der Schöpfung auch daran erkennen, dass im goldenen Zeitalter das Leben der Menschen noch tausend Jahre währte, was die Genesis für Adam und Methusalem bezeugt. Dagegen sei die Lebensspanne in unseren Tagen kaum noch auf fünfzig oder sechzig Winter bemessen.
So sitze ich also hier an der Schwelle meines sechsten Jahrzehnts, matt in den Gliedern, müde im Geist. Ein kostbarer Ring als Erbstück meines Vaters reichte eben hin, um mich als einfachen Pfründner im Heilig-Geist-Spital einzukaufen. Während einstmals eine weitläufige Residenz mein Reich war, friste ich nun mein karges Dasein in einer winzigen Zelle und hoffe, nicht eines Tages in der Narrenkeuche zu enden, aus der die Schreie der Armen im Geiste, die elend in Ketten und auf Stroh gehalten werden, zu mir herüberdringen. Ihren Wahnsinn kann auch die Heilkraft der Nieswurz nicht mehr kurieren.
Ich mühe mich deshalb, selbst in tiefster Verzweiflung nicht der lähmenden Schwermut Acedia zu verfallen, der Todsünde wider den Heiligen Geist, durch die die Mönche in ihren winzigen Zellen jegliche Lust nach Betätigung verlieren und damit auch das Verlangen nach dem Himmelreich.
Aber ist es verwunderlich, dass einen inmitten all der Siechen hier Traurigkeit überfällt, wenn statt Orlando di Lassos Wohlklängen nur schauerliches Gebrüll und Wehklagen an das Ohr dringen, wenn statt erfrischender Stegreifkomödie nur noch die lahme Litanei von Furunkel und Zipperlein aufgeführt wird und wenn einen ohne die genialen Fresken von Meister Sustris die Wände nur noch kahl und grau anglotzen?
Bis zum Herbst vor gut drei Jahren war ich am Hof wohlgelitten. Doch dann entsagte Herzog Wilhelm der Regierung und zog sich frömmelnd aufs Altenteil zurück. Ob ihn die erdrückende Schuldenlast, seine Schwermut oder die Einflüsterungen der Jesuiten dazu drängten – mir ist’s egal. Auf sein nobles Weihnachtsgeschenk ist jedenfalls gepfiffen, denn am 23. Dezember 1597 wurde Wilhelms Sohn Maximilian mit dem bayerischen Herzogtum belehnt, und der ist von gänzlich anderer Wesensart. Mit ihm fand die fröhliche Narretei am fürstlichen Hof ein jähes Ende. Dafür blüht sie jetzt umso üppiger im ganzen Land, freilich trist und sauertöpfisch von der Obrigkeit verordnet, denn fortan muss ein jeder beim Türkenläuten wieder niederknien zum Gebet, schon Fluchen kann ein Stelldichein mit dem Henker bewirken, und zur Fastnacht wurde jüngst selbst die lustige und unschuldige Mummerei wieder verboten.
Wenn ich es recht bedenke, liegt meinem Elend und Überdruss am Leben kein körperliches Gebrechen zugrunde, und die Schwäche an Leib und Gliedern ließe sich mit etwas Speck in der Kohlsuppe und knusprig gebratenem Huhn leicht kurieren. Es scheint mir mehr ein Übermaß an schwarzer Galle, ein schädliches Ungleichgewicht meiner Körpersäfte, so verdrießlich aufs Gemüt zu schlagen. Dagegen wächst kaum ein Kraut, und die Quacksalber sollen mir mit ihren Aderlässen und der üblen Purgiererei vom Leib bleiben.
Als mein eigener Arzt komme ich zu dem Schluss: Es ist Melancholie, die mir die Welt verdüstert, aber gewiss nicht wegen meiner Sünden oder Laster. Von der dreifach möglichen Kausalität, nämlich im Hirn, im Herzen oder als Leiden des Bauches, ist sie bei mir unstrittig im Herzen lokalisiert. Sie ist einzig und allein der Freudlosigkeit zuzuschreiben, denn eine Störung meines Geistes ist gänzlich ausgeschlossen.
Schon der weise Aristoteles hatte vermutet, dass das innerste Wesen des Melancholikers eng mit geistiger Genialität verknüpft ist. Sie gilt gewissermaßen als Krankheit der Gelehrten, die auf der Suche nach dem Weltsinn durch beharrliches Zweifeln und unentwegtes Hinterfragen oftmals im Gegensatz zur Meinung all derer stehen, die im Gleichklang der Herde leben. Ja, dieses Außenseitertum und Löcken wider den Stachel ist auch mir seit Kindestagen wohl vertraut.
Wenn nun das Herz durch Traurigkeit in eine Art Nebel und Dunkelheit gehüllt ist, dann entsteht daraus auch häufig Zorn. Und wenn dieser sich nicht in Verblendung und sündhaftem Wüten gegen sich selbst und andere austobt, können einem daraus Kraft und ein taugliches Heilmittel gegen den Trübsinn erwachsen.
Eines Tages fiel mir in meiner Düsternis plötzlich der Hofratssekretär Aegidius Albertinus ein, ein sprachgewaltiger Homo litteratus, den der Herzog wenige Jahre zuvor in seinen Dienst genommen hatte. Ich bin dem spitzbärtigen Niederländer in der Kanzlei oder bei festlichen Anlässen ein paar Mal begegnet. Er sammelt wunderliche Geschichten und kann muntere Schnurren erzählen. Als Mann von Welt erkannte er natürlich, dass auch ich die Erfahrungen etlicher Reisen und Erlebnisse am Hof in mir trage und daher über einen reichen Schatz an Geschichten verfüge.
»Ihr seid mir ein wackerer Mann mit Witz und Geist«, sagte er bei unserer letzten Begegnung und ermunterte mich augenzwinkernd: »Schreibt alles auf, um auch die Nachwelt damit zu ergötzen.«
Mir erschien dies mit einem Mal als weiser Ratschlag, um meine Langeweile und Schwermut zu bekämpfen. Und mag es auch der Nachwelt wenig nützen, so könnte es zumindest meinen Kohl etwas fetter machen.
So griff ich also mit frischem Mut zur Feder, um meine Erlebnisse, Gedanken und Erinnerungen diesen Seiten anzuvertrauen …
Zweites Kapitel
Obwohl seit meiner damaligen Verhaftung fast drei Jahre vergangen sind, habe ich noch immer den Gestank von Pisse und schwärenden Wunden in der Nase, und dies hat nichts mit meiner augenblicklichen Wohnstatt im Spital zu tun. Nachts schrecke ich häufig vom Lager hoch, geweckt durch schlimme Träume, in denen ich das Wimmern der Gefolterten höre oder das Geschrei des verurteilten Totschlägers, der an seinen Ketten zerrt … dem kräftigen Kleinschmied, der im Suff sein zänkisches Weib erschlagen hatte, war erst der Strick bestimmt worden, dann aber hatte sich das hohe Gericht des einträglichen Handels mit dem Tod erinnert und ihn zur condemnatio ad triremes begnadigt. Seit den Seegefechten gegen Türken und Piraten zahlten die Stadtstaaten am Meer gutes Geld für Galeerensträflinge. Nun wartete der jähzornige Witwer auf den Abtransport nach Venedig oder Genua mit anderen Unglücklichen, die man wegen Trunk- und Spielsucht, Gotteslästerung oder Kirchenraubs für drei oder mehr Jahre zur christlichen Seefahrt verurteilt hatte.
Durch Erzählungen italienischer Handwerker am Hof wusste ich, dass die großen Dreiruderer zwar elegant und schnell übers Meer glitten, in ihren Bäuchen aber herrschte das Grauen. Man konnte in christlichen Landen also auch zur Hölle begnadigt werden.
Wie aber war es zu meiner eigenen Verhaftung gekommen?
Herzog Wilhelm, mein gnädiger Fürst, hatte wenigstens die ersten Jahre seiner Hofhaltung auf Schloss Trausnitz in Landshut noch unbeschwert als lebensfroher Prinz in Saus und Braus verbracht, ehe er später aus mancherlei Gründen zum bußfertigen Frömmler wurde.
Bei seinem Sohn Maximilian bedurfte es einer solchen Wandlung nicht, denn er geriet von klein auf in die Fänge der Jesuiten, und wo nicht diese ihn lenkten, da taten es die Instruktionen des Vaters, die den Knaben in jesuitischem Geist zu mönchischer Zucht und Askese anhielten. Dazu gehörte auch, dass seine Erzieher Gaukler, Springer und Schalksnarren – also einen wie mich – von ihm fernhalten sollten.
So verwundert es nicht, dass der gestrenge junge Herr, der schon als Knabe schrecklich erwachsen war, gleich in den ersten Tagen seiner Regierung ein gallebitteres Religions- und Sittenmandat veröffentlichen ließ. Es wäre fast leichter und gewiss kürzer zu schildern, was ab sofort nicht verboten war. Die eigenen Bürger durften nicht mehr ausheiraten an Orte mit lutherischer Gesinnung, und keiner sollte ungestraft das Land verlassen, um in reformierten Kirchen Predigern zu lauschen. Umgekehrt sollte kein auswärtiger Sektierer in München das Bürgerrecht erhalten, und insbesondere Wiedertäufer wurden erneut gnadenlos bis in den Tod verfolgt.
Schon Wilhelm hatte als gottgefälliges Zeichen bei seinem Regierungsantritt das Frauenhaus am Anger schließen lassen, und unlängst wurden nun auch noch die Hübschlerinnen bei Unseres Herrn Tor, das gegen Schwabing gerichtet ist, vertrieben. Es sollte künftig zur Hebung allgemeiner Sittlichkeit strengstens gegen Unzucht und Leichtfertigkeit vorgegangen werden. Als leichtfertig gilt in diesen Tagen bereits einer, der ohne kirchlichen Segen und gefüllte Geldkatze in ehelicher Gemeinschaft lebt. Aber da Handwerksburschen ohne Vermögen nicht heiraten dürfen, bleibt ihnen folglich nur heimliches Ausschwitzen ihrer Lust, gefährliches Einlassen mit einer Winkelhure oder eben die erwünschte Enthaltsamkeit. Jede anständige Frau, die bei Dunkelheit noch allein in der Stadt unterwegs ist, kann jetzt schuldlos in den Ruch der Unzucht und Ehrlosigkeit geraten.
Natürlich ergehen all die Anordnungen des Fürsten nur in christlicher Sorge um das Gemeinwohl, denn jedermann sollte doch wissen, dass die Lasterhaftigkeit den Allmächtigen erzürnt, der dafür dem Volk Strafen auferlegt, wie die Pest, die lutherische Seuche, Dürre und Krieg oder das Wüten des Türken. Merkwürdig ist nur, dass hier stets zweierlei Maß gilt.
Unser junger Fürst, der sich hierzulande um die Sittsamkeit sorgt und sich und ganz München in quälende Askese zwingt, hat einen hochnoblen Oheim, der in Köln auf Ehre und Enthaltsamkeit – verzeiht – scheißt. Herzog Ernst, Wilhelms jüngster Bruder, vereint wider die Gesetze des Konzils von Trient fünf Bischofssitze und neun Domherrenstellen auf sich, gibt sich aber äußerst ungeniert der Spiel- und Trunksucht und ausgedehnter Jagdleidenschaft hin und erfreut sich des Müßiggangs mit seiner Konkubine, mit der er katholische Bastarde in die Welt setzt. Gepriesen sei der Herr!
Unter den vielen Bildnissen, mit denen italienische Künstler Wände und Decken auf Burg Trausnitz verziert hatten, war auch die Figur eines seltsamen Jünglings, der nur mit Lendentuch und einem Stück Pelz bekleidet war, am ganzen Körper dagegen unzählige Augen und Ohren aufwies. Es war die mythische Gestalt des Argus, von dessen Augen immer nur ein Teil schlief, während die anderen wachten. Das Bild stellte die Allegorie von Wachsamkeit und Verschwiegenheit dar und sollte zum Ausdruck bringen, dass der tugendhafte Fürst allzeit zum Wohle seines Volkes fürsorglich über das Land wacht.
Heute erscheint mir die Allegorie gänzlich unpassend, denn die gepriesene Wachsamkeit entartet zunehmend in üble Spitzelei, und das gegängelte Volk würde sich liebend gern dieser erdrückenden Fürsorge um das Seelenheil jedes Einzelnen entziehen.
Herr Harmlos schleicht nämlich durch die Stadt und ihre Wirtsstuben und rennt flugs zur Obrigkeit, wenn er irgendwo eine Übertretung des Fastengebots erspäht. Geheime Kundschafter und Spione sind überall unterwegs, die jedermann überprüfen in puncto Unzucht und Leichtfertigkeit, und wenn dich eine dieser Schnüffelnasen beim Fluchen erwischt, darf sie deinen Beutel auf der Stelle um sechs Kreuzer erleichtern, und du kannst ein Ave Maria singen, wenn es damit abgeht. Und wenn Ihr denkt, Ihr könntet Euch mit Eurem Liebchen ungestört in den Wald oder eine Scheune zurückziehen, dann wird Euch gewiss ein Förster oder Überreiter aufstöbern, der das Land nach Wiedertäufern absucht.
Was nun in meinem Fall den Ausschlag für die Verhaftung gab, könnte die strenge Zensur gewesen sein, denn es wurden eigens Agenten ernannt, die gezielt und unangekündigt Häuser und Buchläden durchstöbern, um ketzerische Schriften oder Zauberbücher aufzuspüren und zu konfiszieren und den Eigentümer natürlich gleich mit. Im Haus des Prokurators Alexander Secundus Freisinger fanden die Häscher reiche Beute.
Zugegeben, es war nicht die vornehmste Gegend drunten im Tal, noch vor Katzenbach und Kaltentor gelegen, wo auch ärmliche Weber und Loderer hausten, aber das Haus des Prokurators war geräumig, und er ließ mich günstig zur Miete wohnen. Er tat dies nicht aus Mildtätigkeit, sondern weil er sich in anderer Weise Vorteile von mir versprach. Eines Tages kam er im Wirtshaus »Zum Großdamischen« am Markt auf mich zu, als ich eben in das Experiment vertieft war, meinen Trübsinn in reichlich Weingeist aufzulösen. Er unterstützte meinen Wissensdurst mit einem weiteren Krug und forschte mich nebenbei über meine Zeit am Hof aus. Dabei schienen ihn vor allem Berichte über das geheimnisvolle Wirken der Alchemisten zu interessieren. Mag sein, dass ich dabei mit gelöster Zunge und reichlich dämlich – passend zum Namen des Lokals – bei der Erwähnung meiner Lateinkenntnisse eine Spur übertrieb. Jedenfalls war der Prokurator von meinen Fertigkeiten angetan, und da er als öffentlicher Notar und Vorsprech bei Gericht mit regem Schriftverkehr zu tun hatte und nebenbei hinter okkulten und meist schwer zu enträtselnden Berichten aller Art her war, bot er mir eine günstige Unterkunft an und den einen oder anderen Gulden dafür, dass ich ihm in seiner Schreibstube und bei Übersetzungen zur Hand ginge. Da dies allemal besser war, als sich auf dem Markt als Tagelöhner anzubieten, willigte ich ein.
Erst nach und nach begriff ich, auf was ich mich eingelassen hatte. Nicht wegen des Lateins, aber der Prokurator war nicht nur in theoria an geheimen Schriften interessiert, sondern auch an deren Erprobung in praxi. Er verfügte über ein kleines Labor, und soweit sich seine Neigung auf Schriften des Paracelsus und Erkenntnisse der Alchemie erstreckte, deckte sie sich mit meinen Interessen. Aber der Freisinger hatte auch einen Hang zu düsterer Nigromantie und Geisterbeschwörung sowie anderen obskuren Beschäftigungen, und bei ihm traf sich regelmäßig eine bunte Schar Suchender, die unterschiedlicher nicht hätte sein können.
Am ehesten noch hatten die beiden Schulmeister Sinn und Verständnis für die tiefgründige Schönheit alchemischer Texte. Der alte Arnhofer aber, seines Zeichens Bildhauer, kam einfach nicht über den Tod seines Weibes hinweg. Ob ihm ihr Gezänk oder nur die warmen Mahlzeiten fehlten, blieb offen, aber er war mit zwei verschrobenen Witwen vor allem daran interessiert, die Geister der Verstorbenen zu rufen. Der vierschrötige Ringler wiederum und der abergläubische Hosenstricker, der die eigenen Hosen beizeiten gestrichen voll hatte, witterten stets Machenschaften gegen sich, ihr Gewerbe und das Abendland im Allgemeinen, und sie drängten daher auf das Ansegnen wider den bösen Feind, von dem sie sich in Gestalt des Juden, Protestanten oder auch nur missgünstigen Nachbarn umringt wähnten.
Fast möchte ich’s verschweigen, dass auch ein zwielichtiger Wund- und Brecharzt nebst dem Schlechhuber Jörg und seinem Sohn, beide Abdecker und unschicklich rohe Gesellen, vor Jahresfrist zu der Gruppe gestoßen waren. Andererseits hatte es den Vorteil, dass über ihre Nähe zum Henker leichter an Knochen, Schädel und andere brauchbare Utensilien zu gelangen war. Die zwei Loderer und der armselige Leinweber Haberle waren in erster Linie an der Aufstockung ihrer kümmerlichen Barschaft interessiert, und zusammen mit dem Kornrührer und dem Schäftelmacher, Metzger im Tal, hatten die Büttel sie nächtens bei verbotener Schatzgräberei in Hesselohe erwischt.
Die Schrägste von allen aber war die schwarze Kristlin – schwarz waren das ungekämmte Gestrüpp auf dem Kopf, die Glutaugen, der Hals, die löchrigen Lumpen am dürren Gestell, die Fingernägel, ihre Füße und Zähne – kurz: einfach alles an ihr. Sie verhökerte Kräuter, diverse Tränklein, Kröteneier und dergleichen und prahlte damit, sowohl die Zukunft weissagen als auch verlorene oder gestohlene Gegenstände wiederbeschaffen zu können. Dazu ließ sie mit den anderen in der Stube im oberen Stockwerk des Freisinger das Sieb laufen und betrieb allerlei zweifelhaften Hokuspokus. Sie würde man, wenn nicht jetzt, dann gewiss zu einem anderen Zeitpunkt der Hexerei bezichtigen.
Solange dies alles im Verborgenen geschah, mochte es angehen, aber das verrückte Weib hatte die schlichteren Geister innerhalb der Gruppe dazu angestiftet, draußen beim Galgenberg oder drunten in der Au sich im Kreise stehend bei den Händen zu fassen und öffentlich Beschwörungsrituale aufzuführen. Ebenso gut hätte man die Knechte des Stadtgerichts in die gute Stube bitten können.
Die Anzeige war aber auch dem hinterhältigen Fuhrunternehmer im Nachbarhaus zuzutrauen, der längst ein Auge auf die Räumlichkeiten des Prokurators geworfen hatte, um darin für auswärtige Fuhrleute Schlafräume mit Gasterei einrichten zu können. Wir würden es nie erfahren, denn Denunzianten war Anonymität zugesichert.
Das greifbare und überaus beunruhigende Faktum aber war, dass unser bunter Haufen augenblicklich auf Kosten der Stadt München zu Gast beim Schlegel oder Eisenmeister im Stadtgefängnis logierte.
In das Geheule und Schluchzen der Frauen, die man in eine eigene Keuche nebenan gepfercht hatte, mischte sich das Stöhnen des bereits verurteilten Galeerensträflings, das murmelnde Gebetsleiern des Hosenstrickers, das leise Fluchen der Abdecker …
»Du wirst uns doch raushauen, Narr«, versuchte der Kornrührer ganz pragmatisch sich und den anderen Mut zu verschaffen, während es der Prokurator Alexander Secundus Freisinger mit Gelehrtheit versuchte: »Sie können uns nichts anhaben«, versicherte er gewichtig und vor allem sich selbst, »denn nach dem Perneder-Kommentar zur Halsgerichtsordnung ist nur zu strafen, wer anderen mittels der schwarzen Kunst Schaden zufügt und …«
»Hätt der Schlechhuber, der Holzklotz, aber nicht so grob hinlangen dürfen«, unterbrach ihn einer der Schulmeister vorwurfsvoll.
»Ich geb dir gleich eine, du Tintenschmierer!«, wehrte sich der Abdecker. »Ich war bei der Goldgräberei gar nicht dabei.«
»Aber übers Ohr gehauen hat man den Pfeffersack allemal«, beharrte der Schulmeister spitz.
»Haltet doch alle das Maul!«, warf der Metzger ein. »Was soll das Juristengeschwätz? Der Narr hat doch Beziehungen zum Hof, oder?«
Es gab Zeiten, da klang »Narr« für mich wie eine Auszeichnung. Aber jetzt, da ich nicht mehr am Hof war, klang es einfach nur wie »närrisch« im Sinne von »dümmlich«, und so fühlte ich mich in diesem Augenblick auch. Ich war mir keineswegs sicher, ob mein Wort noch Gewicht hätte. Vielleicht würde man mich nicht einmal mehr zum Herzog vorlassen, geschweige denn anhören. Und selbst wenn: Würde die Gnade des Fürsten mich, uns retten?
Zu deutlich und schmerzlich hatte ich das Schicksal der Regina Pollinger vor Augen, der ehemals treuen Haushälterin des Hans Jakob Fugger, die mir so manche Süßigkeit zugesteckt hatte. Sie mag mit den Jahren und insbesondere nach dem Tod ihres Dienstherrn etwas wunderlich geworden sein, aber keinesfalls war sie eine Unholdin. Als vor nunmehr etwa zehn Jahren das Wüten der Obrigkeit gegen die Hexen oder vielmehr bedauernswerte Weibspersonen, die man dafür hielt, begonnen hatte, da geriet auch sie durch gehässige Anschuldigungen in die Mühlen der Justiz. Obwohl der Fugger einst bei Hof hochgeachtet war, erschöpfte sich die fürstliche Gnade darin, dass man die alte Frau und ihre Leidensgenossinnen nicht lebend dem Feuer überließ, sondern erst erwürgte, ehe man ihre Körper zu Asche verbrannte.
Ich fragte mich schon damals, ob göttliche Gnade auch darin bestünde, dass man unter Verzicht auf das Fegefeuer ohne Umschweife den direkten Weg in die ewige Verdammnis nähme.
Dergestalt in Angst und Ungewissheit verharrend, ergriffen wir jeden Strohhalm, der sich uns bot. Die Frau des Eisenmeisters erwarb sich zwar keine Verdienste durch ihre Kochkünste, war aber eine Spur leutseliger als ihr knorriges Ehegespons und die ruppigen Schergen. Als sie nach einer Ewigkeit wieder einmal ihre köstliche Wassersuppe durch die Türöffnung schob, bestürmten wir sie mit Fragen. Ihre dürftige Mitteilung, dass die Obrigkeit der Angelegenheit größte Aufmerksamkeit widme und der Rat daher eigens eine größere Kommission einberufen habe, um mit dem geschworenen Gericht die Vorfälle zu untersuchen, war nicht dazu angetan, uns in irgendeiner Weise zu ermutigen.
Als bei ihrer Aufzählung der Ratsherren ganz nebenbei auch der Name Andreas Ligsalz fiel, da erstarrte ich und hatte die schreckliche Gewissheit, nun für all meine Sünden zu büßen.
Drittes Kapitel
Die Vornehmheit erstreckt sich dieser Tage schon sehr weit nach unten, und jeder Pfeffersack, der sich ein ansehnliches Vermögen erhandelt oder ergaunert hat, giert nach dem Adelsbrief, mit dem er fortan auf einem Landgut herumstolziert und Bauern drangsaliert.
Wenn mich Neugierige nach meiner Herkunft fragten, prahlte ich daher gern damit, dass sie von meines Vaters Seite adelig und meine Mutter gar eine Königin war, denn was könnte Regina – so ihr wohlklingender Name – schon anderes bedeuten. Dies bedurfte freilich einer feinsinnigen Präzisierung, denn meines Vaters Adel war mehr ein Adel der Gesinnung, der Preis einer ehrlichen Haut und gediegenen Könnens: Er war Hofnarr mit Leib und Seele.
Wie sehr dies sein Herr, Herzog Wilhelm IV., der Großvater meines Fürsten, zu schätzen wusste, mag daraus erhellen, dass er, als er seinen Sohn und Thronfolger Albrecht von Meister Mielich porträtieren ließ, auch ein Bildnis meines Vaters in Auftrag gab, das ihn als fürstlichen Narren zeigt, in Gestus und nobler Haltung ein Ebenbild des Prinzen.
Derart ansehnlich und bei Hof in Ehren wollte man meinen, es sei für ihn ein Leichtes gewesen, die passende Jungfer zur Zweisamkeit zu finden, denn sofern einer nicht einfältig, Mönch oder Kleriker ist, gilt es als höchst betrüblich und wider die Natur, sein Leben als einsamer Hagestolz zu verbringen.
Meine Mutter Regina war als Nachkömmling die jüngste Tochter des reichen und vornehmen Kaufmanns Hans Ligsalz und seiner zweiten Gattin aus dem Salzburgischen.
Mag sich der sittsame Bürger noch so sehr an derben Scherzen oder obszönen Fastnachtsspielen ergötzen, seine Tochter oder Schwester einem Spielmann oder gar einem Narren an die Hand geben, das will er keinesfalls.
Wie also ging es zu, dass ein Hofnarr eine Bürgerstochter aus der hoch angesehenen Familie der Ligsalz zu München ehelichen konnte?
Es wird mir nicht gleich die Inquisition an den Hals gehen, wenn ich behaupte, dass selbst des Allmächtigen herrliche Schöpfung nicht ohne jeglichen Makel ist. Und so hatte noch jedes Geschlecht und jede Familie in der Zeiten Lauf einen Makel, einen Fehltritt oder ein schwarzes Schaf aufzuweisen.
Die Ligsalz hätten in der Reihe ihrer Ahnen einen Geköpften zu bieten, durften sich in manchem Jahr des höchsten Vermögens in der Stadt rühmen, das dann ein Nachfahre durch Spekulation und Ungeschick wieder in den Sand setzte, und sie führten die irrwitzige Komödie auf, dass ein Teil der Großfamilie den lutherischen Verheißungen erlag, während die andere Hälfte den Papisten treu die Stange hielt. Potztausend, sie hätten einen Narrenorden verdient!
Ob es nun göttlichem Ratschluss vor oder dem missglückten Ziehen einer ungeschickten Hebamme bei der Geburt zuzuschreiben war, jedenfalls war das zierliche und ansonsten überaus hübsche Mädchen Regina von Geburt an mit einem Klumpfuß geschlagen, den zwar der lange Rock zu verbergen wusste, nicht aber ihr eigentümlich schaukelnder Gang. Und wie der Kaufmann nicht den Narren zum Schwiegersohn will, so will er auch keine Hinkende als Gattin, selbst um den Preis einer stattlichen Mitgift nicht.
Wenige Zeit vor den Gemälden des Thronfolgers und meines Vaters porträtierte Hans Mielich den älteren Bruder Reginas, den Kaufherrn Andreas Ligsalz. Regina, die bis dahin nicht an den Mann zu bringen war, stand nach dem frühen Tod des Vaters unter seiner Kuratel und der seiner herrischen Ehefrau. In deren Gefolge lernte mein Vater sie eines Tages in der Werkstatt des Malers kennen, und sie waren sich in der Gemeinsamkeit ihres Andersseins sogleich zugetan.
Andreas Ligsalz, einer der wohlhabendsten Kaufleute der Stadt, spuckte erst Gift, und seiner Gattin schäumte die Galle, aber wie eine alte Wahrheit lautet: Hochmut kommt vor dem Fall, denn etwa zwanzig Jahre später ging der reiche Kaufherr in Konkurs und verstarb bald darauf, und nochmals zehn Jahre danach hatte sich seine Witwe beim großen Religionsverhör zu verantworten. Doch davon später.
Mertl der Narr jedenfalls führte nach Jahren beharrlichen Werbens, heimlicher Stelldicheins und einem Machtwort des Herzogs seine Königin in die Ehe und entdeckte dabei ein süßes Geheimnis, von dem schon die alten Philosophen und Heilkundigen Kenntnis hatten, denn sie wussten, dass die Schenkel der Hinkenden infolge der Erlahmung nicht mehr die volle Nahrung erhielten, die somit den darüber liegenden Geschlechtsteilen zufloss, sodass diese, umso voller entwickelt und in Verbindung mit der wiegenden Bewegung, dem Liebeswerk einen ungewöhnlichen und wollüstigen Reiz vermittelten.
Rechnet man die Zeit der Reifung im Mutterleib vom Tag der Geburt an zurück, so muss meine Zeugung in den heiligen Tagen der Weihnachtszeit erfolgt sein, die zwar nach alten Mythen durch Öffnung zur Anderswelt reichlich Gefahren enthielt, nach katholischem Brauch aber manches Verbot, insbesondere des Beischlafs an Feiertagen. Doch mag die Übertretung des Gebotes auch sündhaft gewesen sein, so kann ich immerhin mit Gewissheit behaupten, dass ich die Frucht reiner Liebe und freudigen Genusses bin.
Mein Vater wohnte auch nach der Heirat die meiste Zeit am Hof, um jederzeit dem Ruf seines Dienstherrn Folge zu leisten. Zwar schätzte der Herzog durchaus grobe Späße, lärmendes Kindergeschrei zählte jedoch weniger dazu. Meine Mutter behielt daher ihre Kammer im Hause des Bruders am Rindermarkt, und so hatte ich anstelle des Vaters die meiste Zeit das Vergnügen mit einem übellaunigen Oheim, der mich für nicht standesgemäß und eine ägyptische Plage seines Alters hielt.
Obwohl das Haus der Ligsalz zu den stattlichsten Bürgerhäusern am vornehmen Rindermarkt zählte, herrschte darin oft drangvolle Enge. Dort wohnte nämlich nicht nur der alte Andreas mit seiner Familie, auch Brüder des Alten hatten noch Wohnrecht, und die unteren Räume dienten als Lager und Kontor, denn die Ligsalz trieben Handel mit Eisen, Tuch und Salz und tätigten Geldgeschäfte in aller Welt.
Mehr noch als die Enge schlug mir jedoch die Wesensart meiner Mitbewohner aufs Gemüt. Einzig mit meinem Vetter Karl kam ich glänzend aus. Er war zwar aufbrausend und ungestüm, jedoch jederzeit zu einem Streich bereit. So war es folgerichtig, dass er Soldat wurde und eines Tages für Kaiser und Reich im Kampf gegen die Osmanen in Ungarn ins Gras biss.
Über den missgünstigen Alten und sein hochnäsiges Weib will ich an dieser Stelle kein Wort mehr verlieren. Wohl aber über Vetter Hans, den ältesten der vier Söhne. Dass er bei Tisch gewöhnlich raunzte, wenn es Fastenspeisen statt Fleisch gab, weil dies nur ein widersinniges Gebot des großen Ketzers in Rom sei, das mochte ja noch angehen, aber dass er unermüdlich davon sprach, es müsse bei der Messe auch den Laien der Kelch gereicht werden, das verstand ich nicht und noch weniger, dass der Teufel los war, als ich in kindlicher Einfalt einmal vorschlug, er möge doch einfach zu Hause oder in der Wirtsstube genügend Wein trinken.
Im Gegensatz zu seiner Maulerei hatte er bei jeder unpassenden Gelegenheit einen frommen Spruch auf den Lippen. Merkwürdig war nur, dass man ihm und seiner Brut nur selten sonntags bei der Messe in St. Peter begegnete und er den Kirchgang entweder nicht oder andernorts ausübte. Er war vermutlich auch dabei, als lutherisch Gesinnte in der Augustinerkirche die Predigt störten und vor der Kanzel ihr Kampflied anstimmten, das der Herr Luther wider die Erzfeinde Christi unters Volk gebracht hatte: »Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steuer des Papstes und Türken Mord!«
Der Schlimmste von allen aber war Vetter Andre: Nie einen Flecken auf der Hose, nie Pflaumenmus am Ärmel, nie heimlich vom Honig genascht, bei Tisch keine schwarzen Finger und zu jeder Minute des Tages brav gescheitelt. Er wurde schon mit Halskrause und spanischer Tracht geboren, und so hätte man ihn auch ausstopfen sollen als Muster an Tugend und Vorbild für missratene Söhne wie mich.
Andre war ein paar Jahre älter als ich und besuchte ebenfalls die Poetenschule bei Unserer Lieben Frau. Und da mein Heimweg nie schnurstracks nach Hause verlief, sondern vorbei an Schustern und Sporern, Wirten und Krämern sowie unzähligen Fuhrleuten, die alle aufregende Neuigkeiten zu berichten wussten, waren meine Schulstreiche schon bekannt und lag der Stock schon bereit, noch ehe ich den Hausflur betrat. Ich hasste meinen Vetter wie die Pest, er mich vermutlich auch. Zu meinem Glück wurde der Tugendbold bald nach dem Aufruhr in der Augustinerkirche als Artium studiosus an die Universität in Ingolstadt geschickt …
Ratsherr Andre Ligsalz, Bürgermeister und Mitglied der Kommission, dröhnte es in meinem Kopf. Wir hatten uns viele Jahre lang aus den Augen verloren, und jetzt sollte mein vorbildlicher, strebsamer, selbstgerechter und mir verhasster Vetter über mein Schicksal mitentscheiden. Ich tastete mich im Dunkeln an den rostigen Kübel heran …
Bevor ich in Trübsinn versinken konnte, waren aus dem Vorraum die Tritte schwerer Stiefel zu hören. Gleich darauf wurde die Türe aufgestoßen und der Eisenmeister rief uns der Reihe nach heraus. Uns wurden keine Ketten angelegt, aber an Flucht war auch so nicht zu denken. Sechs Bewaffnete eskortierten uns unter Führung des Ratsknechts ins Obergeschoss, um uns dort dem Stadtgericht vorzuführen.
Als sich meine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten und ich mich im Saal etwas umschauen konnte, durchfuhr es mich wie ein Blitz: Am Tisch der Ratsherren neben dem Richter saß sauber herausgeputzt der Erzlangweiler und Tugendwächter – mein Vetter Andre.
Ich hätte augenblicklich nicht einmal sagen können, welchen Tag wohl der Unterrichter Michael Mändl, der zugleich Gerichtsschreiber war, mit gespitzter Feder auf seinem Protokollbogen vermerkte. Nur eines war gewiss, dass er zuoberst das Kürzel »IHS« kritzelte. Es stand für Jesus, denn seines Beistands wollte man sich bei der Wahrheitsfindung versichern, sei sie freiwillig oder notfalls erzwungen. Die Buchstabenfolge zierte allerdings auch das Richtschwert zur Rechtfertigung der Hinrichtung in Christi Namen.
Dienstags hatten sie mich und den Prokurator in das Loch gestopft zu den schon etwas abgehangenen Schulmeistern und Abdeckern. In der Nacht gesellten sich dann die glorreichen Schatzgräber dazu, und den anderen Tag über folgten die restlichen traurigen Gestalten. Danach war nur noch Warten und Bangen.
Ich meinte zu wissen, dass für gewöhnlich dienstags und freitags Gerichtstag war, und die Verhandlung in der Regel Schlag zwölf Uhr mittags begann. Aber trotz der vielen Stunden in Dunkel- und Unwissenheit konnte es noch nicht Freitag sein. Ich entschied mich also für Donnerstagmittag, vierzehnter Mai im Jahre des Herrn 1598. Aber was spielte das schon für eine Rolle. Wesentlicher war, dass bei Erfordernis auch an anderen Tagen Gericht gehalten wurde. Demzufolge schien man unserer Angelegenheit in der Tat eine gewichtige Bedeutung beizumessen, was eher nichts Gutes verhieß.
Meine Befürchtung verstärkte sich angesichts des Aufwandes, den der Rat mit der Einberufung einer größeren Kommission betrieben hatte. Da saßen mit ernsten Mienen neben Vetter Andre noch die inneren Räte Michael Barth und Christoph Schrenck, und auf der anderen Seite wie versteinert drei ehrenwerte Mitglieder des Äußeren Rates.
In der Mitte führte pelzverbrämt den Vorsitz der edle Bernhard Barth von Harmating zu Pasenbach, durch Kaiser Rudolf in den Adelsstand erhoben und seit geraumer Zeit Stadtoberrichter der Residenzstadt München. Ihn schmückte nicht nur das Adelspatent, denn im Gegensatz zu früheren Stadtrichtern, deren Rechtsverständnis sich im besten Falle aus gesundem Menschenverstand speiste, hatte er die Universität Ingolstadt besucht und danach sogar in Siena Recht studiert.
Es musste mit meinem Beruf, wahrscheinlicher noch mit meinem innersten Wesen zusammenhängen, dass mich in kritischen Situationen oft die unpassendsten Gedanken beschlichen. Hei, dachte ich grinsend, das ist doch wie ein Familienfest. Da sitzen die Brüder Barth, daneben ein Ligsalz und ein Schrenck, die ein identisches Wappen führen, und gewiss hatte schon zu irgendeiner Zeit ein Ligsalz etwas mit einer Barth, und ein Barth knusperte an einer Schrenck, und irgendwie und übers Eck waren doch all diese Gewappelten miteinander versippt und verschwägert. Und wenngleich auch nur als schwarzes Schaf, so gehörte auch der gewesene Hofnarr Michel Witz durch seine Mutter selig zu dieser Sippschaft. Aber ehe ich in närrischer Gewohnheit lauthals und leichtfertig »Verehrung die Herren!« in die noble Runde plärren konnte, riss mich der Ruf des Gerichtsdieners in die Wirklichkeit zurück.
»Stille!«, gebot er entschieden, und gleich darauf verkündete der Vorsprech des Gerichts in seiner Rolle als Ankläger den Gegenstand der Verhandlung. Es war zwar erst das untersuchende Gericht, das mittels Verhör und notfalls peinlicher Befragung den Sachverhalt klären sollte, ehe nach erhaltenem Geständnis das erkennende Gericht bei der Malefiz-Verhandlung das Urteil sprach, aber schon mit den Worten des Vorsprechs verging mir jäh das Lachen, denn da war wiederholt von Zauberei die Rede und schließlich gar von Teufelspakt. Da hatte der Spaß ein gewaltiges Loch.
Ich hatte noch gut den Fall eines Nachbarn vor ein, zwei Jahren in Erinnerung. Ihn hatten sie für ein paar Tage im Turm festgesetzt, und danach musste er einen Beichtzettel beibringen und eine Bestätigung der Patres, dass er gut katholisch das Abendmahl empfangen habe. Man hatte ihm den Besitz ketzerischer Schriften und Bücher vorgehalten – also die verbotenen Machwerke Luthers und anderer Sektierer. Dagegen konnte doch der Besitz von Büchern, die lediglich für Eingeweihte die Geheimnisse des großen alchemischen Werks der Transmutation festhielten oder von harmlosen Zaubersprüchen jahrhundertealter magischer Riten berichteten, nicht ins Gewicht fallen.
Jedermann wusste, dass sich die Mehrheit des Volkes keinen teuren Arzt leisten konnte und deshalb gegen die Krankheiten Zuflucht zu Zaubersprüchen und Amuletten nahm, dass die Bauern Vieh und Ernte durch magische Bräuche zu schützen und selbst Pfaffen mit Flurumgängen und Wettersegen das Unheil zu bannen versuchten. Und wurden nicht landauf, landab auf Wallfahrtsmärkten geweihte Sprüche als Amulette oder heilendes Wasser für klingende Münze vertrieben, um vor Krankheit, Vergiftung und Hagelschlag zu bewahren? Es kam doch nur darauf an, dass man die Dinge zum Nutzen und nicht zum Schaden gebrauchte. Was sollte daran plötzlich falsch sein? Was hatte dies mit dem Teufel zu tun?
Der vorgeschriebenen Verhandlungsordnung folgend wurden erst einmal die Namen der Inquisiten festgehalten und – soweit vorhanden – Wohnsitz und Profession. An zwei Stellen kam etwas Bewegung in die stoischen Mienen der Untersucher: Als der Name Alexander Secundus Freisinger fiel und sein Beruf zu Gehör kam, verzogen die vornehmen Herren säuerlich und gequält die Gesichter, als wollten sie sagen: »Traurig, traurig! Wie einer so tief sinken kann.« Die Bezeichnung Hofnarr und meines Vaters Name wiederum bewirkten, dass die Mundwinkel nach oben schnellten, und der Stadtoberrichter ließ sich zu einem bedeutungsschwangeren »Soso« hinreißen.
Es war eine dieser unwürdigen Gelegenheiten, wo andere sich über etwas erheiterten, was ich gar nicht komisch fand. Und echte Pein bereitete mir das Verhalten von Vetter Andre. Er verzog keine Miene, schaute nicht einmal auf, geschweige denn, dass er in meine Richtung geblickt hätte. Nicht einmal ein triumphierendes Lächeln umspielte seine Lippen. War ich ihm so völlig gleichgültig oder schämte er sich so sehr für mich, mehr noch als früher? Es schien mir kein gutes Zeichen zu sein.
Als nun der Richter, wohl in der Hoffnung, die Sache eventuell verkürzen zu können, unvorsichtig die Frage in die Runde warf, ob sich einer in der mutmaßlichen Zaubergesellschaft der vorgehaltenen Verfehlungen schuldig bekenne, da war es um die Ruhe im Gerichtssaal geschehen. Eine Herde Unschuldslämmer wies zunächst lautstark jede Anschuldigung zurück und beteuerte lauterste Absichten, bis der eine oder die andere in Sorge um die eigene Haut anfing, die Anstiftung zu dieser oder jener Tat jeweils einem anderen zu unterstellen. Ich glaubte dabei wiederholt die Worte »Witz« und »Narr« herauszuhören, ehe der Gerichtsdiener auf Geheiß des Unterrichters den Tumult niederbrüllte.
Bernhard Barth kam leichthin zu der Überzeugung, dass auf diese Art weder eine halbwegs geordnete Darstellung des Sachverhalts noch auch nur ansatzweise die Wahrheit zu erzielen sei. Er ordnete deshalb mit gewichtigen Worten an, dass die Aussagen zu distinguieren und auf jede Person bezogen streng getrennt zu erheben seien, damit man am Ende der Gerechtigkeit halber auch distinkt votieren könne.
Die Vernehmung war damit für diesen Tag abrupt beendet, und die anscheinend höchst gefährliche Zaubergruppe fuhr trotz des sonnigen Maientags wieder in das stinkende Verlies im Rathauskeller ein, wo augenblicklich die gegenseitigen Beschuldigungen erneut aufflammten. Als schließlich gar Handgreiflichkeiten begannen und Schmerzensschreie ertönten, die nicht von den Schergen oder des Henkers Befragung herrührten, platzte der Eisenmeister ins Verlies und drohte, den gottlos verderbten Haufen ins Eisen zu schlagen, wenn nicht augenblicklich Ruhe herrsche. Vermutlich hätte er es liebend gern getan, denn es war sein Geschäft. Für das Ein- und Ausschließen des Häftlings erhielt er immerhin vierundzwanzig Pfennige, während das Kostgeld pro Tag nur zwölf betrug. Da war klar, dass zum Ausgleich die Einlage in der Suppe noch spärlicher ausfallen würde als gewöhnlich ohnehin schon.
Ich genoss den Augenblick der Ruhe, lehnte mich an die Wand, schloss die Augen und hing meinen Gedanken nach …
Viertes Kapitel
Während in vergangenen Zeiten noch der Grundsatz galt, ein jeder habe seinen festen Platz in des Herren Ordnung, strebt in den Wirren unserer Zeit der Pfeffersack nach dem Adelstitel und manch stolzer Ritter sinkt in den Bettelstand hernieder.
Im Handwerk jedoch gilt noch weithin, dass der Sohn geflissentlich in die Fußstapfen des Vaters tritt, dass also auch der Sohn des Fleischhauers die Würste stopft und der Spross des Fassmachers ebenfalls die Holzdauben in den Reifen zwingt.
Falls aber nun einer glaubt, die Narretei wäre mir gleichsam in die Wiege gelegt worden, geht er völlig in die Irre, denn obwohl mein Vater prächtig grimassieren konnte, schien er zu Hause nur über eine einzige griesgrämige Miene zu verfügen, die in mir zunächst nicht die Kunst des Spaßmachens weckte. Er fühlte sich unter den verächtlichen Blicken der hochfahrenden Ligsalz und in der Enge der Behausung am Rindermarkt nicht wohl. Auch deshalb wohnte er die meiste Zeit am Hof, wie schon gesagt, und ich bekam nur an wenigen Tagen im Jahr meinen übellaunigen Vater zu Gesicht.
Da also zunächst kein väterliches Vorbild die Wahl meines späteren Broterwerbs begünstigte und andererseits keine Zunftschranken meine Entwicklung in irgendeiner Weise beengten, flottierten meine Neigungen in viele Richtungen.
Einem Parzival gleich, der sofort Ritter werden wollte, nachdem er in Einfalt und kindlichem Staunen zwei Reiter in schimmernder Wehr gesehen hatte, war auch ich bald von dieser, bald von jener Profession augenblicklich begeistert.
Es war an einem lauen Frühlingstag, als ich knapp vierjährig an der Hand meiner Mutter am Rathaus vorbei durch die Burggasse zappelte. Kurz vor dem Torturm der alten Herzogsresidenz steht zur Linken ein wuchtiges Haus mit großen Butzenscheibenfenstern. Die zwei Halbgiebel an den Außenrändern des Satteldaches nennen die Münchner liebevoll »Ohrwaschel«, als sei das Haus trotz der wuchtigen Steinquader ein lebendiges Wesen.
Der Rat hatte erst vor Kurzem das Gebäude von einem Patrizier erworben, und der Stadtmaurermeister war sogleich mit dem Umbau beauftragt worden. Die oberen Räume sollten die Stadtschreiberei beherbergen, während die Kellergewölbe als Weinstadel dienten. Die Fassade war im unteren Teil schon reich bemalt, und auf anderthalb Manneshöhen stand auf einem wackeligen Gerüst ein Mann mittleren Alters, der am Kassettenfries arbeitete. Er war von gedrungener Gestalt, und was ihm an Haupthaar fehlte, ersetzte er durch einen üppigen Kinnbart.
»Das ist Meister Mielich«, klärte mich die Mutter auf, während ich interessiert seinen Pinselstrichen folgte, »er hat ein Bild deines Vaters gemalt.«
»Wo?«, fragte ich neugierig. War mir doch bis dahin das Bild vorenthalten worden.
»Es hängt in der Burg des Herzogs. Dein Vater wird es dir eines Tages sicher zeigen.«
»Will auch malen!«, rief ich keck dem Mann auf dem Gerüst zu.
Meister Mielich stutzte erst, erkannte dann aber meine Mutter, denn in seiner Werkstatt hatte sich vor Jahren meine Menschwerdung angebahnt.
»Munteres Kerlchen«, rief er ihr lachend zu. »Gerät er dem Vater nach?«
»Gott bewahre!«, stöhnte die Mutter. »Er soll die Lateinschule besuchen.«
Obwohl ich mich nur dunkel und schemenhaft an diese Szene erinnere, habe ich noch das ehrliche Entsetzen meiner Mutter vor Augen, das ich damals, weil ich es nicht anders verstand, nur mit dem Beruf meines Vaters in Verbindung bringen konnte, nicht ahnend, dass das Wort »Lateinschule« für mich den weitaus bedrohlicheren Umstand darstellte.
Meister Mielich bot mir leutselig an, ihn hier oder nach Abschluss der Arbeiten in seiner Werkstatt in der Äußeren Schwabinger Gasse zu besuchen, und ich konnte dort in den folgenden Jahren die Kunstfertigkeit des Malers noch häufig bewundern.
Die Begegnung musste mich tief beeindruckt haben, denn Mutter erzählte später lächelnd, ich hätte mich an diesem Tag nicht einmal mehr für die zahmen Löwen interessiert, die nur ein paar Schritte weiter den Zwinger vor der alten Burg durchstreiften.
Ich ging anderntags auch sogleich mit Eifer ans Werk, besorgte mir auf einer nahen Baustelle etwas Kalk und Farbe und begann – in Ermangelung eines Pinsels mit einem dürren Stecken – die Fassade am Haus des Oheims zu verschönern, bis mich eine knochige Hand am Kittel packte und von der Wand wegriss.
»Hundsfott, elendiger!«, hörte ich den Alten schnarren, ehe nur noch Ohrfeigen in meinem Gehör dröhnten.
Ich gebe gerne zu, dass ich nicht über den sicheren Strich eines Hans Mielich verfügte und mein Farbauftrag in Unkenntnis der Perspektive nicht die plastische Illusion von Steinquadern erwecken konnte. Dennoch erschien mir die jähe und schmerzliche Unterbrechung meiner künstlerischen Lehrzeit ganz und gar ungerecht. Bis heute bin ich der festen Überzeugung, dass die Fortsetzung meines Werkes dem Ligsalzhaus in der Reihe der protzigen Patrizierhäuser am Rindermarkt etwas Besonderes verliehen hätte.
Wenige Tage nach dieser Schmach begleitete ich meine Mutter zum Markt, wo für gewöhnlich reges Gedränge herrschte, doch diesmal schien es fast tumultartig zu sein, wobei die Menge nicht wütend, sondern ausgelassen wirkte. Ich zwängte mich zwischen Röcken und Beinkleidern hindurch, bis ich zuvorderst einen wunderlichen Mann sah. Er trug am Leib schäbige Kleider, um die Schultern aber hatte er einen reich bestickten Umhang gelegt, der allerdings bei näherem Hinsehen an etlichen Stellen recht fadenscheinig war und eher einer abgelegten Tischdecke von der Tafel eines Vornehmen glich, ja vielleicht gar eine entwendete Altardecke war. Sein Blick war stechend, der Bart ungepflegt, und auf dem wirren Haupthaar saß – oder besser gesagt hing eine etwas zu groß geratene Krone, die bald links, bald rechts übers Ohr rutschte. Sie schien aus Kupferblech gefertigt zu sein, glänzte im Sonnenlicht jedoch fast golden.
Barfuß und mit großen Gesten paradierte er vor der Menge. Mal grüßte und winkte er huldvoll, mal warf er stolz den Kopf in den Nacken und rief etwas in einer mir unverständlichen Sprache. Halbwüchsige ergriffen das Ende seines Umhangs und trugen ihm das Tuch wie eine Schleppe nach, während ein Witzbold ihm lachend einen Kohlkopf in die eine und eine Stange Lauch in die andere Hand drückte, gleichsam als Reichsapfel und Zepter von Mutter Natur. Und als Herrscher über das Reich verstand er sich offensichtlich auch.
»Er hält sich für den Kaiser«, riefen einige, die vorgaben, sein Geschrei wenigstens teilweise zu verstehen. Und Besserwisser behaupteten: »Er ist nicht der Kaiser, nur ein hergelaufener Schalksnarr aus dem Welschland.«
»Wer ist der Kaiser?«, fragte ich meine Mutter, und bekam zur Antwort: »Unser höchster Herr.« Den jedoch hatte man mir bis dahin nur als den Herrgott vorgestellt, und der wohnte entweder im Himmel oder in der Kirche, lief aber keinesfalls mit rabenschwarzen Füßen über den Markt.
Auch böse Stimmen wurden laut, die sich beklagten, dass mit der Bauwut des Herzogs immer mehr Fremdarbeiter aus dem Süden und Westen an den Hof zögen, die den Einheimischen Lohn und Brot wegnähmen. Und der Tropf, der hier den Kaiser und das Reich verspotte, sei in Wahrheit ein verstockter Hebräer, den man unverzüglich aus der Stadt schaffen müsse.
Das eigentlich Komische an der Geschichte war, was keiner der Marktgänger damals wusste: Während ein falscher Kaiser über den großen Markt zu München stolzierte, hockte zur selben Zeit Karl V., in dessen Reich die Sonne nicht unterging, resigniert und kränkelnd in einer Stube in Innsbruck. Eben noch hatte ihn in Augsburg Meister Tizian hoch zu Ross als stolzen Sieger über die Protestanten porträtiert, nun grübelte er über seine Abdankung nach. Er hatte sich mit Anton Fugger, seinem langjährigen Goldesel, überworfen und vor den heranrückenden Truppen der protestantischen Fürsten fliehen müssen.
Was damals weiter mit dem »Kaiser« am Markt geschah, weiß ich nicht. Ich sah ihn nie wieder, aber das Schauspiel hatte mir früh verdeutlicht, dass sich einem die Dinge nicht immer eindeutig und auf den ersten Blick klar erschlossen, dass stolze Erhabenheit und lächerlich Komisches nahe beieinanderlagen, dass die Meinungen vielfältig sein konnten, dass es zumeist ein »einerseits und andererseits« gab, ein »sowohl als auch«, was ich in späteren Jahren oft als zynische Beliebigkeit empfand. Es versetzte mich allerdings in schwierigen Situationen auch meist in die Lage, einen Ausweg zu finden und mich aus allem herauszureden …
Würde mich mein freches Mundwerk auch aus meinem jetzigen Unglück retten, grübelte ich verdüstert vor mich hin. Ich genoss nicht mehr den Schutz der Narrenkappe, unter dem ich selbst dem Herzog Frechheiten und ungeliebte Wahrheiten an den Kopf werfen konnte, ohne um meinen eigenen Kopf fürchten zu müssen. Jetzt lagen die Dinge gewaltig anders, und Wahrheit mochte sich leicht im Strick verfangen …
Keinen Ausweg fand damals mein Mundwerk vor der drohenden Lateinschule. Mir persönlich hätte es völlig gereicht, in die Schule des Lebens zu gehen, gab es doch täglich Neues zu entdecken. Aber ich räume ein, dass mir meine mühsam erworbenen Lateinkenntnisse später durchaus von Nutzen waren.
Es gab seit Langem die Pfarrschulen bei St. Peter und Unserer Lieben Frau. Ich jedoch sollte die Poetenschule besuchen, die im Unterricht anspruchsvoller und eigentlich den Kindern der Nobilitas vorbehalten war. Vielleicht verdankte ich die Ehre dem Ansehen der Ligsalz, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass mein Oheim für das höhere Schulgeld aufkommen wollte, und da ich genau genommen zu den Kindern des fürstlichen Hofgesindes zählte, war nicht nur der übliche halbe Gulden, sondern ein halbes Pfund im Vierteljahr zu entrichten. Aber darüber machte ich mir keine Gedanken.
Meine Mutter begleitete mich am ersten Schultag zu Unserer Lieben Frau als stolze Kaufmannstochter mit der Gewissheit, dass auf meiner Habenseite gute Anlagen verbucht waren, und in der hoffnungsvollen Erwartung, dass ich mit gebührender Strebsamkeit mein Soll erfülle.
Wie kann ich nun meine Anlagen etwas näher beschreiben, ohne der Gefahr der Selbsttäuschung zu unterliegen, und wie meine Vorzüge ins rechte Licht rücken, ohne mir den Vorwurf hoffärtigen Eigenlobs einzuhandeln? Es wird wohl am besten sein, mich aus dem Blickwinkel anderer darzustellen.
So lässt sich aus den in der Folgezeit oft gehörten Eigenschaften wie »Mauskopf« oder »Fliegenhirn«, womit mich meine Lehrer neckten, auf eine gewisse Zartheit meiner Gestalt und meines Wesens schließen, und mit meinen zwölf Handbreit aufrechten Wuchses war ich weder ein missgestalteter Zwerg noch ein ungeschlachter Riese und entsprach auch in keiner Weise der derben Volksmeinung: je krümmer, desto dümmer.
Wenn man mich einen Possierer und Göckelnarren hieß, so beweist das doch nur, dass schon früh meine Bestimmung ersichtlich wurde. Ja selbst den Titel des Erznequams, eines Nichtsnutzes, mit dem mich der Schulmeister in angemessenem Latein belegte, führte ich mit beträchtlichem Stolz. Lieber ließ ich mich einen Erznarren schimpfen als einen betrügerischen Schwartenhals.
Was mir dagegen sauer aufstieß, das war die Art des Unterrichts, denn es hieß endlos still sitzen und auswendig lernen. Das eine konnte ich nicht, das andere wollte ich nicht. So war ich alsbald mit dem Gebrauch der Rute überaus vertraut getreu dem Liedvers: »O du gute Birkenrut, du machst die bösen Kinder gut.« Der Anstellungsvertrag verpflichtete den Lehrer nicht nur zu »Zucht und Lernung«, sondern er sollte jeden Schüler auch »nach seiner Natur und Eigenschaft« fördern, und dies kam in meinen Augen gewaltig zu kurz, denn wäre es nach meiner Neigung gegangen, wäre das ganze Jahr über großes Theater gewesen. Martinus Balticus hatte eben erst den großen Poeten Hieronymus Ziegler als Schulmeister abgelöst. In München geboren, hatte er in Wittenberg studiert und versuchte nun, sich in seiner Heimatstadt Verdienste zu erwerben. Der Anforderung an den Poeten gemäß inszenierte er zur Fastnacht vor dem hohen Rat eine Schulkomödie. Sie war erfreulicherweise nicht nur in Latein, sondern auch mit deutschen Anteilen abgefasst und handelte von Daniel in der Löwengrube.
Da ich noch neu in der Schule war, trug man mir nicht die Hauptrolle an, wiewohl ich – das Vorbild des kaiserlichen Mimen noch lebhaft vor Augen – der Gestalt des Propheten fraglos die gebotene Würde verliehen hätte. Doch schien es mir als weitaus höhere Kunst, einer unbedeutenden Figur zu wahrer Größe zu verhelfen. Ich durfte den fünften Löwen spielen.
Das Rathaus, in dessen großem Saal die Aufführung stattfand und in dessen Kellergewölbe ich jetzt meinen Erinnerungen nachhing, ist nur einen Steinwurf vom Alten Hof entfernt, und man sah damals etliche der Ratsherren bis ins Mark erschauern, glaubten sie doch, die echten Löwen des Herzogs hätten sich soeben losgerissen. Es gab danach Stimmen, die forderten, man müsse den Sohn des Mertl Witz in den Zwinger sperren anstelle der zahmen Raubkatzen. Welch vorzügliches Lob für die Lebendigkeit meiner Darstellung.
Das Jahr war noch in anderer Hinsicht bemerkenswert, denn auf dem Landtag in München erhoben die Stände schwere Klage wegen der Missbräuche bei den Katholischen. Sie forderten gottesfürchtige Kleriker anstelle der verderbten Seelsorger, die hurten und spielten, und sie verlangten nach dem Abendmahl in beiderlei Gestalt sowie nach ungestraftem Fleischgenuss an Fasttagen.
Zu berichten wäre auch noch, dass der Kaiser seinem Bruder Ferdinand endgültig die Administratio imperii übertrug und sich verbittert in die Einsamkeit seiner Villa neben einem Kloster in der Estremadura zurückzog, während der Rat der Stadt München stolz verkündete, dass der Ratzenklauber im vergangenen Rechnungsjahr nur noch zweihundertzehn der Biester erlegt habe entgegen der großen Plage in den Vorjahren.
Fünftes Kapitel
Immer lauter werdendes Grummeln im Verlies riss mich aus meinen Gedanken, denn nach einer Weile kleinlauten und dumpfen Brütens fingen die ersten schon wieder an zu mäkeln und zu rechten. Ich weiß bis heute nicht genau, ob sie mich tatsächlich für den Hauptschuldigen hielten oder nur für den Gewitztesten, der sich und die anderen am Ende herausreden könne. Jedenfalls verdichteten sich die Vorwürfe in meine Richtung, während der Prokurator darauf beharrte, nur wer anderen mittels Zauberei Schaden zufüge … Ich war mir da beileibe nicht mehr so sicher. Es schien mir inzwischen um anderes zu gehen, um etwas von weit größerer Tragweite, das unser begrenztes Rechtswissen bei Weitem überstieg.
»Du hast uns doch angestiftet«, ging mich der Leinweber jetzt an.
»Hab ich dich auch auf die Idee gebracht, den Kaufmann aufs Maul zu hauen?«, wehrte ich mich. »Und wer hat ihm gedroht, ihn lebendig einzugraben, wenn er nicht die Barschaft zur Hebung des Schatzes aufstocke? Habe etwa ich euch befohlen zu graben, oder hat euch nicht vielmehr die eigene Gier dazu getrieben? Hab ich vielleicht einen von euch Helden in den Kreis gezwungen und ihm das Sieb in die Hand gedrückt oder von Beschwörung der Toten gefaselt?«
»Jesus, Maria, hört auf! Wir hängen doch alle mit drin«, jammerte in einem Anflug von Hellsichtigkeit der Hosenstricker. »Michel, Alexander, sie haben vom Teufel gesprochen, was bedeutet das?«
»Das bedeutet«, sagte ich unverblümt, »dass wir mit viel Glück halbwegs ungeschoren davonkommen und mit etwas Pech tief im Dreck sitzen.«
Es wurde mir zunehmend klar, dass die Verhaftungen in so großer Zahl etwas mit dem unlängst ergangenen Mandat zu tun haben mussten. Freilich, Mandate und Dekrete hatte es bereits in der Vergangenheit in großer Zahl gegeben, aber sie hatten wenig bis nichts bewirkt, wohl auch deshalb, weil es der oftmals unentschlossene und zögerliche Wilhelm am nötigen Nachdruck vermissen ließ.
Doch jetzt herrschte sein Sprössling Maximilian, und der war aus anderem Holz geschnitzt. Als Knabe noch furchtsam und schreckhaft, unterwarf er sich umso mehr der strengen Erziehung und jesuitischen Zucht und Askese, um erst zum Musterschüler und als regierender Fürst zur lebenden Pflichterfüllung zu werden, die schon weit vor Tagesanbruch mit Gebet und Aktenfressen begann. Schon mit vierzehn besuchte die jungfürstliche Leuchte die Universität in Ingolstadt, was für sich genommen keine Kunst war, denn auch ein Michel Witz hatte sich in der Blüte seiner Jugend dort eingeschrieben. Aber während ich damals neben dem Studium alter Texte und römischen Rechts vor allem ein lebhaftes Gespür für die abseitigen studentischen Erfahrungen in Tavernen und Spielstätten entwickelte, erlag Maximilian während seines Studiums ganz dem Drill seiner Lehrer.
Noch heute sehe ich das Strahlen auf des stolzen Vaters Gesicht, als er in seiner Schreibstube den Bericht über das Wohlverhalten seines Thronfolgers las. Von einem keuschen Gemüt war da die Rede, frei von jedem unlauteren Gedanken und dergleichen, einen ernsten und festen Charakter habe er, und dann las Wilhelm grinsend an mich gewandt vor, dass jedes unzüchtige Wort bei seinem Sohn Abscheu errege und leichtsinnige Menschen und Spaßmacher bei ihm zu Widerwillen führten. Bla, bla, bla. Ich entwickelte eine herzliche Zuneigung zu ihm.
Gott sei’s gedankt, hatte das Bürschchen auch einen winzigen Makel, denn es war ungeduldig und wollte seinen Willen stets auf der Stelle haben. Der Herzog schrieb damals an den Hofmeister zurück, er solle Maximilian auch recht ermahnen, seine Angelegenheiten mit mehr Geduld zu verfolgen und nicht so jähzornig und furiosus zu sein, wenn er etwas haben wolle. Mag sein, dass die Worte fruchteten, doch selbst wenn sich der Jähzorn inzwischen gelegt haben sollte, blieb Maximilian dennoch zupackend und energisch. Er wollte gewiss rasche Ergebnisse sehen.
Fickler!, schoss es mir plötzlich durch den Kopf. Sein Präzeptor an der Universität, der ihn im Brief an den Herzog so einschleimend gepriesen hatte, hieß Dr. Johann Baptist Fickler, ein Kanzleilöwe, der sich tagsüber leidenschaftlich in Papieren vergrub und nachts in seiner Wohnung in der Dienergasse bei Tranfunzel oder Kerzenschein seitenlange staubtrockene Traktate verfasste. Da waren manche Schmähschriften dabei, vor allem gegen Lutheraner, in denen er nicht mit Beleidigungen und gehässigen Anwürfen geizte. Doch all dies hätte man nach Ablage im Archiv gelassen übergehen können, aber dieser Fickler hatte bereits in den Achtzigerjahren, als er noch im Dienste des Salzburger Fürstbischofs gestanden hatte, ein Hexentraktat veröffentlicht, hatte also schon vor der ersten großen Hexenverfolgung wissentlich gezündelt und zumindest gedanklich die Scheiterhaufen entfacht.
Inzwischen war der Scharfmacher in Ehren ergraut, und obwohl formal noch Mitglied des Hofrats hielt Maximilian seinen Rat für zunehmend entbehrlich, und Dr. Johann Baptist Fickler staubte mittlerweile die Kuriositäten in der neu gestalteten Kunstkammer ab, wo er schmallippig lange Inventarlisten verfasste. Doch damit war der Sprengkörper Fickler nicht entschärft, denn schon scharrte sein Sohn vor der Türe des Rats. Er hatte sich bei den Ingolstädter Juristen, den Verfassern des großen Hexengutachtens der Universität, bereits Ansehen verschafft. Der Himmel über München schien sich wieder einmal zu verdüstern.
»Die Lage ist ernst«, teilte ich daher auch den anderen mit, ohne dabei näher auf meine eigenen Befürchtungen einzugehen. »Sie werden sich einen nach dem anderen vornehmen, beginnend beim Schwächsten, und so lange bohren, bis sie glauben, die Wahrheit in Händen zu halten, wie immer diese aussehen mag. Tut daher genau das, was ihr zuvor getan habt, nämlich eure Unschuld beteuern, aber hört in Gottes Namen auf, andere dafür zu beschuldigen, denn das ist es, was sie versuchen werden: uns zu trennen und aufeinanderzuhetzen.«
»Aber was sollen wir sagen?«, wünschte der Ringler, der nicht zu den Wortmächtigen gehörte, konkreten Ratschlag.
»Bei manchen Dingen hilft doch kein Leugnen mehr«, befürchtete der Schulmeister. »Man hat uns ja gesehen.«
»Bleibt bei der Wahrheit«, empfahl ich. »Ihr dürft die hohen Herren nicht verärgern, indem ihr Offensichtliches abstreitet. Aber sagt auch nicht mehr, als ihr unbedingt müsst. Folgt dem Rat des Prokurators: Alles, was ihr getan habt, geschah ausschließlich zum Nutzen und in gutem Glauben.«
»Und was ist mit dem Schatzgraben?«, warf der Leinweber besorgt ein. »Wie sollen wir’s damit halten?«





























