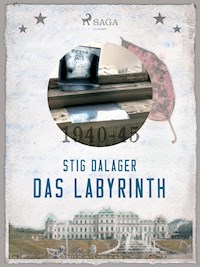
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sieben Jahre nach ihrer Trennung treffen im Herbst 1993 Sine und ihr tot geglaubter Geliebter, der junge Rechtsanwalt Jon Baeksgaard, unvermittelt in Wien wieder aufeinander. Jon ist von New York nach Österreich gekommen, um in Zusammenarbeit mit Simon Wiesenthal den NS-Kriegsverbrecher Jürgen Menken ausfindig zu machen, der unerkannt mit seiner Frau in der Stadt lebt. In Österreich scheint unterdessen der Aufstieg des Rechtspopulismus unaufhaltsam, und eine rätselhafte Serie von Briefbombenattentaten hält die Öffentlichkeit in Atem. Der dänische Star-Autor Stig Dalager verwebt in seinen packenden Polizeithriller "Das Labyrinth" neben Zeitgeschichtlichem auch längst vergessen Geglaubtes, das in Traumsequenzen an die Oberfläche tritt. Spannend und hochpolitisch kreist er um essenzielle Fragestellungen von Vergangenheit und Gegenwart, erzählt aber vor allem von den Irrwegen und Wagnissen eines Mannes auf der Suche nach seiner Bestimmung. Der schwedische Kritiker Lars Olof Franzén bezeichnete die Hauptfigur Jon als "den Odysseus unserer Zeit", und tatsächlich bindet Dalager Reminiszenzen an den griechischen Mythos von Theseus und dem Minotaurus in Knossos in sein Labyrinth ein. Der Frage, wie viel Mensch und wie viel Bestie in ihm steckt, muss sich schließlich auch Jon stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Dalager
Das Labyrinth
Saga
Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden
Laufe der Zeiten,
Da ihm die Götter bestimmt, gen Ithaka
wiederzukehren,
Hatte der Held noch nicht vollendet die
müdende Laufbahn.
Auch bei den Seinigen nicht.
Homer, Odyssee,in der Übertragung vonJohann Heinrich Voß
Prolog
Zu spät oder zu früh oder zur rechten Zeit zum Labyrinth zu gelangen, das ist die Frage.
Hier kommt jetzt der Autor mit seinem Ich und all seinen anderen offenen Fragen an einem Maitag in Kopenhagen an, als sich die Sonne im funkenschlagenden Aufblitzen an einem schwachen bläulich-weißen Himmel zeigt, der mehr verbirgt, als er offenbart. Der größte Teil des Universums ist hinter diesem Himmel verborgen, und doch existiert es mit seinen Milliarden von Sternen, schwarzen Löchern, Planeten, Monden, Sonnen und Erdkugeln. Es ist anregend und bedrückend zugleich, wie wenig wir davon verstehen, aber an den Städten und Menschen des Erdballs halten wir in unserer Einbildung fest, bis wir entdecken, dass Menschen nicht nur Raumpiloten sind mit Sternenstaub in den Genen, sondern als lebende Fossile auch den Abdruck des Universums hinter der schützenden Haut des Stirnlappens tragen. Ist das Universum ein erst schwach kartografiertes Labyrinth, was ist dann mit den unendlichen Irrgängen im hirngekrönten Schloss von Bewusstsein und Unbewusstem? Welche Sterne und welche Gänge werden uns dazu führen, die Bewegung der einen Hand zur anderen Hand zu verstehen, welche schwarzen Löcher heben die Faust zum Schlag, was bringt Menschen dazu, sich zu versammeln und zur Masse zu werden? Was bringt eine Person dazu, zu verschwinden und wieder aufzutauchen?
Beginnen wir die Reise.
Anfang Januar 1986 machte Jon Bæksgaard Ernst mit seinen Plänen, nach Mérida in Mexiko zu gehen, um sein irdisches Paradies zu finden; bei seiner Abreise aus dem klammen Zimmer an der Lower East Side in New York ließ er eine Plastiktüte mit abgetragenen Kleidungsstücken zurück, die er nicht mehr brauchte (in Wirklichkeit hatte er vergessen, sie wegzuwerfen); diese Plastiktüte wurde von einem unterbezahlten fünfundzwanzigjährigen Putzmann gefunden, der sie für sich auf die Seite schaffte; er wohnte in einem Block in einer kleinen Straße in Brooklyn und nahm am selben Tag seinen bescheidenen Fang mit über die Brücke. Zwei Tage später stand er – wie so oft zuvor – auf der Straße, wenigstens aber hatte er das Geld von dem Job und die Sachen aus der Tüte, die ihm zu seinem Glück einigermaßen passten.
Joe Fender, der aus einem kleinen Ort in Missouri stammte und in der Hoffnung nach New York gegangen war, dort ein gelbes Taxi zu fahren, war praktisch obdachlos, und da er wieder einmal weder Arbeit hatte und Geld nur noch für die nächsten drei, vier Tage, wurde er nach einer Woche aus seinem stickigen Zimmer geworfen und stand wieder auf der Straße.
Er ging zum zwölften Mal in zwei Jahren in das beeindruckende Büro der N.Y.C. Taxis, um nach Arbeit zu fragen, wurde aber wieder abgewiesen, weil er keinen City-Führerschein hatte und es sich nicht leisten konnte, einen zu machen. Am nächsten Tag war er wieder da und flehte die Gesellschaft an, ihm das Geld für einen Führerschein vorzustrecken. Weil er aber überhaupt keine Garantien bieten konnte, musste er wieder abziehen.
Die ersten beiden Nächte verbrachte er in einer der wenigen überfüllten Herbergen der Stadt, zusammen mit verdreckten und nach Schnaps stinkenden Asphaltwracks und still für sich schlafenden Einzelgängern, aber als ihm hier seine Ausweispapiere gestohlen wurden, hatte er nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder ging er nach Missouri zurück zu dem, was von seiner Familie noch übrig war, oder er ging unter die Erde, zu den versprengten Obdachlosen in die frostige Finsternis der Subwaytunnel. Um zurückzufahren, brauchte er Geld, und um sich Geld zu beschaffen, brauchte er einen Job, doch für einen Job brauchte er eine Adresse und einen Schlafplatz und etwas zu essen; er stank schon und war im Laufe einer Woche so heruntergekommen und geschwächt, dass ihn keiner nehmen wollte, weder als Tellerwäscher oder Abräumer noch als Liftboy, obwohl er mit einer verzweifelten Beharrlichkeit tat, was er konnte, um auf seinem Weg durch das Wirrwarr der großen Stadt aus Seitenstraßenhotels, Coffeeshops, Pizzerias und Bars wen auch immer vom Gegenteil zu überzeugen; gerade die Verzweiflung in seinen Körperbewegungen und Augen gab den Ausschlag in einer dschungelartigen Stadt, wo man den anderen blitzschnell scharf taxierte und von ihm zumindest erwartete, dass er einem irgendetwas vormachte.
Joe Fender konnte sich weder besonders gut verstellen noch sich smart geben, er hatte nur seine countryartige Energie, und als die fast aufgebraucht war auf seinen mehrwöchigen Betteltouren in der eisigen Winterluft der Fifth Avenue und durch das Viertel in Brooklyn, das er am besten kannte, da beschloss er, dem Ganzen ein Ende zu machen. Das heißt, beschließen ist zu viel gesagt, er hatte das Gefühl, er habe keine Wahl, er fror ganz höllisch, und wenn man friert, kann man nicht klar denken. Das Einzige, woran eine verfrorene Seele in einem unterkühlten Körper denken kann, ist ein Dach über dem Kopf, und kommt sie weit genug von der Bahn ab, die gewisse starke Träume ihr in ihrem eher kindlichen Zustand vorgeschrieben haben, erreicht sie den Punkt, wo selbst der Tod Erlösung bedeutet. Die meisten stellen sich die Hölle warm vor, doch Joe Fender wusste instinktiv, dass die Hölle kalt ist, von brennender Kälte, so instinktiv suchte er die Wärme auf der anderen Seite.
Er kannte den Weg. Eine seiner wenigen Bekannten, ein Mädchen namens Lucy Farry, das er in Brooklyn genau an dem Januartag auf der Straße traf, als er sich ein Zimmer mietete, hatte er schon am nächsten Abend auf sein Zimmer mitgenommen, hier übernachtete sie auf seiner einfachen Matratze, während er sie in den Armen hielt; sie schwitzte den größten Teil der Nacht und zitterte am ganzen mageren, weißen Körper, manchmal rief sie nach Wasser oder ihrer Mutter oder nach Stoff, erst gegen Morgen, als das bleiche Winterlicht in das Zimmer drang, sah er die vielen blauen Male an ihren Armen und Beinen und wusste nicht, was er mit ihr anfangen sollte; an diesem Tag hatte er einen Putzjob in Alphabet City und musste sie allein lassen. Sie schlief, er stellte ihr eine Tasse Wasser hin, deckte sie mit der rauen Bettdecke zu und ging zur Arbeit, aber als er am Nachmittag desselben Tages zurückkam, war sie verschwunden.
Einige Tage später tauchte sie plötzlich auf und war auf Speed und faselte was von einer Aussicht, die sie ihm unbedingt zeigen wolle, ohne zu fragen, nahm sie seine Hand und führte ihn durch die Straßen in ein verfallenes Hochhaus in der Coney Island Avenue, wo ein zeitungslesender Wachmann von ihnen kaum Notiz nahm. Sie fuhren mit dem knackenden Fahrstuhl bis zur obersten Etage, und sie führte ihn über eine kleine Treppe auf das Dach. Vom Sternenhimmel ebenso wie von den pulsierenden Lichtern Manhattans überwältigt, hielten sie einander einen Augenblick an der Hand, dann ließ sie seine Hand los und ging durch ein kaputtes Gitter ganz nach vorn zur Dachkante und begann, darauf zu balancieren.
– Heute Abend tanze ich wie ein Engel, rief sie hysterisch dem geschockten Joe Fender zu, der sie sofort von der Kante wegriss und weiter aufs Dach führte. Doch sie sträubte sich und befreite sich aus seinem Griff und lief zur Kante, er ihr hinterher, bekam sie wieder zu fassen, sie stolperten über ihre eigenen Beine und rollten in enger Umarmung herum; sie landete auf dem Rücken, den Kopf über der Kante, und er über ihr, einige Sekunden lang starrte er an ihrem Gesicht vorbei in den Schacht unter ihnen, dann konnte er sie wieder aufs Dach zurückziehen, er hielt sie jetzt ganz fest und begleitete sie zurück zum Aufgang und dem Fahrstuhl.
Draußen vor dem Gebäude trennten sie sich, weil sie wütend auf ihn war, und weil er, wie sie sagte, kein Engel war, so wie sie, und er sah sie nicht wieder.
Aber dieser schwindelnde Anblick des dunklen Schachts ließ ihn nicht los. Er stieß ihn genauso ab, wie er ihn anzog, und als er eines Nachts, nachdem er eine halbe Stunde unruhig geschlafen hatte, auf dem Steinboden neben einem Subwaypfeiler in der Nähe der Bowery Station aufwachte, erhob er sich wie ein Schlafwandler und tappte durch den dunklen Tunnel zur Straße hoch, um den ganzen Weg über die Brooklyn Bridge zum Hochhaus in Brooklyn zu laufen. Hätte ihn ein Streifenwagen oder irgendein Fußgänger angehalten, hätte er sein Vorhaben wahrscheinlich aufgegeben, aber es hielt ihn keiner auf, auch nicht der Wachmann im Hochhaus, der im Foyer vor dem Siebzehn-Zoll-Fernseher eingeschlafen war, den er selbst mitgebracht hatte und aus dem Stimmen und Klatschsalven einer Nightshow dröhnten. Als Joe Fender oben auf dem Dach im Wind stand, ging er gleich nach vorn zur Kante und ließ sich fallen, wie er sich einmal auf einem Feld in Missouri hatte vom Mähdrescher fallen lassen.
Erst einige Tage später entdeckten ein paar Jungen seinen kaputten Körper neben einem Abfallcontainer. Zwei Polizisten von einer nahen Wache wurden gerufen, sie kamen in schlechter Laune an, weil sie deshalb ihre Mittagspause verschieben mussten; an Ort und Stelle untersuchten sie schnell die Kleidung des Toten und fanden in der Innentasche der Jacke das Foto einer blonden Frau; auf der Rückseite stand ein Name (Sine) mit einer dänischen Adresse, die sich mit Ausnahme einer wichtigen Kleinigkeit, die bei der ersten Untersuchung übersehen wurde, bald als das Einzige herausstellen sollte, was den kalten Körper mit der bekannten Welt verband. Als später einer der Polizisten einige Tage nach Auffinden der anonymen Leiche routinemäßig die Kleidungsstücke nummerieren wollte, die ein Jahr aufbewahrt wurden, und noch einmal die Taschen durchsuchte, stießen seine Fingerspitzen auf einen kleinen weißen Zettel, der sich bei näherer Untersuchung als Quittung für ein PanAm-Flugticket auf den fremd klingenden Namen Jon Bæksgaard erwies. Der Polizist erkundigte sich telefonisch bei der PanAm, die ihm mitteilte, jemand dieses Namens hätte das Ticket gekauft und bezahlt, ohne jedoch eine New Yorker Adresse zu hinterlassen. Da der Polizist jetzt das Foto einer Frau mit einer dänischen Adresse und den mutmaßlichen Namen der Leiche hatte, und da er mit Aufgaben überlastet war und sich im Übrigen nicht sonderlich für den Fall eines toten Mannes interessierte (in seinen Augen sprach hier nichts gegen einen Selbstmord), meldete er den Vorfall der zuständigen Behörde, die routinemäßig eine Kopie des Fotos mit den Erklärungen über Todesursache, Fundort und dem vermutlichen Namen in einem abgestempelten und eingeschriebenen Brief an die Frau und ihre (vermutlich) dänische Adresse schickte.
So kam es, dass Jon Bæksgaard offiziell für tot gehalten wurde, dabei aber quicklebendig in der Sonne durch die engen, lauten Straßen von Mérida lief.
Aber gerade weil die Information über seinen sinnlosen Tod für Sine, die den Brief aus New York endlich Ende Februar in Paris (umadressiert in Århus) erhielt, den Anschein einer großen lähmenden Wahrscheinlichkeit hatte, kam Jon in gewisser Weise dazu, schon zu Lebzeiten zwei Tode zu sterben, ehe er einige Jahre danach wiederauferstehen sollte. Erst starb er in den Augen der Behörden, und zwar ganz offiziell, danach starb er als Möglichkeit in Sines Leben. Denn trotz ihres Abschieds von ihm Ende Dezember 1985 in New York hatte sie ihn damals gegen alle Vernunft nicht aufgegeben und damit gerechnet, ihn früher oder später wiederzusehen.
Aber starb er auch als eine Lebensmöglichkeit, lebte er doch umso stärker als Erinnerung in ihr weiter.
Und als sich der Schock über seinen Tod gelegt hatte und auch die Erinnerung an ihn langsam verblasste, brachte sie ihr Kind zur Welt, das auch seines war.
1993–1994
The pain will not go away. Sine wohnt in Wien im dritten Stock eines Gartenhauses in der Billrothstraße in einer Vierzimmerwohnung mit Balkon. Sie wohnt hier mit ihrem Sohn Tobias und mit Günther, ihrem Freund aus Berlin, den sie im uno-Komplex am linken Donauufer getroffen hat, wo sie an Dritte-Welt-Projekten arbeitet. Es ist Nacht, und die Wohnung ist frisch geweißt, leuchtet stark im Dunkeln, es ist, als gingen Gespenster im breiten Korridor umher, der einmal für Besuch aus dem akademischen Bürgertum der Stadt und wahrscheinlich auch von Offizieren mit ihren Frauen und Kindern gedacht war, und vor ihnen von Geldleuten in ihren gut sitzenden schwarzen Anzügen; früher lebte in der Wohnung ein Kunstmaler, der Professor war, und vor ihm ein Oberst mit Familie, und noch vor ihnen ein Bankier. Der Parkettfußboden des Korridors, der freie Platz hinter der Anrichte und der breite Garderobenschrank samt dem Kristallkronleuchter erinnern immer an früher, als man hier ein anderes Leben führte, so wie an die Gespenster, deren flüsternde Stimmen sie zu hören glaubt, während sie neben Günther schläft, dem traumlosen Günther, der mit seinem schönen, symmetrischen Gesicht und in seiner schlafenden Leblosigkeit ein Fremder sein könnte, ein Jedermann, der durch seine bloße Anwesenheit vor der Einsamkeit schützt. Hat Jon sie angesteckt? Lebt sie am besten, wenn sie träumt?
In diesem Altweibersommer im September in Wien hat sie ihn im vollen Tageslicht ganz vergessen, selbst ganz früh am Morgen, ehe sie mit der Straßenbahn zum Schottentor fährt, Tobias in die Sonderklasse des funktionalistischen Gebäudes in der Gymnasiumstraße begleitet und er sich, die Hand des Begleitlehrers auf der Schulter, zu ihr umdreht, mit diesem Gesicht, das ihm gehören könnte, dreht sich die Zeit für sie nicht zurück; es gibt keine Stelle mehr im Körper, die schmerzt, sie sieht das Gesicht wie ein Gesicht, das gerade in diesem Augenblick hier lebt, das leicht verstörte Gesicht ihres Sohnes, mit der augenblicklichen Angst, mit den gehemmten oder schreienden Kindern in dem funktionalistischen Gebäude allein zurückgelassen zu werden.
In dieser Nacht, in der nur ein Laken ihren fast nackten Körper bedeckt, träumt sie, nicht diese bizarre, albdruckartige oder diffus aufgelöste Art von Traum, er ist wirklicher als das, was sie umgibt. Es ist ein Novembertag vor über sieben Jahren, mit den einsetzenden Presswehen fährt sie allein in einem Taxi zu den Betonbauten des Rigshospitalet; an diesem Novembertag, an dem die grauen Farben des Himmels die Sicht nach oben begrenzen und Kopenhagen fast im Winterschlaf liegt, wirkt Tegners gewaltige und grünspanüberzogene, schräg vor dem Krankenhaus aufragende Statuengruppe eines muskulösen Mannes und zweier Frauen, die ins Licht hochschauen, wie eine schwere Fata Morgana. Als sie vorm Haupteingang des Rigshospitalet mit den automatisch auf- und zugleitenden Türen aus dem Taxi steigt, ist ihr einen Augenblick lang schwindlig, und sie ist schwach auf den Beinen, der Chauffeur, ein ursprünglich aus Pakistan stammender Mann, hat es eilig, aus dem Auto zu kommen, um sie zu stützen und begleitet sie durch die Türen in die summende, überhelle Vorhalle, wo Patienten in Rollstühlen und Besucher in Winterkleidung sich wie in einem Film bewegen.
– Schaffst du es allein?, fragt der Fahrer und legt ihr schützend die Hand auf die Schulter.
Sie sieht in die glänzenden dunklen Augen im grau werdenden Gesicht und nickt. Ein Passant blickt ihnen misstrauisch nach.
Er gibt ihr die Tasche, und sie bewegt sich beschwerlich tiefer in die Halle hinein und will um eine Ecke biegen, verspürt aber wieder die Schmerzen und das Ziehen im Bauch und lehnt sich an die Wand. Einen Augenblick lang dreht sich alles um sie, dann ist er wieder da, der Taxifahrer, er nimmt ihre Tasche und stützt sie und hilft ihr schweigend um die Ecke und zu den Fahrstühlen in der marmorierten Wand. Sie spürt das Wasser und stellt sich vor, es wäre ein See unter ihr, aber da ist nichts. Sein Knoblauchatem verstärkt ihre Übelkeit, und doch hält sie sich an seinem Arm fest. Als eine Fahrstuhltür aufgeht, bittet sie um ihre Tasche, dankt ihm und betritt den neonerleuchteten, engen Raum. Als sie sich zur Tür umdreht, steht er immer noch draußen und gibt auf sie acht. Sie ist allein im Fahrstuhl.
– Zweiter Stock!, sagt er.
Sie drückt den Knopf zum zweiten Stock und wirft ihm ein nervöses Lächeln zu. Die Tür gleitet langsam zu, er verschwindet, sie fährt nach oben. Sie schwebt nach oben, es dauert eine Ewigkeit, ein neuer Schmerz durchzuckt sie, sie hält ihren Bauch fest, als der Fahrstuhl hält und die Tür aufgleitet, weiß sie einen Augenblick lang nicht, wo sie ist, um sie herum ist alles weiß und grau, sie tritt auf den Gang, entdeckt, dass sie die Tasche vergessen hat, macht kehrt, bückt sich und fällt fast über die Tasche. Irgendjemand packt sie von hinten am Arm, ein Mann in weißem Kittel, und zieht sie wieder auf die schwankenden Beine. Alles ist weiß.
Zwei andere Weißgekleidete kommen dazu, sie sprechen zu ihr, sie hört, was sie sagen, versteht es jedoch kaum, sie geleiten sie in einen größeren, nackten Raum mit einer Liege. Sie heben sie halbwegs auf die Liege, einer von ihnen zieht halb die Gardine vor die vielen Fenster, die sich grau in der Ferne verlieren. Man misst ihren Puls, betastet ihren dicken Bauch, sie starrt die weiße Decke an, will nur schlafen, doch jetzt kommt der Schmerz wieder. Plötzlich ist sie wieder ein Kind und liegt still in ihrem kleinen weißen Zimmer, und ihr ganzer Körper ist heiß, und sie redet im Fieber, und ihre Mutter legt ihr die Hand auf die Stirn und sagt:
– Das macht nichts, du wirst schon wieder gesund.
Eine Krankenschwester hat das Gesicht ihrer Mutter und ist ihr dennoch fremd, sie versucht, sich dagegen zu wehren, und sagt:
– Wo bist du, Mama?
– Willst du etwas gegen die Schmerzen?, fragt das Gesicht.
Sie nickt, und man hält ihr eine Plastikmaske vors Gesicht.
Es dauert lange, sehr lange. Sie hat das Gefühl, aufzuwachen und sich umzusehen, und die weißen Gestalten sind verschwunden, die Tür steht zum Gang hin offen, sie ist allein. Wieder.
Sie hat die Maske nicht mehr auf, oder doch?
– Das hilft lange nicht gegen alle Schmerzen, sagt das Gesicht, oder sagt sie es selbst?
Ihre Mutter steht am Fußende der Liege und lächelt ihr zu.
– Warum kommst du erst jetzt?, fragt sie.
Ihre Mutter lächelt wieder, sie ist von der australischen Sonne gebräunt. Jetzt reitet sie vor ihr auf dem schwarzen Hengst, sie reiten über die Felder, wilder und wilder, der Pferdegeruch steigt in ihr hoch, sie klammert sich an den Sattelknopf.
– Ich falle, ich falle, ruft sie und schließt die Augen. Ihre Mutter lacht. Sie öffnet die Augen, der Raum ist leer, der Schmerz kehrt zurück, sie beißt die Zähne zusammen, es knackt in den Kiefergelenken, warum kommt niemand? Irgendjemand macht auf dem Gang halt und schaut herein und verschwindet wieder.
Sie schnappt nach Luft und ist auf einem Schiff, schwankt von einer Seite zur anderen, langsam, in Zeitlupe, ein Mann in Weiß kommt zur Tür herein, an seinem feinen, scharfen Nasenbein erkennt sie die Mumie von Tanis wieder, die sie monatelang Stück für Stück abgebürstet hat, jetzt kommt sie zu ihr und spricht (sie hatte dasselbe sorglose Lächeln):
– Die Hebamme hat sich verspätet, Entschuldigung, sie wird gleich hier sein!
Sie will etwas sagen, aber die Worte bleiben ihr im Hals stecken.
Der Arzt, der weiße Mann, die Mumie, zieht ihr die Beine auseinander. Er berührt sie im Schritt.
– Das Wasser geht schon ab, sagt er, du kommst ziemlich spät, aber wir schaffen das schon.
Er steckt ihre Beine oben in zwei Bügel.
Der Herzskarabäus von Tanis leuchtet auf seiner Stirn.
»Rette mich vor dem geheimnisvollen Gott.«
Die Schmerzen kommen wieder. Sie schließt die Augen und flüchtet in den schwarzen Raum.
– Pressen, pressen!, sagt eine Frauenstimme plötzlich ganz nahe.
Sie will nicht aus dem schwarzen Raum heraus.
– Pressen!, wiederholt die Stimme noch lauter.
Und sie presst und presst, und graue Bilder von ihr selbst in einer Tivolischaukel, die nie anhält, und in einem stinkenden, staubigen Kellerraum, der sich nie öffnen wird und mit leeren Pappkartons ohne Boden angefüllt ist, wechseln sich mit Bildern von dunklen Gesichtern in ihr unbekannten Straßen ab, und in dem Moment, in dem sie aus voller Kraft keucht, sodass es in den Gehörgängen pfeift, hört sie irgendwo in ihrem Hinterkopf das Echo einer Mundharmonika aus dem Kinderzimmer; Gedanken, so fern wie die flatternden Slogans auf den breiten Transparenten hinter den Zeppelinen, die den Himmel durchkreuzen, kommen zu ihr, blitzartig; Gräuelgesichter überwältigen sie plötzlich, und weg sind sie.
Ihr Körper vibriert bei diesen Geräuschen, dem Licht, den Gerüchen, den Gesichtern und dem lautlosen Chaos der Sinne. Im ersten Augenblick öffnet sich unter ihm ein Abgrund von ungeahnter Dunkelheit, wie ein Abbild der Sekunde seiner eigenen Geburt, im nächsten Augenblick schwindelt dem Körper zwischen punktuell auftretenden Zugschmerzen unter einem Scheinwerfer aus stechenden Sonnen am Rande der Erlösung oder des Orgasmus, der Körper spannt sich zu einem Bogen, der Körper ermattet, fällt nach unten, die Welle der Stofflichkeit durchfährt ihn schäumend, und er ist ein Fahrzeug im Sturm und ein Zentrum der Welt zugleich. Er ist ein Reisender, der seine längste Reise in kürzester Zeit zurücklegt, ein blinder und auch ein sehender Reisender, der sich den Elementen zur Verfügung stellt, denselben Elementen, die ihn eines Tages auflösen werden, ihn jetzt aber einem Höhepunkt zutreiben, einem Erblühen des Fleisches.
Alles ist in Alarmbereitschaft, Säfte und Plasma, Schweiß und Wasser durchströmen den Körper, das Skelett reißt an seinen Scharnieren, und die Muskeln der Beckenpartie ziehen sich zu einem harten Knoten aus Schmerzen zusammen, die wie unerträgliche Musik in einem Albtraum wiederkehren, doch neben dem Albtraum lebt ein beginnendes Ziehen von Erwartung, eine Hochstimmung des Körpers, bis in die Schläfen hinein; Tränen und Lächeln huschen über die Physiognomie wie über das Gesicht eines Toren, das Lebendige des Körpers, das hinaus muss, fühlt sich wie ein Stein an und ähnelt einem mit Moorsaft übergossenen Stück Holz, einem Baum, der Hunderte von Jahren in der Mooresfinsternis verschwunden war und plötzlich vom Licht angestrahlt und lebendig wird. Im Gesicht des kaum geborenen Kindes sieht man die Zeichnung des Greises; in den wenigen Sekunden, die es noch mit dem Mutterkuchen verbunden ist, sieht man es von einem wundersamen Zögern und Stille umgeben, und man zweifelt, ob es überhaupt unter den Lebenden weilt; aus seinem ersten impulsiven Schrei hört man den Schock über die Ankunft heraus, in die Welt hineingeworfen zu sein. Vielleicht erholen wir uns nie von diesem Schock aus Licht und Geräuschen, vielleicht erklärt das unser doppeltes Verhältnis zum Licht: Wir sehnen uns nach ihm und flüchten davor. Erst in der Dunkelheit kommen wir zur Ruhe.
Sie ruft aus der Dunkelheit, plötzlich ist der Schmerz weg, sie hört jemanden schreien, es dämmert ihr, dass es ein Kind ist, ein beschmiertes, braunes Wesen, ihr Kind, das lebt. Sie lacht und weint gleichzeitig, die Hebamme, die weiße Frau, legt ihr das kleine fleischliche Bündel auf ihren verschwitzten Körper.
Sie erwacht halb im weißen Schlafzimmer in Wien und streckt die Hand nach Günther aus.
– Was ist?, sagt er im Schlaf.
– Ich habe gerade geboren, sagt sie und tastet in der Dunkelheit nach seiner Schulter, aber er seufzt, dreht ihr den Rücken zu und schläft weiter.
– Ich habe gerade geboren, wiederholt sie flüsternd, ohne ganz zu verstehen, wo sie sich befindet, und warum die Person neben ihr nur aus Nacken, Haar und Schulterblättern besteht.
Sie steht auf, ihre verschwitzten Füße kleben am Parkettfußboden, sie tastet nach einer Zigarette in ihrer Tasche neben dem Bett, steckt sie an und geht zum Fenster, wo der im Dunkeln liegende Hof und die blinden Fenster im Gebäude gegenüber und die brennende Lampe in der Toreinfahrt zur Straße sie nicht beruhigen. Die Stille ist überwältigend, kein Geräusch ist von der Stadt zu hören, Straßenbahnen, Busse, selbst Autos sind schlafen gegangen, sie stellt sich vor, die trockene Wärme und der Föhn mit seinem Sand aus der Sahara, der die Leute manchmal wahnsinnig macht, hätten die Leute jetzt aus der Stadt vertrieben, sie ist auf einer einsamen Insel und muss hinein und nach Tobias schauen, plötzlich hat sie Angst, er würde nicht mehr atmen, er hätte, wie noch vor einigen Jahren, unruhig geschlafen und sich freigestrampelt und wäre aus dem Bett gefallen. Sie geht durch den angrenzenden Raum zu seiner Tür, die angelehnt ist, aber als sie die Tür öffnet, schläft er friedlich in seinem blauen Bett, den Kopf zurückgelegt und mit etwas Speichel in den Mundwinkeln. Sie tritt ganz nahe an ihn heran, wischt ihm den Speichel ab und streichelt seine Stirn und Wangen. Die ganze Anspannung vom Tage ist aus dem Gesicht unter dem dichten hellen Haar gewichen, diesem offenen Gesicht, gelöst und auf eine Weise verwundbar, die sie nicht für möglich gehalten hätte, wenn sie nicht seine Mutter wäre und es selbst gesehen hätte.
Es lächelt in der Dunkelheit.
Sie streicht ihm über das Haar und bemerkt dabei die Schachteln, die er systematisch an der Wand neben dem Bett aufgestapelt hat, zwei Türme bilden sie, einer ist schwarz, der andere weiß, zwei Türme eines imaginären Schlosses in einem imaginären Land; an manchen Tagen kann er sie unablässig einreißen und aufbauen, bis sie ihn unterbricht, und er protestiert in seiner halbfertigen Sprache mit deutschen und dänischen Wörtern und reißt sich von ihr los, um in seiner ungehemmten, sinnlosen Aktivität fortzufahren, die ihn von der Welt isoliert.
Und doch lächelt er in der Dunkelheit. Wo befindet er sich? Woran denkt er? Irgendwo ist er vielleicht glücklich, an einem Ort, von dem sie ausgeschlossen ist, genauso wie es für ihn ausgeschlossen ist, sie anders als in Bruchstücken zu verstehen. Sie hat immerzu dieses Gefühl, zwei Zentimeter davor zu sein, ihn zu erreichen, doch diese beiden Zentimeter sind entscheidend, sie machen den Unterschied aus zwischen Sommer und Winter.
Mit niemandem ist sie mehr verbunden, niemanden liebt sie mehr, mit niemandem ist das Leben so anstrengend und erschöpfend wie mit Tobias. Wie viele Nächte hat sie sich nicht in den Schlaf geweint, wenn er sie in den Jahren, in denen sie allein mit ihm wohnte, zum neunten oder zehnten Mal nachts aufweckte und weder in ihrem Bett noch in seinem eigenen zur Ruhe kam und sich vor irgendetwas fürchtete, was sie nicht verstand, oder energisch durch die Wohnung ging, um ein Spielzeugauto zu suchen, das nicht an seinem Platz war, oder einen Bären, der nicht in seinem Bett lag und manchmal nur in seiner Fantasie existierte. Wie viele Au-pair-Mädchen und österreichische Kindermädchen hat er in den Jahren in Wien mit seinen unvorhersehbaren Ausbrüchen an den Rand der Erschöpfung gebracht, seinen zwanghaften Ritualen, was Kleidung oder Essen betraf, seiner plötzlichen Kommunikationslosigkeit, seinem In-sich-selbst-Zurückziehen, und wie oft steckte sie gerade in einer Arbeit oder war in ihrem Büro in der achten Etage des uno-Gebäudes am linken Donauufer in einer Besprechung und hatte das Gefühl, er wäre in »schlechten« Händen, und im selben Augenblick würde sich in der Wohnung in der Billrothstraße ein kleineres Drama mit ihm abspielen.
Sie hatte ihn in einem Rausch in Kopenhagen geboren – gerade aus Paris zurückgekehrt –, und es war ein langsames Erwachen in eine schmerzliche und vage Realität, die mehrere Ärzte und Psychologen sieben Jahre lang mit unterschiedlichen Diagnosen und Namen belegt hatten, er war ein »HDS-Kind«, er war »autistisch«, er war »neurologisch geschädigt« oder »hirngeschädigt«, möglicherweise bei der Geburt, dieser Geburt, die für sie ein Höhepunkt gewesen war, niemand – nicht einmal sie selbst – hatte in der ersten langen Zeit etwas geahnt. Als Mutter war sie ein Neuling. Wie hätte sie all die kleinen Anzeichen einer Störung lesen können, die sie erst später in einen größeren Zusammenhang bringen konnte, obwohl sie immer noch nicht ganz versteht, was mit Tobias nicht stimmt, ihrem Jungen, der im Schlaf den anderen Jungen gleicht und den normalen herabgesetzten Atem und die Gesichtszüge der anderen hat.
Ein Neurologe in Wien hatte ihr vor einem Jahr nach einer längeren Untersuchung gesagt:
– Ihr Sohn hat einen bleibenden »Schaden«, auf den Sie sich einstellen müssen. Er wird Sie viele Jahre lang sehr stark brauchen, physisch und mental. Sie sind seine Tür zur Welt, ohne Ihre Anwesenheit riskieren Sie, dass er sich in sich selbst verliert.
Sie erinnert sich genau an diesen Tag im Mariahilfer Krankenhaus, wo sie den sprechenden Mund des Neurologen anstarrte und im nächsten Augenblick seine gepflegten Hände bemerkte, die sich auf einem Mahagonischreibtisch falteten, er machte den Eindruck eines Richters in einem Prozess, der vor einigen Jahren begonnen hatte, als sie die Stelle antrat und die große Wohnung in Wien bezog, die sie von einer Woche auf die andere mangels weiterer freier Wohnungen bekommen hatte, und in der sie mit ihrem guten Einkommen hängen geblieben war, auch weil sie ein Zimmer an einen uno-Angestellten und später an Günther vermietet hatte.
Als sie an diesem Tag im Büro des neurologischen Oberarztes in dem weißen Kittel blass wurde, blass und ihr die Worte fehlten, lehnte er sich mit einem Gesicht, das milde Einfühlung demonstrierte, etwas zu ihr vor und sagte:
– Es gibt auch Einrichtungen, gute private Einrichtungen, das ist natürlich nicht billig, aber ...
– Er wird bei mir wohnen, sagte sie bestimmt.
– Die meisten schaffen es nicht, sagte der Oberarzt, früher oder später muss man aufgeben.
– Ich gebe nicht auf, sagte sie, eher gebe ich meine Arbeit hier auf und fahre nach Hause.
– Verzeihen Sie, sagte der Oberarzt mit einem kleinen selbstsicheren Lächeln, aber das Problem wird Sie immer begleiten, und wovon wollen Sie dann leben?
– Mir fällt schon etwas ein, sagte sie und wollte nicht zeigen, wie nervös sie wurde.
Als sie das Krankenhaus verließ, wurde ihr schlecht, und sie musste sich im grauweißen Gang auf einen Stuhl setzen, obwohl Günther damals schon zwei Jahre mit ihr zusammengelebt hatte, dachte sie keinen Augenblick lang an ihn. Ihre Augen verfolgten die Vorbeigehenden im Gang, Krankenschwestern und Kranke, ein gleichmäßiger Strom von Menschen mit fremden Gesichtern und Gebärden, Menschen, die in einer Sprache redeten, die nicht die ihre war. Sie hatte geglaubt, sie hätte sich an das Leben in der Stadt gewöhnt, immer wieder hatte sie ihren Kollegen in der uno-City erzählt, dass ihr die Stadt gefalle, die Parks, das Belvedere, Schönbrunn, der Stephansdom, die Karlskirche, die Donau, die Musik, selbst die Mentalität, aber hier war sie allein, unter gealterten Körpern und effektiven Krankenschwestern mit ihren katholischen Uniformen wusste sie plötzlich nicht, was sie mit Tobias und mit ihrem Leben anfangen sollte.
Sie verspürte eine überraschende Wut auf Jon und auf Tobias, hatte Jon sie nicht verlassen und sie mit einem hirngeschädigten Kind allein gelassen? Hinter ihrer gescheiterten Liebe saß eine gescheiterte Wut, die sich eingekapselt hatte und zu einer harten Saite in ihrem Innern geworden war. Sie ballte eine Hand zur Faust, mit der anderen hielt sie den Sitz fest. In ihrer Familie hatte es noch nie hirngeschädigte Kinder gegeben, Tobias hatte es also von ihm, ähnelten sie einander etwa nicht wie ein Wassertropfen dem anderen? In diesem Augenblick verdichtete sich der ganze Verdruss über Tobias zu einer Last, die sie für immer tragen musste, sie sah sich selbst als diejenige, die immer nur geben sollte und nichts zurückbekam, wie eine Stimme ohne Resonanz, und sie stand schon auf, um zum Oberarzt zurückzugehen und sich dafür zu entschuldigen, dass sie seinen Vorschlag, Tobias unterzubringen, verbissen abgelehnt hatte, als etwas sie zurückhielt.
Am Ende des Ganges spielte ein Junge mit einem Papierflieger, sein Gesicht lag halb im Schatten, der Flieger fiel herunter, er hob ihn auf und drehte sich in ihre Richtung um und sah zu ihr hin, ihre Augen begegneten einander, einige Sekunden lang lächelte er. Sein Lächeln hatte keinen Sinn, es warf sie weit in sich selbst zurück, es erinnerte sie daran, wie Tobias nachts lächelte. Fast ihr ganzes Leben lag in diesem Augenblick auf einer haarfeinen Waage, die Stimmen um sie herum, der korridorartige, schmale Gang löste sich in eine Reihe von Augenblicken auf, in denen sie Tobias an sich gedrückt gehalten hatte, in denen sie eins gewesen waren, die besonderen Augenblicke in ihren Zimmern in der Wohngemeinschaft in Søbredden im Kopenhagener Vorort Gentofte, in der Wohnung in der Billrothstraße, unter den Linden des hügeligen Türkenschanzparks, am Teich mit seinen wechselnden grünen und blauen Farben, und sie stand auf und ging in die Sonne und das Rauschen der lauten Straße hinaus, wo sie ganz schmal und zerbrechlich wirkte. Sie war wieder auf einige unbekannte Ressourcen gestoßen. Die Ressourcen des Lächelns. Und hatte sie es nicht geschafft?
Sie geht aus Tobias’ Zimmer und lässt die Tür einen Spalt weit offen stehen. Sie will wieder zu Günther in das Schlafzimmer, aber als sie das weiße Bett sieht und Günther, seine Schultern und Haare und seinen Nacken, holt sie sich lautlos eine dünne Bluse aus dem Schrank, nimmt das Zigarettenpäckchen und begibt sich in das Wohnzimmer und setzt sich auf das Ledersofa. Ihre Zigarette im Aschenbecher auf dem Sofatisch ist ausgebrannt, sie will sich eine neue anzünden, hat aber das Feuerzeug im Schlafzimmer vergessen, ihr fällt ein, dass Günther immer ein Feuerzeug in seinem Jackett hat, und sie bewegt sich still über den glatten Boden und verharrt einen Augenblick lang im breiten, dunklen Korridor mit dem Garderobenschrank und den Gespenstern. Der Fußboden ist kalt, und ihre Hand zittert etwas, als sie die Tür zu der Nachtschwärze des Garderobenschranks mit seiner stillstehenden Luft und dem Geruch von Lack und schon lange entfernten Mottenkugeln öffnet, sie steckt die Hand in Günthers Jacketttaschen und findet nichts, dann tastet sie sich zu den Westentaschen der Jacketts vor und fühlt in einer das Feuerzeug und zieht es heraus. Am Feuerzeug klebt ein Papier und flattert zu Boden, sie macht das Feuerzeug an und hebt es auf. Es ist ein dünnes Polaroidfoto einer schönen, dunkelhaarigen Frau, sie lehnt sich entspannt an einen Baum in einem Park. Die Schatten der Baumkrone, die in starkem Sonnenlicht steht, geben ihren dunklen Augen einen besonderen Glanz, sie meint, sie schon einmal gesehen zu haben, weiß aber nicht, wo.
Es saust ihr in den Ohren, gedankenlos starrt sie im Licht des Feuerzeugs weiter auf die Frau und zündet in ihrem Zustand aus erregter Müdigkeit fast das Foto an, das Foto fällt ihr aus der Hand, und als sie es aufhebt, sieht sie hinten auf dem Foto einen schnell hingekritzelten Satz. Sie erkennt Günthers Schrift: »Maria 12 Uhr Karlsplatz«. Am liebsten möchte sie sofort ins Schlafzimmer gehen und Günther wecken, bleibt aber eine Weile mit dem Foto in einer Hand und dem Feuerzeug in der anderen stehen.
– Günther, flüstert sie halb gelähmt und sieht durch das Dunkel zu der hohen grauen Tür zum Schlafzimmer hin, der Abstand zur Tür scheint plötzlich sehr groß zu sein, und die Beine können sie nicht tragen und tragen sie doch an der Tür vorbei und durch das Esszimmer zum Sofa im anderen Zimmer, wo sie sich schwer setzt.
Sie kann das Zimmer nicht überblicken, aber dort, wo die Möbel als fest konturierte Schatten hervortreten, und die Matisse-Reproduktionen und die blauen handgedrehten chinesischen Vasen, die Günther für sie auf seiner China-Reise gekauft hat, in der dunklen Eintönigkeit der Nacht ihre Farbe verloren haben, weiß sie, dass sie sich selbst etwas vorgemacht hat. Sie hat sich etwas vorgemacht, weil er lügt, aber seine Art zu lügen ist subtil, beinahe fern und zufällig, so als nickte einem jemand mit wissendem Blick hinter einer Autoscheibe zu, während das Auto in die andere Richtung fährt, erst danach fällt einem ein, wer da gewinkt hat und was dieser kurze Augenblick der Vertrautheit bedeutete, ja, man beginnt zu zweifeln, ob es überhaupt Vertrautheit war, und schließlich, ob das Ereignis überhaupt stattgefunden hat. Vielleicht irrt man sich, und Günther ist gerade perfekt darin, Zweifel am vollen Gebrauch der Sinne zu säen. »Du bist müde«, wird er sagen, wenn sie glaubt, mit ihm verabredet zu sein, »du hast dich in der Zeit geirrt« oder »wir sind an einem anderen Tag verabredet, das hast du einfach vergessen« oder »du weißt doch, dass ich Tobias am Freitagnachmittag nicht holen kann«, wenn sie gerade am Vortag abgemacht hatten, dass er dieses eine Mal Tobias aus der Schule in der Gymnasiumstraße abholt.
Sie hat sich selbst etwas vorgemacht, wenn sie dachte, mit ihm rechnen zu können. Hatte sie nicht so sehr einen Mann und Gesellschaft in der Wohnung gebraucht, dass sie alle seine Ausweichmanöver als Missverständnisse hinnahm, die auf ihr Konto gingen? Ist es ihm nicht gelungen, sie als müde, unaufmerksam und immer etwas hinterherhinkend darzustellen und sich selbst immer als vorneweg, gegenwärtig und effektiv? Oh, selbstverständlich gibt es Tage, an denen sie von Tobias und der Arbeit müde ist, aber unaufmerksam? Nein, nicht unaufmerksam. Und es geht noch weiter, sie hat das Gefühl, Tobias interessiere ihn nicht, obwohl er etwas anderes sagt.
Unter Hunderten von Zimmern und Wohnungen der Zimmervermittlung in der uno-City hatte Günther vor einigen Jahren gerade ihres ausgesucht, als er aus Berlin seine neue Arbeit bei der uno antrat und nur ein Hotelzimmer hatte. Er verdiente mehr als sie und hätte sich etwas Teureres und Größeres nehmen können, aber er habe es nicht eilig, sagte er, er wolle sich umschauen, und vielleicht wäre die Arbeit überhaupt nichts für ihn, ein Headhunter hatte ihn eigens für Planungsarbeiten, eine Führungsfunktion, bei der es darum ging, Mittel von New York nach Wien zu transferieren und Wirtschaftspläne aufzustellen, ausgesucht. Er war nicht nur diplomierter, sondern auch »Prämierter-Wirtschaftswissenschaftler« aus Berlin, wie er scherzhaft gesagt hatte, als sie das erste Mal zusammen in der angenehmen luftgekühlten Kantine der uno-City gegessen hatten und übereinkamen, dass er einziehen würde (anfangs für einige Monate). Am Abend zuvor hatte er sich das Zimmer angesehen, und als Tobias nervös wurde und sich unwohl fühlte, weil er einen fremden Mann in der Wohnung sah, und plötzlich begonnen hatte, sie von ihm wegzuziehen, war Günther ganz ruhig geblieben und hatte sich Zeit genommen, in sein Zimmer mitzugehen, und hatte dort geduldig versucht, mit ihm zu sprechen, Tobias hatte sich erstaunlich schnell beruhigt.
Im Zustand der Isolation, in dem sie mit Tobias lebte, hatte diese Geste und auch sein Blick, der damals lebendig war, sie sofort angezogen; er strahlte, fand sie, sofort Vertrauen aus, obwohl sie nichts von ihm wusste, aber als er ihr schon am nächsten Tag in der Kantine im ganzen Menschengewühl eine kleine Rose mitbrachte und ihr halb im Spaß, halb im Ernst, Details seiner Ehe und anscheinend schmerzlichen Scheidung anvertraute, die er vor einigen Jahren in Berlin durchgemacht hatte, sah sie ihn von diesem Tag an mit anderen Augen als mit denen einer Vermieterin und Kollegin. Anders als der frühere Mieter, der ganz für sich lebte und zu festen Zeiten kam und ging und dabei ein paar Bemerkungen machte und mit dem Kopf nickte, wollte Günther abends gern mitessen, ja, nach einigen Wochen begann er, sie und Tobias und das Au-pair-Mädchen mit verschiedenen exotischen Gerichten zu überraschen, die er in der großen Küche hinter geschlossenen Türen zubereitet hatte (er hatte zwei Jahre an der deutschen Botschaft in Singapur gearbeitet), und nach dem Abendessen hatte er noch so viel Energie, Tobias mit Fotos von Sportwagen und Oldtimern zu unterhalten, die zu seinen vielen »Hobbys« gehörten (er selbst fuhr damals einen völlig überholten MG), und anscheinend machten ihm Tobias’ stark schwankende Konzentration und sein großes Bedürfnis nach Wiederholungen nichts aus.
Günthers Anwesenheit in der Wohnung und seine fast zu energische Mischung aus Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeiten, die Sine in anderen Zusammenhängen amüsiert hätten (jeden Freitag lud er sie in ein Restaurant mit Zigeunermusik nahe dem Burgtheater zum Essen ein und schenkte ihr eine Rose), weckten sie aus dem Schlaf der erotischen Sinne, in dem sie sich als alleinerziehende Mutter mit einer anstrengenden Arbeit und einem außerordentlich schwierigen Kind befunden hatte; ihre Vorbehalte gegenüber Männern und ihr Verdacht, dass kein Mann den Alltag mit ihr und Tobias teilen könnte, und ihre Erwartung, dass Tobias keinen Mann so nahe um sich haben könnte, der nicht sein Vater war (obwohl er ihn nie kennengelernt hatte), all das spielte keine Rolle mehr, und obwohl sie sich weiter einredete, dass Günther in seinem Anzug mit seiner glänzenden Mappe und dem wirtschaftlichen Fachwissen und seinem etwas zu hungrigen Ausdruck kein Mann nach ihrem Geschmack war, gab sie sich ihm doch hin; sie, die in ihren Verhältnissen zu Männern früher sexuell nie passiv gewesen war, ließ sich eines Abends von ihm ausziehen, nachdem sie einen Film im Fernsehen gesehen und bei den Spätnachrichten ausgeschaltet hatten und Tobias schon lange in seinem Zimmer schlief.
Ganz langsam und schweigend, fast sorgfältig, zog er ihr im warmen Zimmer an einem kalten Novemberabend, als der Regen gegen die Fenster der Balkontür schlug, Bluse und Rock und die schwarzen Strümpfe und Büstenhalter und Slip aus, und als sie nackt vor ihm stand, schien er zu zögern, ihren Körper zu bewundern, einige Sekunden lang hatte sie vor etwas Angst, das plötzlich einem voyeurartigen Blick glich, sie spiegelte sich in seinem Blick wie eine Sache, und der Blick veränderte sein Gesicht, seit diesen Sekunden, die von da an in ihrem Unbewussten gespeichert waren, lag hinter der Begierde in seinen Augen etwas Totes, aber sie schob es von sich, sie war selbst wie eine Dürstende auf einem Floß, von der Gier nach dem Körper eines Mannes gepackt, und als er schnell ihre Hand nahm und sie zum großen Bett im Schlafzimmer führte und sich die Kleidung herunterriss und sich über sie warf, war sie empfangsbereit und verlor sich in seinem Stöhnen und in seinen Küssen und der erregenden Wirkung seines Gliedes auf ihren Körper; so viele Jahre war es her, dass sie mit einem Mann zusammen gewesen war, dass ihr Körper bebte, und ihre Augen flatterten wie von elektrischen Stößen, sie versank auf einmal tief in sich selbst und hatte das Gefühl, in einem luftleeren, dunklen Raum zu schweben, und entdeckte erst zu spät, dass er nackt neben ihrem Bett stand und sie betrachtete, während er ihr ein Glas Wasser reichte.
Flüchtig sah sie Jons Gesicht vor sich und konnte ihre augenblickliche Verwunderung nicht unterdrücken, dass sich im nächsten Augenblick das regelmäßige Gesicht und die schmalen Augen eines anderen Mannes in der Dunkelheit über ihr abzeichneten.
– Geht es dir nicht gut?, fragte Günther und setzte sich auf die Bettkante.
– Nein, sagte sie, aber sie wusste nicht, was sie fühlte.
– Hast du mehr erwartet?
– Das ist alles so neu für mich, du musst mir etwas Zeit lassen, sagte sie und trank aus dem Glas, um ihm nicht in die Augen sehen zu müssen.
– Das nächste Mal wird es besser.
Sie nickte und dachte: »Vielleicht gibt es kein nächstes Mal.«
In dieser Nacht schlief er im Bett in seinem Zimmer, aber bereits in der nächsten Woche waren sie wieder zusammen, und er blieb in der Nacht bei ihr, ohne dass sie protestierte. In der ersten Zeit machte er Tobias Platz, als er plötzlich nachts auftauchte und in seiner halb sprachlosen und ungeduldigen Art darauf bestand, neben »seiner« Mutter zu liegen. Günther verschwand schweigend in sein Zimmer und erwähnte den Vorfall beim Frühstück oder in der Straßenbahn zum Schottentor mit keinem Wort. Auch stand er in der ersten Zeit einige Male mitten in der Nacht auf, wenn Tobias unruhig war, um sich »um ihn zu kümmern«, wie er sagte, und jedes Mal, wenn er das tat, öffnete sie sich ihm etwas mehr.
Aber das ist jetzt lange her, sie hat sich längst daran gewöhnt, dass sie allein für Tobias verantwortlich ist, so wie sie sich mit wachsendem Unbehagen daran gewöhnt hat, dass Günther ihn nicht nur übersieht, sondern seine Anwesenheit ihn zunehmend irritiert. »Wenn er nicht wäre«, sagte er eines Tages, »dann könnten wir ganz anders leben, jetzt ist es ein Problem für uns, ein Wochenende nach Paris zu fahren oder Ähnliches.« Oder an einem anderen Tag: »Wenn du nicht so viel mit ihm beschäftigt wärst, würdest du dich vielleicht mehr für mich und meine Arbeit interessieren.« Oder: »Es gibt doch Einrichtungen für Kinder wie ihn, siehst du denn nicht, wie sehr er dich beansprucht?« Oder: »Er wird nie normal werden, warum gestehst du dir nicht ein, dass du ihn ein Leben lang pflegen kannst und er immer derselbe bleiben wird?« Oder: »Du musst dich zwischen mir und ihm entscheiden, er ist ja der Mann in deinem Leben.«
Ihr Unbehagen gegenüber Günther richtet sich jetzt gegen sie selbst. Warum hat sie ihn nicht einfach gebeten zu gehen, warum klebt sie an ihm? Warum hört sie nicht auf, ihn damit zu entschuldigen, dass er nicht der Vater ihres Kindes ist, und woher kommt das schlechte Gewissen, das er ihr so vortrefflich einreden konnte? Ist ihre Lage wirklich so verzweifelt, und ist ihre Angst vor dem Alleinsein so groß, oder setzt sie alles daran, zu beweisen, dass sie sich in ihm nicht geirrt hat, weil sie um keinen Preis will, dass noch eine Beziehung mit einem Mann scheitert?
Aber ist sie an Jon gescheitert, ist nicht er an ihr gescheitert? Sie hat ihn zu sehr geliebt und wollte seine Fehler nicht sehen. War es nicht so?
Nein, sie will nicht an Jon denken. Sie denkt zu viel, sie ...
Das Zimmer um sie hat sich verwandelt, die Stühle, die weißen Wände, die Kaktuspflanzen im Fenster, die Balkontür mit ihrem verchromten Türgriff, Tobias’ gerahmte Zeichnung an der Wand, die einem Gesicht ähnelt, selbst die Dunkelheit draußen ist näher gekommen. Je deutlicher sich die Dinge abzeichnen, desto klaustrophobischer empfindet sie ihren Zustand. Sie friert und steht vom Sofa auf. Bleibt einen Augenblick stehen, Tobias ruft nach ihr, sie geht zu ihm, er wirft sich im Bett herum und ist verschwitzt, sie lässt sich neben dem Bett nieder und drückt ihn an sich.
– Da sind Fliegen, viele Fliegen, sagt er im Halbschlaf.
– Hier sind keine Fliegen, sagt sie und streicht ihm über die nasse Stirn.
– Tausend Bzzzzzzt, sagt er.
– Schlaf jetzt ganz ruhig, sagt sie und spürt, wie müde sie ist.
Nach einer Weile entspannt sich sein Körper, und er schläft fest ein. Sie lässt ihn vorsichtig wieder auf das Bett gleiten und geht aus dem Zimmer. Als sie wieder im Schlafzimmer ist und sich unter das Laken legt, bewegt sich Günther und murmelt mit dem Rücken zu ihr:
– Dieser ganze Krach ...
– Ich mache keinen Krach, sagt sie.
– Ich muss früh aufstehen, ich habe eine wichtige Verabredung ... Musst du nachts in der Wohnung rumlaufen?
– Ja, sagt sie müde und gleitet wieder in den Schlaf.
Günther dreht sich zu ihr um.
– Wenn das so ist, dann schlafe ich am besten allein.
– Tu es, kann sie sagen, ehe sie ganz einschläft. Aber er weckt sie.
– Hast du nicht gehört, was ich sage?
– Doch, sagt sie gereizt. Und jetzt lass mich schlafen.
Er packt sein Kissen, steigt aus dem Bett und geht zu der massiven Tür zum Korridor.
– Ich gehe jetzt, sagt er laut.
– Mit wem bist du morgen verabredet?, fragt sie und richtet sich im Bett halb auf.
– Meinem Chef, sagt er, das weißt du doch.
– Ich weiß nicht mehr viel von dir, sagt sie und fragt sich, wer da mit einem glänzenden Kissen in Händen halb nackt in der Dunkelheit steht.
– Das ist deine eigene Schuld, sagt er und öffnet mit einem Quietschen die Tür zum Flur.
– Wie heißt sie?
– Wer?
– Die auf dem Bild, die auf dem Foto in deiner Jacke?
– Ich weiß nicht, wovon du redest.
– Du weißt genau, wovon ich rede.
– Er macht einen Schritt auf sie zu und schlägt erregt mit dem Kissen an seine Seite.
– In meinen Taschen hast du überhaupt nichts zu suchen!
– Ich glaube, ich kenne sie, sagt sie unbeeindruckt, arbeitet sie nicht in deiner Abteilung?
– Wer, verdammt?
– Ist sie nicht deine Sekretärin? Hast du ein Verhältnis mit ihr?
Er setzt sich schweigend auf das Bett und starrt in die Dunkelheit. Es scheint, als falle er etwas in sich zusammen, er atmet schwer und fingert mit einer nervösen Bewegung an seiner Armbanduhr herum. Sein nackter Oberkörper glänzt, sie kann seine Augen nicht sehen, nur dass der Mund und eine Gesichtsseite sich zu einer leichten Grimasse verziehen, die sie so gut aus der letzten Zeit kennt. Bei einem Besuch im Haus seiner Eltern in Berlin-Wannsee hatte sie denselben arrogant-bitteren Ausdruck auf einem Foto von Günthers Großvater bemerkt, es stand auf dem Schreibtisch seines Vaters und zeigte einen jüngeren Mann in Hauptmannsuniform, und sie erfuhr, dass er 1943 bei Stalingrad umgekommen war. Plötzlich kann sie dieses Gesicht nicht aus ihren Gedanken verbannen.
– Sie heißt Maria Töpfer, sagt er, und sie arbeitet in meiner Abteilung, aber sie ist nicht meine Sekretärin, und ich habe kein Verhältnis mit ihr. Warum muss ich mir so etwas anhören?
– Und du triffst dich nicht morgen mit ihr auf dem Karlsplatz?
– Natürlich nicht, sagt er, ohne sie anzusehen.
– Entweder triffst du sie morgen, oder ihr hattet schon irgendeine Verabredung, sagt sie und beißt die Zähne zusammen.
Er dreht ihr das Gesicht zu. Schüttelt den Kopf.
– Was ist mit dir los? Du hast sie wohl nicht alle, du glaubst, alle würden dich betrügen oder dich hintergehen. Und weißt du, warum?
– Ich glaube, dass du mich »betrügst«, sagt sie, aber er hört ihr nicht zu, erregt hat er sich aufgerichtet und geht auf sie zu.
– Weißt du, warum?, sagt er und hält den Atem an. Es ist immer dasselbe. Es ist wegen Tobias. Du kommst nicht darüber hinweg, dass er so ist, wie er ist, das »Leben« selbst hat dich betrogen, nicht? Er ist nicht so geworden, wie du ihn haben wolltest. Aber das kannst du dir nicht eingestehen. Du hasst ihn, du hasst dein eigenes Leben, aber das geht nicht, das kannst du nicht ertragen, darum ist weder er noch bist du schuld daran, sondern selbstverständlich ich.
– Tobias hat hiermit überhaupt nichts zu tun, sagt sie und hat einen Augenblick lang vor ihm Angst, wie er da einige Meter von ihr entfernt mit einer geballten Faust dasteht. So hat sie ihn noch nie gesehen.
– Und ob er damit zu tun hat, sagt Günther mit erhobener Stimme und Speichel in einem Mundwinkel.
– Du belügst mich doch und nicht er, sagt sie und steigt aus dem Bett und will an ihm vorbeigehen, aber er packt sie an einem Arm und hält ihn fest.
– Ich lüge nicht, ich lasse mir nicht gefallen, dass du so etwas zu mir sagst!
– Und was willst du jetzt tun: mich schlagen?, sagt sie und starrt ihm in die Augen.
Er bleibt erregt mitten in einem Satz stecken und ist einen Augenblick lang ratlos, sie sieht die Wut und das nervöse Zucken in seinen Augen, dann lässt er mit einem leisen Seufzen ihren Arm los und geht rückwärts hinaus, als hätte er plötzlich vor sich selbst und davor Angst, was in ihm lauert, und verschwindet im Flur.
Sie ist erleichtert, sie überlegt im selben Augenblick, wie sie ihn los wird, sie hofft, dass er am Morgen nicht da sein wird, wenn sie und Tobias aufwachen. Sie begreift nicht, was sie an ihm gefunden hat.
Sie legt sich schnell unter das Laken und liegt lange wach und lauscht in die Dunkelheit, während sie ganz zusammenhangslos darüber nachdenkt, ob er vielleicht zu Tobias hineingeht, doch was sollte er mit Tobias? Wie kann sie nur so denken? Das muss die Hitze sein, ja, es ist die Hitze, sie ist erschöpft ...
Nebenan knirscht der Fußboden, er geht im Wohnzimmer herum. Was macht er?
Sie atmet schneller, steigt aus dem Bett, durch die Tür, mitten in einer seltsamen Stille hört sie jemanden weinen, aber sie kennt das Weinen nicht, es ist nicht Tobias, der da weint, sondern er. Günther sitzt im Wohnzimmer und weint.
Sie öffnet die Tür zum Wohnzimmer. Günther, der mit dem Rücken zu ihr auf einem Stuhl sitzt, fährt leicht zusammen und nimmt blitzschnell die Hände vom Gesicht, als hätte sie ihn auf frischer Tat ertappt.
– Du musst entschuldigen, sagt sie, ich wollte nicht, dass ...
– Was?, sagt er trotzig.
– Ich wollte dich nicht verletzen ...
– Was willst du dann?, sagt er.
– Ich habe das Foto in deiner Jacke gefunden, ich war mir sicher ...
– Und was denkst du jetzt?
– Ich weiß es nicht, sagt sie. Ich bin müde, vielleicht irre ich mich, lass uns schlafen, dann sprechen wir morgen darüber.
– Das reicht nicht, sagt Günther, steht auf und bleibt einige Meter von ihr entfernt stehen.
– Lass uns doch schlafen, wir müssen beide morgen arbeiten, sagt sie und fasst sich erschöpft an die Stirn.
– Ich habe keine »Affären« mit anderen Frauen, begreifst du das?, sagt er mit etwas schriller Stimme.
Sie sieht ihn an, wie er dasteht: in seinen Shorts, nackt, entblößt, aggressiv, sie kommt von ihm nicht los, sie kann ihm nicht vertrauen. Sie ist gefangen, vielleicht dauert es die ganze Nacht, bei seiner Beharrlichkeit und Energie kann es stundenlang weitergehen. Sie sagt:
– Dann ist es so, Günther. Du hast keine Affären. Okay?
– Ich habe keine Affären, wiederholt er und starrt sie an.
– Nein, Günther, du hast keine Affären.
Er macht einen Schritt auf sie zu und will mit einem leichten, selbstsicheren Lächeln die Arme um sie legen, sie entzieht sich ihm.
– Ich will heute Nacht gern allein schlafen, sagt sie und hält seinen Blick fest.
– Warum?
– Ich muss etwas für mich allein sein.
– Nein, du willst etwas Abstand zu mir, nicht?
– Du hast den Abstand zu mir gewollt, sagt sie.
– Das sehe ich nicht so, sagt er und will sie wieder umarmen, aber sie ist wieder nicht dafür empfänglich und geht ins Schlafzimmer. Sie kriecht unter das Laken, und er steht einen Augenblick schweigend in der Türöffnung und betrachtet sie. Sie weiß nicht, was er denkt, sie kennt ihn nicht mehr. Hat sie ihn jemals gekannt? Er dreht sich plötzlich um und verschwindet von der Tür und aus dem Zimmer. Kurz darauf hört sie, wie er die Tür zum Zimmer neben der Küche schließt. In der Wohnung ist es wieder still, nur wenige Laute dringen aus der Stadt zu ihr herein, sie wälzt sich im Bett herum und kann nicht schlafen.
Hat sie ihn jemals gekannt? Wie konnte sie mehrere Jahre lang mit einem Mann zusammenwohnen, ohne ihn zu kennen? Was ist los mit ihr? Stimmt etwas nicht mit ihr?
Sie erinnert sich an seinen Vater, den Bankdirektor aus Berlin, und die Mutter, etwas verzagt und grau, von ihrem ersten Besuch in Wien, sie erinnert sich an ihre zögernde und oberflächliche Konversation im Restaurant in der uno-City und ihr unverhohlenes Erschrecken, als sie ihnen in der Wohnung Tobias vorstellten und Günther mit einer Art geschickten Entschuldigung Tobias als »fast normal« präsentierte, obwohl Tobias sich gleich vor ihnen in seinem Zimmer versteckte und es nur stotternd und mit vielen Gebärden schaffte, einige Worte zu ihnen zu sagen. An ihren Gesichtern konnte sie ablesen, dass sie nicht verstanden, was ihr reicher und gut ausgebildeter Sohn mit ihr und ihrem gestörten Kind wollte, wenn ihm die ganze Welt offenstand und er bloß mit den Fingern zu schnippen brauchte, um in Wien eine Frau zu bekommen. »Ist sie nicht schön?«, hatte Günther mehrere Male zu seinen Eltern gesagt, während sie zuhörte, und der Vater nickte anerkennend zu ihr hin und gab ihr das Gefühl, ein Ausstellungsstück zu sein.
Sie hatte dieses Erlebnis so wie viele andere verdrängt, aber in ihrer Schlaflosigkeit ist ihr Körper am Überkochen, und flimmernde Bilder aus den gemeinsamen Jahren mit Günther überlagern ihre Müdigkeit, jedoch immerzu in einem Clair-obscur-Licht; ihre gemeinsamen Spaziergänge mit Tobias im großen grünen Schönbrunner Park und im Zoo bei Elefanten und Tigern, oder ihre Pausen an Sonntagnachmittagen auf dem Platz vor dem Dom oder in den grauschimmernden U-Bahn-Zügen sind farblos und grell erleuchtet wie die Untergrundzüge selbst und liegen von einem Augenblick zum andern wieder im Dunkeln, als ob im Untergrundsystem plötzlich der Strom ausfiele und Kinder in Panik zu schreien begännen.
Etwas in ihrem stillen, verschwitzten Körper schreit auch mitten in der Dunkelheit, aber sie weiß nicht, woher der Schrei kommt, sie weiß nicht, ob sie träumt oder wach ist.
Das alles breitet sich um sie herum aus: Sie ist im Nachtcafé in Paris mit den erregten, redenden und lachenden Menschen um sich herum und dem unruhigen Fötus im Bauch; sie ist in Tanis im Grab mit der trockenen Erde an den Händen und der Sonne, die auf den Hinterkopf brennt, und der kaum erkennbaren balsamierten Leiche mit ihrem schmalen Schädel und dem scharfen Nasenbein, und sie findet den Herzskarabäus nicht weit vom vertrockneten Mund der Leiche und den Hautresten, die noch immer von Harz glänzen, sie schaut hoch, und unter dem segelnden weißen Himmel wird ihr schwindlig; sie ist im Dorf vor Mogadischu, wo die trockene Erde aufgerissen ist und eine längere Schlange magerer schwarzer Frauen, ihre ausgehungerten, dahindämmernden Kinder auf den Armen, vor Kirstens und ihrem Wagen der dänischen Hilfsorganisation mit den Paketen steht, ein Kind klammert sich an ihr Knie, die Fliegen umschwirren eine Wunde an seiner Schulter; sie sitzt im Haus in Sydney ihrer Mutter gegenüber, die Sonne fällt schräg über das Gesicht der Mutter, sie weiß nicht, ob sie lächelt oder weint; sie geht an einem frühen Dezembermorgen mit ihren Koffern und Tüten die Straße an der Lower East Side entlang und will sich nicht umdrehen und blickt doch zurück: Oben im ersten Stock, im Zimmer hinter dem verdreckten Fenster steht er, ein Schatten, Jon. Er hebt die Hand zum Gruß.
Sie schläft, endlich schläft sie.
»Der Tod ist die unbeleuchtete Seite des Lebens«, schreibt Rilke, aber gilt auch, dass das Dasein die erleuchtete Seite des Todes ist? Man kann leben, und doch können die Sinne tot sein; man kann tot sein und doch in der Erinnerung eines anderen leben. Das Gefühl der Gegenwärtigkeit des Todes kann das Lebende noch lebendiger machen, selbst die Sekunden, die zuvor in ihrem taktfesten unmerklichen Von-der-Stelle-Bewegen bedeutungslos waren, werden sinnvoll, schicksalsschwanger, doch warum hat die Abwesenheit der Liebe, die auch eine Art Tod ist, nicht dieselbe erregende Wirkung? Warum lähmt es sie? Warum hört die Musik auf?
Sine erwacht, als Tobias neben dem Bett steht und sie am Arm zieht.
– Mutti, Mutti, es spät, es spät, sagt er in seinem Schlafanzug, tritt einen Schritt zurück und sieht verloren aus. Im selben Moment öffnet Günther die Tür vom Korridor zu ihrem Zimmer, er trägt schon die dunklen Hosen, das blaue Hemd und den Schlips und tritt einen Schritt vor. Der Duft des Aftershaves in seinem glatt rasierten Gesicht kommt in Wellen auf sie zu.
– Du hast verschlafen, sagt er, ohne eine Miene zu verziehen, aber ganz ruhig, das Frühstück ist fertig.
– Warum hast du mich nicht geweckt?, sagt sie und steigt auf den Fußboden und zieht Tobias an sich.
– Du hast heute Nacht nicht viel geschlafen, oder?, sagt Günther und geht vor ihnen ins Zimmer zum gedeckten Tisch. Tobias klammert sich an sie, sie bringt ihn mit einiger Mühe dazu, sich auf einen Stuhl zu setzen und gießt ihm sofort etwas Saft ein, aber weil sie noch nicht ganz wach ist, vergisst sie, das Glas ganz voll zu gießen, wie sonst, und er wackelt unruhig mit dem Stuhl und zeigt auf das Glas, bis sie ihren Fehler bemerkt. Sie schmiert für ihn die üblichen beiden Scheiben Brot mit Marmelade, während sie versucht, zu sich zu kommen.
Ein Sonnenstrahl vibriert als Kante an einer Zimmerwand, wo eine Reproduktion von Noldes »Erregte Menschen« hängt, das Gelb glüht im Maskengesicht des Vordergrunds; der Himmel über der schweigenden Front des gegenüberliegenden Hauses ist dunstig blau und wolkenlos, und sie hat schon das Gefühl eines warmen Tages. Günthers Finger arbeiten schnell mit Messer, Brot und Kaffeetasse, sein Gesicht ist verschlossen, er bemerkt nicht, dass sie ihn betrachtet. Plötzlich steht er auf und gießt ihr Kaffee ein. Ihre Augen begegnen einander, ohne sich wiederzuerkennen, wie zwei glatte Steine, die übereinander hinweggleiten. Dennoch sagt sie:
– Hast du im Zimmer schlafen können?
– Ich habe ausgezeichnet geschlafen, sagt er und lächelt mechanisch.
– Ich glaube nicht mehr richtig an das hier, entfährt es ihr.
– Warum nicht?, sagt er und sieht erstaunt aus.
– Mach deine Augen auf!, sagt sie.
– Ich habe sie auf, sagt er, und du bist immer noch schön.
– Es ist egal, ob jemand schön oder hässlich ist, es geht um etwas ganz anderes.
Er lacht etwas, trocknet sich den Mund an einer Serviette ab, steht auf, geht zu ihr hin, beugt sich über sie und küsst sie auf den Hals. Flüstert:
– Ich liebe dich.
Im selben Moment stößt Tobias mit einer ungeschickten Bewegung das Glas mit dem Saft zu Boden und beginnt ängstlich zu weinen. Sie drückt ihn an sich, während Günther einen Lappen und einen Eimer aus der Küche holt und beginnt, den Fußboden zu wischen und die Scherben aufzulesen.
Sie führt den erschrockenen und murmelnden Tobias in sein Zimmer und beginnt, ihn anzuziehen. Aber jedes Mal,





























