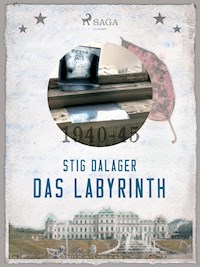Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
An zwei Tagen im Juli 1944 werden die Fesseln der Geschichte für einen Moment abgestreift. Mitten im Zweiten Weltkrieg scheint der Frieden in Nazi-Deutschland auf einmal zum Greifen nah. Claus Schenk Graf von Stauffenberg plant ein Attentat auf Adolf Hitler. Er weiß, er hat nur eine Chance, möchte er den Führer erschießen. Die Geschichte zeigt, es wird ihm nicht gelingen und er selbst wird für seine mutige Tat wie viele anderer seiner Mitwisser und Mitplaner mit dem Leben bezahlen. Stig Dalager erzählt in diesem fesselnden Roman die wohl dramatischsten 48 Stunden der deutschen Geschichte.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stig Dalager
Zwei Tage im Juli
Roman
Aus dem Dänischenvon Heinz Kulas
Saga
Mit diesem Roman stehe ich tief in der Schuld bei einer Reihe hervorragender historischer Werke über Claus von Stauffenberg und Adolf Hitler. Darunter seien besonders Werner Masers Adolf Hitler: Legende, Mythos, Wirklichkeit (München, 1971) erwähnt, Alan Bullocks Hitler und Stalin – Parallele Leben (London, 1991), Peter Hoffmanns Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder (Stuttgart, 1992), Joachim Fests Staatsstreich – der lange Weg zum 20. Juli (Berlin, 1994), Stig Hornshøj-Møllers Førermyten (Der Führermythos, Kopenhagen, 1998), Ian Kershaws Hitler, 1–2 (London, 1997-2000). Außerdem sind mir die Angaben in Albert Speers Autobiographie Erinnerungen (Neuausgabe: Berlin, 1999) von besonderem Nutzen gewesen. Natürlich ist keiner der Verfasser dieser Bücher für den Bericht in dem vorliegenden Roman verantwortlich, dafür stehe nur ich selber ein, und zwar um so mehr, als er eine Fiktion ist, die sich auf das Wissen der Historiker stützt. Indes wäre der Roman ohne dieses Wissen nicht entstanden.
Ich möchte dem ehemaligen Kulturattaché an der deutschen Botschaft in Kopenhagen, Herrn Boris Ruge, Enkel von Fritz von Schulenburg und Charlotte von Schulenburg, für sein Engagement und seine Unterstützung meines Vorhabens danken. Darüber hinaus danke ich Marion Gräfin Dönhoff für ihre Ermunterung und die Mitteilung ihrer persönlichen Erfahrungen mit einigen der am Putschversuch Beteiligten sowie für ihren Eindruck von der Begegnung mit Adolf Hitler.
Stig Dalager
Wohin sollt’ ich fliehen?
Ich tat nichts Böses. Doch jetzt fällt mir ein,
Dies ist die Erdenwelt, wo Böses tun
Oft löblich ist und Gutes tun zuweilen
Als schädlich gilt und töricht.
Lady Macduff in William Shakespeares Macbeth.
Nach Richard Lányi: Shakespeares Dramen, 1934/35,bearbeitet von Karl Kraus, Kösel-Verlag, München, 1970.
I
19. Juli 1944
Ein wundervoller blauschwarzer Himmel, die verdunkelten Häuser und Gebäude in Steglitz gleiten langsam vorüber, hier ist nichts von der gespenstischen Stimmung in der Mitte Berlins, keine grauen Gesichter, keine Trümmer, kein Kalkstaub, kein Gasgeruch, kein Schwefel; er ist müde und eigenartig wach zugleich, der dumpfe Schmerz im rechten Armstumpf meldet sich plötzlich, doch er ist so daran gewöhnt, ihn zu verdrängen, daß kein Platz für ihn ist, daß er ihn fast heiter stimmt; nur wenn man in diesem Moment sein Gesicht durch die Scheiben des kleinen schwarzen Mercedes mit Schweizer am Steuer sähe, würde man sich über den grauen Schimmer auf der Haut und die leicht aufgelösten Gesichtszüge wundern, die an einen Schlafwandler erinnern.
Viele Wochen lang hat er nachts kaum mehr als zwei, drei Stunden geschlafen, die Telefone klingeln unablässig, ohne Rücksicht auf Zeit und Ort, und das Band der Gespräche ist endlos, er kann nicht mehr wie früher auf einem nackten Stein einschlafen. Manche Nacht hat er in seinem Bett in der Tristanstraße geschlafen, während es Bomben auf die Stadt regnete und das Echo der Flak in der Nacht zu hören war.
Vor drei Wochen hatte ihm der Chirurg Professor Ferdinand Sauerbruch nach ihrer Besprechung mit einer Reihe von Generalen und Politikern in seinem Haus in Grunewald zu einigen Wochen Erholung geraten, doch er hatte es in den Wind geschlagen.
– Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, sagte er und begann von seinen Putschplänen zu reden.
Sauerbruch wollte ihm nicht zuhören.
– Ihre Verwundungen sind zu schwer, Ihr körperlicher Zustand ist zu schlecht, Ihre Nerven sind nicht gut genug, Sie werden zu leicht Fehler machen! sagte er in seiner gewohnt direkten Art.
Er regte sich auf, war verletzt, stand auf und wollte gehen, Sauerbruch hielt ihn zurück und versuchte, ihn zu beschwichtigen. Er fühlte einen leichten Schwindel, Sauerbruchs massive Gestalt verlor sich in dem ohnehin schon schwach erleuchteten Raum, wo eine Lampe dank der unsicheren Stromversorgung plötzlich unheildrohend flakkerte.
– Sie wissen, daß ich 37 Hitlers Arzt war, sagte Sauerbruch und kniff die Augen zusammen, – schon damals war er für mich ein Grenzfall zwischen verrückt und genial. Er ließ deutliche Zeichen von Größenwahn erkennen, sein starrer Blick hatte mich erschreckt. Ich weiß noch, wie ich zu einem Freund sagte: Herr Hitler hat das Potential in sich, der wahnsinnigste Verbrecher zu werden, den die Welt gekannt hat. Mein Freund lachte und sagte: Was soll man machen? Die Deutschen lieben ihn. Er ist der Rattenfänger unserer Zeit.
– Worauf wollen Sie hinaus? fragte er.
– Ich unterstütze Sie hundertprozentig bei dem, was Sie tun müssen. Doch momentan fehlt Ihnen die Kraft, sagte Sauerbruch mit Betonung auf momentan und trocknete sich die schweißnasse, gefurchte Stirn mit einem weißen Taschentuch.
Aber keiner kann ihn mehr überreden umzukehren. Im Gegenteil, er überredet andere zum Mitmachen. Er macht weiter, obwohl er an ihren Gesichtern sehen und ihren Stimmen hören kann, daß sie verwirrt sind und ihm gewiß nur halb folgen können. Obwohl sie ihn im Stich lassen, obwohl er sich fast selber im Stich ließ.
Er muß sich ständig vor Augen halten, wo ihre Grenzen sind, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Das gilt auch für General Wagner, den er vor einigen Stunden in Zossen besucht hat, um die Pläne für morgen durchzugehen. Wagner wollte unbedingt Hasen vor die Flinte bekommen, und als sie ins Gelände gingen, dachte er: Nur das Hasenschießen, sonst interessiert ihn gar nichts.
Nein, er ist ungerecht. Er ist müde und übertreibt.
Sein rechtes Auge folgt der Häuserreihe, sein linkes ist weg, eine Klappe verdeckt die Augenhöhle. Vor einigen Wochen noch hätte Schweizer das Glasauge in einer Schachtel im Auto aufbewahrt, jetzt aber ist es egal.
Er bittet Schweizer, das Auto anzuhalten, dieser nickt und biegt schweigend in die einsame Straße vor der Kirche ein.
In den letzten vierzehn Tagen ist er mindestens zwanzig Jahre gealtert, falls Alter sich überhaupt messen läßt. Doch seine Instinkte, sein Körper und sein Willen sind immer noch erst siebenunddreißig Jahre alt. Was hatte Trott vor einer Stunde zu ihm gesagt, als er ihm in seinem kleinen Haus gegenübersaß? Ich bin mindestens sechzig und werde nie jünger werden. Ich bin bereit zu sterben, aber wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Er sieht Trotts große, dünne Gestalt vor sich, das feine Lächeln unter der scharfen Nase. Wenn dieser Mann lächelt, dann verändert sich die Welt.
Er steigt aus dem Auto und geht in Richtung der dunklen Kirche, seine langschäftigen Stiefel federn unter ihm, und die kühle Luft und der Himmel machen ihn wach, wieder der Himmel; er ergreift mit seinen drei Fingern den Handgriff der Pforte, dreht ihn halb herum und geht hinein.
Seine Schritte auf dem Marmorfußboden hallen unter den Gewölben der kleinen Kirche im Dämmerlicht wider, ein Küster wendet sich apathisch nach ihm um und verschwindet leicht hinkend hinter einem Vorhang, er ist mit der Stille und den schwach flackernden Lichtern mehrerer Altäre allein. Sein Blick fällt auf ein dunkles Gemälde, das Mariä Himmelfahrt zeigt, in ihrem schwach erleuchteten Gesicht ist ein melancholisches, frommes Lächeln zu erahnen. Er tritt vor den Altar, zündet eine Kerze an, geht einige Schritte zurück, und anstatt die Hände zu falten, umfaßt er mit den drei Fingern den lose herunterhängenden rechten Uniformärmel. Er schließt die Augen und murmelt ein Gebet. Plötzlich fällt ihm mitten im Gebet etwas ein, und er lächelt. Als er einmal vor dem Marienbild in der Kirche in Lautlingen stand – er war drei – hatte er zu seiner Mutter gesagt: Ich will nicht nach oben in den Himmel, ich will immer hierbleiben – oder doch in den Himmel, aber nicht ins Fegefeuer und die Hölle.
Er ist ruhig, und dennoch zittern die drei Finger der linken Hand leicht, er nimmt die Hand vom Ärmel und geht weiter in die Kirche hinein, sucht sich eine Bank und läßt sich auf das harte Holz gleiten.
Hölle. Hiersein. Himmel.
Er ist verzweifelt, hatte er nicht zu Ludwig Thormaehlen gesagt: – Ich bin fast darüber verzweifelt, daß ich wieder gesund wurde, daß ich nach Tunesien wieder auf die Beine kam. Ich bin verzweifelt, weil ich vielleicht nicht die Aufgabe erfüllen kann, die mir zugefallen ist.
Bilder kommen über ihn, Worte, Geräusche, ferne Bewegungen, Landschaften und Gesichter, die sich ineinander verweben und plötzlich hervortreten. Eine Welle von Lärm und Wut in den innersten Hüllen von Hirn und Rückenmark und ein Gefühl von Doppeltheit, als ginge ein anderer mit ihm, jemand, den er kennt und der ihm im stillen Kirchenraum dennoch fremd ist.
Hat er nicht seit je in eben dieser Räumen, die er selten aufsucht, das Gefühl von einem anderen gehabt, einem anderen, dessen Atem er im Nacken spürt und der seine Gesichtszüge trägt, jedoch glücklicher, freier, fast etwas mystisch und unbegreiflich größer ist als er, den er mit den Wäldern verbindet, den Tälern, den Bergen in Oberfranken und mit Namen wie Lautlingen, Jettingen, Amerdingen, Greifenstein, oder mit bestimmten Strophen in Stefan Georges Gedichten, und der sich plötzlich in Träumen, aus denen er in letzter Zeit nachts erwacht ist, als Fata Morgana eines Jungen herauskristallisiert, der da durchsichtig einige Meter vor seinem Bett steht und ihm zulächelt. Ruft er ihn nicht?
Er bildet sich ein zu wissen, wer es ist. Bei der Erstkommunion vermißte er ihn und flüsterte ihm etwas zu, dem Zwillingsbruder Konrad Maria, tot, schon am Tage nach der Geburt fort, aber dennoch wie eine Membran anwesend, eine Verdoppelung des Lebenden und Toten, wodurch manchmal sein Sehvermögen und seine Energie gestärkt sind und er das Gefühl hat, beschützt zu sein, unverwundbar trotz seiner Wunden; manchmal jedoch das Gefühl von Heimatlosigkeit, Halbheit.
Alt-jung, heimatlos sehend, ja, er sieht. Sah er nicht in Hitlers einschüchternden Blick, als er ihm 42 im aufgeheizten Hof des Heereshauptquartiers in Winniza, wo die Fliegen und Mücken eine Plage waren, zum erstenmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand und Hitler am Ende den Blick abwenden mußte? Sah er nicht, wie hinfällig und psychopathisch er war, als er ihn fast zwei Jahre später in Begleitung des geschminkten und unter Morphium stehenden Göring auf dem Berghof wiedertraf? In diesen großen Räumen mit Panoramablick und voller geschmackloser Schilderungen und seltsamer Drapierungen und von servilen SS-Leuten und Ohrendienern bevölkert, hier hatte er beim Führer, der in einer plötzlichen Eingebung und aus Eitelkeit Truppenteile und Divisionen auf den Karten hin und her schob, als wären es Spielzeugheere, Verfall und Anzeichen von Irrsinn erlebt. Seine verschleierten Augen und der leiernde Redestrom, jäh von Kunstpausen unterbrochen, in denen er alle Anwesenden forschend betrachtete oder einen fernen Punkt in den Berchtesgadener Bergen fixierte, weckte bei allen Anwesenden die Angst. Man erwartete einen seiner sattsam bekannten Wutanfälle, die manchmal in einer kompletten und momentanen Lähmung seiner ganzen Beredsamkeit kulminierten; in solchen Augenblicken konnten ihm die Stimme und auch die Luft wegbleiben, um im nächsten Augenblick weiterzumachen, als wäre nichts geschehen.
Er hatte gesehen, was er bisher nur durch Gerüchte oder Berichte aus zweiter Hand oder aus sinnlosen Führerbefehlen kannte, die für Zehntausende von Soldaten Gefangenschaft, Elend und Tod bedeuteten und die er in seiner Zeit in der Organisationsabteilung des Generalstabs in Winniza mit aller Kraft abzuwenden versucht hatte. Er hatte in dieser Gesellschaft innerhalb von fünf Minuten die Intrigen und die Rücksichtslosigkeit der obersten Heeresleitung in Winniza durchschaut und wiedererkannt, die, gelähmt und dem Führer zu Munde redend, seinen Befehl, sich nicht zurückzuziehen, gutgeheißen und die Armee von Feldmarschall Paulus im eisigen Niemandsland der Sowjetunion im Stich gelassen hatte. Er hatte in Hitlers, Görings, Keitels Nonchalance und Egozentrik den schwindelerregenden Abstand zwischen den Führern und den gemeinen Soldaten wiedererkannt, die ohne ausreichende Bekleidung und Material in den Schlammpfützen, Eiswüsten und Frostnächten der russischen Steppen ihr Leben aufs Spiel setzten.
Als er sah, wie es um die Bewegungsmöglichkeiten auf dem Berghof stand, hatte er zu Generalmajor Stieff gesagt: – Sehen Sie nicht, daß man sich in der Nähe des Führers nahezu zwanglos bewegen kann?
Doch Stieff bestand darauf, daß der Führer unberechenbar war und jeden zweiten Tag SS-Wachen in die Konferenzräume befahl, die alle fanatisch bewachten und sich bei der geringsten falschen Bewegung auf jeden stürzen würden.
Und dann lachte Stieff sein plötzliches, überlegenes Lachen, das ihm bestätigte, sich nicht geirrt zu haben, als er ihn dem jungen von dem Bussche gegenüber einen nervösen Rennreitertyp genannt hatte.
Stieff, der nicht nur zu ängstlich war, als es darauf ankam, sondern ihn auch im Stich gelassen hatte und erst vor vier Tagen in der Wolfsschanze die Aktentasche mit Sprengstoff außerhalb seiner Reichweite gebracht hatte.
Hauptmann Bussche hatte ihn dazu bewegt, als er Ende November des letzten Jahres durch Schulenburgs Vermittlung mit ihm im Quartier des Ersatzheeres in Düppel zusammentraf. Nachdem er an der Ostfront dreimal durch Brustdurchschuß verletzt worden war, saß der Mann mit den hellen Haaren und den hellblauen, aufmerksamen Augen nun in dem spartanischen Raum vor ihm und war davon besessen, Hitler auszulöschen. Während Bussche ihm abwechselnd in die Augen sah und seine Hände anstarrte, erzählte er mit bebender Stimme von einer Erfahrung in Dubno in der Ukraine, bis er schließlich schwieg:
Am Ende eines großen Platzes hatten SS-Leute ein großes Loch ausgehoben, zu dem sie jetzt große Gruppen von Juden – Kinder, Frauen, Männer – führten und ihnen befahlen, sich auszuziehen und in das Loch hinunterzusteigen, während sie mit ihren Gewehren und Pistolen herumfuchtelten; auf dem Boden lag schon eine Schicht aus Körpern, einige von ihnen zuckten immer noch; jetzt wurde den Juden befohlen, sich mit dem Gesicht nach unten auf die Ermordeten zu legen, worauf man sie mit Schüssen in den Hinterkopf tötete.
– Es war ein ganz gewöhnlicher Tag, die Sonne schien, und plötzlich tat sich der Boden unter mir auf, sagte Bussche, plötzlich war ein ganz selbstverständlicher, immer gegenwärtiger Zusammenhang zwischen dem, was Menschen einander antun konnten, und dem, was ausgeschlossen war, eine ganz natürliche Ordnung des Universums verschwunden. Ich fühlte ein großes Verlangen, mit den Juden in den Tod zu gehen oder laut zu schreien, und ich berichtete am selben Tag meinem Regimentschef alles, was ich gesehen hatte, und forderte ihn auf, diese Ungeheuer sofort zu verhaften, doch er lehnte ab. Die sind zu stark, sagte er, wir erreichen nichts weiter, als daß wir selber erschossen werden.
Er sagte Bussche, er habe Kenntnis, daß Tresckow, Schulenburg, York und Beck auch von den Massenmorden an den sogenannten rassisch Minderwertigen, insbesondere den Juden wüßten, ebenso hätten sie Kenntnis, daß Millionen russischer Kriegsgefangener umgekommen waren, erfroren, verhungert, in sogenannten Lagern oder unter freiem Himmel an beliebigen Stellen hinter der Front erschossen.
– Ich zweifle nicht daran, daß die Morde an den Juden vom Führer persönlich und direkt angeordnet sind, sagte er, – und daß auch das Heer Blut an den Händen hat. Vor allem wegen dieser Verbrechen müssen wir handeln.
Bussche schien seine Klarheit in dieser Frage zu überraschen und konnte anscheinend nicht glauben, daß so viele andere im tiefsten Innern erschüttert waren und auch Bescheid wußten; er hatte sein Wissen viel zu lange für sich behalten und war gezwungen gewesen, es vor den meisten geheimzuhalten, so geheim, daß es fast unwirklich geworden war, und erst jetzt, da er sich das Grauen wieder in Erinnerung rief, verlor er für einige Minuten den Boden unter den Füßen. Das Grauen war wirklich und von dieser Welt, wenn jedoch diese Welt so war, wo war dann die Erlösung?
Er sieht vor sich, wie Bussche, als er auch von einem lutherischen Standpunkt aus über die Berechtigung des Tyrannenmordes sprach (er wies auf Luthers Äußerungen zum Recht auf Widerstand hin), wieder ganz anwesend war und ihn unterbrach: – So etwas ist für mich überhaupt nicht mehr wichtig, über diesen Punkt bin ich hinaus.
– Wie halten Sie’s mit dem Soldateneid? fragte er ihn.
– Der Soldateneid beruht auf gegenseitiger Treue, er ist jedoch von Hitler gebrochen worden und deshalb ungültig, sagte Bussche und wirkte ganz klar.
Sie sprachen darüber, wie ihm Stieff als Mitverschwörer Zugang zu Hitlers Lagebesprechung in der Wolfsschanze oder auf dem Berghof verschaffen könnte, und er deutete an, daß Bussche das Attentat auf Hitler selber ausführen sollte. Als er ihm klarmachte, daß Stieff nicht dazu imstande war, wurde Bussche unruhig.
– Er hat Zugang zu Hitler und hält Deutschlands Schicksal in der Hand, sagte er, als würde er laut denken, – ich verstehe ihn nicht.
Eine Stunde später willigte Bussche ein, das Attentat auszuführen, und war bereit, am 23. November anläßlich einer Vorstellung von Ostfrontuniformen im Führerhauptquartier in Mauerwald sich zusammen mit Hitler in die Luft zu sprengen – er wollte den Sprengstoff mit einer Handgranatenzündung am Körper tragen und sich im richtigen Augenblick über Hitler werfen. Doch genau wie so viele andere geplante Attentatsversuche wurde nichts daraus. Hitler hatte einen Teufelskreis um sich gezogen – oder waren es reine Zufälle, die ihm immer wieder das Leben retteten? Die Vorführung wurde abgesetzt, die benötigten Uniformen verbrannten einen Tag vorher bei einem Luftangriff vor Berlin in irgendwelchen Eisenbahnwagen.
Bussche fuhr an die Front zurück, und er versuchte vergeblich, ihn im Januar wieder für eine Vorführung zurückzubeordern. Bussches Divisionskommandant lehnte es ab, seine Leute als Modepuppen einzusetzen.
Er erinnert sich noch immer an Bussches Gesicht, der ihn, nachdem er sich die Sache überlegt hatte, an jenem Oktobertag aufsuchte, um ihm sein Ja zum Attentat zu geben. Es war ruhig, seine Hände und sein Körper ebenso, doch seine Stimme bebte. Über seinen Augen lag ein Schleier.
Er dachte: Er macht es und ist schon dabei wegzugehen.
Er spürte seine Stärke und seine Ausstrahlung am ganzen Körper. Er sah seinen verborgenen Schmerz.
Er gebrauchte seine Augen, und dennoch war er blind gewesen. Blind war er auch an diesem Tag in Bamberg im Januar 1933 gewesen, als er sich, in Leutnantsuniform auf dem Wege zu einer Abendgesellschaft, von einer hitlerbegeisterten Menschenmenge mitreißen ließ und an der Spitze dieser johlenden Menschen durch die Stadt zog, die NSDAP-Fahnen schwenkten und Kampflieder der Partei sangen; älteren Offizieren hatte er erklärt, daß die großen Soldaten stets Sympathie für eine echte Volkserhebung empfunden hätten. War nicht auch er über Hitlers Ernennung zum Reichskanzler begeistert gewesen, hatte er Hindenburg nicht für einen Reaktionär gehalten, an den sich die Spießbürger klammerten, und hatte er nicht selbst Stefan George gegenüber seine Sympathie für Hitler verteidigt und sich mit mehreren Anhängern des Kreises darüber gestritten, ob es richtig wäre, für ihn zu stimmen, um den bürgerlichen Parteien klarzumachen, daß sie nicht an der Macht bleiben konnten?
Er erinnert sich an das Schweigen des Meisters bei diesem Anlaß, an sein Nicken und den plötzlich fernen Blick, als wollte er ein weiteres Mal seine Gleichgültigkeit gegenüber allem unterstreichen, was mit Politik zu tun hatte. Aber hatten alle diese verführerischen Worte, das neue Reich, die neue Ordnung, Deutschlands welthistorische Mission, das Führerprinzip – hatten all diese Worte, die im Munde des Meisters wie Botschaften von einer noch nicht erstandenen Welt und eines geheimen Deutschland klangen, das nur sie gemeinsam hatten, nicht dazu beigetragen, ihn für Hitler und den Nationalsozialismus zu begeistern? Als Soldat, als Offizier war er dafür gewesen, daß die Nationalsozialisten den erniedrigenden Vertrag von Versailles brachen, er war für den Wiederaufbau und die Vergrößerung des Heeres gewesen, er war national, das waren seine Reflexe, das war seine Erziehung, das war seine Familie und die Geschichte seiner Familie, das war Gneisenau, das waren die Staufer. Doch warum hatte er nicht gesehen und gehört? Hatte der Meister nicht gesagt, wenn die Nationalsozialisten an die Macht kämen, müsse in Deutschland jeder mit einer Schlinge um den Hals herumlaufen, damit man ihn jederzeit aufhängen könne; und wer das nicht wolle, der werde gleich gehängt?
Noch im April 1942 hatte er in der Organisationsabteilung des Generalstabs in Mauerwald geglaubt, es wäre für das Heer ein Geschenk, daß Hitler selber die Führung übernahm und mehrere Feldmarschälle und Generale entlassen hatte; er hatte in ihm eine hervorragende und willensstarke Persönlichkeit gesehen und fand es natürlich, daß er in allen Fragen der Kriegsführung die letzte Entscheidung traf, und als ihm in einer Diskussion weder sein Bruder Alexander noch sein Vetter Clemens zustimmten, war er aufgebraust und hatte gesagt, das Schicksal der ganzen Nation hänge von der direkten Verbindung dieses Mannes zum Generalstab und zum Heer ab. In seinem Glauben an Hitler hatte er Generalleutnant von Loeper zurückgewiesen, der ihm vertraulich von dem sinnlosen Befehl berichtete, den er als Kommandeur der 10. Infanteriedivision in der Panzergruppe 2 in der Nähe von Moskau erhalten hatte, wonach er sechshundert Kilometer weiter nach Gorki vorstoßen sollte, obwohl er nur über zehn Prozent seines Materials verfügte. Er erinnert sich an Loepers Enttäuschung und Verblüffung, als er Hitlers Absicht verteidigte, die Hauptstadt einzunehmen und alles auf eine Karte zu setzen, und als er ihn überzeugen wollte, daß die Ostfront immer noch zu halten und die Sowjetunion zu besiegen wäre.
– Welchen Preis müssen wir dafür zahlen, Stauf? hatte Loeper ihn gefragt, und er hatte geschwiegen.
Auch den damaligen Sekretär an der deutschen Botschaft in Moskau, Herwarth von Bittenfeld, hatte er im selben Frühjahr von Hitlers Vorzügen und der Schwäche und dem fehlenden Überblick seiner Berater überzeugen wollen, doch hatte Herwarth ihm nicht direkt gesagt: – Dieser Mann ist eine Inkarnation des Teufels, er müßte verhaftet werden!
Durch all diese Briefe und Frontberichte, die er erhielt, wußte er ja Bescheid, er wußte, daß die Winterausrüstung der Truppen überhaupt nicht ausreichte und daß Hitler und Keitel dies völlig falsch berechnet hatten und daß aus demselben Grund Zehntausende im russischen Winter erfroren. Jeden Tag hatte er persönlich in der Organisationsabteilung des Generalstabs daran gearbeitet, weitere Bekleidung zu beschaffen und umzuleiten; im März 1942 wußte er, daß nur ein verschwindend geringer Teil der einhundertzweiundsechzig Infanteriedivisionen an der Ostfront für Angriffsoperationen einsetzbar war und es um die sechzehn Panzerdivisionen noch schlimmer stand; er wußte, daß über eine Million Männer bereits verloren war; er wußte aus den Briefen von Oberst Ulrich Bürker von der 10. Panzerdivision, daß die Männer im Feld auf dem Schlachtfeld bei Borodino vor Moskau (die einfachen Soldaten, von denen er seit seiner ersten Offiziersbestallung immer eine hohe Meinung hatte) mit ihren Fahrzeugen im Schlamm steckengeblieben waren und in Schwärmen von Raketen und Panzern zusammengeschossen wurden, daß die Überlebenden total erschöpft waren, fertig, und dennoch durch sinnlose Führerentscheidungen vorwärts getrieben wurden; er wußte, daß Hitler im Januar 1942 wie ein Wahnsinniger getobt hatte, als Generalstabschef Halder den Mut besaß, den Führerbefehl anzuzweifeln, die Front ohne Rücksicht auf die Folgen zu halten. All dieses und noch viel mehr hatte er gewußt, doch die Vorstellung von den großen Zangenbewegungen der Truppen durch das südliche Rußland, durch Nordafrika, den Irak und Persien auf den Kaukasus und das Kaspische Meer zu, hatte ihn fasziniert; mit seiner ganzen Überredungsgabe versuchte er eines Tages, Oberleutnant Richard von Weizsäcker vor den Lageplänen im Hauptquartier zu überzeugen, daß der Krieg noch immer zu gewinnen wäre; sie wären Soldaten, und sie hätten eine Aufgabe: Sie kämpften für Deutschland. Doch Weizsäcker war anderer Meinung und fand sein Vertrauen in die Möglichkeiten stark übertrieben.
Hatte er nicht wegen seines eigenen soldatischen Glaubens an die Möglichkeiten, die Sowjetunion und Stalin zu besiegen, längere Zeit geschwankt, ob er Hitlers fanatische Pläne unterstützen oder über Hitlers immer unprofessionelleren, ja schonungslosen und desperaten Befehle verzweifeln sollte, die für das Heer anscheinend endlose Verluste und sinnlose Organisationsprobleme bedeuteten? Jeden Tag hatten er, sein Chef und Untergebene der Organisationsabteilung daran gearbeitet, neue Forderungen an die Rüstungsindustrie aufzustellen, Pläne für den freiwilligen Zusammenschluß russischer und anti-bolschewistischer Truppen zu machen, sich neuartige Typen von Infanteriedivisionen auszudenken, Material und Vorräte für Tausende von Kilometern entfernte Truppen zu beschaffen und Truppen von der Ostfront nach Afrika zu verlegen; doch das meiste ließ sich nur langsam oder überwiegend unter großen Schwierigkeiten umsetzen, und obwohl er weitergearbeitet hatte, schienen das Heer und die Operationen langsam auseinanderzufallen und sich aufzulösen.
Als er im August 1942 mit Oberstleutnant i. G. Mertz in Winniza über diese Dinge sprach, war fast alles, woran er glaubte, hinter dem Horizont versunken: die großen Zangenbewegungen ließen sich wegen fehlenden Materials und fehlender Mannschaften und wegen Hitlers Angewohnheit, sich in Details zu verlieren und immer selbstsicherer jeden Rat zurückzuweisen, besonders den von Generalstabschef Halder, nicht durchführen; täglich machte Hitler im Hauptquartier Generale und Generalstab herunter, er stieß die entwürdigendsten und gehässigsten Beschuldigungen und Beleidigungen aus, gelegentlich steigerte er sich ins reine Lächerlichmachen, was ihn selber und seine Einfälle in immer neue Höhen hob und das Opfer als inkompetent oder idiotisch darstellte; seine Angriffe gegen die leitenden Offiziere wurden um so schriller, je näher die Katastrophe bei Stalingrad rückte und er die Kontrolle verlor und möglicherweise selber nicht mehr an einen Sieg glaubte; schlechte Nachrichten mußten beschönigt und umgeschrieben und konnten nur zu bestimmten Tageszeiten oder überhaupt nicht überbracht werden; im Laufe des Sommers und Herbstes 1942 verwandelte er sich in ein Nachtwesen, das kaum mehr das Licht und die Wärme des Tages vertrug und in den engen Gängen der Holzhäuser und Baracken inmitten des dreieckigen kleinen Waldes im innersten Sperrkreis seines Lagers Werwolf sein eigenes mysteriöses Leben führte. In seinem Nachtreich, umgeben von Dienern und anderen Helfern, verfiel Hitler manchmal in depressive, grübelnde Zustände, die nach stimulierenden Mitteln verlangten, mit denen sein Leibarzt Theodor Morell ihn versorgte. Diese Aufputschmittel wurden ihm allmählich unentbehrlich und trugen zu weiteren Unlustzuständen und Exzessen bei, so als er während der Besprechung gegenüber Halder höhnisch darauf bestand, daß die Kriegsführung bei Stalingrad keine Frage militärischen Könnens sei, sondern der Glut des nationalsozialistischen Bekenntnisses. Immer deutlicher zeigten sich bei Hitler der nationalsozialistische Fanatismus und seine Menschenverachtung, und er begann, ihn dafür zu hassen und als Verbrecher zu sehen. Mertz wie dem ehemaligen Militärattaché an der deutschen Botschaft in Moskau, General Köstring, gegenüber hatte er im August 1942 seinen klaren Abstand ausgedrückt: – Ich hasse den Führer, ich hasse dieses ganze Pack um ihn herum!
Er erinnert sich, wie Hitlers Befehl an Paulus, als dieser mit seiner Armee auf dem Weg nach Stalingrad am 26. August die Wolga erreichte, ihn zunehmend darin bestärkt hatte, mit diesem Mann abzurechnen. Der Befehl lautete, die ganze männliche Bevölkerung Stalingrads zu vernichten, und dieser Befehl widersprach nicht nur all seinen Vorstellungen vom Kampf gegen die stalinistische Tyrannei zugunsten der Sowjetbevölkerung, sondern auch allem, was er als Soldat unter anständiger Kriegsführung verstand, und er hatte in der folgenden Nacht einen Alptraum, aus dem er in gewisser Weise noch nicht erwacht war.
Er sah sich selber an der Spitze eines Panzerregiments durch die Prospekte einer verkohlten, halb brennenden Stadt einziehen, hier und dort wurden Männer zwischen den Trümmern erschossen, eine Wolke aus Ruß und Asche lag über der Stadt, in der Ferne stand ein halb zerschossener zwiebelförmiger Turm, ein Windstoß fegte plötzlich die Aschewolke weg und offenbarte eine graue Stille, in der Männer mit den Händen über dem Kopf aus den Ruinen und den gähnenden Löchern in den zerschossenen Fassaden heraustraten. Alle standen still in dieser Niemandslandschaft und schauten in seine Richtung, im Turm erklang eine Glocke, doch ihr Geläut wurde von der Stimme des Führers übertönt, die durch die kaum noch vorhandene Stadt gellte: – Schießt, erschießt sie! rief die Stimme, und er hob langsam den Arm, um ein Signal zu geben, als ihm klar wurde, daß der Junge, den er in weiter Ferne sah, der Junge, der am Glockenseil hing und den Ton erzwang, Heimeran war, sein Sohn. Der Führer war unsichtbar; er selbst zog seine Pistole und befahl, den Kübelwagen vorwärts zu fahren, und fing an, auf die Lautsprecher zu schießen. Doch ganz gleich, wie sehr er schoß, breitete sich die manische Stimme des Führers zwischen den Ruinen und in seinen Ohren aus.
Er erhebt sich von der Holzbank und geht zum Marien-Altar und starrt in die wenigen brennenden Kerzen, deren Flammen auf dem dunklen Gemälde einen schwachen Widerschein erzeugen; aus dem Innern der Kirche dringen einige Geräusche zu ihm, der Küster läßt irgend etwas mit einem plötzlichen harten Knall auf den Steinboden fallen, er hört ihn aufseufzen, und wieder wird es dunkel. Aus irgendeinem Grund hört er Georges Stimme flüstern:
Warum schickst du dann den Sommer
Wo wir schnellen frei und nackt?
Er erinnert sich an seinen schmächtigen Körper und das markante Gesicht mit den grauen, träumenden Augen, die an den Tagen, als sie im Garten vor dem Pförtnerhäuschen in Berlin-Nikolassee um ihn versammelt waren, gleichsam im Sonnenlicht verschwanden. Allein seine schweigende Anwesenheit war wie ein Versprechen, daß es in seinem Leben etwas Unbegreifliches gab, und das Unbegreifliche war lebendig. Es strömte wie Musik aus seinem Mund und eröffnete eine Welt der Schönheit, die er mit jungen Männern auf dem Marktplatz bei der Akropolis verband oder mit der Atmosphäre in längst begrabenen griechischen Städten, wo das Leben sich unbeschwert entfaltete, frei, und wo die Welt eine Einheit war, weil Männer spartanisch und geistig ihre Ideale lebten; es war eine Welt, die er schon als Zwölfjähriger aus Hölderlins Gedichten kannte, eine größere und reichere Welt voll Musik, Gesang und einfachen Taten, inspiriert von Worten wie Treue und Bruderschaft und Hingabe an eine gemeinsame Sache. Wenn der Meister über den neuen Menschen und über die Vereinigung von Fleisch und Geist redete, die diesen charakterisierte, wenn er in seinen Gedichten auf die halbmystischen Handlungen des Tempelordens hinwies, die eine versteinerte, von Begehren und Verblendung geprägte Welt auflösten, wenn er auf die Welt der Schönheit deutete, die in der Natur liegt, und auf noch nicht erwachte Urkräfte, die durch das Volk erlöst würden, und wenn er wie Hölderlin von der Liebe sprach, die die Welt trug, und von Freundschaft, die sie weitertragen würde, hatte er sich erwählt und in ihren kleinen Kreis berufen und von der unklaren, aber starken Vorstellung einer großen Aufgabe überwältigt gefühlt, die ihn erwartete; so wie seine Vorfahren wollte er sich in den Dienst der Nation stellen, er wollte führen, aber auch dienen, er wollte wie Hölderlins Empedokles die Tyrannei bekämpfen und dem Volk zur Macht verhelfen und, wenn nötig, das eigene Leben opfern.
Als Achtzehnjähriger schrieb er dem Meister über seine Gefühle für das, was in allen Dingen lebte, und vom Lebendigen im Menschlichen, das sich beim Lesen seiner Gedichte offenbarte und in ihm gerade die Sehnsucht zu handeln weckte. Das Ganze war für ihn so dunkel gewesen wie die überwältigenden Gefühle in der Einsamkeit seines Albfelsens in den Bergen bei Lautlingen, mit ihrer unendlichen Perspektive und sausenden Stille, die ihn oftmals an die Geburt der Welt erinnert hatten. Hier hatte er, wie nirgendwo sonst in all den Jahren, Ruhe gefunden und war er in seiner Idee von der göttlichen Größe der Natur und seiner eigenen Zugehörigkeit zu dieser Welt bestätigt worden; hier hatte er im wachen Zustand geträumt und sich davon überzeugt gefühlt, daß Traum und Handeln genauso zusammengehörten wie Gott und Mensch.
Eben das hatte der Meister selber und seine Gedichte ihm und den anderen eingeschrieben, Max Kommerell, Johann Anton Thormaelen, Walter Anton und seinen eigenen Brüdern Alexander und Berthold. Sie glaubten an eine spirituelle Wiedergeburt eines ganzen Landes, an ein hellenistisches Mirakel, sie glaubten, Gott offenbarte sich in edlen Handlungen und Gedanken der Menschen, sie fühlten sich gefährdet und privilegiert zugleich und erlebten, daß sie ein geheimes Wissen hüteten, daß sie der Kern eines geheimen Deutschland waren, das immerzu auf dem Wege gewesen war und das nur der Dämon zerstören konnte. Das Geheime, das sich offenbaren sollte, lag mit den Worten des Meisters dort,
Wo noch kein taster es spürt
Lang im tiefinnersten schacht
Weiblicher erde noch ruht –
Wunder undeutbar für heut
Geschick wird des kommenden tages.
Er war gerade siebzehn Jahre alt, als er dem Meister zum erstenmal in Berlin begegnete, und während seine Brüder, wie im Kreis üblich, sogleich Namen erhielten, die ihre besondere Art des In-der-Welt-Seins ausdrückten, behielt er den eigenen, er war Claus, und wenn der Meister in seiner stillen Art zu ihm redete und seinen Namen benutzte, fühlte er, daß er mit einem Seher und einem Freund zugleich sprach, der ihn vorbehaltlos als den akzeptierte, der er war, und ihm zugleich mit einem kleinen Wink und einer Weisung zeigte, was er werden könnte. Er fühlte sich ermuntert und aus der Fassung gebracht und zugleich bestätigt. Erst in der Gegenwart dieses Mannes begann er, sich selbst zu entdecken; auf ganz selbstverständliche Weise, fast wie in einem Traum, öffnete dieser kleine Mann mit den scharfen Zügen und den starken Augen ihm und seinen Brüdern die Worte und Gedanken Holbeins, Friedrichs des Großen, Herders, Goethes, Hölderlins und Nietzsches; sie waren die Helden des geheimen Deutschland, und obwohl er sie aus dem literarischen Salon der Mutter und von Lesungen in der Jägerstraße in Stuttgart kannte, flossen sie hier zusammen und wurden im Antlitz, in Gedichten und Worten des Meisters seltsam lebendig. Durch seine bloße Anwesenheit schien er die Zeit aufzuheben. Damals verstand er bei weitem nicht alles, was der Meister schrieb, doch wenn er laut las oder sprach, ergab sich allein durch das Hören seiner Worte plötzlich und manchmal ein unerklärlicher Sinn, derselbe Sinn, wie er ihn erlebte, wenn er allein oder zusammen mit seinen Brüdern auf dem Cello musizierte. Der Meister, der allein für seine Gedichte und Ideen lebte, verlangte für sich selber nichts, sondern gab die ganze Zeit, er lebte puritanisch, und seine Kleidung war verschlissen (wie seine dunkle Lodenjacke) und fast ärmlich; es war ihm ein Mysterium gewesen, wie es solche Menschen überhaupt geben konnte, jedoch eines der Mysterien, das ihn darin bestärkte, daß das In-der-Welt-Sein in erster Linie eine Frage der Gesinnung war. Gerade in den Jahren, als er wegen seiner schwachen Gesundheit wiederholt dem Eberhard-Ludwig-Gymnasium in Stuttgart fernbleiben mußte und einen Privatlehrer bekam und sich oftmals selber und seinem eigenen Willen überlassen fühlte, war er für Menschen, die aus ihrer eigenen Energie heraus lebten, besonders empfänglich.
Später dann hatten Schulenburg und Tresckow ihre Gedanken über die Gedichte des Meisters mit ihm geteilt, ja, waren sie sich nicht auch durch diese Gedichte nähergekommen, und war er nicht durch sie zu der Überzeugung gelangt, daß sie dasselbe sahen, wenn sie die Welt aus Schande und Grauen betrachteten, die sie jetzt umgab? Hatte Schulenburg ihm nicht erzählt, wie er eines Tages in Prag, wo er zum erstenmal in einer Gesellschaft die Gedichte des Meisters über den Krieg gelesen hatte, so bewegt gewesen war, daß er allein sein mußte, um sich zu besinnen?
Er murmelt:
Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt von schande
...
Wenn je dieses volk sich aus feigem erschlaffen
Sein selber erinnert der kür und der sende:
Wie oft waren ihnen diese Zeilen seitdem nicht Code und Zeichen gewesen? Und wie oft hatte er nicht aus des Meisters Widerchrist zitiert, entweder um die Reaktion junger Offiziere zu sehen und sich über ihre Haltung zu Hitler klarzuwerden oder einfach, weil er gerade in diesem Gedicht die Dämonie Hitlers so bildhaft beschrieben fand, so verführend und prophetisch, daß jedem, der es hörte, die Augen über seine Taten aufgingen.
Er memoriert:
›Dort kommt er vom berge · dort steht er im hain!
Wir sahen es selber · er wandelt in wein
Das wasser und spricht mit den toten.‹
O könntet ihr hören mein lachen bei nacht:
Nun schlug meine stunde · nun füllt sich das garn ·
Nun strömen die fische zum hamen.
Die weisen die toten – toll wälzt sich das volk ·
Entwurzelt die bäume. zerklittert das korn ·
Macht bahn für den zug des Erstandnen.
...
Der Fürst des Geziefers verbreitet sein reich ·
Kein schatz der ihm mangelt · kein glück das ihm weicht –..
Zu grund mit dem rest der empörer!
Ihr jauchzet · entzückt von dem teuflischen schein ·
Verprasset was blieb von dem früheren seim
Und fühlt erst die not vor dem ende.
Dann hängt ihr die zunge am trocknenden trog ·
Irrt ratlos wie vieh durch den brennenden hof ..
Und schrecklich erschallt die posaune.
Als er mit Tresckow zum erstenmal über das Gedicht sprach, sagte dieser: – Ich weiß kein anderes Gedicht, das mich auf dieselbe Weise berührt. Wenn ich es lese oder höre, weiß ich nicht, ob ich gleich die Uniform ausziehen soll oder dieses Doppelspiel weitermachen soll: Jeden Tag denke ich daran, wie und wann wir mit diesem Mann und dem Wahnwitz abrechnen können, jeden Tag führe ich Befehle aus und gebe Befehle weiter, die in irgendeiner Weise seinen Stempel tragen.
– Tragen Sie die Uniform weiter, das ist unsere einzige Möglichkeit, sagte er.
Tresckow sah ihn mit einem kleinen müden Lächeln in seinem freundlichen, melancholischen Gesicht an, das ihn sogleich an Berthold und sein nach innen gekehrtes, stilles Wesen erinnerte, aber an den Berthold, wie er als Junge war: verträumt und entschlossen, der große Bruder, immer einen kleinen Schritt voraus und mit Gedanken beschäftigt, denen er selber gerade erst auf die Spur gekommen war. Tresckow war auch immerzu voraus gewesen und war nicht nur ein Träumer, er war ein handelndes Wesen mit einem Schein über oder neben seinem Gesicht, das war ihm unerfindlich, vielleicht kam der Schein ganz einfach von seiner Haut oder seinen Augen oder von seinem sanften Lächeln, er schien tief in seine eigene Welt versunken und war zugleich vielleicht derjenige von ihnen allen, der am besten Bescheid wußte, obwohl er sich meistens Tausende Kilometer von Deutschland entfernt in der Heeresgruppe Mitte aufhielt und nur in größeren Abständen nach Berlin kam oder den Generalstab besuchte.
Tresckow war fast allen Plänen voraus gewesen. Hatte Tresckow ihm nicht 43 gesagt, er hätte schon 42 mehrere Offiziere für Putschpläne allein mit der Begründung angeworben, Zehntausende von Juden würden auf das grausamste umgebracht, und er wäre überzeugt, daß der Befehl direkt vom Oberbefehlshaber, von Hitler selber komme, was ihm nur allmählich aufgegangen sei, weil es so ausgezeichnet getarnt und ungeheuerlich wäre und den Oberbefehlshaber des Heeres ein für allemal zum Verbrecher stempelte. Tresckow und seine Mitverschworenen aus der Heeresgruppe Mitte hatten schon im März 43, als er sich selber an die Front in Tunesien geflüchtet hatte, ihr Attentat am Tag des Frontbesuchs Hitlers im Hauptquartier in Smolensk geplant, und welche Überlegungen hatten sie nicht bis ins letzte Detail angestellt.
Er kennt es jetzt, diesen Gemütszustand von Nervosität und Erregung und eine merkwürdig schuldbetonte Leere, während man Schritt für Schritt ein Mordkomplott durchdenkt und vorherzusehen sucht, wie man das Ziel am besten und mit dem geringsten Risiko für den Putschplan unschädlich macht. Schon seit er mit seiner damals schwachen Gesundheit seinen Dienst beim 17. Bayerischen Reiterregiment in Bamberg angetreten hatte und bis er zwölf Jahre später als Quartiermeister in der ersten leichten Division zum Generalstab kommandiert wurde, hatte er seine Ausbildung bei Kavallerie, Infanterie, Artillerie und der Panzerwaffe getreu der Familientradition als Tätigkeit im Dienste der höheren Sache gesehen. Er hatte das Offiziershandwerk gelernt, um für Volk, Staat und Nation zu kämpfen; Offizier zu sein hieß, im Dienste des Staates und Teil des Staates mit dessen gesamter Verantwortung zu sein. Hatte er sich nicht geradezu eingebildet, ihm selber wäre eine besondere Rolle zugedacht (er sah sich selber im Lichte einer großen Aufgabe, ohne daß er viele Jahre lang eigentlich wußte, worin sie bestand). Soldat sein hieß, Verantwortung für die Nation zu übernehmen, das hieß gegebenenfalls auch, einen Feind zu bekämpfen, aber hieß es auch, Mörder zu sein? Er hatte nie gelernt, wie ein Mörder zu handeln.
Tresckow und seine Mitverschwörer in Smolensk waren darauf verfallen, Hitler bei seiner Truppeninspektion direkt mit Pistolen niederzuschießen, dann aber kamen die ganzen Bedenken: Benutzte man Maschinenpistolen, riskierte man dann in der unausweichlich entstehenden Verwirrung nicht, Generalfeldmarschall Kluge oder andere hohe Offiziere in Hitlers unmittelbarer Nähe zu treffen? Trug Hitler nicht eine schußsichere Weste? Und was war mit seiner wachsamen und viele Männer zählenden Leibwache, wie sollte man sie ablenken? Tresckows endgültige Wahl war einfach: Mit Hilfe seines Adjutanten Schlabrendorff übergab er einem Adjutanten Hitlers an dem Tag, als dieser mit seinem Flugzeug nach Ostpreußen zurückkehren sollte, ein Päckchen mit zwei Flaschen Cointreau. Angeblich war das Päckchen ein Geschenk an einen Freund, und der Adjutant nahm es mit ins Flugzeug. Eine Flasche enthielt Sprengstoff mit einem Zeitzünder, dessen Mechanismus Tresckow einige Zeit zuvor erprobt hatte. In Berlin hatte Olbricht alle notwendigen Maßnahmen für einen Putschversuch getroffen, und man wartete nun in eisiger Spannung auf die Mitteilung, das Flugzeug des Führers sei abgestürzt. Doch einige Stunden nach dem Abflug in Smolensk landete Hitler unbeschadet in der Nähe der Wolfsschanze.
Als er zum erstenmal vom Attentatsversuch hörte, verblüffte es ihn, daß dieser ebensowenig geglückt war wie der von Oberst Gersdorff am Heldengedenktag im Zeughaus in Berlin, als sich Gersdorff mit Sprengstoff in der Tasche seines Uniformmantels zusammen mit Hitler in die Luft sprengen wollte, Hitler jedoch, ganz gegen seine Gewohnheit, durch die Ausstellungsräume geeilt war. Als hätte der Führer einen sechsten Sinn, als würde irgendein Dämon oder eine unheimliche Intuition ihn beschützen.
Nein, daran glaubt er nicht. Doch, er glaubt daran. Hatte er nicht eine ganze Nation in den Bann geschlagen, waren Soldaten nicht bereit, mit seinem Namen auf den Lippen in einen sinnlosen Tod zu gehen, waren nicht Nachbarn bereit, sich gegenseitig anzuzeigen, zeigten nicht Kinder ihre Eltern an, waren nicht junge Männer, die nichts von der Welt wußten, bereit, Unschuldige zu töten, zu ermorden, zu Krüppeln zu machen ...? Hamburg, München, Berlin, überall fallen Bauten in Schutt, in diesen Städten wirbelt der Staub auf, und das Feuer fegt durch die Straßen, während er selber unberührt, geschützt hinter den dicken Mauern der Wolfsschanze sitzt. Ein Gefreiter mit den Augen eines Fanatikers. Ein Heiland mit dem glühenden Blick eines Psychopathen. Ein Verwandlungskünstler, ein Rattenfänger, ein Meisterredner.
Hatte Generaloberst Beck in seiner ruhig-abgeklärten Art nicht zu ihm gesagt: – Schon 38 sah ich, daß er unberechenbar war, hemmungslos, ich sah, daß er Deutschland ins Unglück führen würde. Unser Plan war, ihn zu verhaften, doch Chamberlain überzeugte die Welt, daß er ein Friedensstifter wäre.
Und hatte Goerdeler im selben Jahr nicht seine ganze Energie darauf verwendet, seine englischen Verbindungsleute zu überzeugen, daß die barbarische und sadistische Verfolgung von Zehntausenden polnischer Juden, die man mit Maschinengewehren über die deutsche Grenze trieb, eine Antwort verlangte und der Anfang vom Ende Deutschlands war? Der hitzige Goerdeler, der bis vor einigen Wochen noch zweifelte, ob es richtig wäre, Hitler umzubringen.
Doch die Engländer blieben blind und taub, und hatte er nicht selber an Hitler als Friedensstifter geglaubt, bis ihn die Entlassung des Kriegsministers von Blomberg und des Generalobersten von Fritsch empört und Schulenburg ihn überzeugt hatte, daß der Mann Krieg wollte? Damals hatte er zu Schulenburg gesagt, er würde sich bereitwillig hinter Beck stellen, ohne ihm je begegnet zu sein. Und als daraus nichts wurde, hatte er gedacht: Welch ein merkwürdiges Gefühl, den bereits gezogenen Säbel wieder in die Scheide zu stecken.
Doch als der Krieg kam, als der Krieg des Friedensstifters kam, war er begeistert gewesen. War er nicht euphorisch aus Polen zurückgekommen? Er erinnert sich an den Abend im schönen Trebbow, an dem er und Schulenburg Charlotte Schulenburg mit dem überraschend schnellen Sieg über Polen und ihren eigenen Meriten unterhalten hatten. Er erinnert sich an die begeisterte Stimmung unter den Panzertruppen seines Regiments während des Feldzugs gegen Frankreich und die Freude über den erstaunlich leichten Sieg, der die Maginot-Linie in eine Luftfestung verwandelte. Hitler hatte es gegen den Rat der meisten seiner Generale klar gesehen, daß die Maginotlinie zu durchbrechen war, er hatte wie Napoleon in großen Zügen gedacht und sich plötzlich als militärisch schöpferischer Geist erwiesen. Das war ein Geist, den er bewundern konnte.