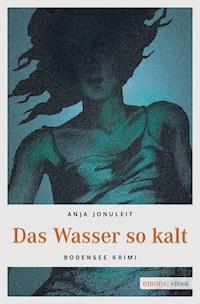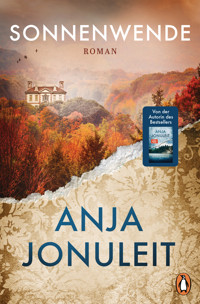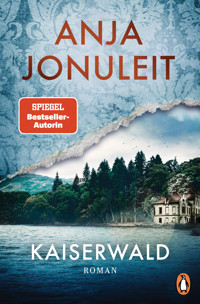9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein altes Phantombild – ein düsteres Familiengeheimnis Als Schriftstellerin Eva in der Zeitung ein Phantombild entdeckt, ist sie tief schockiert: Die Unbekannte hat frappierende Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Die Frau war in Bergen gewaltsam zu Tode gekommen, ihre Identität konnte nie aufgedeckt werden. Eine Reise nach Norwegen führt Eva Schritt für Schritt in die Vergangenheit einer Fremden voller Rätsel – und zurück in ihre eigene Familiengeschichte. Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? ›Der Apfelsammler‹ ›Das Nachtfräuleinspiel‹ ›Novemberasche‹ ›Rabenfrauen‹ ›Herbstvergessene‹ ›Die fremde Tochter‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anja Jonuleit
Das letzte Bild
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Tochter Astrid
Danke
Früher
10. August 1944
Der Wald will kein Ende nehmen. Dabei müsste sie doch längst am Ziel sein. Den ganzen Tag ist sie schon unterwegs und langsam bekommt sie es mit der Angst zu tun. Auch ist sie inzwischen so unendlich müde.
Sie schaut sich um und schlüpft dann in eine Lücke zwischen den Adlerfarn, damit sie vom Weg aus nicht zu sehen ist. Sie streift sich die Riemen ihres Felltornisters von den Schultern und sinkt ins Moos. Der Farn umschließt sie. Es ist ein bisschen wie in einem Haus. Eine Weile liegt sie im Moos, es ist schön weich, aber dann meldet sich der Hunger wieder, und durstig ist sie auch. Und obwohl sie weiß, dass sie den ganzen Proviant längst verputzt hat, den Apfel und auch die zwei Stullen, die sie aus der Küche stibitzt hat, rappelt sie sich hoch, klappt den Tornister auf und sieht hinein. Wie erwartet ist nichts Essbares mehr zu finden. Nur die graue Feldflasche ist da. Die Feldflasche, die Karte von ihrer Omi und die beiden Puppen. Sie holt sie heraus, zuerst die Ursel, die mit ihren blonden Zöpfen so hübsch aussieht. Und dann die andere. Die, die sie Nini weggenommen und deren Zöpfe sie abgeschnitten hat, ratsch, ratsch, mit zwei sauberen Schnitten.
Gretchen betrachtet die Puppen. Plötzlich hat sie einen Kloß im Hals, der so dick ist, dass es wehtut. Sie wollte doch nur Heiraten spielen und dafür brauchte sie ja einen Bräutigam für die Ursel. Und weil kein anderer da war, hat sie heimlich die Franziska genommen, die Puppe ihrer Schwester, und sie in einen Franzl verwandelt.
Eine Träne tropft auf das verschnittene Haar des kleinen Bräutigams. Natürlich hat Nini sie gleich bei Tante Anneliese verpetzt. Und dann hat sie mal wieder Senge bekommen, zuerst von Tante Anneliese und später noch von der Mutti mit dem Kleiderbügel. Das hat so wehgetan. Und deshalb hat sie beschlossen, in das Prinzessinnenschloss zurückzugehen, zu Geeske, die immer lieb zu ihr war und sie in den Arm genommen und beschützt hat. Auch vor der Mutti, obwohl die Mutti ja die Frau Doktor ist und Geeske bloß eine Küchenhilfe. Geeske jedenfalls wird es verstehen, dass sie nur einen Mann für die Ursel gebraucht hat und nichts Böses wollte. Und außerdem soll die Mutti sich ganz dolle um sie sorgen, ja, weinen soll sie, so wie Gretchen nach der Senge mit dem Kleiderbügel geweint hat.
Mit der Schürze ihres Kleidchens wischt sie sich die Tränen ab. Der Gedanke an ihre weinende Mutti gibt ihr neue Kraft. Recht geschieht es ihr. Sie will zu Geeske, dort will sie bleiben. Außerdem kann es jetzt nicht mehr weit sein. Sie ist ja schon den ganzen Tag unterwegs und genauso lange hat die Fahrt vom Prinzessinnenschloss bis zu dem anderen Schloss, wo die Leute französisch sprechen, auch gedauert.
Sie steckt die Puppen zurück, nimmt den letzten Schluck Wasser, schultert den Tornister und geht weiter.
Nach einer Weile hat sie den Eindruck, dass der Wald lichter wird. Und dann glaubt sie, das Muhen einer Kuh zu hören. Sie bleibt ganz still stehen und lauscht angestrengt. Ja, da ist es wieder, das Muhen.
Auf einmal fällt alle Müdigkeit von ihr ab. Sie ist da. Sie hat es geschafft. Sie rennt so schnell sie kann in die Richtung, aus der das Muhen kommt, mitten durch den Wald. Stöckchen knacken unter ihren dicken Schnürschuhen, Laub raschelt, sie kann es kaum erwarten, endlich die Kuhwiese zu sehen, dann ist es nicht mehr weit bis zum roten Schloss mit den weißen Zackenfenstern, wo Geeske sicher schon das Abendessen zubereitet. Vielleicht gibt es ja Griesbrei mit Pflaumenkompott. Oh, sie hat solchen Hunger.
Sie tritt aus dem Wald und bleibt abrupt stehen. Aber wo sind denn die Schwarzweißen, diese Kühe hier sind ja ganz hell, hat man sie vielleicht angemalt? Oder sind auch die Kühe weggebracht worden, zusammen mit den Kindern, und durch die hellen ersetzt? Außerdem sind hier auch noch lauter Pferde. Und dann entdeckt sie, weit im Hintergrund, ein riesiges Gebäude, fremd. Noch ein Schloss, ein anderes Schloss!
Langsam dämmert es ihr. Das hier ist nicht die Weide hinter dem Prinzessinnenschloss. Ihr Blick huscht hin und her, den Weg am Waldrand entlang nach links und rechts, über die Wiese mit den fremden Kühen und das fremde Schloss in der Ferne.
In dem Moment hört sie Pferdegetrappel. Eilig versteckt sie sich hinter einem Baumstamm. Eine Kutsche mit zwei Pferden kommt den Weg entlang. Hastig zieht sie sich in den Wald zurück, dorthin, wo der Adlerfarn am dichtesten ist. Sie geht in die Knie, streckt sich ganz leise auf dem Waldboden aus, legt den Kopf ins Moos und bemüht sich, mucksmäuschenstill zu sein. Sie wartet. Ein kleiner schwarzer Käfer klettert mühevoll über das Moos, direkt auf ihre Nasenspitze zu. Das Pferdegetrappel ist nicht mehr zu hören. Ist die Kutsche vorbeigefahren? Wohl eine Ewigkeit liegt sie da, atmet so leise sie kann. Irgendwann hebt sie den Kopf, um besser hören zu können. Sie schaut nach oben, auf die fein gezackten Blätter des Adlerfarns, und hält die Luft an. Und da, ganz langsam, taucht ein Gesicht über ihr auf, das Gesicht eines Mannes.
Wenn sich die Bedeutung eines Geheimnisses daran bemisst, wie lange der Schwur hält, es nicht zu enthüllen, dann muss das Geheimnis der Frau aus dem norwegischen Isdal sehr, sehr bedeutend sein. 47 Jahre ist es her, dass sie gefunden wurde, ein toter Mensch ohne Namen und ohne Nationalität, und in all den Jahren hat von denen, die etwas wussten, nicht einer geredet.
Die Zeit, 10. Januar 2018
Eva entdeckte es an einem Montag, um kurz nach sieben. Sie stand an der Theke beim Bäcker und wartete darauf, dass die Verkäuferin ihr die Butterbrezeln in zwei Tüten verpackte, eine für Justus und eine für sie, als ihr Blick wie jeden Morgen auf die BILD fiel, die in einem Stapel auf dem Tresen lag. Gewöhnlich lächelte sie dabei leise und vielleicht auch ein wenig überlegen in sich hinein. Bei einer besonders platt oder ätzend formulierten Schlagzeile würde sie später Justus oder einer ihrer Freundinnen davon erzählen und einen kleinen Witz machen. Heute jedoch wurde sie von einem unerklärlichen Unbehagen erfasst. War die unbekannte Tote eine Deutsche?, stand da in fetten Lettern. Bei dem Bild darunter handelte es sich um eine Phantomzeichnung, und was das bedeutete, das wusste man ja.
»Mama? Die Brezeln!«, sagte eine Stimme, Justus, dicht hinter ihr. Abwesend und fast ein wenig widerwillig löste sich ihr Blick von den leicht schräg stehenden braunen Augen, der spitzen Nase und den vollen Lippen. Die Verkäuferin sah sie an, mit hochgezogenen Augenbrauen und einem ziemlich genervten Gesichtsausdruck.
»Oh, Pardon«, sagte Eva und öffnete ihr Portemonnaie, holte rasch ein paar Münzen heraus und legte sie auf den Tresen. Sie konnte nicht verhindern, dass ihr Blick, kaum hatte sie nach den Tüten gegriffen, gleich wieder zu dem Gesicht auf der Zeitung zurückwanderte. Und plötzlich war da dieses Gefühl, eine Art Wiedererkennen, gepaart mit einer dunklen Ahnung. Nein, dachte sie, das kann ja nicht sein. Was sollte das auch für einen Sinn ergeben? Trotzdem tat sie kurz darauf etwas, das sie selbst nie für möglich gehalten hätte. Sie griff nach der Zeitung und warf dabei einen verstohlenen Blick über die Schulter zu Justus.
»Was kostet die?«, fragte sie und klappte die Zeitung rasch um, das Gesicht nach innen.
»Ein Euro«, antwortete die Verkäuferin ein wenig schnippisch, woraufhin Eva ihr, weil sie es nicht anders hatte, hastig eine Zweieuromünze in die Hand drückte und sich abwandte.
»Sie bekommen noch was raus«, rief die Frau ihr hinterher, doch Eva war schon auf dem Weg nach draußen.
»Die hast du jetzt aber nicht wirklich gekauft?«, hörte sie Justus’ Stimme. Er klang entrüstet. Seine Mutter hatte ihm jahrelang immer wieder erklärt, warum ihr dieses Revolverblatt nicht ins Haus kam, schließlich war sie nicht umsonst Germanistin und schrieb preisgekrönte Biografien.
»Hier«, sagte sie, ohne darauf einzugehen, und reichte ihm die Tüte mit der Brezel. Er zuckte die Achseln.
»Bis später«, sagte sie, ohne ihm einen Kuss auf die Backe zu geben, wie sie es zu Hause an der Tür getan hätte. Schließlich war er fünfzehn Jahre alt und sie befanden sich in Sichtweite der Bushaltestelle, wo sein Kumpel bereits herumdümpelte. Allerdings wäre die Gefahr, dass der etwas außerhalb seines Smartphones wahrnahm, relativ gering, dachte Eva und fragte Justus der Form halber, ob er nicht doch den Schirm nehmen wolle, was er wie erwartet ablehnte. Kurz sah sie ihm hinterher, wie er durch den Regen davontrottete, mit dem schlaksigen Gang eines Jungen, der zu schnell gewachsen war und sich noch nicht an die Länge seiner Gliedmaßen gewöhnt hatte.
Dann steckte sie die Zeitung unter ihren Trench, trat unter dem Vordach hervor und rannte zu ihrem Wagen. Sie fuhr zu schnell, das war ihr klar, sie sah ja kaum etwas durch den Regen, der auf die Windschutzscheibe pladderte. Doch etwas in ihr ließ sie Gas geben, bis sie fünf Minuten später in ihre Einfahrt in der Pasinger Gustav-Adolf-Straße bog und ungeduldig darauf wartete, dass das elektrische Garagentor aufschwang.
In der Küche warf sie die Zeitung auf den Tisch, neben die Druckfahne, die gestern gekommen war. Noch im Mantel zog sie scharrend einen Stuhl zurück, ließ sich darauf nieder und legte die Zeitung vor sich.
So saß sie da und betrachtete das Gesicht der Frau, einen Augenblick nur, bevor sie die fett gedruckte kurze Passage auf der Titelseite las. Durchbruch nach 50 Jahren! Australischer Super-Prof entschlüsselt Zahnschmelz. Verkohlte Leiche eine Deutsche? Hastig blätterte Eva nach hinten, um den dazugehörigen Artikel zu finden. Während ihre Augen über die Zeilen wanderten, spannte sich ihr Körper immer mehr an.
Norwegens rätselhaftester Kriminalfall: Die Spur führt nach Deutschland. War die Frau, die am 29. November 1970 in einem abgelegenen Tal in Norwegen bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, eine Deutsche? Ein australischer Experte der Universität Canberra hat mithilfe einer Zahnschmelzanalyse herausgefunden, dass die Isdal-Frau, wie sie in Norwegen genannt wird, vermutlich aus der Gegend von Nürnberg stammte. Der Fall der unbekannten Toten, die damals mit insgesamt acht verschiedenen belgischen Pässen in Norwegen herumgereist war, gibt der Polizei bis heute Rätsel auf.
»Was …«, flüsterte Eva fassungslos, blätterte zurück zur Titelseite und starrte auf das Phantombild. Sie konnte den Blick nicht abwenden, während sich die einzelnen Informationen in ihrem Kopf nach und nach zu einem merkwürdigen Ganzen fügten. Nürnberg. Belgien. Norwegen. Das Gesicht.
Einen Moment lang wurde ihr schwindlig und sie spürte eine Kraftlosigkeit in den Gelenken, dieselbe mürbe Schwäche wie vor drei Jahren, als herausgekommen war, dass Johannes sie belogen hatte.
Ihr Blick wanderte zurück zum Text. Die norwegische Polizei hofft, in Zusammenarbeit mit den europäischen Kollegen nun endlich Klarheit in den Fall zu bringen. Und dann, ganz unten, fett gedruckt, ein Kasten mit dem Aufruf: Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Identität der unbekannten Toten beitragen können, nimmt diese Redaktion sowie jede Polizeidienststelle entgegen.
Nürnberg. Belgien. Norwegen.
Das Gesicht ihrer Mutter. Ihr eigenes Gesicht.
Saint-Antoine, Frankreich, 1954
Im Grunde beginnt alles an dem Tag, an dem sie Juliette nach der Schule besucht, um sich die neue Schallplatte von Vera Lynn anzuhören. Da wird sie sich später eine gute Ausrede einfallen lassen. Denn eigentlich muss sie nach der Schule immer gleich nach Hause, wo Ann-Marie ihr die Arbeit für den Tag zuteilt. In letzter Zeit denkt Marguerite manchmal, dass die beiden sie wohl nicht nur aus Barmherzigkeit bei sich aufgenommen haben, wie sie das ständig betonen. Vielleicht geht es ihnen nur um eine billige Hilfe in Haus und Garten. Einen Plattenspieler besitzen ihre stocksteifen Zieheltern natürlich nicht, wohingegen Juliette sogar einen eigenen in ihrem Zimmer stehen hat. Auch nennt Juliettes Vater die neue Musik nicht ständig sittenlos, also besitzt Juliette sogar ein paar Platten von Bill Haley. Und nun hat ihr Vater ihr aus Paris die neue Scheibe von Vera Lynn mitgebracht.
Wie immer betritt Marguerite Juliettes Zimmer mit dem der luxuriösen Umgebung gebotenen Respekt. Wie gut Juliette es hat. All die hübschen Möbel: der Toilettentisch. Der große Spiegel mit dem Silberrahmen. Die hellgelben Seidenvorhänge. Nicht zum ersten Mal stellt sie sich vor, all das würde ihr gehören. Sie würde alles dafür geben, in so einem Haus, in so einem Zimmer leben zu dürfen. Vorsichtig lässt sie sich auf Juliettes weißem Himmelbett nieder, wobei sie jeden von Juliettes Handgriffen genau verfolgt. Wie sie den runden Lederkoffer aus dem Schrank nimmt, ihn auf den Tisch stellt und aufklappt, die Platte aus der Papierhülle nimmt und auf den grünen Plattenteller legt. Dann ist der feierliche Moment gekommen, in dem sie mucksmäuschenstill sein muss: wenn Juliette den Arm mit der Nadel hochnimmt und auf die Rille setzt.
Im nächsten Moment knistert es ein bisschen und dann erklingt eine elegante Melodie, die Töne schweben durch den Raum, Trompeten und Geigen, wie schön das ist, und dann fängt ein Chor an zu singen.
Aber was ist das? Was sind das für Worte?
Auf Wiederseh’n. Auf Wiederseh’n.
Erschrocken reißt Marguerite die Augen auf. Verständnislos blickt sie zu Juliette, die aber nichts Außergewöhnliches daran zu finden scheint. Dann ist der deutsche Part vorbei und Vera Lynn singt auf Englisch weiter. Doch bald kommt es erneut, dieses Auf Wiederseh’n, und auf einmal spürt Marguerite, wie ihr die Tränen in die Augen treten. Sie ballt die Hände zu Fäusten, presst die Lippen aufeinander, blinzelt. Immer wieder blinzelt sie und hofft dabei, dass Juliette sie nicht anschaut. Doch just in dem Moment treffen sich ihre Blicke. Und Juliette sieht, wie ihr die Tränen über die Wangen laufen.
Einen Augenblick lang sieht Juliette sie nur an. Dann läuft sie zur Tür hinaus und holt ihre Mutter.
»Was ist denn los?«, fragte Madame Dumont einige Momente später, während sie im Türrahmen steht, genauso steif wie Juliette.
Aber Marguerite kann nicht antworten. Sie weint jetzt unkontrolliert, die Tränen strömen ihr übers Gesicht, und je länger das Lied dauert, desto schlimmer wird es. Inzwischen steht auch Juliettes Vater in der Tür. Und so sehen alle drei Marguerite beim Schluchzen zu, der Vater bestürzt, die Mutter distanziert und Juliette mit gewohnt undurchdringlicher Miene.
Erst als die letzten Takte verklingen, kann sie aufhören zu weinen. Inzwischen hat Juliettes Mutter sich aus ihrer Erstarrung gelöst und reicht Marguerite ein Stofftaschentuch, mit dem sie sich die Augen abtupft und die Nase schnäuzt.
»Geht es dir nicht gut?«, fragt Juliettes Vater freundlich und tut ein paar Schritte auf sie zu, setzt sich neben sie. Marguerite schüttelt den Kopf und nickt gleich darauf.
»Doch, doch«, sagt sie hastig und lächelt mit geschlossenen Lippen, damit er die Lücke zwischen ihren Vorderzähnen nicht bemerkt. »Es geht mir gut. Das Lied hat mich nur traurig gemacht.«
Juliettes Mutter nickt und bietet ihr ein Stück Johannisbeer-Tarte an. Als Marguerite dankend ablehnt, dreht sie sich um und geht weg. Monsieur Dumont jedoch sitzt weiter neben ihr und sieht sie so komisch von der Seite her an, so als würde er die Wahrheit kennen.
Ein paar Tage später trifft sie ihn zufällig auf der Landstraße. Sie ist zu Fuß unterwegs, hat wie jeden Abend Eier und Milch in Saint-Émile bei den Martins geholt und ist nun auf dem Heimweg, als ein schwarzer Citroën sie erst überholt und dann zurücksetzt, um neben ihr zu halten. Es ist das Auto von Monsieur Dumont.
»Bonjour, Marguerite. Soll ich dich mitnehmen?«
Marguerite will erst ablehnen. Zu deutlich steht ihr die Blamage von neulich vor Augen. Doch es ist heiß und sie hat noch mindestens zwei Kilometer Fußmarsch vor sich. Und so steigt sie ein.
Monsieur Dumont fährt los. Durch die offenen Fenster weht der Duft nach Sommer herein, nach Getreide und Heu. Monsieur Dumont fragt sie nach allem Möglichen. Wie es in der Schule geht, was für Musik sie mag. Marguerite hat sich die Milchkanne zwischen die Füße geklemmt und hält den Deckel fest daraufgedrückt, während Monsieur Dumont ganz zwanglos mit ihr plaudert. Langsam taut sie auf und erzählt und sieht ihn dabei von der Seite an. Er sieht schön aus, denkt sie mit einem Mal, auch wenn er natürlich schon alt ist. Aber das gefällt ihr auch an ihm. Dass er ein richtiger Mann ist. Nicht so ein Jungspund wie Simon, dem sie alles erklären muss. Wie er sie küssen muss zum Beispiel. Monsieur Dumont scheint alles zu wissen. Alles zu verstehen.
Unvermittelt fragt er: »Das neulich mit dem Lied. Bei uns zu Hause. Was war da los?«
Marguerite erschrickt. Mit dieser Frage hat sie nicht gerechnet. Sie weiß nicht, was sie sagen soll.
Er fährt rechts ran, hält unter einer Salweide. Aus dem Augenwinkel sieht Marguerite, dass er sich ihr zuwendet. Als sie nicht reagiert, fasst er sie ganz leicht am Kinn und bringt sie dazu, ihn anzuschauen.
»Na los, du kannst es mir sagen. Lass mich dir helfen. Ich weiß, dass du es nicht leicht hast.«
Ganz sanft klingt seine Stimme, und dann legt er auch noch seine Hand auf ihre und drückt sie begütigend.
Da fängt sie wieder an zu weinen und währenddessen brechen die Worte aus ihr heraus, erst stockend, dann immer fließender. Am Ende hat sie ihm alles erzählt.
Wie sie damals weggelaufen ist, mit Ninis Puppe. Wie der Mann sie im Wald gefunden und in das deutsche Krankenhaus nach Lamorlaye zurückgebracht hat. Doch als sie ankamen, war das Haus leer gewesen. Alle Deutschen waren fort, auch Nini und die Mutter.
»Dann wurde ich zuerst in einem Waisenhaus untergebracht. Und irgendwann bin ich zu den Roussels gekommen.«
Sie senkt den Blick. Er ist irritiert, das sieht sie ihm an. Vielleicht denkt er, sie würde ihm einen Bären aufbinden? Schon bereut sie es, ihm alles erzählt zu haben. Und was, wenn er es Juliette weitersagt und die es in der ganzen Schule verbreitet? Marguerite weiß nur zu gut, wie die Leute hier über die Deutschen denken, über die Boches. Sie weiß auch, was die Boches hier gemacht haben. Und da spielt es für die Leute bestimmt keine Rolle, dass Marguerite damals noch ein Kind war, ein kleines noch dazu. Die Deutschen sind die Feinde, die Besatzer, die großes Leid über die Familien gebracht haben.
Ängstlich tastet sich ihr Blick nach oben. Zu ihrer Erleichterung sieht Monsieur Dumont immer noch freundlich aus, freundlich und auch ein bisschen besorgt. Jetzt lächelt er ganz traurig. Und dann hebt er die Hand und streicht ihr zaghaft übers Haar. Sie ist so erleichtert, dass sie schon wieder heulen muss, was ist nur los mit ihr, so viel geheult hat sie seit damals nicht, seitdem sie mit sechs Jahren von heute auf morgen ihre Mutter und ihre Schwester verloren hat.
»Aber … hat man denn nie versucht, deine Familie zu finden? Ich meine, da gibt es doch diese Suchanträge beim Internationalen Roten Kreuz … Hat nie jemand so einen Antrag für dich gestellt?«
Unter Schluchzen schüttelt sie den Kopf und sagt mit tränenerstickter Stimme: »Ich habe doch die Puppe gestohlen.«
»Was?«
»Ich habe meiner Schwester die Puppe weggenommen. Und irgendwie …«
Da nimmt er sie in den Arm und hält sie. Er hält sie fest und spricht beruhigend auf sie ein. Dass alles gut werde. Dass er ihr helfen werde. Dass es doch Mittel und Wege gebe.
Und endlich, endlich lässt das Beben nach. Ihre Muskeln entspannen sich, sie wird ganz weich, nachgiebig in der Erschöpfung, die auf einen Weinkrampf folgt. Ruhig atmet sie jetzt, bemerkt, dass er nach Tabak riecht, nach Holz und ganz leicht nach Rasierwasser.
Da löst er sich von ihr und sagt: »Wenn du einverstanden bist, nehme ich Kontakt zu den Behörden in Lamorlaye auf. Vielleicht kann man mir dort sagen, was das damals für ein Krankenhaus gewesen ist. Mit ein bisschen Glück gibt es irgendwo alte Personalakten, mit denen sich die Spur deiner Mutter nach Deutschland zurückverfolgen lässt.«
Marguerite hängt an seinen Lippen. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Das würde er für sie tun.
In dem Moment hören sie ein Motorengeräusch. Ein Trecker, der näher kommt. Monsieur Dumont sieht in den Rückspiegel und will gerade den Motor anlassen, als Marguerite ihm die Hand auf den Arm legt und sagt: »Bitte. Sie dürfen es keinem verraten, auch nicht Juliette. Niemand hier darf wissen, dass ich in Wirklichkeit eine Deutsche bin.«
Als Antwort lächelt er.
»Keine Sorge, Marguerite. Das bleibt unser Geheimnis.«
Eine ganze Weile lang saß Eva noch am Küchentisch, bevor sie die Zeitung zusammenfaltete, den Umschlag mit der Druckfahne nahm und in ihr Schreibzimmer im Wintergarten ging. Sie blickte hinaus auf die leuchtend roten Ahornbüsche, immer noch beunruhigt auf eine Art, die sich mit dem Lesen eines Artikels in einem Schundblatt nicht erklären ließ. Aber was sollte diese tote Frau mit ihrem Leben und dem Leben ihrer Mutter zu tun haben? Das konnte doch nicht sein.
Eva fuhr ihren Laptop hoch und zog die Druckfahne aus dem Umschlag. Sie hatte gerade eine Biografie über die NS-Erziehungsexpertin Johanna Haarer beendet, ein Projekt, das ihr nähergegangen war, als sie es zu Beginn für möglich gehalten hätte, nicht zuletzt deshalb, weil es Fragen aufgeworfen hatte, die sie sich zuvor nie gestellt hatte. Seit diesem Buch hatte sie einen anderen Blick auf die Generation ihrer Mutter, vor allem aber auch auf ihre eigene Generation, die zwar in Zeiten des Wohlstands aufgewachsen war, deren Kindheit jedoch geprägt war durch Eltern, die ihre Kriegserlebnisse oftmals nicht verarbeitet hatten. Zwei Jahre hatte Eva an diesem Buch gearbeitet, hatte sich in die Sichtweise einer Frau eingedacht, die Müttern geraten hatte, ihre Kinder schreien zu lassen, um sie nur ja nicht zu verzärteln, und war nun gottfroh, das verdammte Ding, das sie mehr als eine schlaflose Nacht gekostet hatte, endlich loszulassen und sich etwas Neuem, diesmal vielleicht Positiverem, zuzuwenden. Die Druckfahne zu lesen war der allerletzte Akt, der feierliche Abschluss einer zwei Jahre währenden Reise.
Eine halbe Stunde später war sie noch nicht weit gekommen. Zwar saß sie schön brav an ihrem Schreibtisch, einen roten Fineliner in der Hand, doch statt sich ein letztes Mal konzentriert auf den Text einzulassen, ertappte sie sich dabei, wie ihre Gedanken in alle möglichen Richtungen mäanderten, um immer wieder zu dem Gesicht in der BILD zurückzukehren.
Die Ähnlichkeit war beunruhigend. Ein bisschen so, als würde sie in einer Folge Aktenzeichen XY ungelöst ihr eigenes Gesicht entdecken. Oder war sie auf dem Weg, sich in einen kompletten Unsinn hineinzudenken? Was Kriminalfälle oder gewaltsame Tode anging, war sie eine Mimose, und das letzte Mal, als sie XY ungelöst angeschaut hatte, war sie vielleicht dreizehn gewesen. Danach hatte sie vor lauter Schiss nächtelang nicht richtig schlafen können und jede Nacht ihre Zimmertür verrammelt. Es hatte Monate gedauert, bis sie die Bilder, vor allem aber Eduard Zimmermanns Grabesstimme wieder aus dem Kopf bekommen hatte.
Vielleicht würde ja ein Tee helfen. Ein schöner Assam mit Sahne und Honig. Sie schob den Stuhl zurück und stand auf, ging in die Küche. Geflissentlich ignorierte sie die Zeitung, die noch immer auf dem Küchentisch lag, bebrühte die Teeblätter, legte die Butterbrezel auf einen Teller und war schon fast wieder zur Tür hinaus, als sie sich doch noch einmal umdrehte, Teller und Teepott abstellte und die Zeitung erneut zur Hand nahm. Einem inneren Zwang folgend las sie den Artikel noch einmal durch und blätterte dann zurück zur Titelseite. Sie hielt das Bild in Armeslänge vors Gesicht und ließ die Zeitung schließlich sinken. So groß war die Ähnlichkeit nun auch wieder nicht, dachte sie. Eigentlich handelte es sich doch eher um eine typmäßige Übereinstimmung. Und was die in dem Artikel erwähnten Orte anging, so war es schon arg weit hergeholt, da eine Gemeinsamkeit sehen zu wollen. Ihre Mutter war in den vierziger Jahren in Norwegen gewesen, diese Frau hatte sich offensichtlich 1970 dort aufgehalten. Und bloß weil eine Frau, die anscheinend kriminell war, jede Menge gefälschter belgischer Pässe mit sich herumgeschleppt hatte, gab es noch lange keine Verbindung zu Evas Großmutter, die während der deutschen Besatzung eine Zeit lang in einem Krankenhaus im belgischen Lüttich gearbeitet hatte. Nein, da ging wohl ihre Fantasie mit ihr durch. Hatte Johannes ihr das nicht immer wieder vorgeworfen? Sie neige dazu, sich in abseitige Details hineinzusteigern und Muster zu sehen, wo es gar keine gebe. Eva stand auf, stellte den inzwischen lauwarmen Tee in die Mikrowelle und ging dann mit Tee und Brezelteller zurück in ihr Schreibzimmer. Ja, so war es, dachte sie. Eine berufliche Deformation, der Tatsache geschuldet, dass sie es gewohnt war, die Lücken in den Lebensläufen, die sie tagein, tagaus beschäftigten, mit ihrer Vorstellungskraft zu füllen.
Sie nahm einen Schluck Tee, biss von ihrer Brezel ab und machte sich dann an die Arbeit. Es musste gegen Mittag sein, als sie die Haustür gehen und Justus rufen hörte: »Bin da-a!«
Überrascht sah sie auf die Uhr. Schon zwanzig nach zwölf. Höchste Zeit, mit dem Kochen anzufangen, dachte sie und rief zurück: »Ich komme gleich!« Sie machte sich eine letzte Notiz und ging mit dem Geschirr in der Hand zurück ins Haus. Als sie an Justus’ Zimmer vorbeikam, steckte sie den Kopf hinein, aber er war nicht da. Wahrscheinlich saß er mit seinem Smartphone in der Küche und arbeitete sich durch die neuesten Memes. Als sie die Küchentür mit dem Ellbogen aufdrückte, sah sie ihn tatsächlich dort am Tisch sitzen, mit dem Rücken zu ihr.
»Hallo, mein Lieber, alles klar?«, fragte sie und stellte das Geschirr ab. »Was willst du essen? Spaghetti carbonara?«, fragte sie und gab ihm einen Kuss auf den dunklen Haarschopf. Erst in dem Moment bemerkte sie, dass er nicht an seinem Smartphone hing, sondern die Zeitung betrachtete, die vor ihm auf dem Tisch lag. Das Bild der Isdal-Frau. In dem Moment drehte er sich zu ihr um und sagte mit großen Augen: »Alter, ist das creepy, die sieht ja aus wie du!«
In dieser Nacht schlief Eva wenig. Stundenlang wälzte sie sich hin und her, versuchte mit allen Tricks, die Müdigkeit herbeizulocken, zählte Schäfchen, atmete in den Bauch und stellte sich schließlich, als nichts half, ihre Regen-Playlist auf Spotify ein. Zwar beruhigten sie die Regengeräusche, aber schlafen konnte sie trotzdem nicht. Immer wieder kehrten ihre Gedanken zu dem Gesicht der Frau zurück. Zu dem Gesicht und den merkwürdigen Parallelen zum Leben ihrer Mutter.
Nachdem auch Justus die Ähnlichkeit bemerkt hatte, hatte Eva wohl eine Minute lang wie vom Donner gerührt dagestanden, bis Justus nach seinem Smartphone gegriffen und Google geöffnet hatte. Tatsächlich gab es etliche Informationen über den Fall. Was Eva dann wirklich erschütterte, war ein mehrseitiger Beitrag in der Zeit. Es war eine Sache, eine reißerische Behauptung in der BILD zu lesen. Wenn allerdings die Zeit darüber berichtete, mit welchen Verfahren Wissenschaftler der Universität Bergen den Zahnschmelz der Toten analysiert hatten und so zweifelsfrei feststellen konnten, dass die Frau die ersten vier Lebensjahre in oder um Nürnberg verbracht hatte, dann war das doch eine andere Nummer. Denn ebenso zweifelsfrei wusste Eva, dass ihre Mutter als kleines Kind bei ihrer Großmutter in Zirndorf, einer kleinen Stadt bei Nürnberg, gelebt hatte. Über ihre Zeit in Norwegen oder auch in Belgien wusste Eva jedoch so gut wie gar nichts. Wie verschlossen ihre Mutter in manchen Dingen war, hatte sie besonders während der Arbeit an ihrem letzten Buch bemerkt, der Biografie über die Haarer. Als sie zu Beginn ihrer Recherchearbeit einmal den Versuch unternommen hatte, ihrer Mutter irgendwelche Äußerungen über deren Kindheit im Dritten Reich zu entlocken, hatte die alle Schotten dicht gemacht. Ach, was ist das bloß mit eurer Generation! Warum suhlt ihr euch immer im Bodensatz der Geschichte? Such dir doch mal ein erfreuliches Thema aus.
Eva richtete sich auf und knipste die Nachttischlampe an.
Bei der Erinnerung an dieses »Gespräch« stieg leise Wut in ihr auf. Warum hatte ihre Mutter nicht ein einziges Mal mit ihr darüber reden können? Dann säße sie jetzt nicht mitten in der Nacht hier herum und grübelte über etwas nach, das höchstwahrscheinlich nichts, aber auch gar nichts mit ihrem Leben zu tun hatte.
Sie sah auf die Uhr. Gleich zwei. Noch knapp vier Stunden, bis der Wecker klingelte. Sie griff nach einem der Bücher auf ihrem Nachttisch. Ein Roman, der im Mittelalter spielte und sie bisher noch jedes Mal eingeschläfert hatte. Diesmal allerdings nicht, also legte sie das Buch entnervt zur Seite, knipste das Licht wieder aus und ergab sich ihren hin und her huschenden Gedanken. Als um Viertel vor sechs der Wecker klingelte, hatte sie einen Entschluss gefasst: Sie würde ihrer Mutter das Bild zeigen und versuchen, mit ihr darüber zu sprechen.
Kurz bevor er sein Smartphone auf »nicht stören« stellte, bemerkte Laurin Abrahamsen, dass seine Schwester angerufen hatte. Was wollte Inger denn von ihm? Normalerweise sahen sie sich zweimal im Jahr, an Weihnachten und am Geburtstag ihrer Mutter. Ob etwas passiert war? Er schob den Gedanken beiseite und wandte sich seinen Studenten zu.
»Wenn wir hier in Norwegen über die Opfer des Zweiten Weltkriegs sprechen, meinen wir eigentlich immer nur unsere Widerstandskämpfer, also die, die von den deutschen Besatzern getötet wurden. Erst in den letzten Jahren hat dieses Geschichtsbild eine Wandlung erfahren und wir beginnen zunehmend, die Ereignisse von damals differenzierter zu betrachten, so auch die Definition, wer zu den norwegischen Opfern gehörte.«
Laurin Abrahamsen trat hinter dem Pult hervor und ließ den Blick über die Studentinnen und Studenten im Hörsaal schweifen.
»Sie wissen ja bereits, dass das Geschichtsbewusstsein immer vom jeweiligen Zeitgeist abhängt, und so bestimmt heutzutage nicht mehr Patriotismus den Diskurs, sondern eine Sichtweise, die weniger von Heldenverehrung und mehr von Menschlichkeit geprägt ist. In der letzten Vorlesung haben wir uns mit dem Widerstandskämpfer und Friedensnobelpreisträger Jan Andersen beschäftigt, der beides vereint: Heldentum und den Kampf für Menschenrechte. Sicher haben Sie alle inzwischen sein Buch gelesen, in dem er über seine Zeit im Widerstand und die Verhaftung durch die deutschen Besatzer 1942 berichtete.«
Jetzt lächelte Abrahamsen. An den ratlosen Blicken konnte er erkennen, wie es um sie stand. In ihren Hoodies saßen sie da, die jungen Männer. Was war das überhaupt für eine Mode? Und die Mädchen hatten ein Vogelnest auf dem Kopf. Na ja, nicht alle. Die junge Frau ganz links trug das blonde Haar offen. Eine hübsche Blondine mit vollen Lippen und großen Brüsten unter einer weißen, eng geschnittenen Bluse. Sie sieht ein bisschen aus wie Lilian, dachte er einen Moment lang irritiert, drängte den Gedanken jedoch gleich wieder beiseite.
»Heute dagegen möchte ich mit Ihnen über die Deutschenflittchen sprechen.« Er genoss ihre entsetzten Blicke. Jetzt hatte er sie. Auch die Augen der Blonden weiteten sich.
»Ja, so wurden sie genannt, ›Deutschenflittchen‹ oder etwas freundlicher ›Deutschenmädchen‹ – die Frauen, die sich während des Krieges mit einem der dreihundertfünfzigtausend Wehrmachtssoldaten eingelassen haben.«
Er setzte sich in Bewegung, schritt die erste Reihe ab wie ein General, der eine Parade abnimmt. Er sprach ganz entspannt, das Ansteckmikro trug seine Stimme bis in die obersten Winkel des Hörsaals.
»Aber was war das denn überhaupt, ein Deutschenflittchen?«, fragte er und sah sie an, einen nach dem anderen, bis sein Blick wieder auf der Blonden ruhte. »Was musste man gemacht haben, um als eines zu gelten? Haben Sie sich das nicht auch schon einmal gefragt?«
Ihre Blicke waren Antwort genug. Bis auf einige wenige Ausnahmen haben sich diese Dumpfbacken noch nie etwas gefragt, dachte er, außer vielleicht, wo die nächste Studentenparty stattfand, bei der sie so richtig abfeiern konnten. Wenn er dieses Wort schon hörte.
»Waren das Prostituierte oder Naziparteihuren oder einfach Frauen, die mit einem Deutschen ins Bett gingen? Waren das Frauen, die von einem Soldaten ein Kind bekamen? Oder reichte es schon, auf der Straße mit einem Deutschen zu sprechen?«
Das Echo seiner Worte stand im Raum. Er genoss den Augenblick vollkommener Aufmerksamkeit seines Publikums. Über die Jahre war er ein immer besserer Redner geworden. Schon lange brauchte er keine Notizen mehr, bewegte sich frei im Raum und genoss seine Macht über die Studierenden.
»Drei Millionen Einwohner hatte Norwegen während der Besatzungszeit. Dreihundertfünfzigtausend deutsche Männer befanden sich damals im Land, alle im zeugungsfähigen Alter. Wie viele Frauen hatten ein Liebesverhältnis mit einem Deutschen, was schätzen Sie?«
Wieder diese Ratlosigkeit, es war zum Schießen, dachte er. Ein paar Hände gingen nach oben, auch die der üppigen Blondine.
»Ja?«, forderte er sie auf.
»Fünfzigtausend?« Ihre Stimme so wohlanständig wie erwartet.
»Wie erfreulich«, sagte er mit jenem warmen Timbre in der Stimme, das Anerkennung signalisierte. »Jemand, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.«
Sie öffnete die Lippen und schlug die Augen nieder. Sie fühlte sich geschmeichelt, ganz wie beabsichtigt.
»Schätzungen zufolge waren es zehn Prozent der weiblichen Bevölkerung zwischen achtzehn und fünfunddreißig, also tatsächlich fünfzigtausend Frauen, die Sex mit einem Wehrmachtssoldaten hatten.« Sein Blick ruhte noch immer auf der Blonden. »Und es waren zwölftausend Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen.«
Es war dieses Prickeln am Anfang, bevor etwas geschah, das er am meisten genoss. Doch im Augenblick hatte er erst einmal eine Botschaft zu verkünden.
»Wer von Ihnen ist aus Oslo?«, fragte er unvermittelt. Ein paar Hände gingen nach oben.
»Dann waren Sie sicher schon einmal zum Baden auf Hovedøya?«
Ein junger Mann mit Zopf nickte. Der Rest hielt sich lieber bedeckt. Um nicht aufgerufen zu werden, wenn sie an der falschen Stelle nickten, gingen sie lieber in Deckung. Er richtete seinen Blick auf den Zopfträger.
»Dann wissen Sie sicher auch, wozu die kleine Insel Hovedøya nach dem Krieg diente?«
Laurin stand jetzt vollkommen still. »Nein?« Inzwischen war er gut darin, sie in den rechten Momenten den Atem anhalten zu lassen. »Na ja …«, sagte er generös. »Da sind Sie nicht der Einzige.« Er sah die Erleichterung im Blick des jungen Mannes. »Nach dem Krieg …« Er setzte sich wieder in Bewegung. »… hat man dort die Deutschenmädchen interniert. Bis zu eintausend dieser Frauen hielt man dort fest. Dabei existierte … und jetzt hören Sie gut zu … keinerlei Rechtsgrundlage für ihre Internierung. Aber woher wusste man überhaupt, welche Frau sich mit einem Deutschen eingelassen hatte? Da gab es natürlich zum einen die altbewährte Denunziation. Die andere Methode, die den Behörden gute Dienste leistete, waren Karteien, die während der deutschen Besatzung zur Abwehr von Geschlechtskrankheiten angelegt worden waren.«
Jetzt stand er in der Mitte und blickte über die Reihen. »Man hat diese Frauen also widerrechtlich dort eingesperrt. Aber das war noch nicht genug. Vorher hat man sie durch die Straßen getrieben, ihnen die Haare geschoren. Vielen hat man überdies auch noch die Staatsbürgerschaft entzogen. Und wie, glauben Sie, ist man mit den Kindern dieser Frauen umgegangen?«
Er ließ die Worte in der Stille wirken. Jetzt war er in seinem Element. »Wir haben zwei Generationen gebraucht, bis wir endlich den Mut hatten, uns mit der Diskriminierung dieser Frauen und Kinder auseinanderzusetzen. Um die siebzig Jahre hat es gedauert, bis die Regierung sich bei ihnen entschuldigt hat. Im Jahr 2000 erfolgte die Entschuldigung bei den Kriegskindern, wie sie auch genannt wurden. Doch es dauerte weitere achtzehn Jahre, bis sich die norwegische Ministerpräsidentin auch bei den betroffenen Frauen entschuldigte!«
Er sah ihnen an, wie erschüttert sie waren. Das sollten sie ruhig sein, diese blonden Milchgesichter. Noch wussten sie nicht, dass diese Aufarbeitung der Vergangenheit weitgehend ihm zu verdanken war. Vor Jahren hatte er sich des Themas angenommen und nicht geruht, bis ein Klima für politische Diskussionen entstanden war, in dem diesen Menschen Gerechtigkeit zuteilwerden konnte. Allerdings war diese Gerechtigkeit leider reichlich spät gekommen – die meisten dieser Frauen waren schon gestorben und die Wunden der Kinder längst vernarbt. Im Laufe des Semesters würde er diesen Milchbärten schon noch zeigen, dass die nationale Entschuldigung im Jahr 2018 zum großen Teil sein Verdienst gewesen war.
»Bis zum nächsten Mal werden Sie diese Frauen genauer unter die Lupe nehmen«, sagte er. »Versuchen Sie herauszufinden, woher sie kamen, welche Schulbildung sie hatten.«
Die Blonde hing an seinen Lippen. Er hatte lange gebraucht, um zu begreifen, welche Türen ihm die Macht des Wissens öffnete.
»Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag«, sagte er, drehte sich auf dem Absatz um und ging zum Pult zurück. Stühle klappten hoch, Gemurmel setzte ein. Er stellte sein Smartphone wieder an. Noch zwei Anrufe von Inger. Er wollte sie gerade zurückrufen, als hinter ihm jemand sagte: »Herr Professor?«
Er wandte sich um. Die wohlanständige Blonde. Sie stand da und lächelte ihn an.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte er und richtete seinen dunklen Blick auf sie. Er sah, wie sie errötete. Natürlich wusste er um seine Wirkung. Dasselbe verwegene Aussehen wie sein Vater. Das einzig Gute, was dieser Mann ihm vermacht hatte.
»Ich wollte Sie um eine Lektüreempfehlung zum heutigen Thema bitten. Ich möchte mich intensiver damit auseinandersetzen.«
»Aber selbstverständlich. Kommen Sie in meine Sprechstunde. Dann gebe ich Ihnen eine Leseliste. Schön, dass es Studierende gibt, die von Anfang an engagiert sind und nicht erst eine Woche vor den Klausuren.«
Sie nickte eilfertig und erfreut.
Er schenkte ihr noch einen Blick, länger diesmal, und wandte sich wieder seinem Smartphone zu. Doch sie blieb stehen und sagte: »Ich habe Ihr Buch gelesen.«
Er lächelte nachsichtig. »Ich gehe davon aus, dass Sie das Buch über die Deutschenmädchen meinen?«
»Oh … ja … das meine ich. Ich fand es … sehr informativ.«
»Das freut mich. Machen Sie weiter so.«
Wieder nickte sie. Sie hielt sich sehr gerade. Wusste sie denn nicht, dass ihre Brüste in der engen Bluse wie eine Einladung wirkten?
»Dann sehen wir uns also in meiner Sprechstunde«, sagte er, nahm seine Aktentasche und verließ den Hörsaal. Während er im Korridor durch einen Strom von Studierenden ging, wählte er Ingers Nummer und hielt sich das Smartphone ans Ohr. Sie antwortete fast sofort.
»Endlich erreiche ich dich.« Ihre Stimme klang panisch.
»Was ist denn los?«, fragte er leicht irritiert.
»Es geht um Mutter. Sie hatte einen Schlaganfall. Du musst kommen, möglichst schnell.«
Drei Stunden später fuhr Eva im weiterhin strömenden Regen zum Haus ihrer Mutter in Grünwald und überlegte, wie sie vorgehen sollte. Welchen Einstieg sollte sie wählen? »Du, Mama, schau mal, die Tote hier sieht aus wie du!« Oder: »Mama, kennst du die Tote hier auf dem Phantombild? Es gibt da ein paar merkwürdige Übereinstimmungen mit deinem Leben.«
Seltsamerweise fühlte sie sich trotz des Schlafmangels überwach, hatte zugleich aber Mühe, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Mit einem flauen Gefühl bemühte sie sich, die Informationen, die sie bisher über die Frau gesammelt hatte, in eine vernünftige Reihenfolge zu bekommen. Am 29. November 1970 hatte man sie gefunden, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, in einem einsamen Tal in der Nähe von Bergen. Angeblich hatte sie Tabletten geschluckt, jede Menge Schlaftabletten, aber gestorben war sie, wenn Eva das richtig verstanden hatte, schon vorher an einer Kohlenmonoxidvergiftung.
Eva umklammerte das Lenkrad fester.
Irgendwann im Dezember hatte der Polizeichef dann auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass man von einem Selbstmord ausgehe und die Ermittlungen einstellen werde.
Sie setzte den Blinker und fuhr die Akazienallee entlang. Sie rechnete nach. Wie alt war ihre Mutter damals gewesen? Geboren 1938 … Dann war sie im Herbst 1970 zweiunddreißig Jahre alt. Zu der Zeit hatte sie wohl noch als Stewardess bei der Lufthansa gearbeitet. Eva selbst war noch nicht auf der Welt gewesen.
Sie bog rechts ab und folgte der gewundenen Auffahrt, die zum Haus ihrer Mutter Ingrid und ihres Stiefvaters führte. Nasse gelbe Blätter regneten von den Bäumen, klatschten auf ihre Windschutzscheibe und wurden vom Scheibenwischer hin- und hergeschoben. Nicht gerade das Wetter, das ihre Mutter schätzte. Sie parkte den Wagen auf dem Vorplatz und blieb noch einen Augenblick sitzen. Dieses wunderschöne, große Haus, dachte sie wie immer, wenn sie ihre Eltern besuchte. Und wie immer überkam sie eine gewisse Traurigkeit bei dem Gedanken, dass ihre Mutter und Bodo es ganz alleine bewohnten. Was, wenn ihre Mutter damals tatsächlich noch mehr Kinder bekommen hätte, so wie sie und Bodo es sich so sehnlichst gewünscht hatten?
Eva nahm die Tasche vom Beifahrersitz und stieg aus. Mit eingezogenem Kopf rannte sie zum überdachten Eingangsportal und klingelte. Zu ihrer Überraschung öffnete ihre Mutter selbst, barfuß und im Seidenpyjama. Die rot lackierten Fußnägel lugten perfekt manikürt unter den cremeweißen Hosenbeinen hervor. Massaï von Dior, das einzige Rot, das ihre Mutter im Haus duldete.
»Bist du krank?«, fragte Eva statt einer Begrüßung, bemerkte aber gleich darauf, dass ihre Mutter wie gewohnt ein perfektes Make-up aufgelegt hatte. Auch mit über achtzig achtete Ingrid sehr auf sich.
»Sehe ich denn so aus?«, antwortete sie mit gespielter Entrüstung und fügte dann hinzu: »Zuzanna hat eine üble Erkältung, also fliegen wir schon früher. Ich packe gerade.«
Seit Jahren schon verlängerten ihre Mutter und Bodo sich den Sommer in ihrem Haus in Taormina, wo das Thermometer bis weit in den November hinein noch gute zwanzig Grad anzeigte. Genau das richtige Wetter für Ingrid.
»Wolltet ihr nicht erst nächste Woche los?«, fragte Eva ein wenig perplex, als ihre Mutter sich vorbeugte und sie mit einem Kuss auf die Wange begrüßte – einer links und einer rechts, ganz so wie auf einer dieser Cocktailpartys, die Bodo und sie immer noch gaben und an die Eva sich niemals hatte gewöhnen können. Als Ingrid nach dem frühen Tod von Evas Vater zum zweiten Mal geheiratet hatte, war Eva neun Jahre alt gewesen. Sie erinnerte sich noch gut an die Hochzeit und wie sie dort gestanden hatte, ein verlorenes Kind in einem steifen Kleid, in dem es sich fremd gefühlt hatte. Genauso fremd wie in dem prächtigen Haus, in dem sie sich mehr als einmal verlaufen hatte. Wie schön es doch gewesen wäre, Geschwister zu haben.
Sie streifte Schuhe und Mantel ab, schlüpfte in die Gästepantoffeln und folgte ihrer Mutter hinauf ins überheizte Schlafzimmer, wo sie auch noch den Pullover auszog. Ihre Mutter konnte es nie warm genug haben, was sich darin äußerte, dass sie die Fußbodenheizung immer ein wenig zu hoch einstellte und an allen möglichen Orten im Haus Heizkissen deponiert hatte. Dieser Drang nach Wärme hat etwas Pathologisches, dachte Eva oft. Als sie ihre Mutter einmal darauf angesprochen hatte, hat die nur knapp erwidert, sie habe als Kind genug gefroren für ein ganzes Leben.
»Wenn du einen Grüntee möchtest, du weißt ja, wo die Kanne ist. Ich habe sogar frischen Matcha«, sagte ihre Mutter fröhlich, während sie in dem begehbaren Kleiderschrank verschwand und kurz darauf mit ein paar weißen Blusen und Leinenröcken wieder herauskam. Ihre Mutter liebte Weiß. Die Farbe der Reinheit. Auch ihr Schlafzimmer war vollkommen in Weiß gehalten. Sogar die antiken Rahmen von Großmutter Leontines Heiligenbildchen, die über dem Toilettentisch aus Kirschholz hingen, hatte sie durch reinweiße ersetzt. Ingrids Vorliebe für Weiß und helle Naturtöne hatte sich noch verstärkt, als sie vor ein paar Jahren auf das Buch der Aufräumkönigin Marie Kondo gestoßen war und danach in einem Rundumschlag alles entsorgt hatte, was sich in irgendeiner Weise negativ auf ihr Seelenheil auswirken könnte. Durch Ausmisten und Wegschmeißen hatte sie konsequent daran gearbeitet, belastendes Lebensgepäck loszuwerden und in eine neue, aufgeräumte Zukunft zu starten. Zum Glück war es Bodo gelungen, die kostbarsten Stücke zu retten, indem er sie einlagern ließ, und ein paar persönliche Gegenstände hatte er kurz entschlossen in Kartons gepackt und heimlich zu Eva gebracht. Wenn die Ausmisteritis abgeklungen ist, wird sie froh sein, all das wiederzuhaben, hatte er gesagt. Eva war ganz seiner Meinung gewesen und hatte alles bei sich auf dem Dachboden untergebracht.
»Ich möchte keinen Grüntee, danke«, sagte Eva und spürte kurz die altbekannte Entrüstung über ihre Mutter, die auch mit über achtzig noch nicht begriffen hatte, dass Eva keinen Grüntee mochte und vor allem diesen mehligen Matcha regelrecht verabscheute.
Sie stellte ihre Handtasche ab und setzte sich auf die Polsterbank am Fußende des großen Bettes. Aber wer konnte ihrer Mutter schon böse sein? Die zauberhafte, immer gut gelaunte Ingrid, der nichts wichtiger war als ein Leben in Frieden und im Einklang mit ihren Mitmenschen.
»Wie schön, endlich verwendest du sie!«, sagte Ingrid unvermittelt. Eva musste erst dem Blick ihrer Mutter folgen, um zu begreifen, wovon die Rede war.
Die Tasche, eine Birkin Bag, war ein Geschenk ihrer Mutter zu ihrem vierzigsten Geburtstag vor drei Jahren gewesen. Eva hatte sich zuerst wirklich über die Tasche gefreut. Doch als sie durch einen Zufall erfahren hatte, dass diese Tasche so viel kostete wie ein neuer Golf, hatte sie sie entsetzt in den luxuriösen Karton zurückgelegt und erst einmal zwei Jahre dort ruhen lassen, geschützt in einem braunen Staubbeutel und eingeschlagen in weißes Seidenpapier. Ingrid war der großzügigste Mensch, den Eva kannte. Wie schön wäre es für sie gewesen, eine Enkelschar um sich zu haben, die sie nach Strich und Faden verwöhnen könnte. Doch zum Verwöhnen hatte sie eben nur Eva und Justus.
»Ja«, antwortete Eva und betrachtete ihre Mutter, die gerade versonnen und hoch konzentriert eine Bluse glatt strich.
Eva seufzte innerlich. Gleich würde sich der Gesichtsausdruck verändern. Sie wollte ihrer Mutter das eigentlich nicht zumuten, jetzt nicht. Aber was blieb ihr anderes übrig?
Ihre Mutter interpretierte Evas Aufmerksamkeit falsch und erklärte: »Es geht nicht nur darum, die Kleidungsstücke schön kompakt zu kriegen. Vor allem vermittelst du ihnen so deine Dankbarkeit für ihre Dienste«, sagte sie und stellte das Marie-Kondo-mäßig gefaltete Paket in ihren Koffer.
Eva holte gerade tief Luft, um ihrer Mutter den Zeitungsartikel zu zeigen, da sagte die: »Gestern hat uns übrigens Johannes besucht. Ich habe ihn und Justus für die Herbstferien nach Taormina eingeladen. Ich hoffe, das ist dir recht. Warum kommst du nicht auch dazu?«
Eva seufzte. Auch drei Jahre nach ihrer Scheidung von Johannes schien ihre Mutter nicht begreifen zu wollen, dass bei Johannes und ihr nichts mehr zu machen war. Sie hatten sich getrennt, er lebte mit einer anderen zusammen, und das würde auch so bleiben.
Ein wenig müde sagte sie: »Vielleicht nächstes Mal.« Und dann fuhr sie fort: »Ich bin wegen etwas Bestimmtem gekommen. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll, aber ich hab da was in einer Zeitung gesehen …«
»Ach Kind, du weißt doch, dass ich seit Jahren keine Zeitungen mehr lese.«
Erleichtert, dass Ingrid den Themenwechsel zu akzeptieren schien, aber auch irritiert über deren Einwand, holte Eva die Zeitung heraus. Kurz zögerte sie, den Blick auf das Bild in ihrem Schoß gesenkt. Sie wollte ihrer Mutter nicht den Tag vermiesen. Aber diese Ähnlichkeit … Sie schluckte und schaute ihre Mutter an, die dabei war, mit liebevoller Hingabe einen Rock zu glätten. Während Eva sie über das Leinen streichen sah, traf sie der Gedanke mit voller Wucht: Genau so hätte die Frau im Alter ausgesehen.
Da schaute Ingrid sie an und ihre Blicke trafen sich.
»Was ist denn?«, fragte sie und richtete sich auf.
»Bitte erschrick nicht«, sagte Eva und hob das Phantombild in die Höhe.
Zuerst schien Ingrid nicht richtig zu verstehen, so wie Eva es auch nicht verstanden hatte. Fast tonlos murmelten ihre Lippen die Schlagzeile. War die unbekannte Tote eine Deutsche? Doch dann weiteten sich ihre Augen.
Durch die Reaktion ihrer Mutter ermutigt, sagte Eva: »Dann siehst du es also auch! Diese Ähnlichkeit … die ist doch einfach irre …« Fast hektisch raschelte sie mit der Zeitung, blätterte sie auf. »Aber das ist noch nicht alles! Weißt du, was hier steht? Das ist … unglaublich. Diese Frau ist in Nürnberg aufgewachsen, genau wie du, und hat wohl belgische Pässe verwendet. Du warst doch auch in Belgien, als Kind, das hast du mir doch mal erzählt?«
Eva sprach immer schneller und nahm kaum wahr, dass ihre Mutter aufs Bett gesunken war und Evas Worte wie einen kalten Regenschauer über sich ergehen ließ.
Jetzt zeigte Eva mit dem Finger auf eine Passage, die sie mit Leuchtstift markiert hatte. »Und gestorben ist sie in Norwegen … Du warst doch auch in Norwegen, deine Mutter hat da in einem Krankenhaus gearbeitet, nicht wahr, während der deutschen …«
Auf einmal durchschnitt Ingrids Stimme ihren Redefluss.
»Schluss jetzt!«, rief sie. Sie schien vollkommen außer sich. Fast schreiend fuhr sie fort: »Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen!«
Eva sah ihre Mutter erschrocken an. Sie war es nicht gewohnt, dass Ingrid laut wurde. Ingrid erhob nie die Stimme, niemals. In ihrem ganzen Leben hatte Eva sie bis jetzt nicht ein einziges Mal schreien hören.
Die Tür ging auf und Bodo kam herein.
»Was ist denn hier los?«, fragte er, ebenfalls vollkommen perplex. Seine heitere, auf Harmonie gebürstete Frau hatte hier herumgeschrien?
»Hallo, Eva«, sagte er, als er sich wieder gefasst hatte und sie mit einem Kuss auf die Wange begrüßte.
»Ich …«, sagte Eva und hob kraftlos die Zeitung hoch, »ich habe gestern das hier entdeckt.«
Er sagte nichts, aber Eva sah sehr wohl, wie seine Augen groß wurden, als er die Frau auf dem Bild betrachtete. Immer noch schweigend las er den dazugehörigen Artikel.
»Die Ähnlichkeit ist schon bemerkenswert«, hob er zaghaft an.
»Was soll daran bemerkenswert sein?«, erwiderte Ingrid, ihre Stimme klang noch immer fremd. Dann griff sie nach einer Sommerdaunenjacke und begann, sie zusammenzufalten. Sie blickte kurz auf, sah von Bodo zu Eva und sagte in ihrem gewohnt munteren Tonfall: »Seid mir nicht böse, ihr Lieben, aber jetzt muss ich wirklich weiterpacken. Sonst wird das nichts mit unserer Reise. Eine alte Frau ist ja kein D-Zug …« Aber das Lächeln, das diese Worte begleitete, wirkte dermaßen zittrig, dass es für Eva keinen Zweifel mehr gab: Ihre Mutter verbarg etwas vor ihr.
Saint-Antoine, Frankreich, 1954
So häufig wie in den vergangenen zwei Wochen hat sie Juliette noch nie besucht. Ihre Ziehmutter wird schon misstrauisch. Wahrscheinlich argwöhnt sie, Marguerite könnte sich mit Simon oder sonst einem Jungen herumtreiben. Gestern hat sie das erste Mal so eine Andeutung gemacht.
Dennoch ist es nahezu unmöglich für Adrien und sie, sich auch nur kurz ungestört zu unterhalten. Sie haben kaum Gelegenheit, mehr als einen Satz allein zu wechseln. Und im Grunde ist sie ja gar nicht richtig mit Juliette befreundet, daher wird es für sie immer schwieriger, einen Vorwand zu finden, um sich schon wieder bei ihr einzuladen. Das geht so lange, bis Adrien ihr an einem Freitagabend an der Haustür zuflüstert: »Ich habe etwas herausgefunden. Komm Sonntagvormittag vorbei. Dann sind meine Frau und Juliette in der Messe.«
Marguerite kann es kaum erwarten, dass der Samstag endlich vorbeigeht. Damit sie selbst nicht in die Messe muss, erklärt sie schon am Samstagabend, sie fühle sich fiebrig. Vielleicht habe sie gestern beim Kirschenpflücken zu lange in der Sonne gestanden. Sollen die beiden ruhig denken, dass sie vom vielen Arbeiten krank geworden ist. Obwohl sie sonst gern zur Messe geht. Das ist nämlich der einzige Ort, an dem die beiden Alten sie in Ruhe lassen.
Jedenfalls schlüpft sie aus dem Bett, kaum dass sie hört, wie Ann-Marie und Jean-Luc am nächsten Morgen aus dem Haus gehen. Sie verlässt das Grundstück durch die hintere Gartenpforte und nimmt den Schleichweg zwischen den Hecken, damit niemand sie sieht. Zehn Minuten später klingelt sie bei den Dumonts.
Lächelnd öffnet er ihr die Tür. Bevor er sie jedoch hereinbittet, sieht er sich noch einmal um. Es ist dieser Blick, der Marguerite das erste Mal die Heimlichkeit ihres Tuns vor Augen führt: Sie und Monsieur Dumont teilen ein Geheimnis miteinander.
Er führt sie in sein Büro. Ein holzgetäfelter Raum mit einem wuchtigen braunen Ledersofa mit Knöpfen in der Lehne. Ein steinerner Kamin. Ein mit Papieren übersäter Schreibtisch. Aktenstapel auf einem halbhohen Schrank an der hinteren Wand.
»Nimm Platz. Hast du Durst? Möchtest du eine Limonade?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, vielen Dank, Monsieur Dumont.«
Er lächelt. »Du kannst mich Adrien nennen.«
»Adrien«, sagt sie, setzt sich artig auf das Sofa und legt die Hände in den Schoß. Sie ist ein wenig unsicher, hat Angst vor dem, was er ihr gleich sagen wird, aber irgendwie auch davor, mit ihm allein zu sein. Aus irgendeinem Grund ist es ihr wichtig, was er von ihr denkt. Sie will ihm gefallen. Sie weiß, dass sie hübsch ist mit ihren dunkelbraunen Augen und dem ebenso dunklen Haar, hübscher als die anderen in der Klasse, auch als Juliette. Aber sie will, dass auch er sie hübsch findet. Sie hat extra ihr bestes Kleid angezogen, das hellblaue mit dem engen Oberteil und dem weit schwingenden Rock. Er setzt sich in den Sessel ihr gegenüber.
»Also zunächst einmal habe ich für dich einen Suchantrag beim Roten Kreuz gestellt. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis wir da eine Antwort bekommen. Das ist das eine.« Er lehnt sich zurück, schlägt die Beine übereinander. »Und dann war ich in Lamorlaye und habe mit ein paar Leuten von der Gemeinde gesprochen. Es gibt da nur ein Haus, das wie ein Schloss aussieht: das Manoir de Bois Larris, das ehemalige Anwesen der Familie Menier. Du weißt schon, die Schokoladenfabrikanten. Tatsächlich hatten die Deutschen das Haus damals beschlagnahmt und für ihre Zwecke verwendet.«
Er sieht sie ununterbrochen an, während er spricht. Vielleicht denkt er, dass sie ihm nicht folgen kann? Also beeilt sie sich und nickt und er fährt fort: »Das Anwesen steht übrigens seitdem leer. Aber leider …«, er schüttelt bedauernd den Kopf, »gibt es keine Unterlagen mehr. Die Deutschen haben alles mitgenommen. Es ist nichts mehr da.«
Wieder nickt sie. Weniger eifrig nun. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Da sagt er: »Es gibt da allerdings etwas, das du wissen solltest. Du hast mir doch gesagt, dass es ein Kinderkrankenhaus war, in dem deine Mutter gearbeitet hat.«
Sie nickt.
»Das kann nicht sein.«
»Nein?« Sie sieht ihn mit großen Augen an.
»Nein. Das war es wohl nicht. Aber so richtig verstanden habe ich noch nicht, was es damit auf sich hatte. Nur dass es offenbar kein … normales Kinderkrankenhaus war. Anscheinend wurde damals ein großes Geheimnis um diesen Ort gemacht. Es soll streng verboten gewesen sein, sich dem Anwesen zu nähern. Noch nicht einmal die Soldaten der Wehrmacht hatten dort ohne Weiteres Zugang. Na ja … Jedenfalls habe ich eine Menge Gerüchte gehört. Du weißt ja, wie das ist. Die Leute reden und man weiß nie so genau, was stimmt und was nicht.« Er verstummt.
Sie sieht ihm an, dass er noch etwas sagen will, es ihm aber schwerfällt. Als er weiter schweigt, sagt sie: »Bitte. Sie müssen mir alles sagen.«
Da steht er auf und setzt sich neben sie, sieht sie bedauernd an.
»Ich bin mir nicht sicher … Vielleicht ist es nur Geschwätz. Dann möchte ich dich damit wirklich nicht belasten. Nächste Woche treffe ich mich mit einer Frau, die dort gearbeitet hat. Warten wir doch erst mal ab, was sie zu sagen hat.«
Aber Marguerite bleibt hartnäckig. Sie will alles wissen. Jetzt.
Da seufzt er und sagt: »Du hast doch sicher von der … Ideologie der Nazis gehört. Was sie alles gemacht haben, um ihre … Rasse aufzuwerten?«
Marguerite reagiert nicht, sieht ihn nur an. Ein unangenehmes Gefühl kriecht in ihr hoch.
»Jedenfalls geht das Gerücht, dass das Haus in Lamorlaye so eine Art Heim war, in dem sie … wie soll ich sagen … Arier züchten wollten.«
»Was?«
»Ja. So eine Art Begattungsheim, in dem sie arische Frauen mit SS-Angehörigen zusammengebracht haben, um … wie sie es nannten … rassisch wertvollen Nachwuchs zu zeugen.«
»Und meine Mutter hat dort … gearbeitet?«, flüstert Marguerite.
»Das wissen wir noch nicht. Warten wir ab, was diese Frau nächste Woche sagt.« Sein Blick ist ganz weich, als er fragt: »Wie kann ich dich erreichen? Ich meine, du willst doch nach wie vor nicht, dass jemand anderes davon erfährt?«
»Nein …«, sagt sie erschrocken. »Niemand darf es wissen.«
»Hm«, sagt er und sieht sie ernst an. »Dann können wir hier nicht in Ruhe reden. Wenn Juliette und meine Frau da sind.« Da sagt er plötzlich: »Gehst du jeden Tag zu den Martins?«
»Ja«, sagt sie. »Meistens.«
»Und du gehst immer die Straße nach Saint-Émile?«
»Ja.«
»Gut. Dann werde ich dich schon finden.«
Die ganze nächste Woche kann sie an nichts anderes denken. Was Adrien wohl herausfinden wird? An den Abenden kann sie lange nicht einschlafen. Und je schwärzer sich die Nacht über sie herabsenkt, desto schwärzer werden auch ihre Gedanken. In diesen Stunden liegt sie da und ihre Furcht wächst ins Unermessliche. Die Furcht davor, er könnte etwas herausfinden, was schlimm ist. Die Furcht, er könnte nichts herausfinden. Und die Furcht, er könnte alles seiner Frau oder – schlimmer noch – Juliette verraten. Erst gegen Morgen, wenn die Dämmerung die Schatten der Nacht mit sich fortnimmt, sinkt sie in einen leichten Schlaf und ist froh, dass Ann-Marie sie erst gegen acht Uhr weckt. Immerhin sind Sommerferien.
Die Vormittage vergehen dann wie im Flug, wenn sie nach ihrem Café au Lait mit Ann-Marie den Haushalt besorgt oder sich um den Garten kümmert, so wie sie das seit Beginn der Ferien jeden Tag tut. Sie ist froh um die banalen Aufgaben, die es zu tun gilt: die Fenster putzen, die Wäsche auf die Leine hängen, die Aprikosen ernten und die schwarzen Johannisbeeren.
In diesen Stunden, wenn die Sonne auf sie herunterbrennt und jeden Winkel des Gartens ausleuchtet, erscheint es ihr fast so, als hätte es die Nacht mit ihren Schreckgespenstern nicht gegeben, und ihre Gedanken bewegen sich in eine andere Richtung. Und während ihr der Schweiß die Achseln herunterrinnt, beginnt sie an Monsieur Dumont zu denken, an Adrien, jedoch auf eine andere Art. Es ist immer noch merkwürdig für sie, an ihn als an Adrien zu denken. Aber vor allem ist es aufregend. Auch kann sie es noch nicht richtig fassen, dass er das für sie tut. Noch nie hat irgendjemand etwas für sie getan, ohne etwas dafür zu wollen. Natürlich ist ihr der Gedanke gekommen, ob Adrien nicht vielleicht doch etwas von ihr möchte. Sie ist ja nicht auf den Kopf gefallen und weiß, was Männer von Frauen wollen. Doch je mehr sie darüber nachdenkt, desto mehr gefällt ihr die Vorstellung. Dass so ein gut aussehender, erfolgreicher, kluger Mann sie möglicherweise als Frau ansehen könnte. Na ja, dass sie hübsch ist, das weiß sie. Auch muss sie sich nicht den Büstenhalter ausstopfen wie Valérie und Manon das tun. Und dass auch ältere Männer ihr hinterhersehen, entgeht ihr natürlich auch nicht. Wie die Väter von Claudette und Valérie sich neulich die Hälse nach ihr verrenkt haben. Was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass sie von Valéries Mutter nicht mehr nach Hause eingeladen wird.
Sie betrachtet ihre Hände, die vom Saft der Johannisbeeren schon ganz dunkel sind. Und da muss sie plötzlich an Madame Dumont denken, wie sie ihr neulich, als sie geweint hat, einfach nur eine Johannisbeer-Tarte angeboten hat. Mit einem Mal fragt sie sich, was für ein Mensch Madame Dumont eigentlich ist. Sicher, Madame Dumont ist eine schöne Frau. Und doch scheint sie so distanziert, unnahbar fast. Darin ähnelt sie Juliette, die wirkt auch manchmal so kühl. Sie ist eine hervorragende Schülerin, aber außer ihr hat Juliette in der Klasse keine Freundin. Was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Marguerite, die aus einer ganz anderen gesellschaftlichen Klasse kommt, überhaupt zu ihr nach Hause eingeladen wird.
Und dann, an einem Mittwochabend, ist es so weit. Sie geht die Landstraße entlang, wie jeden Abend. Und wie jeden Abend seit eineinhalb Wochen hält sie es vor Anspannung kaum aus und sieht sich immer wieder um, obwohl weit und breit kein Motorengeräusch zu hören ist.
Sie trägt das weiße Blüschen, das mit den angeschnittenen Ärmeln, und bevor sie aufgebrochen ist, hat sie sich, wie jeden Abend seit eineinhalb Wochen, das Haar besonders ausgiebig gebürstet, was Ann-Marie schließlich bemerkt hat.
»Was stehst du dauernd vor dem Spiegel herum?«, hat sie mit missbilligendem Blick gesagt. »Du gehst nach Saint-Émile und nicht auf die Champs-Élysées!«
Aber Marguerite hat nur mit den Schultern gezuckt und weitergebürstet.
Und plötzlich ist da tatsächlich ein Geräusch. Als sie sich umsieht, entdeckt sie das Auto von Adrien, das einen Moment später neben ihr anhält. Vor dem Einsteigen schaut sie sich kurz um, und als niemand zu entdecken ist, öffnet sie die Tür.
Das Herz schlägt ihr zum Zerspringen.
»Hallo, Adrien«, sagt sie und steigt ein.
»Hallo, Marguerite«, sagt er ernst, legt den Gang ein und fährt los. Wie immer trägt er ein weißes Hemd, aber diesmal hat er die Krawatte abgenommen und die Hemdsärmel hochgekrempelt. Verstohlen betrachtet Marguerite seine Hände, die auf dem Lenkrad liegen.
Warum sagt er denn nichts? Ist es so schlimm, dass er gar nicht weiß, wie er es ihr beibringen soll?
Doch da biegt er rechts ab, in den Feldweg, der zur verlassenen Gärtnerei führt.
Marguerite sitzt da, den kleinen Eierkorb hat sie neben ihre Füße gestellt. Es dauert nicht lange, da hält Adrien neben einem Gewächshaus, das nur noch ein Gerippe ist, in dem Geißblatt und Sommerflieder um die Wette wuchern. Die Hitze ist erfüllt vom Blütenduft.