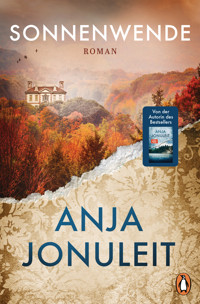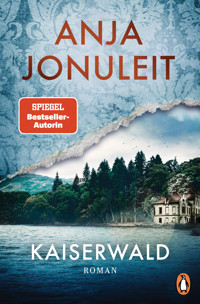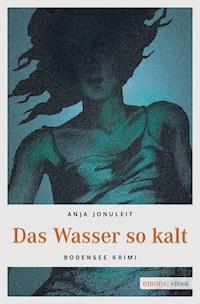
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bodensee Krimi
- Sprache: Deutsch
Nomen ist nicht immer Omen. Das zumindest weiß Marie Glücklich sicher. Frisch verlassen, stellen- und mittellos, kehrt sie in ihre schwäbische Heimat zurück. Als eine alte Schulfreundin ihr einen Job vermittelt, lässt sie sich, wenn auch widerwillig, auf die Sache ein: Das Institut für Demoskopie in Allensbach sucht für eine Studie über den 'Einfluss des Internet auf die Partnersuche' allein stehende Männer und Frauen, die in einer Online-Kontaktbörse ein Inserat aufgeben. AAls Marie wenig später anonyme Anrufer erhält und in der Nähe ihres Hauses am Seeufer die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, ist sie allerdings nicht mehr sicher, ob es die richtige Entscheidung war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Jonuleit, 1965 in Bonn geboren, ist Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie lebte und arbeitete in New York, Bonn, Rom, Damaskus und München. 1994 kehrte sie mit ihrer Familie an den Bodensee zurück. Sie ist Mutter von vier Kindern.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig. Dies ist kein Tatsachenbericht. Der Ortskundige mag mir daher ein paar Freiheiten zugestehen. So wie im Oktober keine Partyschiffe mehr auf dem Bodensee fahren, wird auch der geneigte Leser das Haus der Marie nicht in der Gegend finden, in der ich es angesiedelt habe. Sämtliche Fehler, die dieses Buch beherbergt, gehen allein auf mein Konto. Und ihr seid alle nicht gemeint.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-658-4 Bodensee Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für meine Mutter
in Liebe und Dankbarkeit
Prolog
Langsam ging er die nass glänzende Straße entlang, eine krähenhafte Gestalt in dunklem Mantel. Die Rechte hing schlaff herunter, gichtknotige Finger umkrampften etwas Gelbes, Schmutziges; die Linke steckte tief in der Manteltasche. Ein schwarzer Wagen näherte sich, hupte. Er hörte es nicht. Er ging, mit müdem Schritt, mitten auf der Fahrbahn. Seine Lippen formten endlose Sätze, wie ein geheimes Mantra. Das Auto hupte noch einmal. Zögernd hob er den Kopf, verunsichert. Ein Erwachender, der sich nach tiefem Schlaf in der realen Welt wiederfindet. Er drehte sich um und sah, wie ein rotgesichtiger Mann in einem teuren Wagen das Fenster herunterließ, blickte in ein wutverzerrtes Gesicht, dessen Mund sich lautlos zu bewegen schien. Ein Motor heulte auf, und schwarzbraunes Spritzwasser durchnässte seine Hosenbeine.
Auf seinem Weg die Seewiesenstraße entlang musste er einige Male stehen bleiben. Sein Atem ging rasselnd, die erschlafften Lider drückten schwer auf seine Augen. Als er an dem einzigen Haus, das linkerhand der Straße und somit direkt am See gebaut war, vorbeikam, blockierte ein Kleinlaster seinen Weg. »Der pfenniggute Umzug« stand auf einer schmutzig grauen Plane, ein grünes Kleeblatt prangte über dem i. Ein untersetzter Mann in braunem Overall und ein Großer, Dünner mit fettigem Zopf waren gerade dabei, ein Klavier mit Hilfe von Tragegurten die Eingangstreppe hochzuwuchten.
Bevor er die Straße überquerte, warf er noch einen Blick über den Zaun. Im Gegensatz zu den anderen Gärten in dem Viertel machte dieser einen eher verwilderten Eindruck. Auch das Haus sah vernachlässigt aus. Das ehemals rote Ziegeldach war moosbesetzt, von den Sprossenfenstern blätterte die Farbe, und die Fassade war bis weit auf das Dach mit wildem Wein bewachsen, dessen Blätter einen dichten bunten Teppich auf dem Gras bildeten. Das Gebäude war viel älter als die anderen, die Bäume höher, und um das Haus herum führte ein von Eiben und überalterten Buchsbäumen gesäumter Pfad zum Seeufer hinunter. Das Anwesen besaß als Einziges keine richtige Garage, nur einen Holzschuppen.
Gerade als er vorbeigehen wollte, trat eine Frau aus dem Haus. Groß und dünn war sie. Grobknochig. Sah von Weitem wie diese amerikanische Schauspielerin aus, wie hieß sie noch?, ein Typ, der sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Sie stand im Schatten der Veranda und sah sich suchend um, zögernd, als wüsste sie nicht so recht, was sie hier eigentlich sollte. Im Gegensatz zu dieser Schauspielerin, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, wirkt die hier eher unsicher, dachte er, regelrecht verloren. Die Frau bückte sich und beugte sich über einen Karton. Auf dem Kopf trug sie so etwas wie eine Kappe. Darunter, wie rote Stahlwolle, krisseliges, wirres Haar, das ihr, zu einem Zopf gebunden, wie ein Seil den Rücken hinunterhing. Er umrundete den Lastwagen, ging noch ein Stück geradeaus, und als die Straße einen Knick nach rechts machte, bog er in den Eriskircher Weg, der durchs Naturschutzgebiet in Richtung Innenstadt führte. Ein Windstoß fuhr durch die Erlen und ließ das Schilf um ihn herum geheimnisvoll wispern.
Nach einer guten Stunde hatte er den Hafenbahnhof erreicht. Ein böiger Wind wehte vom Wasser her. Abgesehen von ein paar Frauen mit Einkaufstaschen, die mit gesenktem Kopf gegen den Wind ankämpften, war der Platz vor der Schiffsanlegestelle menschenleer. Hier in Friedrichshafen war allerdings mehr los als in Lindau. Deshalb hatte er seinen Standort bis zum nächsten Frühjahr auch hierher verlegt. Dennoch würde sich das Geschäft erst dann wieder lohnen. Jetzt konnte er froh sein, wenn er genug zusammenbekam, um sich etwas zu essen zu kaufen. Und zu trinken. Vielleicht würde er heute wieder die Mülleimer durchsuchen müssen. Einmal, das würde er nie vergessen, hatte er in einem Abfalleimer an der Schiffsanlegestelle einen Umschlag mit zweihundert Mark gefunden. Seit diesem Tag kontrollierte er regelmäßig alle Abfalleimer rund um die Mole. Man konnte schließlich nicht wissen, ob einem das Glück nicht noch einmal hold war.
Vor der Konzertmuschel an der Freitreppe machte er Halt, hockte sich nieder und begann in seinem Stoffbeutel zu kramen. Kurz darauf förderte er einige Pastellkreiden zutage. Umständlich ordnete er sie vor sich auf dem Boden an. Dann tauchte seine rechte Hand erneut in den Beutel und holte eine kleine Blechbüchse heraus, die er ein Stück weiter links auf den Boden stellte. Zuletzt griff er in seine Manteltasche und zog eine eselsohrige Postkarte hervor. Er betrachtete sie konzentriert. Dann begann er zu malen.
Es musste Nachmittag sein – der Himmel leuchtete inzwischen in strahlendem Blau, und die Schatten der Bäume waren länger geworden–, als ein flaues Gefühl im Magen ihn aufschauen ließ. Beim Malen vergaß er alles um sich herum. Wenn er malte, sahen seine Augen nur noch Licht, Farbe und Form. In kürzester Zeit hatten seine Finger auf dem rauen Asphalt eine Landschaft voll Licht und Schatten entstehen lassen: satte Rottöne, strahlendes Gelb, frisches Grün leuchteten dem Betrachter entgegen und ließen so manchen vorbeieilenden Passanten in seinem Schritt innehalten. Erstaunt fragte sich der eine oder andere, wie dieser seltsame alte Mann es mit den wenigen Farben, die vor ihm auf dem Boden lagen, fertigbrachte, ein Bild von solcher Farbvielfalt entstehen zu lassen.
Ob es ihn nicht störe, wenn der Regen alles wieder wegwasche, hatte ihn einmal eine elegante Dame gefragt, die ihm lange beim Malen zugesehen hatte.
Nein, hatte er geantwortet, das störe ihn nicht. Der Anfang, das sei es, was zähle.
Ob er nicht das Bedürfnis habe, etwas Bleibendes zu schaffen?
Darauf hatte er sie nur verwundert angesehen.
Es hatte sich herausgestellt, dass die Dame eine kleine Galerie in der Bindergasse in Lindau besaß. Sie hatte ihn ermuntern wollen, für sie zu malen, war noch ein paarmal wiedergekommen, hatte etwas von Talent und nutzen gesagt. Doch er war einfach gegangen. Hatte ihr den Rücken zugekehrt und war in den nächsten Supermarkt geschlurft, um seine Vorräte aufzustocken.
Langsam, mit beinahe zärtlicher Sorgfalt, verstaute er seine Malkreiden im gelben Beutel, steckte die Karte wieder in seine Manteltasche und stand auf, eine Hand in den Rücken gestemmt. Er warf noch einen letzten Blick auf das Bild. Dann bückte er sich, nahm die Blechbüchse vom Boden. Zu seinem Erstaunen hatte er so viel eingenommen, dass er sich etwas Feines würde leisten können. Er sammelte die Münzen heraus – ein Fünfeuroschein war auch noch darin– und steckte das Geld in seine rechte Manteltasche. Dann öffnete er den Beutel und tat die Blechbüchse hinein, zog die Kordel fest zusammen und ging davon.
Am Franziskusplatz überquerte er die Charlottenstraße, warf einen mürrischen Blick auf die überdimensionale rote Nadel in der Mitte des Kreisverkehrs und machte vor dem Toto-Lotto-Kiosk an der Ecke Halt. Wo er schon einmal hier war, könnte er nachschauen, welcher Tag heute war. Herta Fritz, eine rundliche Frau Anfang sechzig, die ihr graues Haar zu einem altmodischen Dutt geschlungen trug, sah ihn durch die Glasscheibe an.
»Wollt nur sehen, was für 'n Tag heute ist«, sagte er.
»Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nicht aufs Wochenende hinlebt. Samstag. Samstag ist heute.«
»Hm«, brummte Paul Kubin, nachdem er einen flüchtigen Blick auf die Schlagzeilen der Regionalzeitung geworfen hatte. Tod und Korruption, Korruption und Tod, nur darum ging es doch. Er hatte die Welt durchschaut, ihre ganze Erbärmlichkeit und die Sinnlosigkeit des Daseins erkannt. Aber niemand wusste von seiner Einsicht, und so würde es bleiben.
Bleiweiß
Samstag, 21.Oktober
Wie lange war es her? Fünfzehn, siebzehn, achtzehn Jahre? Marie Glücklich blickte hinaus auf den See, der irgendwo in der Ferne mit einem bleiernen Himmel verschmolz. Dicke, schwere Tropfen fielen auf die Wasseroberfläche und sahen dabei aus wie Tausende und Abertausende winziger Zirkuszelte. Die Äste der alten Weide wurden von einer Bö erfasst, einzelne Blätter wirbelten in einem wilden Tanz durch die Luft. In Maries Kopf dröhnten dumpfe Stimmen, die ihr zuraunten: Du hast Schiffbruch erlitten und kommst zurückgekrochen, eine Verliererin.
Sie wandte sich ab, und ihr Blick fiel auf die Kartons, die überall im Zimmer herumstanden. Das also war ihr nach all den Jahren geblieben. Ein Dutzend Kisten und Kartons, ihre Bilder. Ein paar Möbel und ein altes Klavier. Sie bückte sich und öffnete einen der Kartons. Farben und Pinsel. Rasch schloss sie ihn wieder. Wie lange würde diese Blockade anhalten? Seit vier Wochen hatte sie keinen Pinsel mehr angerührt. War herumgetappt wie in einem dunklen Tunnel ohne Ausgang. Müde schlug sie die nächste Kartonklappe auf. Geschirr. Die blaue Tasse mit dem geflügelten Herz. Gestern, das war wie aus einem anderen Leben.
Spät in jener Nacht, nachdem Lorenz ein paar Sachen in einen Koffer gepackt und das Haus verlassen hatte, hatte Marie die Szene immer und immer wieder durchgespielt. So, wie sie im Nachhinein gerne reagiert hätte. Wie ein distanzierter Beobachter sieht sie sich selbst auf dem schwarzen Sofa, das rote Haar umrahmt in wilden Locken ihr Gesicht; entspannt zurückgelehnt sitzt sie da, die Beine untergeschlagen, ein Glas Rotwein in der Hand.
Da ist Lorenz, abwechselnd stehend und gehend, der nervös nach den richtigen Worten sucht, sich verhaspelt, wieder von vorne beginnt.
»Was ist los?«, fragt Marie die Souveräne. Lässig, in sich ruhend.
»Ich… ich muss mit dir sprechen. Es geht um uns.« Lorenz, unsicher und stotternd. Schließlich bricht es aus ihm heraus: »Ich glaube, wir sollten uns eine Weile trennen.«
»Wie bitte?« In Maries Stimme schwingt ein belustigter Unterton mit. Als könne sie das Gesagte auf keinen Fall ernst nehmen. Lorenz, der am Fenster steht, dreht sich um und wiederholt noch einmal denselben Satz, sicherer diesmal. Bestimmter. »Ich möchte mich von dir trennen. Eine Weile allein leben.«
Marie die Souveräne blickt Lorenz direkt in die Augen und sagt ohne mit der Wimper zu zucken: »Keine schlechte Idee. Den Gedanken hatte ich auch schon.«
Lorenz, wie vom Donner gerührt, fassungslos. Wird wieder unsicher.
»Wie? Diesen Gedanken hattest du auch schon…«
Marie die Kalte geht nicht auf das Gestotter ein, stellt eine Gegenfrage. Denn wer fragt, führt.
»Hast du 'ne andere?« Nicht eine andere, nein, 'ne andere. Das ist cooler.
Lorenz der Verdatterte weiß nicht so recht, wie er reagieren soll.
»Ja… ich meine, nein…«
»Was denn nun? Beides geht ja wohl schlecht.«
»Ich habe eine Frau kennengelernt, an der Akademie. Ich brauche ein wenig Abstand, um mir über meine Gefühle klar zu werden.«
»Nun, den Abstand kannst du gerne bekommen. Wenn du wiederkommst, glaube nicht, mich noch hier vorzufinden.« Ein eisiger Blick aus grünen Augen von Marie der Coolen.
Aber so war es nicht gewesen. Und wenn sie daran zurückdachte, wie es gewesen war, fühlte sie immer noch das Elend, diese klumpige Übelkeit in sich aufsteigen, die einen dazu treibt, sich zu erbrechen. Alles aus sich herauszukotzen. Ich möchte, dass wir uns eine Weile trennen. Eine Weile trennen. Trennen. Die Worte hallten, wie von einem endlosen Echo getragen, in ihrem Kopf wider. Drückten von innen gegen die Schädeldecke und gaben ihr das Gefühl, dass ihr Kopf zu eng war, ihr Hirn zu klein, um die wahre Bedeutung des Gesagten zu erfassen. Sie saß da, auf dem schwarzen Sofa aus glattem Leder, das sie noch nie gemocht hatte, die Schultern vornübergebeugt. Mit einem Mal hatte sie keine Energie mehr. War wie leer gepumpt. Ein Reifen ohne Luft, schlaff und nutzlos, nur noch Hülle.
Von Ferne drang seine Stimme an ihr Ohr… Eine andere Frau kennengelernt… muss mir klar werden, was ich will… eine Weile Abstand… ein Haufen Klischees, wie aus einem schlechten Film, eine Szene aus einer brasilianischen Endlosserie, Folge siebenhunderteinundachtzig.
»Ich wollte nicht, dass du es so erfährst.«
»Aber ich habe es so erfahren!«
»Seit Wochen übe ich das nun schon in meiner Fantasie, wollte es dir immer wieder sagen. Aber ich konnte nicht.«
Seit Wochen. Und gestern Nacht hast du noch mit mir geschlafen, du Schwein! Sie wollte ihm die Worte entgegenschleudern, ihn in seiner Rolle als ach so verständnisvoller Vater, der ein unangenehmes, aber notwendiges Gespräch führt, erschüttern. Ihm diese Ruhe entreißen. Ihm mit der Hand ins Gesicht schlagen. Doch sie tat nichts von alledem. Sie sah, wie er sich wieder zum Fenster drehte und in den strahlend blauen Spätsommertag hinausblickte. Hinaus in ein Leben, in dem sie keinen Platz mehr hatte.
»Und wie soll es nun weitergehen?«, fragte Marie nach einer Weile, und ihre Worte klangen hohl. Als wäre der Raum bereits leer, als habe jemand die Möbel und ihr Leben schon ausgeräumt und an einen anderen Ort, den sie noch nicht kannte, verbracht.
»Ich werde mir ein Apartment nehmen. In der Nähe der Akademie. Du kannst natürlich hier wohnen bleiben. Bis du etwas anderes gefunden hast.«
»Ich will hier nicht weg«, sagte sie quengelnd, unmündig, wie ein Kind, über dessen Kopf hinweg bestimmt wird, was es zu tun hat. Und das doch schon weiß, wie die Entscheidung der Erwachsenen ausfallen wird.
»Du kannst natürlich auch hier bleiben und dir einen Untermieter nehmen.«
»Du hast gesagt, du willst dich vorübergehend von mir trennen. Wirst du zurückkommen?«
»Ich weiß es nicht.« Er sah sie bedauernd an. Bedauernd und voller Mitleid.
Ich brauche dein Mitleid nicht! Sie spürte Wut in sich aufsteigen, wusste aber nicht, was sie damit anfangen sollte. Vermutlich hätte sie blödes Zeug herausschreien sollen wie »Pack deinen Krempel und verschwinde von hier«!, »Verpiss dich und komm mir nie wieder unter die Augen!« oder »Ich bedaure, dass ich dich je kennengelernt habe, du mieser Verräter«.
Doch all das sagte sie nicht. Sie saß nur da. In diesem Gefühl, langsam im Moor zu versinken. Wenn du weißt, gleich ist es so weit, gleich quillt der Matsch dir in den Mund, in die Nasenlöcher, die Augen, in deinen Hals, deine Lungen. So ist das also, wenn man verlassen wird. So. Wie kann man sich zugleich wie ein Kind und uralt fühlen? Wohl weil Kinder und Greise eines gemein haben: die Hilflosigkeit.
Später, in der Nacht, ihrer letzten gemeinsamen Nacht, saß sie neben ihm im Bett und sah ihn an. Saß stumm da und sah ihn an und weinte. Lautlos. Sie küsste ihn verstohlen auf die Schulter. Wenn du gehst, dachte sie, wird es sein, als wärst du gestorben. Immer wieder kehrte dieser Gedanke zu ihr zurück, und sie konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Gegen Morgen kam noch ein anderes Gefühl dazu. Eine eigenartige Mischung aus Existenzangst und Trotz, verursacht durch den Gedanken an ihr Konto, auf dem noch genau sechshundertfünfundfünfzig Euro und dreiundzwanzig Cent waren.
*
Die Lichter am Schweizer Ufer blinkten in der Dunkelheit. Von ihrer Wohnung im neunten Stock konnte sie den ganzen See überblicken. Die Nacht war sternenklar, und ein warmer Wind strich über ihr Gesicht. Sie konnte nicht verstehen, warum so viele Leute über den Föhn klagten. Bei diesem Wetter fühlte sie sich erst richtig lebendig. Der Ausblick von ihrem Balkon entschädigte sie für die dumpfe Beklemmung, die sie immer wieder überfiel, wenn sie durch das weiße, kahle Treppenhaus zum Aufzug ging, wenn ihr Blick auf den grau gefleckten Steinboden fiel oder auf die Stahltüren des Fahrstuhls.
Sie schloss die Balkontür. Es blieben ihr noch knapp zwei Stunden, um sich auf heute Abend vorzubereiten. Sie ging ins Bad und trat vor den Spiegel. Sah in ihr Gesicht, auf dem das Leben seine ersten Spuren hinterlassen hatte, ein Gesicht, dessen Linien schon erkennen ließen, wie es im Alter einmal aussehen würde. Sie beugte sich über die Badewanne, drehte den Hahn auf, und ein heißer Strahl prasselte auf den Wannenboden. Schnell drückte sie den Stöpsel herunter. Sie sah noch einmal in den Spiegel. Aber mein Haar ist immer noch genauso schön wie vor zehn, zwanzig Jahren, dachte sie. Wie Seide, hatte ihre Mutter immer gesagt, wie reine Seide.
Bei dem Gedanken an den heutigen Abend fühlte sie Unbehagen in sich aufsteigen; spürte, wie ihre Handflächen feucht wurden und sich ihr Magen zusammenzog. Dabei hatte sie sich anfangs auf den Abend gefreut. Aber das war, bevor sie den Brief erhalten hatte. Wenn sie nur lockerer sein könnte, ein bisschen unverkrampfter. Und mutiger. Aber sie ging nun einmal so selten tanzen. Erst recht auf einem Schiff. Aber immer noch besser als die anderen Fahrten, zu denen er sie überreden wollte. Wie die Heurigenfahrt von Bregenz aus. Wo sie doch überhaupt keinen Wein mochte. Oder dieses »Fondueschiff mit Livemusik« ab Romanshorn, auf das er sie hatte schleppen wollen. Sie hatte das schon vor sich gesehen: käseverpestete Luft und einen nasalen Sänger, der auf einem Keyboard herumdrückte und »Die Hände zum Himmel« sang!
Das Bad hatte ihr gutgetan und ihre Anspannung ein wenig gelöst. In einen weißen Bademantel gehüllt, ein Handtuch um das nasse Haar gewickelt, ging sie ins Schlafzimmer, um sich etwas Passendes zum Anziehen herauszusuchen. Ihr Blick fiel auf ihre Handtasche, die auf dem Konsoltisch unter dem Fenster lag. Der Brief. Er würde ihr helfen, heute Abend die richtigen Worte zu finden. Mit dem Brief hatte er ihr ein scheußliches Gedicht und eine CD mit alten Schlagern geschickt. Sie lag noch original verpackt auf dem Nachttisch. Wir werden niemals auseinandergehn… Sie blickte auf. Sah sich selbst in der Balkontür stehen, eine Frau in einem weißen Morgenmantel. Sie durfte es nicht länger hinausschieben, heute Abend würde sie es ihm sagen müssen, so schonend und vorsichtig wie möglich. Sie würde ihm sagen, dass sie einfach nicht zusammenpassten, dass sie nicht das Gleiche empfand wie er. Sie nahm den Brief. Wusste nicht, warum sie es tat, aber sie faltete den Brief, rollte ihn zu einer dünnen Röhre zusammen und steckte ihn durch das Loch im Futter, strich das Papier zwischen Futter und Außenleder der Tasche glatt, sodass man seine Existenz nicht erfühlen konnte. Dann tat sie den Ring in die Tasche und zog den Reißverschluss zu. Sie würde ihm den Ring heute zurückgeben.
Richtig bewusst geworden war ihr alles erst heute früh, als sie sich gezwungen hatte, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Sie würde nicht mit einem Mann zusammenziehen, den sie nicht liebte, nur damit sie nicht mehr allein war. Dass sie vor drei Monaten auf diese Annonce geschrieben hatte, führte sie rückblickend auf einen Anfall von Torschlusspanik zurück. Sie hatte sich durch die Anzeigen einer Kontaktbörse geklickt, nur so zum Spaß, und war auf seinen Eintrag gestoßen. Und sie war entzückt gewesen. Anders konnte man es nicht nennen. In seiner Anzeige fehlte alles, was sonst gang und gäbe war. Keine starre Schablone, keine Vorgaben, nur diese wenigen schlichten Sätze: Liebe ist mehr… Liebe ist alles. Leicht verrückterERsucht auf diesem Wege eine ebenso verrückteSIE, die Lust hat, mit mir ein paar Schritte auf meinem Lebensweg zu gehen… vielleicht auch bis zum Ende des Weges. Das hatte sie gelesen, und seine Worte hatten sie berührt. Und so hatte sie geantwortet. Und auf ihre Antwort folgte ein erfrischender Chat. Das erste Treffen nach dem Motto »Zeitung unter dem Arm, Rose in der Hand« verlief amüsant und vielversprechend. Sie verstanden sich, saßen beieinander, bis die Kneipe zumachte, und es war keine Minute langweilig oder peinlich oder unangenehm. Und sie konnten miteinander lachen.
Erst nach und nach fiel ihr bei ihm etwas Drängendes auf, und sie fühlte sich vereinnahmt, erstickte beinahe unter seiner Zuwendung. Sie versuchte, Abstand zu ihm zu gewinnen, war um fantasievolle Ausreden nicht verlegen gewesen, gebrauchte Ausflüchte, um ihn nicht jeden Tag sehen zu müssen, und ging sogar einige Male gar nicht mehr ans Telefon, ignorierte das Klingeln an ihrer Wohnungstür.
Irgendwann, sie wusste nicht zu sagen, wann das Gefühl sie das erste Mal beschlichen hatte, fühlte sie sich beobachtet. Ob es nur Einbildung war oder ob er sie tatsächlich verfolgt hatte? Was sie – im Nachhinein betrachtet– als besonders merkwürdig empfand, waren seine ausweichenden Antworten, wenn die Rede darauf kam, wo er wohnte. In all den Wochen hatte er ihr nie konkret gesagt, wo er wohnte. Überhaupt war alles, was sie von ihm hatte, eine italienische Mobilfunknummer. Als sie erstaunt nachgefragt hatte, hatte er ihr irgendetwas von einem supergünstigen Handyvertrag erzählt.
Was auch immer es gewesen war: Heute Abend würde sie dieser unglückseligen Geschichte ein Ende bereiten. Und morgen würde sie wieder in ihr altes Leben zurückkehren, ganz und gar. Diese Geheimnistuerei, dieses merkwürdige Versteckspiel, zu dem er sie getrieben hatte, all das hatte nun ein Ende. Morgen würde sie sich jemandem anvertrauen, sich aussprechen, alles erzählen, was sie in den letzten drei Monaten erlebt hatte. Wie sie sich gefühlt hatte, welche Ängste in ihr gewachsen waren. Es war vorbei. Erleichtert fühlte sie die Klarheit ihrer Entscheidung in sich. Es war vorbei.
Das Gedicht, das er ihr mit dem Brief geschickt hatte, lag noch auf ihrem Nachttisch. Sie starrte den weißen Bogen an, atmete tief ein und wieder aus. Weg mit diesem kranken Zeug, weg damit. Sie nahm es, zerknüllte es, spürte das Papier in ihrer Faust. Nein. Nein, dachte sie plötzlich. Ich werde es Marion zeigen. Morgen werde ich ihr alles erzählen und ihr den Brief und das Gedicht zeigen. Damit sie ihr glaubte. Das Ungeheuerliche, was sie in den letzten drei Monaten erlebt hatte, glaubte. Sie öffnete die Faust, begann das Papierknäuel zu entfalten, es glatt zu streichen. Ja, sie musste ihr das Gedicht zeigen. Sonst würde sie ihr niemals glauben. Sie konnte es ja selbst kaum. Sie ging zum Bücherschrank, griff hinein, wahllos, und steckte das gefaltete Blatt in ein Buch, ein kleines blaues Buch mit Goldschnitt, stellte es zurück und schloss den Schrank.
In der Diele warf sie einen prüfenden Blick in den Spiegel. Das weiße Seidenkleid, eines seiner Geschenke, würde sie heute das letzte Mal tragen. Sie steckte die Perlenohrringe an, griff nach der flauschigen grauen Jacke. Plötzlich fühlte sie sich stark und selbstbewusst. Heute würde sie es ihm sagen.
*
Er hatte sie den ganzen Abend beobachtet. War an Deck gestanden und hatte sie keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Und alles gesehen. Jetzt wusste er Bescheid.
Die erste Stunde saß sie am Tisch, der Platz rechts neben ihr blieb leer. Natürlich, denn eigentlich hätte er dort sitzen sollen. Aber er hatte heute Abend Wichtigeres zu tun, er musste sie auf die Probe stellen. Wollte sehen, was sie tun würde, wenn er nicht kam.
Anfangs fühlte sie sich unwohl, das erkannte er daran, dass sie immer wieder in ihrer Handtasche kramte und so tat, als suche sie etwas darin. Doch nach einer Viertelstunde unterhielt sie sich bereits mit einer blondierten Frau und ihrem dicklichen Begleiter. Und noch einmal eineinhalb Stunden später saß sie mit ihrem direkten Tischnachbarn, einem älteren Mann, der auf eine, wie er fand, ekelerregende Weise erfolgreich aussah, an der Bar und schien sich wunderbar zu amüsieren. Ganz lebendig wurde sie, und daran, wie sie sich immer übers Haar strich oder zerstreut ihre Nase oder ein Ohrläppchen berührte, erkannte er, dass sie den Mann attraktiv fand. Wie sie ihn anstrahlte! Den Kopf zurückwarf und lachte. Geradezu aufreizend. Ihr Hals war so weiß und zart, und ihr wunderbares Haar hatte sie heute zu einem Knoten geschlungen, in dem zwei silberne Spieße steckten. Am meisten aber schmerzte ihn, dass sie den Ring nicht mehr trug. Ihre Hände waren völlig schmucklos, nackt und hässlich ohne den Ring. Und das war das Zeichen.
Er tastete nach dem Messer, das in der Innentasche seines schwarzen Daunenanoraks steckte. Glatt und scharf, wie es sein musste. Glatt und scharf.
Später, als das Schiff seine Fahrt beendet hatte und allgemeine Aufbruchstimmung herrschte, versteckte er sich in der Toilette und durchsuchte ihre Handtasche. Draußen polterte ein Betrunkener gegen die Tür. »Aufmachen, he, mach die Tür auf, ich muss kotzen!«
Rasch versteckte er die Tasche unter seinem Anorak, zog sich die Mütze etwas tiefer ins Gesicht und drängte sich an dem Mann vorbei, der sich schwankend an der Türklinke festhielt. Der Alkoholdunst, den er verströmte, nahm ihm kurzfristig den Atem.
So gut wie alle Passagiere hatten das Partyschiff bereits verlassen. Er ging über die Brücke, ein unauffälliger Mann in dunklem Overall, der es eilig hatte, nach Hause zu kommen. An Land zögerte er ganz kurz. Bevor er endgültig in der Dunkelheit verschwand, griff er unter seinen Anorak, zog die Tasche heraus und warf sie in einen der Abfalleimer an der Mole.
Morgengrau
Sonntag, 22.Oktober
Lange bevor die Morgendämmerung mit ihrem matten Schein den neuen Tag erhellen sollte, war Paul Kubin aufgewacht und hatte sich auf seinem Gaskocher einen Becher starken Kaffee zubereitet. Von einer seltenen Zufriedenheit erfüllt, betrachtete er den im Halbdunkel des Heizungskellers weißlich schimmernden Dampf, beobachtete, wie die zahllosen vaporisierten Wassertröpfchen einen aufsteigenden, sich windenden Schleier über dem Becher bildeten, und wie stets empfand er eine beinahe kindliche Freude bei dem Gedanken, den ersten Schluck noch vor sich zu haben. Heiß und stark musste Kaffee sein, so heiß, dass man gezwungen war, noch eine Weile zu warten, bevor man das erste Mal nippen durfte. Unwillkürlich lächelte er, als er daran dachte, dass dies ein immer wiederkehrender Streitpunkt zwischen Hilde und ihm gewesen war. Nie war sie müde geworden, ihn daran zu erinnern, wie ungesund es war, zu heiß zu essen oder zu trinken. Du wirst noch einmal magenkrank werden, hatte sie gesagt und irgendwelche Statistiken aus Japan zitiert, wonach so und so viel mehr Japaner als Japanerinnen jährlich an Magenkrebs erkrankten, weil der Mann dort grundsätzlich vor der Frau seine Mahlzeit einnahm und die Frau erst dann begann, wenn der Mann fertig war und das Essen sich inzwischen auf magenfreundliche Temperaturen abgekühlt hatte.
Hoffentlich hielt der Föhn noch etwas an, das wäre das Beste, was ihm jetzt im Herbst passieren konnte. Wenn das Thermometer erst einmal unter den Gefrierpunkt sank, würden seine vor Kälte steifen Finger ihren Dienst verwehren, und er wäre gezwungen, stillzuhalten und abzuwarten. Die Tage würden in dumpfer, endloser Eintönigkeit dahinsickern, in der Sinnlosigkeit eines Daseins ohne Ziel verrinnen. Solange er malen konnte, war der Weg sein Ziel. Solange seine Hände die Verbindung zu den Farben, die er in sich trug, bildeten, ihm dabei halfen, sein Innerstes nach außen zu kehren, gab es etwas, das ihn am Leben hielt.
Er tastete sich den dunklen Gang entlang, vorsichtig, um nicht zu stürzen, stieg die wenigen Stufen hinauf und sah sich um, bevor er in die Dämmerung hinaustrat. Früher einmal, da hatte der beginnende Morgen für ihn etwas Verheißungsvolles gehabt, war so etwas wie ein Symbol der Hoffnung und Zuversicht gewesen. Das war, bevor der Tod durch seine Endgültigkeit alle Hoffnung unter sich begraben hatte.
Langsam ging er die Karlstraße entlang, atmete die klare, noch unverbrauchte Luft in seine Lungen, hustete, ließ seinen Blick an den Häuserzeilen entlangschweifen. Kaum ein Fenster war an diesem Sonntagmorgen erleuchtet. Ruhe lag über der Stadt. Er bog nach rechts ab, durch die Passage, und trat auf die Uferpromenade hinaus. Ein frischer Wind strich über sein Gesicht. Er blieb stehen und sah auf das graugrüne Wasser. Dieses Graugrün hatte er damals vergeblich festzuhalten versucht. Was hatte er sich bemüht, täglich von Neuem. Und war doch immer wieder gescheitert. So wie er damals, in den düstersten Monaten seines Lebens, an allem und letztendlich am Leben selbst gescheitert war.
Er war früh dran, und das war gut, denn gestern Abend war wieder eines dieser Partyschiffe auf dem See unterwegs gewesen. Es würde sich bestimmt lohnen, einen Blick in die Abfalleimer an der Schiffsanlegestelle zu werfen, bevor seine Kollegen ihm zuvorkämen. Er beugte sich über den ersten Behälter und begann mit spitzen Fingern die oberste Schicht abzutragen. Er würde wohl nie so tief sinken, dass es ihm nichts mehr ausmachte, im Müll zu wühlen. Da war immer noch dieses Unbehagen, dessen er sich nicht entledigen konnte, dieses Gefühl, gleich eine unangenehme Überraschung zu erleben.
Nichts, nur ein paar alte Zeitungen, leere Chipstüten und verhutzelte Papiertaschentücher. Beim nächsten Behälter hätte er um ein Haar in ein gebrauchtes Kondom gegriffen. Durch diese Entdeckung abgeschreckt, wollte er seine Suchaktion schon abbrechen, als er beim dritten Anlauf eine mit grauen Pailletten besetzte Damenhandtasche hervorholte. Er klappte sie auf und warf einen Blick hinein, holte einen Geldbeutel heraus. Achtzig Euro, ein Führerschein und ein Ausweis. Ein Lippenstift, Tempos, ein Tampon, ein gelber Post-it-Block und ein Kugelschreiber mit Werbeaufdruck. Schwarze Schrift auf rotem Grund.
Graues Tier
Samstag, 28.Oktober
Es dauerte eine Weile, bis sich das Läuten des Telefons einen Weg durch den Nebel seines Bewusstseins gebahnt hatte. Andreas Sommerkorn blinzelte, tastete auf dem Nachttisch nach dem Hörer, verfehlte ihn und hörte einen dumpfen Knall und das hässliche Geräusch von zersplitterndem Glas. Mit einem Ruck fuhr er in die Höhe – ein stechender Schmerz raubte ihm für einen Augenblick fast den Atem– und sah sich suchend um. Der Hörer lag neben dem Bett auf dem Boden, zwischen der Nachttischlampe und einem zerbrochenen Rotweinglas, dessen Inhalt einen kleinen, leicht gewölbten See auf dem Parkett bildete. Das ist die Oberflächenspannung, fuhr es ihm absurderweise durch den Kopf.
Das Telefon hatte zu klingeln aufgehört oder wie immer man das Dudeln dieser modernen schnurlosen Dinger nennen mochte. Er betrachtete die blutrote Lache auf dem Boden und bemerkte, dass auch die Nachttischlampe in der Rotweinpfütze lag. Vorsichtig zog er den Stecker aus der Wand. Der scharfe Schmerz in seinem Kopf war einem dumpfen Pochen irgendwo hinter den Augäpfeln gewichen. Über den Geschmack in seinem Mund wollte er lieber nicht nachdenken, dann hätte er sich nur fragen müssen, ob der Zersetzungsprozess seiner Innereien schon begonnen hatte.
Welcher Tag war heute? Die Anzeige auf seinem Digitalwecker signalisierte Samstag, den 28.Oktober. Eigentlich hatte er gestern Abend nicht vorgehabt, sich zu betrinken. Doch auf das erste Glas war ein zweites gefolgt, auf das zweite ein drittes, und schließlich hatte er zu zählen aufgehört. Er konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, dass er im Bett weitergetrunken hatte.
Vorsichtig hob er die Beine über die Bettkante und stieß mit dem linken Fuß an die leere Rotweinflasche, die hohl gegen den Bettrand schlug. Langsam wird es Zeit, dass ich wieder auf den Damm komme. Dabei hatte der gestrige Abend so gut begonnen. Er hatte seine Skatfreunde bei sich zu Hause gehabt, sie hatten gegessen, kalte Platte, ein paar Runden gespielt, geredet und gelacht. Als aber die Gäste dann irgendwann nach Mitternacht aufgebrochen waren, hatte ihn das heulende Elend gepackt, und er war noch lange dagesessen, hatte auf die flimmernden Fernsehbilder gestarrt und getrunken.
Er fror, schaute an sich hinunter und merkte, dass er nur in der Unterhose dasaß. Das Pochen hinter seiner Stirn war stärker geworden. Langsam erhob er sich, ging ins Bad und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, immer wieder, bis die Benommenheit langsam wich und sein Verstand wieder klarer wurde. Er putzte sich zweimal die Zähne und rasierte sich. Als er unter der Dusche stand, begann das Telefon wieder zu dudeln. Nass wie er war, rannte er ins Schlafzimmer und fischte den Hörer aus der Rotweinlache. Als er ihn ans Ohr hob, verursachte ihm der Geruch nach abgestandenem Alkohol Brechreiz.
»Sommerkorn!«, brachte er mühsam hervor.
»Ei, ei, ei, das hört sich aber gar nicht gut an!«, hörte er seine Kollegin Barbara Stern sagen, gut gelaunt und aufgeräumt.
»Ich bin nicht da, hörst du? Es ist Samstagvormittag, und ich habe frei, verstehst du: FREI.«
»Ich fürchte, du wirst da sein müssen.«
»Sag es nicht! Erstens hab ich in den letzten Wochen so viele Überstunden angehäuft, dass ich dieses Jahr überhaupt nicht mehr erscheinen müsste. Zweitens hab ich einen jesusmäßigen Kater. Und drittens fahre ich heute, wie du sehr wohl weißt, mit Tim zum Klettern. Also ruf gefälligst den Schumann an. Der hat Bereitschaft.«
»Der Schumann ist krank.«
»Und ich habe gestern neue Kletterschuhe für Tim gekauft. Und neue Karabiner. Die wollten wir heute ausprobieren.«
»Na, die werden dir ja nicht schlecht! Glaubst du, ich hatte nichts Besseres vor?« Langsam wurde Barbara ärgerlich. »Im Ried, zwischen Friedrichshafen und Eriskirch, haben Kinder eine Tote gefunden. Die sollte sich der Herr Kommissar vielleicht einmal ansehen. Ich schlage dir Folgendes vor: Du hältst jetzt deine matschige Birne unter kaltes Wasser, ziehst dir Gummistiefel an und wartest auf mich. Ich hol dich ab.«
Es hatte zu regnen begonnen. Ein feiner Nieselregen, der langsam, aber unerbittlich seinen Kragen durchnässte und sich als dunkler Schatten auf seine Schultern legte. Wie immer hatte er keinen Schirm dabei. Er zog ein zerknülltes Taschentuch hervor und wischte die Tropfen von seiner Brille. Oberkommissarin Stern trat neben ihn und hielt den Schirm über sie beide.
»Kein schöner Anblick.« Sie wühlte in ihrer Handtasche und holte ein Päckchen Kaugummis heraus. »Willst du einen?«
Sommerkorn griff wortlos zu.
»Wie lange sie wohl schon im Wasser liegt?«
»Schwer zu sagen. Nach der Gasbildung zu urteilen mindestens drei Tage, vielleicht eine Woche. Aber bei den Temperaturen geht natürlich alles langsamer.«
»Glaubst du, sie ist erwürgt worden?«
»Die Verletzungen am Hals sehen nicht gerade nach Treibverletzungen aus«, antwortete Sommerkorn und betrachtete den aufgedunsenen Körper der Frau in Weiß. Sah die zwei Kollegen von der Wasserschutzpolizei am Bug des Polizeiboots stehen und rauchen. Rauchen und warten, dass sie endlich nach Hause fahren konnten. Sie hatten getan, was getan werden musste. Hatten die Körperlage gesichert, vermessen und beschrieben, Windstärke und Windrichtung gemessen, die Wassertemperatur. Und warteten jetzt nur noch auf den Gerichtsmediziner. Der sich verspätete.
Die Kollegen von der Spurensicherung hatten Holzbretter ausgelegt. Ein Beamter in weißem Overall und Latexhandschuhen bückte sich, um etwas Rundes, Blechernes genauer in Augenschein zu nehmen. Dieser Fundort war, je nach Standpunkt, entweder der ideale Tatort oder der Alptraum eines jeden Ermittlungsbeamten. Modrig und halb unter Wasser. Ein Stück weiter rechts führte ein verrotteter Steg aufs Wasser hinaus, davor lag ein Kahn, der jedoch nicht den Eindruck vermittelte, als würde man weit mit ihm kommen. Der Polizeifotograf, ein junger Mann, der aussah, als müsste er sich jeden Augenblick übergeben, tänzelte ungeschickt über ein Brett, um die letzten Fotos von Leiche und Fundort zu schießen.
»Er sieht aus wie ein großes graues Tier, das schläft«, sagte Sommerkorn.
»Wie bitte?«, fragte Barbara, die sich in den Wagen gebeugt hatte und irgendetwas auf dem Rücksitz zu suchen schien, wahrscheinlich Zigaretten.
»Der See. Er sieht aus wie ein Tier.«
Barbara kroch aus dem Wagen, eine zerknitterte Schachtel Camel in der Hand, und stellte sich neben Sommerkorn, um die Aussicht zu betrachten. Großflächig und silbergrau breitete sich der See unter ihnen aus; die Hügel waren mit gelben und roten Farbklecksen bedeckt, die aussahen, als habe ein Kind sie willkürlich verteilt. »Ein sehr friedliches Tier«, sagte Barbara, zog die letzte Zigarette aus der Packung und steckte sie an.
»Da ist ja mal wieder einiges los«, sagte Sommerkorn und ging vor Barbara her, zwischen den Autos hindurch, die dicht gedrängt eines neben dem anderen standen.
»Hoffentlich sitzen die alle im Theaterstadel«, sagte Barbara und meinte damit die Kleinkunstbühne, die neben dem Wirtshaus lag.
Sie öffneten die Eingangstür und tauchten ein in das Summen, das sich zu einem Brummen steigerte, als sie vom Korridor in die Wirtsstube traten. Das Lokal war voll besetzt, und die Kellnerin, eine dralle Blondine Anfang zwanzig, rief Barbara im Vorbeigehen zu: »Alles besetzt, tut mir leid.« Dann fiel ihr Blick auf Sommerkorn, sie verlangsamte ihren Schritt und lächelte: »Wenn Sie einen Moment warten möchten, da hinten wird gleich was frei.«
Eine Hand mit blutrot lackierten Fingernägeln legte eine dicke kunstledergebundende Speisekarte vor ihm auf den Tisch.
»Wir wissen's schon. Ein Glas Pfefferminztee und einmal Dim Sum.«
»Für mich einen Grog.« Barbara grinste vor sich hin. »Und die Bärlauchmaultaschen. Mit Salat.«
»Was gibt's zu grinsen?«
»Wie machst du das? Ich meine, du hast die halbe Nacht gesoffen, müsstest eigentlich Tränensäcke und mindestens ein blutunterlaufenes Auge haben und ein kümmerliches Dasein fristen… Stattdessen lächelt dich die erste Maid, die deinen Weg kreuzt, aufmunternd an.«
»Was soll denn das schon wieder heißen?« Sommerkorn griff nach einem Bierstängel, zog ihn aus der Papiertüte und brach ihn in der Mitte auseinander.
»Na ja, wenn ich nicht spätestens um zehn ins Bett komme, sehe ich am nächsten Morgen aus wie schon mal verdaut. Dann brauche ich mindestens zwei Stunden, bis ich mich auf die Straße trauen darf. Aber anmachen würde mich an so einem Tag bestimmt keiner.«
Als Antwort murmelte Sommerkorn etwas Unverständliches und sah sich um. Das Wirtshaus am Gehrenberg war wie immer gut besucht. Alle Barhocker waren besetzt, und im Wintergarten saßen Familien mit Kindern, die sich in der Spielecke tummelten. Die herrliche Aussicht auf den Bodensee lockte die Gäste zu jeder Jahreszeit hierher. An heißen Tagen saß man draußen im Biergarten, unter alten Platanen und Kastanien, trank Radler und genoss die kühlende Brise, die hier oben meist wehte. An kühleren Tagen saß man bei Kerzenschein am Tisch, der Regen trommelte auf das Glasdach und verstärkte das Gefühl von Wärme und Behaglichkeit.
Sommerkorn sah, wie eine Bö durch die Äste der Kastanie fuhr und ein paar rostbraune Blätter herunterschüttelte. Die Kellnerin kam und stellte Tee und Brot auf den Tisch. Barbara nahm eine Scheibe und zupfte ein Stück davon ab. Krümel rieselten auf die Tischdecke.
»Okay, lass uns sehen, was wir haben«, sagte Sommerkorn. »Keine Papiere, keinen Hinweis auf ihre Identität. Dr.Bender meinte, das am Hals könnten Würgemale sein. Er will sich aber nicht festlegen. Das einzig Konkrete im Moment ist dieser Ring. Ein Ehering?«
»Nicht unbedingt. Meine Nichte ist siebzehn, und sie und ihr Freund tragen auch solche Ringe. Die aussehen wie Eheringe, meine ich.« Sie machte eine Pause und fragte dann: »Wer macht denn die Obduktion?«
»Hoffentlich der Fassbinder.«
Eine Weile lang sagte keiner etwas. Die Bedienung brachte die Maultaschen und die Dim-Sum-Röllchen. Bevor sie sich umdrehte, warf sie Sommerkorn noch einen langen, bedeutungsvollen Blick zu.
*
Es war schon dunkel, als Marie erschöpft auf einen ihrer beiden Campingstühle niedersank. Das Haus war nun endlich so sauber, dass sie morgen mit den Streicharbeiten würde beginnen können. Die paar Möbel, die sie mitgebracht hatte, standen verloren in der Mitte des Wohnzimmers. Sie hatte so wenig, dass es für ein Einzimmerapartment gereicht hätte. Marie ging ins Bad, zog sich aus und stieg unter die Dusche, hielt das Gesicht unter den dürftigen Wasserstrahl, der aus dem verkalkten Duschkopf nieselte. Am Montag würde sie alles Weitere in Angriff nehmen, würde Farbe und Plastikplanen kaufen. Mit der Küche würde sie anfangen. Nach dem Duschen wühlte sie in ihrem Rucksack nach ihrer Brieftasche, stieß dabei auf ihre Kontoauszüge. Noch zweihundertsiebenundvierzig Euro. Ich brauche dringend einen Job. Nur als Übergang. Bis ich neue Auftraggeber habe.
Sie wollte jetzt eigentlich nur noch schlafen, doch trotz ihrer Mattigkeit jagte ein Gedanke den nächsten, und sie würde sicher lange nicht einschlafen können, wenn sie sich jetzt gleich ins Bett legte. Hunger hatte sie keinen, aber Kochen würde sie ablenken und vielleicht auch ein wenig beruhigen. Sie öffnete den Kühlschrank, holte ein Glas Artischocken heraus, die angebrochene Flasche Frascati, den Mascarpone und den gekochten Schinken, den sie heute gekauft hatte. Ihre Bewegungen waren langsam, sie musste sich konzentrieren, was als Nächstes zu tun war.
Sie stellte das Radio an, nahm den großen Weidenkorb und schickte sich an, nach draußen zu gehen, um Holz aus dem Schuppen zu holen. Sie öffnete die Tür, die direkt von der Küche hinters Haus führte. Plötzlich hielt sie inne.
»…haben spielende Kinder die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um ein Verbrechen handelt. In einer Sondersendung heute um 20.30Uhr im See-TV bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Frau. Und nun zum Wetter: Sintflutartige Regenfälle in Konstanz haben…«
Atemlos hatte Marie zugehört. Sie fröstelte. Auf einmal erschien ihr die Nacht dunkler als noch vor wenigen Minuten, und die hell erleuchtete Küche ohne Vorhänge kam ihr wie eine Bühne vor. Der Wind peitschte die Regentropfen hinein, klopfte gegen die Scheibe und rüttelte an den Fensterläden. Ein wenig einsam liegt das Haus schon, dachte sie. Auf beiden Seiten war es von unbebauten Seegrundstücken umgeben, auf denen windzerzauste Apfel- und Birnbäume standen; unten am Ufer lagen ein paar Boote, von denen die Farbe abblätterte. Vor dem Haus verlief die Straße, eine Sackgasse, die in einen Fußweg zum Ried mündete. Auf der anderen Straßenseite lag das Schulgebäude aus den zwanziger Jahren, aber da war ab dem frühen Nachmittag keiner mehr. An einigen Wochenenden, das hatte sie im Gemeindeblatt gelesen, fand dort ein Englischkurs statt.
Sie schaltete die Außenbeleuchtung ein, die ein blasses gelbliches Licht auf den Schuppen warf. Die Schatten der Bäume gingen ineinander über und verschmolzen mit dem See zu einem einzigen großen Dunkel. Die Äste der Trauerweide rauschten in der Nacht. Plötzlich knackte es hinter einer Eibe. Marie fuhr zusammen. Eine Weile lang stand sie einfach so da, starrte auf den Busch, dem das Licht der Gartenlaterne eine merkwürdig verkrüppelte Gestalt verlieh. Dann schüttelte sie sich, sagte laut: »Das wird ja immer besser!« und stapfte die drei Stufen hinunter, öffnete polternd die Schuppentür, schmiss Buchenscheite in den Korb und kehrte ebenso laut vernehmlich ins Haus zurück.
Sie knallte die Tür hinter sich zu, verriegelte sie und ging zum Küchenfenster. Marie musste heftig ziehen, bis es aufging. Sie beugte sich hinaus, der Wind wehte durch ihr Haar, Tropfen prickelten auf ihrem Gesicht, und sie beeilte sich, die Läden zu schließen. So ging sie von einem Raum zum nächsten, das Haus kam ihr jetzt ziemlich groß vor, und vergewisserte sich, dass alle Fenster und Türen geschlossen waren. Im Wohnzimmer verriegelte sie die Läden vor den Fenstertüren, die auf die Seeterrasse hinausführten. Dann ging sie zurück in die Küche, um Feuer im Herd zu machen und sich endlich ihre Fettuccine mit Artischocken und Schinken zuzubereiten.
*
Er wusste immer, wie spät es war. Auch in jener Samstagnacht vor einer Woche, als er sie tötete, wusste er, ohne auf die Uhr zu sehen, dass es kurz nach halb zwölf gewesen war. Als es vorbei war, hatte er – der Bestätigung halber– auf ihre Armbanduhr geblickt und gesehen, dass sie 23.38Uhr anzeigte. Er hatte ihre Handtasche an sich genommen, die kleine Kamera aus seinem Anorak gezogen und die Aufnahme gemacht. Er hatte das Messer gegriffen und das Haar abgetrennt. Mit einem sauberen Schnitt. Es war alles ganz einfach gewesen, nur den Ring hatte er fast nicht an ihren Finger bekommen. Dann hatte er den erschlafften Körper über Bord geworfen.
Er lächelte. Er wusste immer, wie spät es war. Und deshalb trug er auch niemals, niemals eine Uhr bei sich. Das hatte er in Algier gelernt. Anhand des Sonnenstands, des Lichts immer zu wissen, welche Stunde war. Das hatte er dort gelernt. Das und anderes. Und deshalb wusste er auch, dass die alte Fettel, die über ihr wohnte, jetzt gleich den Fernseher anstellen würde und er nun eine Stunde und fünfzehn Minuten Zeit hätte, alles gründlich zu durchsuchen. Eigentlich hatte er ja erwartet, sie würde den Brief mitbringen. Um mit ihm darüber zu sprechen. Um ihn – er lachte in sich hinein– zu fragen, was das bedeuten sollte, ihn zur Rede zu stellen. Allein dieser Gedanke hatte etwas Groteskes. Ihn zur Rede stellen! Nun, die Gelegenheit hatte sie gehabt. Aber das Ende war sicher anders gewesen, als sie erwartet hatte.
Er schloss die Wohnungstür auf, leise, und betrat die Diele. Mit seinen latexbehandschuhten Fingern öffnete er Schubladen und Schranktüren, durchsuchte ihren Schreibtisch, ihre Regale, sah hinter dem Spiegel nach, unter dem Bett und der Matratze. Sogar unter der Grillabdeckung auf dem Balkon. Nichts. Wo hatte sie den Brief, wo? Nicht dass es viel ändern würde, wenn er ihn fand. Aber er wollte ihnen die Sache nicht zu einfach machen. Sie sollten auch ihren Spaß haben. Bevor in ihnen die Gewissheit reifte, dass sie ihn nie finden würden, nie. Dass sie keine Spuren, nichts finden würden, was ihnen einen Weg zu ihm weisen würde. Wie bei der kleinen österreichischen Schlampe, da hatten sie nach über zwei Jahren immer noch nichts. Denn das Wasser war sein Freund. Das Wasser, das – ohne sein Zutun– für ihn arbeitete und alle Spuren beseitigte. Er dachte daran, wie er sie über Bord hatte fallen sehen, wie ihr Kleid sich wie ein weißes Segel bauschte, und an das Platschen, dieses satte, breite Platschen, als sie auf dem Wasser aufschlug und die Wellen sich über ihr schlossen. Da hatte er sich umgedreht und eine Weile durchs Fenster gesehen, hatte in den hell erleuchteten Salon geblickt und den Typen beobachtet, diesen aufgegockelten Schnösel in seinem Anzug, der den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen war. Er hatte ihn beobachtet, hatte dort gestanden und sich der grimmigen Gewissheit hingegeben, dass dieser Lackaffe würde warten können, bis er verfaulte. Er würde sie niemals wieder anfassen. Eine Weile lang hatte der Gockel einfach nur dagesessen und an dem uringelben Getränk in seinem Glas genippt. Bis er sich, fragend zunächst, dann unwillig und schließlich nervös umgeblickt hatte. Weil sie nicht wiederkam.
Kurz bevor sie anlegten, war er auf die Toilette gegangen, hatte ihre Tasche durchsucht nach dem Brief. Den er nicht fand. Er hatte so lange gewartet, bis alle Gäste von Bord waren und er ungesehen an Land gelangen konnte. Diesem Besoffenen im Klo hätte er am liebsten die Faust in den Magen gerammt. Musste er ihn mit seinem säuerlichen Alkoholdunst anblasen!
Den Brief würde er hier nicht finden. Er holte den Staubsauger aus dem Besenschrank in der Diele und ging damit durch die ganze Wohnung, nahm das Desinfektionsmittel, das er in seinem Rucksack mitgebracht hatte, und begann alles, jede Fläche, gründlich zu polieren. Dann schritt er noch einmal von Raum zu Raum, nahm den Staubsaugerbeutel aus dem Gerät, überprüfte, ob er auch wirklich nichts ausgelassen und alles Wichtige eingepackt hatte. Kurz bevor Frau Starks Seifenoper im Stockwerk über ihm zu Ende ging, verließ er die Wohnung. So leise und unauffällig, wie er gekommen war.
Der Abend war weniger kalt als nass. Er schlug den Weg in Richtung Graf-Zeppelin-Haus ein, ging am Jachthafen entlang, von Lichtinsel zu Lichtinsel, und schaute in das schwarze aufgewühlte Wasser. Der September war kühl gewesen, zu kühl und zu nass für den ausklingenden Sommer, und der Oktober war bisher ebenso verlaufen. Alle, mit denen er gesprochen hatte, beklagten sich über das deutsche Wetter. Und er hatte genickt und ihnen zugestimmt, und sie hatten sich bestätigt gefühlt. Er hatte in sich hineingelächelt, hintergründig, und gedacht, wie leicht es doch war, sie zu täuschen. Kinderleicht. Denn wenn sie in seine Augen sahen, sahen sie nur sich selbst.
Rasch schritt er aus, dicht am Geländer. Er hörte das Plätschern der Wellen in der Dunkelheit, das Rauschen des Regens und des Windes im Laub der Bäume über ihm. Irgendwo kreischte ein Vogel, ein verzweifeltes, schrilles Kreischen, wahrscheinlich wieder so eine verdammte Katze. Er fühlte Zorn in sich aufsteigen. Er hasste Katzen. Katzen waren für ihn die widerlichsten Tiere überhaupt. Wann immer er eine erwischte, sorgte er dafür, dass zumindest diese eine keinem Vogel mehr etwas antun würde.
Auf dem Seeparkplatz stieg er in seinen Wagen und fuhr nach Hause. Als er in seine Straße einbog, sah er schon von Weitem, dass seine Nachbarin, eine Mutter von vier Kindern, gerade dabei war, Einkäufe aus dem Auto zu holen. Die beiden Kleinsten, ein Rotzlöffel mit dem klangvollen Namen Timothy, und sein Bruder Roger (»Rod-schäär«!), eine miese kleine Ratte, der ihm jeden Frühling aufs Neue den Garten plünderte und zuerst dicke Sträuße von Tulpen pflückte und später dann die Pfingstrosen und andere Sommerblüher dezimierte, rannten immer um den Wagen herum und beschimpften sich gegenseitig als »Doppelwichser« und »Arschficker«. Die Mutter, drei prall gefüllte Stoffbeutel in den Händen, mahnte die Kinder, ein bisschen »runterzuschalten«. Dieses Proletenpack, dachte er. Für euch werd ich mir auch noch was Schönes überlegen. Seitdem die Familie vor gut zwei Jahren das Haus neben ihm gekauft hatte, wurde er ständig durch irgendetwas gestört. Entweder durch das Donnern dieser Skateboards, mit denen die Gören die Straße vor seinem Haus auf und ab fuhren. Oder im Sommer durch den penetranten Grillgestank, wenn sie wieder ihre Leichenteile rösteten. Und dann erst »Vati«! Wenn er daran dachte, wie dieses Weichei vor dem Grill stand, mit einer Rüschenschürze um den Bauch! Für ihn gab es kaum einen lächerlicheren Anblick als einen Mann in Küchenschürze vor einem Grill. Und die Blagen, die kreischend über den Rasen jagten und Ball spielten. Und schließlich dieses stumpfsinnige Muttertier, das nichts anderes zu tun wusste, als samstagnachmittags mit einem Frühstücksbrett unter den Knien und einem Messerchen in der Hand den Löwenzahn aus ihrem Rasen zu stechen.
Als er vorbeiging, hörte er den kleinsten Bengel kreischen: »He, da ist der böse Mann von nebenan!«
Er starrte den Jungen an. Dann wandte er sich zu der Frau, die jetzt dabei war, zwei volle Körbe hinten aus dem Espace zu hieven. Eilig sprang er hinzu: »Guten Abend, Frau Weimann! Warten Sie, ich helfe Ihnen.« Verbindlich lächelnd trug er die Körbe ins Haus, kehrte gleich noch einmal um und holte einen Kasten Mineralwasser und einen Kasten Bier. Sie bedankte sich. Überschwänglich. Nun kipp mal vor lauter Dankbarkeit nicht aus den Latschen, dachte er, während sie, ein tumbes Grinsen im Gesicht, vor ihm stand. Wie leicht sich alle täuschen ließen!
»Gern geschehen«, sagte er. Er ging den geplättelten Aufgang hinunter, vorbei an Roger, der auf dem Bürgersteig vor dem Auto stand.
»Ich mag dich nicht«, sagte der Junge.
»Aber Roger, so etwas sagt man nicht.« Die Stimme der Mutter drang von der Haustür her an sein Ohr.
Er ging an dem Jungen vorbei und flüsterte ihm zu: »Pass auf, du kleine Ratte, wenn ich dich allein erwisch.«
Er drehte sich noch einmal um und lächelte der Mutter zu. Verschwand in seinem Haus. Nicht ohne noch einmal freundlich zu winken.
*
Es begann wie immer. Sie lag im Bett und hörte ein Geräusch aus der Küche. Unterdrücktes Kichern, ein Stöhnen. Mühsam versuchte sie aufzustehen, es gelang ihr kaum, immer und immer wieder sank sie auf die Matratze zurück. Endlich tappte sie schwankend durch einen langen, nicht enden wollenden Gang. Aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Gesicht vor ihr auf. Eine aufgedunsene, weiße Masse, die Lippen rotverschmiert, ausgefranst, die Augen zwei dunkle Löcher. Sie schrie. Konnte nicht aufhören zu schreien. Sie sah, dass die Fratze den Mund weit geöffnet hatte, ein dunkler Schlund. Sie taumelte, stützte sich an der Wand ab, berührte etwas Kaltes, Glattes. Der Spiegel im Flur. Der Schrei verstummte. Weiter musste sie, weiter, dorthin, von wo die Geräusche kamen. Warum bekam sie nur die Augen nicht richtig auf?
Das Kichern hörte auf, ein rhythmisches Scharren setzte ein, da war das Stöhnen wieder, lauter diesmal. Wie lang dieser Gang war. Unendlich langsam kam sie voran, sie wollte schneller gehen, wollte endlich sehen, doch ihre Schritte wurden wie von Wassermassen gebremst. Endlich stand sie vor der Küchentür und drückte die Klinke herunter, angstvoll und leise, keiner durfte sie hören. Im ersten Moment verstand sie nicht, was sie sah. Ein Mann stand mit dem Rücken zu ihr, weiß leuchtete sein Körper im Dunkel, vor ihm auf dem Tisch saß eine Frau, ihr Haar lag wie ein dunkler Schatten um ihren Kopf.
Plötzlich drehte sich der Mann um und blickte Marie ins Gesicht. Er sagte: »Ich brauche einfach ein wenig Abstand!« und lachte. Die Frau lachte auch, ein schrilles, hysterisches Kreischen, und sie konnten beide nicht aufhören, sie lachten, bis ihnen die Tränen über die Wangen liefen. Wie betäubt stand Marie da, das Lachen dröhnte in ihren Ohren.
Was danach kam, war neu. Die Starre löste sich, sie lief hinaus in die Nacht, schneller diesmal, das Gewicht an ihren Beinen war nicht mehr da. Sie hastete durch den Garten, durch braune Laubmassen, stolperte über abgestorbene Zweige und blieb keuchend liegen, ihr Atem weißer Nebel. Sie hörte, wie die Haustür krachend ins Schloss fiel. Sie war allein.
Ein Knacken hinter der Eibe ließ sie hochfahren. Hastig rappelte sie sich auf. Wohin? Zurück zu den lachenden Fratzen konnte sie nicht, kein anderes Haus war in der Nähe. Sie rannte durch den Garten bis zum Zaun, wo war die Pforte? Hinter sich hörte sie ein gleichmäßiges Rascheln, dumpfe Schritte auf weicher Erde, immer näher kamen sie. Sie musste weg hier, raus aus dem Garten. Mit großer Anstrengung zog sie sich an den gewundenen Streben des Zauns in die Höhe, Speerspitzen zerrissen ihr Nachthemd, und warmes Blut floss ihre Beine hinunter. Doch jetzt nicht innehalten. Ein Sprung und weiter rannte sie, an alten Obstbäumen vorbei bis zum Ried. Nur nicht anhalten, da waren die Schritte schon wieder, dumpf und schwer. Sie warf einen hastigen Blick über die Schulter, ihr Hals schmerzte bei jedem Atemzug, die scharfe Nachtluft hatte ihr Tränen in die Augen getrieben.
Hier ging es nicht mehr weiter. Nur Schilf und Schlamm. Und dahinter der See. Sie stapfte durch den Matsch, ihre Füße wurden schwerer, immer schwerer, es roch nach modrigem Wasser. Dann stolperte sie wieder und fiel. Sie wollte sich aufraffen, schnell, schnell, die Schritte kamen näher, doch ihre Füße steckten im moorigen Grund, und sie knickte in sich zusammen, schlaff wie eine Marionette, deren Puppenspieler die Fäden aus der Hand legt.
Jetzt war er gleich bei ihr. Sie wollte schreien, doch kein Laut drang aus ihrer Kehle, so sehr sie sich auch bemühte. Dunkel und riesengroß stand er über ihr. Bückte sich, und sie sah sein Gesicht. Lorenz. Wie gebannt beobachtete sie, schaute nur zu, wie er sich über sie beugte, die Hände an ihren Hals legte und immer fester zudrückte.
Rosa Wolken
Montag, 30.Oktober
Gierig atmete Marie ein. Dieser Geruch gehörte für sie zum Leben wie atmen und schlafen. Sie stand vor dem Regal und drehte das Glas noch einmal um: siebzehn achtundfünfzig. Vergewisserte sich, dass sie richtig gesehen hatte. Das Zeug kostete hier tatsächlich doppelt so viel wie in München. Sie nahm ein anderes Glas und kontrollierte das Preisschild. Das Gleiche. Aber sie brauchte es. Unbedingt. Wenigstens Chromtitangelb und Englischrot. Und Acrylemulsion, eine Flasche würde sie mitnehmen müssen. Sie zog ihren Geldbeutel aus dem Rucksack und zählte die Scheine. Das würde gerade reichen.
Plötzlich kam es ihr vor, als beobachtete sie jemand. Kurz darauf hörte sie eine fremde und doch irgendwie vertraute Stimme, die ihren Namen sagte: »Mia?«
Überrascht drehte sie sich um. So viele Leute gab es nicht, die sie so nannten. Ihre Augen weiteten sich. Sie erkannte die Frau, die sie angesprochen hatte, sofort.
»Aber… Paula! Das darf ja wohl nicht wahr sein!«
»Du siehst noch immer so aus wie früher… wie lange ist das jetzt her? Doch bestimmt zehn Jahre!«
»Und du bist noch schöner als damals!«
Sie musterten einander mit großen Augen. All die Jahre schienen plötzlich wie weggewischt, und das Lächeln auf ihren Gesichtern wurde zu einem Lachen, das sie wieder zu Kindern und Freundinnen machte. Als hätten sie sich erst gestern verabschiedet, nach der Schule. Die Jahre verschwanden, und so standen sie sich gegenüber, verändert und doch vertraut. Und jede las im Gesicht der anderen die Spuren, die die Zeit hinterlassen hatte, erkannte in den Falten der anderen die vergangenen Stunden, Tage, Jahre.
»Lass uns in ein Café gehen. Wir müssen uns alles erzählen.«
Sie saßen sich gegenüber, in einem Wintergarten-Café in der Salzgasse in Lindau, und konnten es immer noch nicht fassen. Konnten nicht glauben, dass sie beide wieder hier wohnten, wo sie doch damals nicht schnell genug aus dem ganzen Mief, wie sie es nannten, hatten herauskommen können.
Paula erzählte, dass sie verheiratet war und mit ihrer Familie in Schachen lebte. »In einem wunderbaren Haus, es wird dir gefallen. Im Wohnzimmer eine ganze Fensterfront von der Decke bis zum Boden. Aber das Beste ist: Ich habe zwei Kinder, Leni und Anna.«
Marie war sprachlos. Ihre Freundin Paula, die Paula, die sie gekannt hatte, die nichts so sehr liebte wie ihre Unabhängigkeit, die von Reisen und fernen Ländern geträumt hatte, die als Entwicklungshelferin nach Afrika gehen und die Welt verändern wollte. Diese Paula hatte einen Mann und zwei Kinder und ein Haus. Und war offenbar glücklich.
»Ja, das haut dich um!« Paula lachte ihr freches Lachen. Sie hatte immer noch diese zwei Grübchen, die ihrem Gesicht einen lausbübischen Ausdruck verliehen.
Sie schwiegen eine Weile. Marie sah in das Blätterdach über ihr, ein Geranke von jahrealtem Kastanienwein. Die Frage, die Marie am meisten interessierte, wollte ihr nun, da sie Paula gegenübersaß, nicht über die Lippen. Sie kratzte das Salz von ihrer Butterbrezel, druckste herum, kam sich ein wenig unbeholfen vor in Gegenwart ihrer einstmals besten Freundin. Sie musterte Paula. Ihr Blick glitt über das teure dunkelgrüne Kostüm, die Perlenohrringe, das blond gesträhnte Haar, das sicher von einem Frisör, der sich Coiffeur nannte, gestylt wurde. Mit einem Mal fühlte sie eine Distanz, spürte, wie die vergangenen Jahre sich wieder zwischen sie schoben wie eine Wand. War sich ihrer eigenen prekären Situation bewusst. Hier war sie nun, eine Frau Mitte dreißig, ohne Geld, ohne Job. Und ohne Mann. Und gegenüber saß ihre Freundin aus Kindertagen, lebte offenbar in einer glücklichen Partnerschaft in einem, wie sie selbst sagte, wunderbaren Haus, und hatte zu allem Überfluss auch noch zwei Kinder. Saß ihr gegenüber, zum Greifen nah, und war doch Lichtjahre entfernt von Maries Wirklichkeit.
Doch eine Frage hatte sie so manches Mal in den vergangenen Jahren beschäftigt, und während sie ihre Serviette zu einer Ziehharmonika faltete, überwand sie sich schließlich: »Warum hast du dich nie mehr gemeldet? Ich meine, ich habe dir dreimal geschrieben. Und du hast nie geantwortet…«
Über das eben noch strahlende Gesicht der Freundin legte sich ein Schatten, und Paula, die nie um eine Antwort verlegen war, die immer genau wusste, was sie wollte und wie sie es bekam, zögerte.
»Ja, weißt du, damals, nach dem Studium, da bin ich in so eine Art Loch gefallen. Ich… ich war dann ziemlich krank, fast ein ganzes Jahr.«
Marie sah, wie Paula ihren Kaffeelöffel umkrampfte, wie ihre Fingerknöchel weiß hervortraten.
Marie war perplex. Sie hatte eine andere Reaktion erwartet, war sie doch all die Jahre insgeheim überzeugt gewesen, dass Paula, die beliebte, überall gern gesehene Paula eines Tages einfach das Interesse an ihr verloren hatte. An ihr, der etwas schwermütigen, melancholischen Freundin, die alles immer bierernst nahm. Vor allem das Leben. »Aber… warum hast du mir nie ein Wort davon geschrieben? Wir waren doch Freundinnen. Vielleicht hätte ich dir helfen können.«
Paula hob den Kopf und blickte Marie direkt in die Augen. Sie sah ernst aus. »Nein… niemand hat mir damals helfen können, da musste ich ganz allein durch.« Sie schluckte, schwieg einen kurzen Moment und fuhr dann fort. »Und irgendwie hab ich's dann ja auch geschafft. Aber diese Geschichte erzähle ich dir ein andermal. Tatsache ist, dass wir uns beide wieder im Lande der Kehrwoche eingefunden haben.«