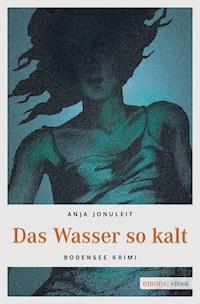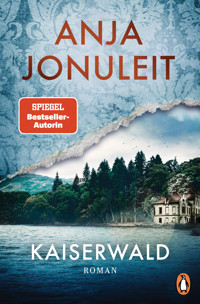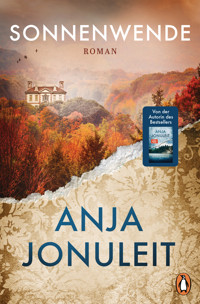
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kaiserwald-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Ich erinnere mich noch gut daran, als wir im Kaiserwald ankamen. Es war, als würde man an einen Ort reisen, den es gar nicht mehr gab.«
25 Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Maywald in Riga ist ihre Tochter durch einen anonymen Brief auf die Diplomatenfamilie von Prokhoff aufmerksam geworden. Deren Stiftung »Drei Linden« finanziert dubiose Ökodörfer in ganz Europa. Dass Rebeccas Tochter sich in den Sohn der Familie verliebt, war nicht vorgesehen – um keinen Preis darf er ihre wahre Identität erfahren. Und auch er verbirgt etwas vor ihr: Was hat es mit seinen nächtlichen Alpträumen auf sich? Wer ist „J“ in seinem Kalender? Ein weiterer Hinweis führt sie nach Lettland. Angeblich will sie sich das Ökodorf »Tris Liepas« anschauen. In Wahrheit aber muss sie endlich Klarheit gewinnen über das Schicksal ihrer Mutter. Doch die von Prokhoffs setzen alles daran, ein dunkles Geheimnis zu bewahren. Die grandiose Fortsetzung des Erfolgsromans »Kaiserwald« von SPIEGEL-Bestsellerautorin Anja Jonuleit
www.anjajonuleit.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Ich erinnere mich noch gut daran, als wir im Kaiserwald ankamen. Es war, als würde man an einen Ort reisen, den es gar nicht mehr gab.«
25 Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Maywald in Riga ist ihre Tochter durch einen anonymen Brief auf die Diplomatenfamilie von Prokhoff aufmerksam geworden. Deren Stiftung »Drei Linden« finanziert dubiose Ökodörfer in ganz Europa. Dass Rebeccas Tochter sich in den Sohn der Familie verliebt, war nicht vorgesehen – um keinen Preis darf er ihre wahre Identität erfahren. Und auch er verbirgt etwas vor ihr: Was hat es mit seinen nächtlichen Alpträumen auf sich? Wer ist »J« in seinem Kalender? Ein weiterer Hinweis führt sie nach Lettland. Angeblich will sie sich das Ökodorf »Tris Liepas« anschauen. In Wahrheit aber muss sie endlich Klarheit gewinnen über das Schicksal ihrer Mutter. Doch die von Prokhoffs setzen alles daran, ein dunkles Geheimnis zu bewahren. Die grandiose Fortsetzung des Erfolgsromans »Kaiserwald« von SPIEGEL-Bestsellerautorin Anja Jonuleit
Anja Jonuleit, 1965 in Bonn geboren und am Bodensee aufgewachsen, arbeitete einige Jahre für die Deutsche Botschaft in Rom. Nach einer Abordnung an die Botschaft Damaskus studierte sie am Sprachen- und Dolmetscherinstitut in München Italienisch und Englisch. Zurück am Bodensee machte sie sich als Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin selbstständig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Ihren Romanen – darunter »Herbstvergessene«, »Der Apfelsammler«, »Rabenfrauen« und »Das letzte Bild« – folgt mit ihrer Dilogie »Kaiserwald« und »Sonnenwende« ein breit angelegtes Familiendrama.
Die Presse über den ersten Teil der Kaiserwald-Dilogie:
»Anja Jonuleit ist ein atemberaubender Thriller gelungen, der so dicht, so komplex und so spannend ist, dass man ihn nicht beiseitelegen kann.«
Kieler Magazin über »Kaiserwald«
»Ein Trip mit ungewissem Ausgang. Und ein sehr gefährlicher […] Dieser Roman ist unglaublich spannend.«
www.buecher.de über »Kaiserwald«
»Was all die Protagonisten dieses Romans miteinander verbindet, klärt Anja Jonuleit in einem steil ansteigenden Spannungsbogen mit Thriller-Qualitäten exzellent auf.«
Ruhr Nachrichten über »Kaiserwald«
www.penguin-verlag.de
ANJA JONULEIT
SONNENWENDE
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Bianca Dombrowa
Umschlaggestaltung: FAVORITBÜRO, München
Umschlagmotive: Artwork unter Verwendung von © Arcangel/Evelina Kremsdorf; © Shutterstock/Joe Belanger, Dario Rigon, Autsawin Uttisin
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-31726-3V002
www.penguin-verlag.de
Für meine Töchter Astrid und Laura, die mich zu dieser Geschichte inspiriert haben.
Prolog
Latvijas Avīze, Mittwoch, 22. Oktober 1997. Wasserleiche am Ufer des Kisch-Sees entdeckt: Todesumstände rätselhaft
Riga, Kaiserwald – Im Stadtteil Kaiserwald ist am Montag, dem 20. Oktober, die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung der Kriminalpolizei Riga hervor. Demnach habe eine Spaziergängerin am Montagabend gegen 17.30 Uhr den leblosen Körper am Ufer des Kisch-Sees, im Bereich des öffentlich zugänglichen Badestrands an der Roberta Feldmaņa iela, entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Toten um die fünfzehnjährige Schülerin Alise S., die zuletzt am Freitagabend, dem 17. 10.1997, bei einer Schulveranstaltung in der Ezermalas iela gesehen wurde. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf Umstände ihres Todes. Die Ermittlungen hierzu sind eingeleitet. Zeugenaufruf: Die Polizei Riga bittet Personen, die das Mädchen am Abend des 17.10. nach einundzwanzig Uhr gesehen haben, um sachdienliche Hinweise. Das Mädchen war mit einem grünen Wollkleid bekleidet und hatte auffälliges langes rotes Haar.
Erster Teil
1.
Ich weiß, was du getan hast. Geh zur Polizei. Sonst muss ich es tun. Das war die SMS von gestern Nacht. Er drückte auf die Taste und steckte das Smartphone zurück in die Tasche seiner Barbourjacke. Den Espresso vor sich auf dem Bistrotisch hatte er noch nicht angerührt. Der Gedanke an den Geschmack verursachte ihm Übelkeit. Er hatte ihn sowieso nur bestellt, weil er irgendetwas hatte bestellen müssen, während er auf sie wartete. Und derweil brannten die Worte ein Loch in sein Gehirn.
An dem hohen Sideboard hinten an der Wand saßen zwei Teenagermädchen in bauchfreien Strickpullovern und kicherten. Sie hatten ihre MacBooks vor sich auf dem Tisch stehen und schienen irgendetwas für die Schule machen zu wollen. Er bemerkte die Blicke, die sie ihm immer wieder zuwarfen, und fragte sich, ob sie über ihn lachten – oder nur seine Aufmerksamkeit erregen wollten.
Der Fenstertisch war gerade frei geworden, als er kam. Er nahm dort Platz und behielt so den Bürgersteig im Auge. Von hier würde er sie kommen sehen. Er würde jeden kommen sehen. Er selbst aber war halb verdeckt von der Säule mit der Tannengirlande, sodass man ihn von außen erst spät erblicken würde und er auf diese Weise die Gelegenheit hätte, schnell dahinter zu verschwinden. Ihm war klar, dass es leichtsinnig war, ohne Bodyguard unterwegs zu sein. Aber er konnte Brammer bei diesem Treffen nicht gebrauchen. Nicht einmal Brammer. Tatsächlich war es das erste Mal seit Jahren, dass er tagsüber ein Café betreten hatte. Für so etwas hatte er schon lange keine Zeit mehr.
Die Tür ging auf, und ein schwarz gekleideter Typ mit breiten Schultern kam mit großen Schritten in seine Richtung. Er spürte, wie sein Körper in Habachtstellung ging und sein Herz zu rasen begann. Und als sei es gestern gewesen, sah er den Mann mit dem Messer wieder vor sich, wie er aus dem Nebel direkt auf ihn zugerannt war. Seine Hand schoss in die Tasche seiner Wachsjacke, umschloss die Walther PPK, die Brammer ihm besorgt hatte, und umklammerte den Griff der Waffe. Doch dann hörte er die Mädchen gicksen. Eine von ihnen sprang auf und fiel dem Typ um den Hals, sodass ihr viel zu kurzes Oberteil hochrutschte und man ihren pinken BH sah. »Iiiiih, bist du nass!«, kreischte sie, als der Typ seine regennassen Haare in ihre Richtung ausschüttelte.
Sein Herz hämmerte weiter, als er die Hand schon längst wieder aus der Tasche gezogen hatte. Und da stand mit einem Mal Jo vor ihm. Nun hatte er sie doch nicht kommen sehen. Sie sah dramatisch aus, ganz in Schwarz, dramatisch und wie immer so schön, dass es ihm im ersten Moment den Atem verschlug, trotz all der dunklen Jahre und all der Wunden, die sie ihm geschlagen hatte. Die sie sich gegenseitig geschlagen hatten. Im Augenwinkel bemerkte er, dass die Teenager und der Typ vom Nebentisch verstummt waren und zu ihr herübersahen. Natürlich erkannten sie sie. Jo lächelte zu ihm herunter, und ihm war klar, dass sie um ihre Wirkung wusste und dass sie ihren Look mit Regenschirm und Accessoires und dem Make-up, das aussah, als sei sie ungeschminkt, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hatte.
Eines der beiden Mädchen trat näher. Es hatte ihr Smartphone in der Hand. Natürlich.
»Oh mein Gott! Joooo?« Ihre Stimme war mehr ein Quietschen, als sie den Wunsch mit dem Selfie vorbrachte.
Wie immer in diesen Situationen reagierte Jo souverän und so warmherzig, als lägen die beiden Mädchen ihr am Herzen. Falk rückte ein wenig mehr in die Ecke, drückte sich ganz an die Wand, er durfte auf keinen Fall im Hintergrund dieser Fotos auftauchen. Als Jo dann ebenfalls ein Selfie von sich und den beiden hübschen Mädchen machte, um diesen Fanmoment festzuhalten, spürte er, wie seine Hände sich zu Fäusten ballten. Die Erinnerung an die Jahre mit ihr steckte ihm so tief in den Knochen, dass der kleinste Reiz seine Gefühle wieder hochkochen ließ. Er hätte es besser wissen müssen. Er hätte sich woanders mit ihr treffen sollen. Das Gespräch, das er mit ihr zu führen hatte, brauchte weiß Gott keine Zuschauer.
Mit einem kleinen Seufzer schlüpfte Jo aus ihrem übergroßen Mantel, griff nach ihrem Regenschirm, den sie für das Selfie abgestellt hatte, durchmaß das ganze Café mit ihrem Laufsteg-Gang, um Mantel und Schirm an der Garderobe loszuwerden. Sie kehrte zurück und ließ sich ihm gegenüber auf dem grün gepolsterten Samtstuhl nieder. Trotz des regnerischen Wintertages trug Jo eine riesige schwarze Hollywood-Sonnenbrille, die auf dem vermeintlich nachlässig aufgetürmten blonden Haar steckte. Auch ihre restlichen Klamotten – der enge Rolli, die schmale Hose – waren schwarz. Das einzig Nichtschwarze an ihr war die Perlenkette ihrer Großmutter um ihren schlanken Hals. Einmal hatte sie ihm unter Tränen erzählt, dass sie diese Kette immer dann trug, wenn sie die ganze positive Erb-Energie ihrer siebenhundert Jahre alten Ahnen benötigte. Vielleicht traf das ja wirklich zu. Vielleicht aber spielte sie an diesem Tag auch nur wieder eine Rolle, möglicherweise die Holly Golightly aus Frühstück bei Tiffany. Und da sie wusste, dass er das mit der Erb-Energie wusste, vermutete er eher, dass die Kette ihre Rolle unterstreichen sollte.
Die Kellnerin kam, und Falk sandte ein Stoßgebet zum Himmel, dass sie offenbar kein Instagram nutzte. Nachdem Jo einen Masala Chai bestellt hatte, saß sie ihm gegenüber und rang nervös die schmalen weißen Hände, die sie vor sich auf den Tisch gelegt hatte und an denen, er glaubte es kaum, der Ring prangte, den er ihr zu ihrem zehnjährigen Jubiläum geschenkt hatte. Als sie sich das erste Mal verlobt hatten. Sein Magen zog sich zusammen. Sie würde doch wohl nicht glauben, er habe die Absicht, eine Neuauflage ihrer kranken Beziehung zu starten?
Und so kam er sofort zur Sache und schob ihr das Smartphone über den Tisch, wobei er sie keine Sekunde aus den Augen ließ.
Ich weiß, was du getan hast. Geh zur Polizei. Sonst werde ich es tun.
Er sah, wie ihr Blick den Bildschirm abtastete. Wie sie die Brauen zusammenzog und ihn dann ansah, in einer Mischung aus Irritation und Ratlosigkeit.
»Was ist das? Warum zeigst du mir das?«
»Ist die Nachricht von dir?«
Sie wich zurück, als hätte er sie geohrfeigt.
»Hast du mich deshalb angerufen?« Ihre Stimme zitterte wie ihre Lippen. Und wie auf Knopfdruck füllten sich ihre Augen mit Tränen. »Dass du mir so etwas zutraust …«
Er presste die Lippen zusammen. Er traute ihr noch ganz andere Dinge zu. Aber das würde er jetzt nicht thematisieren.
»Du hast mir schon einmal gedroht.« Er dachte an ihren Überraschungsbesuch im letzten Herbst, kurz bevor er mit Mathilda im Park joggen und der Mann mit dem Messer auf ihn losgegangen war. Zuerst war sie ganz sanft gewesen, hatte versucht, ihn zu umgarnen. Und als er nicht darauf einging, war sie ausgerastet und hatte die Drohung mit den Fotos aus der Kiste geholt.
Sie riss die Augen auf, und eine einzelne Träne kullerte ihre Wange hinunter. Sie wischte sie nicht weg.
»Wann soll das gewesen sein?«
»Ich glaube, das weißt du genauso gut wie ich.«
Sie atmete tief ein und hörbar zittrig wieder aus. Ihre Stimme war sehr leise, als sie nun sagte: »Ich war verzweifelt.«
Die Kellnerin kam, stellte den Chai auf den Tisch und verzog sich diskret. Falk bemerkte, dass die Teenager immer wieder zu ihnen herübersahen. Er konnte nur hoffen, dass diese Szene hier nicht doch irgendwie im Internet landen würde.
Er beugte sich vor, deutete auf die SMS und sagte eindringlich: »Ich muss es wissen. Ob du das warst.«
Eine zweite Träne lief Jo übers Gesicht. Und obwohl er sie so gut kannte, obwohl er all das tausendfach erlebt hatte, ihre Auftritte in allen Schattierungen kannte, sie still weinend oder dramatisch schluchzend oder schweigsam vor Schmerz und dem Zusammenbruch nahe, war er sich in diesem Moment doch wieder unsicher, ob sie nicht wirklich litt.
Plötzlich flüsterte sie, und ihr zarter, blasser Mund bebte.
»Ich hab die Hölle durchgemacht wegen dir, weißt du das? Und trotzdem dachte ich, das Herz bleibt mir stehen, als ich gestern deinen Namen auf dem Display sah.«
Er wusste nicht, was er erwidern sollte, sah sie nur an, ihr betörend schönes Gesicht, diese strahlend blauen Augen, die jetzt von Tränen glänzten.
»Warum hast du mir das angetan?«
Er holte tief Luft. Das hätte er sich ja denken können. Dass es ihr gelingen würde, auch dieses Gespräch in eine ganz falsche Richtung zu drehen. So war sie. Schon immer gewesen. Es kostete ihn seine ganze Selbstbeherrschung, als er nun sagte:
»Das mit uns hätte niemals funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Du weißt das so gut wie ich.«
Sie schlug die Augen nieder. »Ich hasse dich«, stieß sie hervor. »Und ich liebe dich. Ist das nicht armselig?«
Als Falk vor dem ROD-Tower ankam, bemerkte er, dass er die Hände zu Fäusten ballte. Immer noch. Es war ein Fehler gewesen, sie anzurufen. Er war nun genauso schlau wie vorher. Er wusste doch, dass Jo eine hervorragende Schauspielerin war, die jede Bühne, die sich ihr bot, für ihre Ziele nutzte. Und eines dieser Ziele schien momentan tatsächlich zu sein, ihn wieder herumzukriegen. Aus dem einzigen Grund, weil er nicht mehr zu haben war.
Er betrat das Foyer, wischte sich die Regentropfen aus den Haaren und nickte den beiden Empfangsdamen zu. Vor dem Privataufzug legte er den Daumen auf den Fingerprint-Türöffner. Während der Lift sich lautlos in Bewegung setzte, um in die Führungsetage der ROD Immobilien zu fahren, wanderten seine Gedanken wieder zu Jo, der Frau, mit der ihn fast fünfundzwanzig Jahre einer ebenso wechselhaften wie unheilvollen Beziehung verbunden hatten.
Zusammengekommen waren sie in einem Bootcamp in Utah, wo man ihnen beiden die Seele aus dem Leib erzogen hatte. Und während die nichtsahnende Welt um sie herum ihre Verbindung für eine logische Konsequenz hielt, für ein Naturgesetz wie das Newton’sche Kraftgesetz oder eine mathematische Formel, dass zwei mit einem Platinlöffel im Mund Geborene eben zwangsläufig zusammenfanden, wussten sie beide es doch besser. Dafür hatten die Erzieher der Provo Canyon School gesorgt: mit Einzelhaft, dem Einsatz von Drogen, Misshandlungen und vielen unaussprechlichen Dingen. Unfassbar, dass dieses Dreckloch von einem Internat noch immer existierte.
Die Aufzugtüren öffneten sich, und Falk trat hinaus. Einen kurzen Moment schwankte er, als er die Glasfront des ROD-Tower entlangging und sein Blick auf die unter ihm im Regen liegende Stadt fiel. Erst fünfzehn Uhr und schon fast wieder dunkel, dachte er. Und: dass er dieses neue Jahr ohne seine Frau begonnen hatte. Ohne Mathilda, die seit zwölf Tagen abgetaucht war. Und obwohl er wusste, dass seine Mutter alles dafür getan hatte, sie zu vergraulen und Mathilda nun jedes Recht hatte, auf Abstand zu gehen, fing er langsam an, sich Sorgen zu machen. Was, wenn ihr doch etwas zugestoßen war? Wenn der Typ, der ihn hatte erstechen wollen, nun Mathilda ins Visier genommen hatte?
Er durchquerte das Vorzimmer zu seinem Büro, lächelte seiner Assistentin Betty zu, die gerade am Telefon war, und schloss die Tür hinter sich. In seinem Büro nahm er als Erstes die Waffe aus der Jacke, tat sie in seine Schreibtischschublade und schloss sie ab. Seit jenem Abend im Park nahm er regelmäßig Schießunterricht. Brammer hatte ihm einen erstklassigen Lehrer besorgt, Andreas Jäger, wie Brammer ein ehemaliger Zeitsoldat, der ihm dabei half, seinen Waffenschein zu machen und sich nicht mehr so hilflos zu fühlen. Er hatte zuvor noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Den Wehrdienst hatten er und Tristan seinerzeit nicht antreten müssen. Seine Eltern hatten dafür gesorgt, dass sie beide wehruntauglich geschrieben wurden. Falk wusste nicht, warum sie das eigentlich getan hatten, wo sie, solange er denken konnte, davon überzeugt waren, gegen die Verweichlichung der Jugend anarbeiten zu müssen. Er nahm an, dass das ihre Art der Wiedergutmachung war, nachdem sie erfahren hatten, was man ihnen in der Provo Canyon School angetan hatte. Obwohl Tristan – im Gegensatz zu ihm – die Zeit recht unbeschadet überstanden hatte. Aber Tristan war schon immer anders gewesen als er, ein Überlebenskünstler. Vielleicht war er ja auch einfach nur manipulativ und skrupellos.
Falk setzte sich an seinen Schreibtisch, stellte sein Smartphone auf das Lade-Dock und schaltete den Laptop ein. Während der Rechner einen Piepton von sich gab und hochfuhr, wanderte sein Blick erneut nach draußen, durch die regenbenetzte Scheibe, wo er sich in den schiefergrauen Baumgerippen am Flussufer verfing. Die Straßenbeleuchtung hatte sich schon eingeschaltet.
Das neue Jahr hatte für ihn so ungut begonnen, wie das alte zu Ende gegangen war. Zuerst Weihnachten. Das er ohne Mathilda, dafür aber mit seinen Eltern und Tristans Familie verbracht hatte und dabei Zeuge wurde, wie die Kinder seines Bruders in affenartiger Geschwindigkeit ein Geschenk nach dem anderen aufrissen, um sich dann zu streiten und den Rest des Abends an ihren iPads zu hängen. Sein Bruder und seine Mutter hatten sich an den Weihnachtspunsch gehalten, und Georg hatte Veronika, seine Schwägerin, die er für eine lasche und inkompetente Mutter hielt, konsequent ignoriert. So war das Familienglück perfekt gewesen. Silvester war auch nicht viel besser gewesen. Das hatte er in Sankt Moritz verbracht, um in seiner Eigenschaft als neuer Vorstand die Angelegenheiten der Dreilinden-Stiftung zu vertreten. Der leidige Vorstandsposten war ihm mit der Eheschließung zugefallen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er nur zu gerne darauf verzichtet. Aber der Erbvertrag war so eine Art Alles-oder-nichts-Deal gewesen: Wenn er an das Vermögen wollte, musste er den Posten annehmen; so hatte sein Großvater es seinerzeit festgelegt. Natürlich könnte er es so handhaben wie Tristan, den im Grunde nichts interessierte – außer Golfen und seine Ruhe. Und der seine Unterschrift unter alles setzte, was man ihm vorlegte. Aber so war er nicht. Er nahm alles immer so verdammt ernst. Und so hatte er sich seit seiner standesamtlichen Heirat im Herbst darum bemüht, sich wenigstens einen groben Überblick über die Projekte der Stiftung zu verschaffen. Im Grunde konnte er sich nicht beklagen. Die Mitarbeiter hatten die relevanten Themen gründlich und übersichtlich für ihn aufbereitet, ihm gewissermaßen alles vorverdaut und in magenfreundlichen Häppchen gereicht, damit er nicht allzu viel Zeit darauf verwenden musste. Er hatte ja noch einen »richtigen« Job, seine Arbeit im Vorstand von ROD Immobilien, die in den letzten Jahren immer zeitintensiver geworden war und ihn nun fast auffraß. Und so hätte er es mit der Stiftung jetzt eigentlich gut sein lassen können. Wäre da nicht die Sache mit Sieglinde König gewesen.
»Pling« machte sein Smartphone, das Signal für eingehende Telegram-Nachrichten. Seitdem Mathilda abgetaucht war, hatte er die Signaltöne auf laut gestellt. Er griff danach. Sein Blick fiel auf eine ihm unbekannte Nummer. Vielleicht schrieb Mathilda ihm von einem anderen Handy aus? Oder es war doch etwas passiert! Mit zuckenden Fingern öffnete er die Nachricht. Im ersten Moment waren seine Augen langsamer als sein Verstand. War das ein Meme, das seine Nichte Wilhelmine ihm geschickt hatte? Das Kind und er teilten denselben Humor, weshalb sie ihn regelmäßig mit schrägen Fotos und noch schrägeren Videos versorgte. Aber wieso dann unter dieser Nummer? Er tippte auf das Foto, um es zu vergrößern.
Fast wäre ihm das Smartphone aus der Hand gefallen. Mit schreckgeweiteten Augen starrte er auf das Gesicht vor sich auf dem Display. Es war dasselbe Gesicht wie in seinem Traum. Jedes Detail. Das rote Haar wie die Schlangen der Medusa. Die Haut so weiß wie Kalk. Die Augen weit geöffnet und blicklos. Aber wie war das möglich? Ein unheimliches Gefühl kroch in ihm hoch. Wie konnte jemand wissen, was er träumte?
Auf dem Heimweg ließ er Brammer die Heizung hochdrehen. Im Rückspiegel begegnete er dem wie immer reglosen Blick seines Leibwächters. Um nichts in der Welt hätte er je sagen können, was dieser Mann dachte oder – Gott bewahre – fühlte. Er schaltete die Sitzheizung ein und bald wieder aus. Die Hitze kroch ihn unnatürlich an, als säße er auf einer Art elektrischem Stuhl. Und die ganze Zeit über war ihm klar, dass die Kälte, die er spürte, aus seinem Inneren kam.
Im Büro hatte er noch ewig so dagesessen und auf das bleiche Gesicht auf seinem Smartphone gestarrt. Es war kein Foto, das man ihm da geschickt hatte, es war eine Zeichnung, und sie sah aus wie die Bilder, die Xenia immer gemalt hatte. Fratzen hatte seine Mutter die Gesichter genannt und mit ihrer konsequenten Ablehnung und ihrem Unverständnis für die künstlerischen Ambitionen ihrer Tochter dafür gesorgt, dass Xenia sich immer mehr in sich selbst zurückzog, bis sie irgendwann ganz verstummte. Wie am Fließband hatte Xenia diese Zeichnungen damals produziert, als sie noch in Riga, in dem Haus im Kaiserwald, gewohnt hatten. Als könnte sie die Freundin so wieder zum Leben erwecken. Erst Jahre später hatte er begriffen, dass seine Schwester in Alise verliebt gewesen war. Über sein Smartphone gebeugt war er dann darauf gekommen, das Foto zu vergrößern. Und hatte in der unteren Ecke die Signatur entdeckt, das kleine X. Daraufhin war er betäubt und verwirrt in seinen ergonomischen Schreibtischstuhl zurückgesunken und hatte versucht, sich durch seine Verwirrung hindurchzutasten, aus ihr herauszugelangen, zurück in sein hell erleuchtetes Büro im ROD-Tower. Doch da waren sie ihm schon auf den Leib gerückt, die dunklen Erinnerungen an jene Nacht, und hatten ihn zum Grund gezogen wie der Nöck, von dem seine Dreilinden-Oma ihnen als Kinder erzählt hatte. Tatsächlich war er erst wieder aufgetaucht, als Betty den Kopf zur Tür hereingesteckt und erschrocken gefragt hatte, ob es ihm gut gehe, er sei so blass. Schnell hatte er etwas von Unterzucker gemurmelt, und wenige Sekunden später stand eine Tüte Studentenfutter auf dem Schreibtisch. Betty blieb demonstrativ so lange stehen, bis er sich eine Handvoll Rosinen und Nüsse in den Mund geschaufelt hatte. Als sie sein Büro wieder verlassen hatte, griff er kauend nach dem Smartphone, scrollte durch seine Kontakte und fand sie tatsächlich noch, Xenias Nummer. Doch wie erwartet: Diese Rufnummer war nicht vergeben. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Das war wohl zurzeit sein Schicksal: dass er die Menschen, die er unbedingt sprechen wollte, nicht erreichte. Wie sehr sehnte er sich nach Mathilda …
Während der Wagen weiter Stop-and-go durch den dichten Berufsverkehr kroch, wählte er nun noch einmal Mathildas Nummer, und wie erwartet sprang auch dieses Mal sofort die Mobilbox an. Es war doch nicht möglich, dass sie zwölf Tage lang ihr Smartphone ausgeschaltet ließ. Er beugte sich vor, gab Brammer die Order, in Lichtenberg vorbeizufahren, an Mathildas Apartment, das sie auch nach der Eheschließung behalten hatte. Das war auch so etwas, das ihn beschäftigte. Dass sie die Wohnung nicht aufgegeben hatte. Als wollte sie sich den Rückweg offenhalten. Und während draußen die noch immer weihnachtlich geschmückten Straßen vorbeizogen, versuchte er zu ergründen, wohin sie abgetaucht sein könnte – während er gegen die immer wieder in ihm aufsteigende Angst ankämpfen musste, ihr könne etwas zugestoßen sein.
Als sie nach den Feiertagen nicht zurückgekommen war, war er sich sicher gewesen, dass sie nach Namibia geflogen sein musste. Zwar lebten ihre Eltern nicht mehr, aber sie hatte natürlich noch Freunde dort. Doch je mehr Zeit verging, desto größer wurden seine Zweifel. Und dann beauftragte er Brammer, die Passagierlisten nach Windhoek überprüfen zu lassen, nur um herauszufinden, dass in den Tagen um Weihnachten herum keine Passagierin namens Mathilda Bekendorp verzeichnet gewesen war. Da hatte er begonnen, sich Sorgen zu machen. Wo konnte sie sein? Sie kannte nur wenige Menschen hier in Deutschland. Und enge Freunde waren seines Wissens nicht darunter. Warum hatte seine Mutter auch nicht ein Mal die Klappe halten können! Nicht dass gerade er in der Position gewesen wäre, ihr einen Vorwurf zu machen. Schließlich war er selbst so dumm gewesen, Mathilda von der Bedingung zu erzählen. Im Suff war das gewesen, ausgerechnet in ihrer Hochzeitsnacht. Seitdem hatte sie das mit sich herumgetragen und kein Wort darüber verloren. Unter diesem Aspekt passte sie eigentlich gut in diese Familie. Denn wenn die Prokhoffs eines konnten, dann war es das: Geheimnisse in sich einzuschließen, den Schlüssel wegzuwerfen und sie ein Leben lang mit sich herumzutragen.
Nachdem die Hochzeitspläne mit Josephine im letzten Jahr endgültig zerplatzt waren, hatte er dagestanden und nicht weitergewusst. Zuerst war er nur wütend gewesen, dass sie die Verlobung tatsächlich gelöst hatte. Allerdings war das seiner Meinung nach nur wieder ein weiterer ihrer Schachzüge gewesen, um zu bekommen, was sie wollte. Sie kannte den Erbvertrag und wusste, dass er unter Druck war und heiraten musste, um endlich finanziell unabhängig zu sein. Und obwohl die Beziehung, die Jo und ihn aneinandergekettet hatte, wohl noch am besten als »zerstörerisch« bezeichnet werden konnte, war sie doch die einzige Verbindung gewesen, aus der so etwas wie eine Ehe hätte entstehen können. Und dann war plötzlich Mathilda aufgetaucht. Im letzten Sommer, während der großen Hitzewelle, war sie ihm eines Abends in den Wagen gecrasht. Und obwohl es nicht seine Schuld gewesen war, hatte er noch Wochen danach Albträume davon gehabt, hatte sie vor sich gesehen, wie sie auf dem Fahrersitz gekauert hatte, zusammengesackt und bleich, mit diesem rotgoldenen Haar, und dieses Bild hatte sich überlagert mit jenem anderen Bild, das er schon so viele Jahre lang vergeblich loszuwerden versuchte. Mathildas Anblick war ihm an diesem heißen Sommertag wie ein Stromstoß in den Körper gefahren, und er hatte – das erste Mal in seinem Leben – den Namen von Prokhoff benutzt, damit sie im Krankenhaus die bestmögliche Behandlung erfuhr. Und dann waren zwei Dinge passiert: Er hatte die Kellertür zu den tief in ihm verschlossenen Albträumen nicht mehr zubekommen. Das war das eine. Das andere hatte während der Tage, die Mathilda mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus verbracht hatte, stattgefunden und ihn völlig unerwartet erwischt: Er hatte sich in diese schöne, geerdete, überaus direkte und ein bisschen sonderbare Frau verliebt, die manchmal sprach wie ein Kerl und ihm körperlich – das wusste er inzwischen – haushoch überlegen war, obwohl man es ihr auf den ersten Blick nicht ansah.
Sein Smartphone klingelte. Er fummelte es aus der Jackentasche und war sofort alarmiert. Es war sein Vater. Sein Vater rief ihn selten an. Etwas musste passiert sein. Ohne Zeit an ein Grußwort zu verschwenden, hörte er ihn sagen:
»Gerade war Horst Schmitt bei mir. Frau König hat versucht, sich umzubringen.«
Falk versagten die Worte, und er spürte, wie sein ganzer Körper sich anspannte. »Du meinst Sieglinde König …«
»Ja, Sieglinde König, unser Stiftungsvorstand. Sie hat offenbar versucht, sich vor die U-Bahn zu werfen … heute Morgen war das … aber ein Passant hat sie gerettet.«
»Das ist ja … schrecklich.« Falk begegnete Brammers Blick im Rückspiegel.
»Ja«, sagte Georg, »das ist schrecklich.« Dann schwieg er einen Moment und fuhr nahezu übergangslos fort: »Da müssen wir nun schnell eine Nachfolgerin finden. Bis zum Charity-Dinner im Ritz sind es nur noch vier Wochen!«
Im ersten Moment glaubte Falk, nicht recht verstanden zu haben. Dann brach es aus ihm heraus: »Daran denkst du jetzt? Ans Spendensammeln?«
Sein Vater seufzte. »Das Leben geht weiter. So ist das nun mal.«
Mit tonloser Stimme fragte Falk: »Weißt du, in welcher Klinik sie ist?«
»Wir haben sie in die Marienstein-Klinik in Treptow bringen lassen, eine ziemlich gute Privatklinik. Deine Mutter hat sich dafür eingesetzt … Wir finden, dass wir ihr das schuldig sind.«
2.
Sie war wieder zurück, hockte in ihrem Apartment in Lichtenberg und checkte ihr Smartphone, das andere, auf dem seit ihrer überstürzten Abreise vor Weihnachten über hundert Nachrichten eingegangen waren: verpasste Anrufe, SMS und Telegram-Nachrichten. Und alle waren sie von Falk.
»Bitte. Rede mit mir. Ich mach mir große Sorgen.« Das war seine letzte Nachricht gewesen, vorgestern um 5.43 Uhr.
Sie scrollte durch die Nachrichten. Bitte komm zurück. Wir müssen reden. Bitte melde dich. Es ist nicht, wie du denkst. Immer wieder die gleichen Worte. Man könnte meinen, Falk habe in ihrer Abwesenheit ein Rhetorikseminar besucht, wo ihm die Methode der kaputten Schallplatte eingetrichtert wurde. Jedenfalls hat er jetzt so richtig Drehzahl bekommen, dachte Penelope und ertappte sich dabei, wie der Gedanke eine grimmige Genugtuung in ihr auslöste. Wahrscheinlich enthielt sein Erbvertrag einen Passus, der eine Mindestdauer seiner Scheinehe vorschrieb, und jetzt ging ihm die Düse, dass ihm das Geld davonschwamm, wenn ihre Ehe vorher geschieden würde.
Ein prasselndes Geräusch ließ sie aufschauen. Wieder eine Bö, die den Regen über das Küchenfenster wischte. Sie stand auf und sah hinunter auf die Reihe dicht an dicht geparkter Wagen, wo auch ihr geliebter Landrover stand, mit dem sie heute schon über siebenhundert Kilometer zurückgelegt hatte, bei strömendem Regen, vom Allgäu nach Berlin. Der Abschied von ihren Großeltern heute Morgen war ihr schwergefallen. Sie wusste nicht, wie lange sie hier noch durchhalten würde, mit diesen ganzen Lügen, wie lange es noch dauern würde, bis sie das alles endlich hinter sich lassen und wieder zurückkehren konnte in ihr eigenes Leben. Und wann würde sie ihre Großeltern wiedersehen? Der Gedanke an die beiden tat ihr weh, wie sie heute Morgen auf der Straße gestanden und ihr hinterhergewinkt hatten, der Opa in seinen Haferlschuhen und dem Janker, die Oma in ihren Giesswein-Pantoffeln und dem grünen Lodenmantel, den sie rasch übergeworfen hatte. Wenn dieser ganze Zirkus hier nur schon vorüber wäre und sie ihnen alles erzählen könnte! Wenn sie jetzt wieder daran dachte, wie die Oma sich nach ihrer Umschulung erkundigt hatte, nach den einzelnen Fächern, und wie sie gezwungen gewesen war, ihr so dreist ins Gesicht zu lügen. Und wie der Opa ihr, kurz bevor sie ins Auto gestiegen war, auf die Schulter geklopft und gesagt hatte, dass sie das alles vorbildlich meistern würde, so wie sie bisher immer alles in ihrem Leben gemeistert hatte. Um ein Haar hätte sie da ihre Geheimhaltungspläne über den Haufen geworfen und ihnen reinen Wein eingeschenkt.
Sie sah hinunter auf die Straße, auf den im orangeroten Licht der Laternen nass glänzenden Asphalt und ging dann ins Bad, um ihre Laufsachen anzuziehen. Bevor sie in die Prokhoff’sche Villa zurückkehren konnte, musste sie sich unbedingt noch auslaufen. Sie streifte die Jeans ab und hängte den blau-weiß gemusterten Norwegerpullover, den die Großeltern ihr zu Weihnachten geschenkt hatten, auf einen Bügel und schlüpfte in ihr Odlo-Shirt, das noch immer auf dem Trockenständer über der Badewanne hing. Die Regenhose holte sie aus der Kommode neben dem Bett und stieg hinein. Sie wollte sich gerade abwenden, als ihr Blick auf das aufgerollte Plakat fiel, das sie vorhin, gleich nach ihrer Rückkehr, auf dem Tisch abgelegt hatte. Noch in Unterwäsche löste sie den Gummi und rollte es aus. Auf der Vorderseite das Filmposter Der Berg ruft, das in ihrem alten Jugendzimmer über dem Bett gehangen hatte; auf der Rückseite der Schlachtplan, den sie in den vergangenen zwei Wochen minutiös ausgearbeitet hatte. Sie beschwerte die vier Ecken mit zwei Kettlebells und den beiden Wasserflaschen, die sie für ihr Krafttraining verwendete, und betrachtete die Mindmap mit den diversen Kreisen und Pfeilen, in denen sie ihre nächsten Schritte geplant hatte und – je nach möglicher Entwicklung – auch alternative Vorgehensweisen. Es gab so viele Spuren, denen sie nachgehen musste: allen voran eine auf einem rosaroten Handzettel notierte Adresse in Riga, die sie bei nochmaliger Sichtung der Sachen ihrer Mutter gefunden hatte, Līksnas iela 29, Moskauer Viertel sowie Donnerstagabend. Penelope wusste auch nicht, warum, vielleicht lag es nur an den Nachwirkungen von Xenias Graphic Novel, in der diese behauptet hatte, ihre Mutter und Georg von Prokhoff seien ein Liebespaar gewesen. Jedenfalls hatte dieser Zettel ihre Aufmerksamkeit erregt, und sie hatte sich gefragt, warum ihre Mutter wohl den Flyer einer Pizzeria aufbewahrt hatte. Die Handschrift darauf stammte jedenfalls weder von ihrer Mutter noch von ihrem Vater. Und so hatte sie sich vorgenommen, sich als Erstes nach ihrer Rückkehr einmal Georgs Handschrift anzusehen.
Während sie ihre Laufschuhe anzog, kehrten ihre Gedanken wie so oft in den vergangenen Tagen fast zwanghaft zu dem toten Mädchen zurück, Alise Vitola. In ihrer Graphic Novel hatte Xenia sie Elise genannt. Penelope hatte diese Alise zweifelsfrei wiedererkannt als das Mädchen, das Falk und Tristan geküsst hatte, als das Mädchen, das laut Xenias Comic nachts aus Georgs Zelt gekommen war. Weshalb Penelope nun den Plan gefasst hatte, so bald wie möglich nach Riga zu fliegen. Weil sie seit der Lektüre von KaiserwaldI den Verdacht nicht loswurde, dass es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden ihrer Mutter und Alise Vitolas Tod geben könnte. Am liebsten würde sie gleich morgen oder übermorgen fliegen, also noch vor ihrer offiziellen Rückkehr zu den Prokhoffs. Wer wusste schon, wann sie wieder die Gelegenheit bekäme, sich für ein paar Tage zu verdrücken, ohne den Verdacht der Prokhoffs auf sich zu lenken? Andererseits wäre es gut, schon bei ihrem Reiseantritt bestimmte Informationen zu haben, zum Beispiel die genaue Adresse der Prokhoffs damals in Riga. Eines sollte ihr jedoch klar sein: Wenn die Prokhoffs, so wie Xenia das in KaiserwaldI hatte anklingen lassen, in irgendeiner Weise etwas mit dem Verschwinden – oder gar dem Tod – dieses Mädchens zu tun hatten, dann musste sie aufpassen, dass sie sich nicht zu auffällig für diese Stadt interessierte. Sie würde also entweder ohne deren Wissen fliegen oder einen sehr plausiblen Grund für diese Reise finden müssen.
Sie nahm die Regenjacke von der Garderobe, schnallte sich den Rucksack mit den Gewichten auf den Rücken und zurrte den Gurt fest. Kurz bevor sie das Licht löschte, fiel ihr Blick auf die Weihnachtskarte, die sie bei ihrer Rückkehr vorgefunden hatte. Es war ein Foto ihres Vaters mit seiner zweiten Frau und den drei Kindern vor einem mit Strohsternen und Bienenwachskerzen dekorierten Weihnachtsbaum. Ihr Vater und Jule, die das »neue« Baby auf dem Arm hielt, strahlten, als würden sie dafür Geld bekommen. Die beiden älteren Geschwister, Nele, neun, und Friedolin, sechs, wirkten ein wenig mürrisch.
Penelope wandte den Blick ab. Das Foto erinnerte sie an das unerfreuliche Telefonat, das sie mit ihrem Vater geführt hatte, vor nunmehr sieben Tagen. Eine ganze Woche lang hatte sie dieses Gespräch von Tag zu Tag verschoben, doch als am Neujahrstag ihr Smartphone geklingelt und sie seinen Namen auf dem Display gelesen hatte, hatte sie das als Zeichen gedeutet und das Gespräch angenommen. Und weil sie sie war, hatte sie nach dem Festtagsgeplänkel und dem Austausch von Dankesbezeugungen recht zügig die Rede auf den 21. Oktober 1997 gebracht, den Abend, an dem Alise Vitola zuletzt lebend gesehen worden war. Sie hatte gehört, wie ihr Vater scharf eingeatmet hatte. Nach einer beklemmenden Pause hatte er schließlich erwidert: »Wie kommst du denn jetzt bitte darauf?« Seine Stimme klang vorwurfsvoll. Doch ehe sie antworten konnte, seufzte er und sagte: »Schon gut, schon gut, ich weiß ja …«
Damit spielte er auf das ausgeprägte Erinnerungsvermögen seiner Tochter an, das man inzwischen als HSAM diagnostiziert hatte.
Sie zog die Wohnungstür hinter sich zu, ging am Aufzug vorbei – sie nahm niemals den Aufzug, auch nicht, wenn sie zwei volle Einkaufstüten zu tragen hatte – und lief die Treppe hinunter.
Ihr Vater hatte sich schneller gefasst, als sie erwartet hatte. Sie hatte ihn vor sich gesehen, im Wohnzimmer seiner perfekt renovierten Altbauwohnung, wie er dastand, inmitten von lauter Holzspielzeug, ganz ehemaliger Schulleiter, leicht gebeugt mit seinen eins neunzig und auch ein wenig schief, das Smartphone in der feingliedrigen Lehrerhand. Bestimmt trug er – wie immer, seitdem er mit Jule zusammen war, – braune Cordhosen und eines der vielen Karohemden, mit denen er inzwischen verwachsen schien. Selbst seine ehemals unauffällige Brille hatte er gegen eines dieser Hipster-Brillengestelle aus Horn ausgetauscht. Penelope fragte sich, was als Nächstes käme, ein modischer Salafisten-Bart?
Im Hintergrund war mit einem Mal Babygeschrei zu hören, dann rief ihr Vater und klang dabei überraschend aggressiv: »Verdammt noch mal, Nele! Lass deinen Bruder in Ruhe!«2014, mit siebenundsechzig, war er noch einmal Vater geworden, zur gleichen Zeit, als er in Pension gegangen war. Nicht zum ersten Mal fragte Penelope sich, ob er sich seinen Ruhestand tatsächlich so vorgestellt hatte, mit Tragetüchern und Babykotze. Ihr Vater und ihre Mutter waren fünfzehn Jahre auseinander gewesen, weshalb ihre Großeltern nur wenig älter waren als ihr Vater. Seine Frau Jule war fünfunddreißig Jahre jünger als er, was Penelope nun drei Halbgeschwister beschert hatte: die nölende Nele, den teilnahmslosen Friedolin, der weder Hallo noch Danke sagen konnte; und nun auch noch den ständig kreischenden Balthasar.
»Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich mich jetzt noch daran erinnere, was an einem Tag im Oktober 1997 passiert ist!« Dieser Satz galt offensichtlich wieder Penelope, wobei seine Stimme nun anders klang, wieder ganz nach dem Mathelehrer, der bei einem Fünferkandidaten die Mitternachtsformel einforderte. Doch Penelope ließ sich nicht beirren. Diesmal war sie an der Reihe, etwas von ihm einzufordern.
»Natürlich nicht an das genaue Datum. Aber dass du dich an diesen Streit mit Mama erinnerst, das erwarte ich schon.« Und dann legte sie noch ein wenig nach. »Immerhin ging es um eine tote Schülerin.«
Eine Weile war es still. Dann sagte ihr Vater: »Das Ganze hat deiner Mutter sehr zu schaffen gemacht. Sie war, ich weiß auch nicht, wie von Sinnen. Hat sich in den Kopf gesetzt, dass ich …« Er brach ab.
Aber Penelope hakte nach: »Was hat sie sich in den Kopf gesetzt?«
»Sag mal, wieso gräbst du das denn jetzt wieder aus? Verschwende deine Energie doch nicht auf diese alten Geschichten. Das tut dir nicht gut!«
So war ihr Vater schon immer gewesen, rational, kühl, darauf bedacht, seine Energie nicht auf Dinge zu verschwenden, die zu nichts führten. Wenn er wüsste, dass sie auf ihre Karriere als Berufssoldatin verzichtet und einen Mann geheiratet hatte, den sie kaum kannte, und das aus dem einzigen Grunde, weil sie endlich herausfinden wollte, mit letzter Konsequenz, was damals mit ihrer Mutter geschehen war!
Mit einem Mal hatte sie keine Geduld mehr. In scharfem Ton sagte sie: »Möchtest du, dass ich das Gespräch wiederhole?« Und ehe er noch in der Lage war, etwas zu erwidern, gab Penelope den Streit, den sie damals mitangehört hatte, wieder, Wort für Wort. Die Anklage ihrer Mutter, seine Antworten. Sie soll abgetrieben haben. Das waren die genauen Worte ihrer Mutter gewesen. »Und dann hat Mama dich angeschrien. Was hast du mit den zweitausend Mark gemacht, die du abgehoben hast? Was? Hast du irgendwas damit zu tun? Das hat Mama dich gefragt, und jetzt frage ichdich: Was hat Mama damit gemeint? Dass du was mit diesem Mädchen hattest und ihr Geld für eine Abtreibung gegeben hast?«
Penelope hatte an sich halten müssen, nicht ebenfalls zu schreien wie ihre Mutter damals. Sie spürte, wie ihr Herz galoppierte, wie sie das Smartphone fest umklammert hielt.
Wieder schwieg ihr Vater. Doch diesmal war es ein anderes Schweigen. Und als er endlich antwortete, war seine Stimme feindselig: »Du bist ja vollkommen verrückt. Hörst du dir eigentlich selbst zu?«
Und dann hatte er einfach aufgelegt.
Penelope riss die Haustür auf, viel zu schwungvoll, sodass die schwere Metalltür gegen den Stopper donnerte, und trat auf den Bürgersteig, den Rucksack mit den Gewichten auf dem Rücken.
Es regnete noch immer. Mit einer routinierten Bewegung stopfte sie sich die Haare unter die Mütze, steckte sich die Airpods in die Ohren, wählte ihre Lauf-Playlist und überquerte die Straße. Sie lief an der Bushaltestelle vorbei und an einem parkenden Wagen, dessen Scheibenwischer in langsamem Rhythmus über die Windschutzscheibe glitten. Der Bürgersteig und auch die Straße waren menschenleer, so wie es ihr am besten gefiel. Das war wohl das größte Problem, seitdem sie in Berlin lebte: dass es hier ständig und überall Menschen gab. Sie atmete tief und verfiel bald in einen gleichmäßigen Rhythmus. Wieder kehrten ihre Gedanken zu ihrem Vater zurück. Wahrscheinlich hätte sie etwas geschickter vorgehen sollen; wobei, wenn sie ehrlich zu sich selbst war, Diplomatie nicht gerade ihre hervorstechendste Charaktereigenschaft war. Sollte sie diese Eigenschaft überhaupt je besessen haben, dann hatten vierzehn Jahre Bundeswehr ihr diese Art von Feingefühl offenbar endgültig ausgetrieben.
Als Penelope eine Dreiviertelstunde später wieder in ihre Straße zurückkehrte, war es dunkel geworden. Die letzten dreihundert Meter legte sie im Sprint zurück. Sie fühlte sich jetzt besser, ruhiger im Kopf. Im Moment gab es für sie nur die kalte Luft, die in ihrer Lunge brannte, und den Regen, der ihr Gesicht kühlte. Ein paar Minuten lief sie noch locker den Bürgersteig auf und ab, vorbei an der Bushaltestelle, wo ein paar Jugendliche im Bushäuschen saßen und rauchten. Penelope kehrte um, zog sich die Mütze vom Kopf und sah einen Augenblick hinauf in den Regen, der im orangenen Licht der Straßenlaternen schräg vom Himmel fiel. Immer noch in leichtem Trab wechselte sie die Straßenseite und steuerte auf ihre Haustür zu. Im Augenwinkel sah sie einen Mann aus einem der geparkten Wagen steigen. Sie beachtete ihn nicht weiter, tastete in der Jackentasche nach dem Schlüssel. In dem Moment hörte sie durch die Musik aus den Airpods, wie jemand ihren Namen rief. Sie blickte auf, begriff, dass es der Mann sein musste, der eben aus dem Auto gestiegen war. Den Hausschlüssel wie eine Waffe in der Hand, ging sie sofort in eine Abwehrhaltung, spürte, wie jeder Muskel ihres Körpers sich anspannte. Erst als er in den Lichtkegel der Straßenlaterne trat, erkannte sie ihn.
3.
Die König hat versucht, sich umzubringen. Dieser Satz auf Dauerschleife in seinem Kopf. Er legte sich noch ein wenig mehr in die Riemen. Tsch-klack. Tsch-klack. Die Rudermaschine machte einen Heidenlärm und kam doch gegen die Lautstärke seiner Gedanken nicht an. Er stieg ab, holte die Airpods, die immer noch in seiner Messenger Bag waren, und stöpselte sie sich in die Ohren. Wieder auf der Rudermaschine, donnerte nun Iron Maiden durch seine Gehörgänge und verdrängte den Gedanken an die junge Frau. Das war auch so etwas, was er von Mathilda übernommen hatte: diese schreckliche Musik, die man hören konnte, um alles andere zum Schweigen zu bringen.
Eigentlich wäre er lieber laufen gegangen, aber er hatte keine Lust gehabt, vor dem durchtrainierten Brammer, diesem Sporttier, durch den Park zu keuchen. Mit Brammer im Nacken fühlte er sich immer wie der kleine Falk aus dem Sommercamp, der zur Strafe Liegestütze machen musste, während alle anderen um ihn herumstanden und lachten, allen voran Tristan. Er steigerte das Tempo, bis ihm der Schweiß ausbrach. Und landete doch nur wieder bei Sieglinde König. Die versucht hatte, sich vor die U-Bahn zu werfen.
Das erste Mal war er ihr im Sommer begegnet, als sie im Foyer des ROD-Tower auf ihn gewartet hatte. Ob sie ihn kurz sprechen könne. Es ginge um die ROD-Familienstiftung. Wenn er an diese Begegnung dachte, wie sie da vor ihm gestanden hatte, mit dem zu einem strengen Knoten zusammengefassten blonden Haar und ihrer weißen, bis zum obersten Knopf geschlossenen Bluse, hatte sie äußerste Effizienz und Beherrschtheit ausgestrahlt. Eigentlich hatte sie ausgesehen wie der wahr gewordene Traum seiner Mutter, die ein Faible für anständig aussehende junge Leute hatte. Soweit er wusste, war Sieglinde König früher selbst Stipendiatin der Familienstiftung gewesen. Das hatte sein Vater ihm einmal erzählt. Er erinnerte sich auch, dass er die junge Frau eine Überfliegerin genannt hatte, einen seltenen Glücksfall und eine Person, die unbedingt »in unserem Sinne« gefördert werden müsse. Nach Abschluss ihres Studiums hatte sie dann zuerst als Pressereferentin für die Stiftung gearbeitet, und später hatten seine Eltern sie in den Vorstand geholt. Und doch hatte Falk sich an jenem Juli-Tag von ihr überrumpelt und belästigt gefühlt, wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil gerade seine Verlobung in die Binsen gegangen war und er einfach nur seine Ruhe gewollt hatte. Er hatte die König daraufhin mit ein paar dürren Worten abgewimmelt: dass sie sich an seinen Bruder wenden solle, da er, Falk, ja gar keinen Posten in der Stiftung innehabe. Ein paar Tage später hatte sie ihm eine Mail geschrieben. Dass sie ihn trotzdem dringend sprechen, ihm etwas Wichtiges über die Stiftung sagen müsse. Er sei der falsche Ansprechpartner, hatte er schriftlich wiederholt, ihr aber immerhin angeboten, ihr Anliegen kurz zu schildern, er werde es an die entsprechende Stelle weiterleiten. Was sie jedoch nicht getan hatte und ihm stattdessen noch einmal schrieb, eine Mail, die – das konnte er nicht anders sagen – befremdlich klang. Daraufhin hatte er sich dann doch mit ihr getroffen.
Das Treffen war eigenartig verlaufen. Schon zu Beginn hatte sie fahrig gewirkt und ihm dann, als sie sich in einer Nische bei McDonald’s gegenübersaßen, eine wahrhaft abenteuerliche Geschichte erzählt, die im Verlauf der Viertelstunde, die sie dort verbrachten, immer abenteuerlicher wurde. Gleich zu Beginn hatte sie ihm eine Excel-Tabelle mit den Geldflüssen der Stiftung gezeigt und ihm in einem sich steigernden Sprechtempo von ihrem Verdacht erzählt, dass diese oder jene größere Summe für kriminelle Zwecke missbraucht würde. Als er sagte, auf die Schnelle könne er dazu nichts sagen, und Sieglinde König bat, ihm die Tabelle doch zuzuschicken, damit er sie sich in Ruhe ansehen könne, weigerte sie sich. Im Laufe des Gesprächs wurde sie immer nervöser, sah sich häufig um und fragte ihn schließlich mit gesenkter Stimme, ob er nicht auch den Eindruck habe, dass der Typ dort sie beobachten würde. »Der Typ dort« war ein junger Mann mit Zopf, der, ein Schlachtfeld von leeren Burger-Schachteln vor sich auf dem Tablett, auf seinem Smartphone herumwischte und erst aufblickte, als sie beide ihn anstarrten. Schließlich hatte Falk sich mit den Worten von ihr verabschiedet, dass er »der Sache nachgehen« werde. Kurz hatte er tatsächlich überlegt, einen Blick in die Stiftungsfinanzen zu werfen. Aber dafür hätte er sich die Zugangsdaten verschaffen und erklären müssen, warum er sie benötigte. Und so war die Angelegenheit in die Mühlen seines Alltags geraten. Bis ihm der Portier im Stadtpalais vorgestern einen Brief übergeben hatte. Er fühlte sich elend und schuldig.
Er ließ den Griff der Rudermaschine los. Schweißnass stieg er unter die Dusche, wo er lange blieb und das Wasser auf Kopf und Schultern prasseln ließ, bis seine Gedanken irgendwann stoppten. Mit nassen Haaren setzte er sich anschließend auf den breiten Fenstersitz und begann, die Salat Bowl zu essen, die er sich vom Lieferservice um die Ecke hatte bringen lassen. Auch heute übernachtete er wieder in der Stadtwohnung, die er seit Mathildas Verschwinden verstärkt nutzte. In erster Linie deshalb, weil es von hier aus nur die halbe Strecke bis nach Lichtenberg war. Und er – ohne Brammers Wissen – jeden Abend vor dem Zubettgehen noch einmal zu Mathildas Wohnung fuhr, um vor ihrem Haus im dunklen Wagen zu sitzen und den Blick zwischen ihren Fenstern und der Haustür hin und her wandern zu lassen. Wie gut, dass niemand wusste, was für ein liebeskranker Trottel er in Wirklichkeit war. Während er kaute, blickte er auf die regennasse Straße hinunter, auf die Leute, die im Schein der Schaufensterbeleuchtung wie vom Sog der Tide in die Läden hineingezogen und mit Einkaufstüten beladen wieder ausgespuckt wurden. Dieses Treiben beruhigte ihn, es war ein bisschen so, als bewegten die Leute sich stellvertretend für ihn. Solange sie sich dort unten bewegten, konnte er innehalten. Vielleicht erinnerte ihn der Anblick auch an seine Kindheit, an die Zeit vor dem ersten Internat, als Agnes mit ihm jeden Nachmittag vor dem Fünfuhrtee in einem dieser Wimmelbücher geblättert hatte, im Grunde die einzige Zeit des Tages, in der er stillgesessen hatte. Agnes hatte ihn immer liebevoll BusyBee genannt.
Er stand auf, ging in die Küche und spülte die Essensreste aus der Schüssel. Er öffnete die Klappe der Spülmaschine. Und musste schon wieder an Sieglinde König denken. Als ihm der Portier vorgestern den Brief überreicht hatte, hatte er im ersten Moment geglaubt, er sei von Mathilda. Als er ihn entgegennahm, schwankten seine Erwartungen zwischen überbordender Erleichterung (es ging ihr gut!) und einem winzigen Anteil an Furcht (sie wollte die Scheidung!). Erst als die Fahrstuhltüren hinter ihm zuglitten, war ihm der unregelmäßige, krakelige Schriftzug auf dem Umschlag aufgefallen, und er hatte begriffen, dass das nicht Mathilda geschrieben haben konnte. Oder doch? Noch im Lift stehend, hatte er den Umschlag aufgerissen, auf einmal hatten seine Finger gezuckt. Doch als er kurz darauf eine ausgedruckte Excel-Tabelle herauszog, in die jemand mit rotem Fineliner hineingekritzelt hatte, war ihm klar geworden, von wem der Brief stammte. »Sprechen Sie mit niemandem über diesen Brief« stand zuoberst in roter, ungelenker Blockschrift. Und darunter: »Ich habe jetzt die Beweise. Es geht um Leben und Tod.« Dann teilte sie ihm ihre Alt-Moabiter Adresse mit und bat ihn, sie unverzüglich aufzusuchen. (Das Wort unverzüglich hatte sie dreimal unterstrichen.) Sie sei derzeit krankgeschrieben und immer zu Hause. Ganz zuunterst noch einmal die Warnung: »Trauen Sie niemandem. Und damit meine ich NIEMANDEM.« Entnervt hatte er den kompletten Brief ins Altpapier geworfen.
Etwas zu schwungvoll schloss er die Klappe der Spülmaschine. Warum geriet eigentlich um ihn herum plötzlich alles außer Kontrolle? Diese arme Frau, die sich vor einen Zug hatte werfen wollen. Anonyme Botschaften auf seinem Smartphone. Das Bild aus seinen Albträumen, das ihm jemand geschickt hatte. Die Messerattacke im Park im Oktober. Und als wäre das alles noch nicht genug, blieb Mathilda einfach verschwunden, der erste und einzige Mensch seit langer Zeit, bei dem er das Gefühl hatte, angekommen zu sein. Man sollte meinen, dass er langsam genug Gründe hätte, um durchzudrehen. Aber das war eben nicht seine Art. Er machte einfach weiter, schleppte sich fort von Tag zu Tag, von Mond zu Mond, wie der alte Storm es so treffend formuliert hatte, der Lieblingsdichter seiner Dreilinden-Oma. Aber die hatte, wie der Dichter auch, depressiv-suizidale Tendenzen gehabt. Und so schloss sich der negative Gedankenkreis, und er war wieder bei Sieglinde König angelangt. Er unterdrückte ein Seufzen. Daran wollte er jetzt nicht wieder denken. Solange es die Hoffnung gab, dass Mathilda wiederkommen würde, blieb ihm die Hoffnung, dass auch für ihn irgendwann alles gut werden würde. Irgendwie.
Er sah auf die Uhr. Gleich acht. Gewöhnlich machte er seine abendliche Fahrt nach Lichtenberg immer erst gegen zehn oder elf, als allerletzte Amtshandlung gewissermaßen. Aber heute würde er sich ohnehin nicht mehr konzentrieren können. Also konnte er seine Gute-Nacht-Fahrt auch gleich machen. Er griff nach seiner Jacke, nahm den Autoschlüssel und verließ die Wohnung.
4.
Falk. Penelope nahm die Airpods aus den Ohren. Da stand er, ihr Mann, und sie fühlte sich überrumpelt. Ihre Blicke trafen sich, doch sie konnte nicht sagen, in welcher Stimmung sie ihn hier vorfand. Denn wie immer trug er diesen leicht ironischen Ausdruck um den Mund, den, den er der Welt präsentierte, egal, ob er glücklich, wütend oder traurig war. Die Situation hatte etwas Surreales: Da standen sie sich gegenüber, ein Mann und seine Frau, nachdem sie zwei Wochen zuvor und ohne ein Wort gegangen war. Für einen Moment schien er unsicher, und sie sahen sich nur schweigend an. Im Hintergrund schepperte es, die Jugendlichen grölten, bewarfen sich mit leeren Getränkedosen.
»Warum hast du mir nicht geantwortet?«, brach Falk das Schweigen.
Penelope spürte, wie ganz kurz die Wut in ihr aufflackerte, wie eine Glut, die von einem Blasebalg angefacht wurde. Hatte seine intrigante und versnobte Mutter ihm denn nicht erzählt, dass sie Bescheid wusste? Dass sie herausgefunden hatte, was er für ein Spielchen mit ihr getrieben und sie nur deshalb geheiratet hatte, um an das Riesenvermögen seines Großvaters zu kommen? Doch schon im nächsten Moment erstarb die Flamme wieder. Wer war sie, dass sie sich zum Moralapostel aufschwang! Außerdem sollte sie ihre Kraft besser darauf verwenden, taktisch vorzugehen, zielführend. Doch dann blitzte ein Gedanke in ihr auf: Genauso würde eine verliebte Frau, deren Gefühle verletzt worden waren, sich verhalten. Also sagte sie:
»Das weißt du wirklich nicht?«
Er tat einen Schritt auf sie zu. Sie wich seinem Blick nicht aus, blieb stehen, wo sie war.
»Du hast da etwas vollkommen missverstanden. Unsere Beziehung hat nichts, aber auch gar nichts mit diesem Erbvertrag zu tun.« Er sprach ruhig und eindringlich, nahm sie bei den Schultern, und sie ließ es zu.
»Bitte«, sagte er. »Das kannst du doch nicht wirklich glauben. Nach allem, was zwischen uns war. Bitte, Mathilda, ich …«
Als er sie mit ihrem falschen Namen ansprach, noch dazu in diesem fast flehentlichen Ton, zuckte sie zurück. Lügnerin, zischte eine Stimme in ihr, und sie blinzelte, gegen die Regentropfen und gegen dieses plötzliche Beben in ihrer Brust, gegen die Bilder, die wild durcheinander und in schnellem Wechsel auf sie einprasselten. Der unvergessliche Tag im herbstgoldenen Spreewald. Sein Antrag. Dabei seine Gesichtszüge so voller Hoffnung und Vertrauen. Oder der Moment im Park. Wie er auf dem Boden lag, schutzlos, überrumpelt, nachdem ein Unbekannter ihn mit einem Messer attackiert hatte. »Du hast mir das Leben gerettet«, das hatte er wenig später zu ihr gesagt, im Licht der Straßenlaterne vor der Prokhoff’schen Villa, mit einem Blick genau wie jetzt gerade. Sie sei nun für immer für ihn verantwortlich. Das hatte er ihr damals ins Ohr geflüstert. Für alle Zeit.
Die Jugendlichen an der Bushaltestelle grölten noch immer. Penelope warf einen kurzen Blick in ihre Richtung. Dann hörte sie Falk sagen: »Können wir oben weiterreden?«
Sie zögerte, wollte um etwas Zeit bitten, dann spürte sie, wie sie längst nickte: »Komm.«
Erst als sie schon auf der Treppe waren, fiel ihr die Mindmap ein, die sie – gut sichtbar – auf dem Tisch ausgebreitet hatte, mit sämtlichen Namen – auch seinem – und Leuchtstiftmarkierungen in allen Farben. Vor ihrer Wohnungstür stieg sie, ohne die Schnürsenkel zu öffnen, aus ihren Laufschuhen, ließ die nassen Schuhe vor der Tür stehen und schloss rasch die Wohnungstür auf. Während Falk noch damit zu tun hatte, die Schnürsenkel seiner braunen Lederschuhe aufzuziehen, lief sie zum Tisch, noch immer den Rucksack auf dem Rücken, nahm das alte Filmplakat, rollte es zusammen, die Vorderseite nach außen, und wollte es gerade auf dem Schrank verschwinden lassen. Doch Falk hatte die Wohnung schon betreten und fragte: »Was hast du denn da? Ein neues Poster, das du aufhängen willst?«
Penelope hielt in ihrer Bewegung inne. »Ach, ein uraltes Ding.«
»Zeig doch mal.«
Im Bruchteil einer Sekunde überschlugen sich ihre Gedanken. Was sollte sie jetzt machen? Seine Aufforderung ignorieren und das Filmposter einfach weglegen? Doch was, wenn er es sich dann selbst nehmen und ansehen würde? Rasch rollte sie es wieder auf und hielt es ihm hin in der Hoffnung, dass die Kritzeleien auf der Rückseite nicht durchdrückten.
»Der Berg ruft?«, fragte er in leicht amüsiertem Ton. »Woher kennt ein anständiges Mädchen aus Namibia denn so einen alten Schinken?«
Penelope überlegte fieberhaft. Was sollte, was konnte sie antworten, was passte zu ihrer vorgeblichen Vita als Deutschnamibierin? Mathilda, deren Identität Penelope kurzerhand übernommen hatte, hatte in Deutschland studiert und dort nach dem Studium ein paar Jahre gearbeitet, in einer Klinik in Garmisch, weshalb diese kleine Koloration ihrer Biografie durchaus möglich gewesen wäre. Während Falk sie weiter anblickte, erwartungsvoll und – wie sie fand – ziemlich neugierig, rollte sie das Plakat wieder zusammen und sagte das Erstbeste, was ihr in den Sinn kam.
»Ach, das Ding war ein Geschenk. Von einem früheren Freund.«
Sie schob die Rolle auf den Schrank.
»Von einem früheren Freund? Wie heißt er?«
Penelope wandte den Blick ab, nahm den Rucksack vom Rücken und ging hinüber zur Küchenzeile, wo sie sich die Hände wusch. Dann griff sie nach dem Wasserkocher. Um Zeit zu gewinnen, fragte sie: »Du auch einen Tee?«
Er nickte, betrachtete sie aber weiter aufmerksam und wartete auf eine Antwort. Und ehe sie sich’s versah, hörte sie sich selbst sagen: »Noah.«
»Woher kennst du ihn?«
Der Wasserkocher begann zu knacken. Penelope legte ihre völlig durchnässte Mütze zum Trocknen auf den Heizkörper. Dann nahm sie zwei Mugs, zog die Schublade mit den Teepackungen heraus. Sie musste sich jetzt konzentrieren, am besten, sie bliebe so nah wie möglich bei der Wahrheit.
»Aus meiner Zeit in Garmisch.«
»Aha.« Das klang nicht so, als wollte er sich mit dieser Info begnügen. Und prompt schob er die Frage nach: »Und wieso schenkt er dir dieses Poster? Habt ihr damit eine – Geschichte?«
Seine Stimme klang noch immer lässig. Oder war da ein gewisser Unterton herauszuhören? Penelope spürte seinen Blick im Rücken, bemühte sich darum, die Packung mit dem Ingwer-Zitronen-Tee ganz ruhig zu öffnen und zwei Teebeutel in die Becher zu hängen.
»Wir waren eine Weile zusammen«, sagte sie möglichst beiläufig. Und als er sie nach wie vor erwartungsvoll ansah, fügte sie die dicke Lüge hinzu: »Er hat versucht, mir das Skifahren beizubringen.«
»Ach. Ist er Skilehrer?«
»Unter anderem«, antwortete Penelope und hielt die Luft an. Wie lange würde diese Vernehmung noch gehen?
»Du hast mir nie von ihm erzählt.« Einen kurzen Moment fragte sie sich, ob er vielleicht eifersüchtig war, und ertappte sich dabei, dass ihr der Gedanke gefiel. Und so schwieg sie noch ein bisschen länger, wartete, bis das Wasser zu kochen begann. Dann fiel ihr der eigentliche Grund dieser Unterhaltung wieder ein. Wie in Zeitlupe goss sie den Tee auf, tauchte die Teebeutel immer wieder unter und tat das mit aufreizend langsamen Bewegungen, bevor sie sich schließlich umdrehte, um dann so ruhig wie möglich zu sagen: »So wie du mir nie erzählt hast, dass du kurz vor der Heirat mit Josephine standst?«
Sein Gesicht blieb bei ihren Worten völlig reglos. So als hätte sie gar nichts gesagt. Und wieder einmal wurde ihr klar, dass sie diesen Mann, zu dem sie am 16. Oktober auf dem Standesamt Ja gesagt hatte, überhaupt nicht kannte.
5.
Bei der Nennung von Josephines Namen fuhr ihm der Schrecken wie ein Schuss in den Körper. Wie kam Mathilda denn jetzt auf sie? Hatte eines der Kids aus dem Café heute heimlich ein Foto von Jo und ihm gemacht und es gepostet? Auszuschließen war das nicht. Oder drehte er aufgrund der ganzen Ereignisse langsam durch? So ruhig, wie es ihm möglich war, erwiderte er: »Da gibt es auch nichts groß zu erzählen. Das ist Vergangenheit … völlig irrelevant für die Gegenwart … für uns.«
Täuschte er sich, oder hatte er sie gerade zusammenzucken sehen? Und klang ihre Stimme nicht ein wenig scharf, als sie jetzt sagte: »Ziemlich vieles bei uns ist Vergangenheit. Ich würde sogar sagen, wir bestehen fast hauptsächlich aus Vergangenheit.« Ihr Blick schien in ihn einzudringen, in seinen Kopf, und er war sicher, dass sie seine Gedanken las.
Und da geschah etwas in ihm. Die ganze Anspannung der letzten Wochen, des heutigen Tages, die Sorge um sie, um ihre noch junge Beziehung, die anonyme Botschaft, die erdrückenden Schuldgefühle wegen Sieglinde König. Und die breiige, klumpige Angst, die mit dem Bild aus seinen Albträumen zu tun hatte, das nun sogar auf seinem Smartphone lauerte: Alles sackte in ihm ab, sackte auf den Grund seines Körpers, und zurück blieben eine große Erschöpfung und der schlichte Wunsch, ihr endlich alles zu erzählen. Doch wie sollte das gehen? Lag nicht das Schlimmste so tief in ihm verschüttet, dass er selbst keinen Zugriff mehr darauf hatte? Aber könnte er nicht wenigstens mit einer Teilwahrheit beginnen? Und so tat er einen Schritt auf sie zu, sah sie eindringlich an und sagte: »Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll.«
Auf ihrem Gesicht flackerte ein Ausdruck der Überraschung auf, ganz leise nur, aber für ihn, der sie nun schon eine Weile kannte, doch deutlich erkennbar.
»Einfach am Anfang?«
Als er nickte, nahm sie die Teebeutel aus den Tassen und trug sie hinüber zu den beiden Sitzsäcken unter dem Dachfenster, auf das der Regen trommelte. Mit einem Schulterzucken und einem Lächeln, das sie verschmitzt und bedauernd gleichzeitig aussehen ließ, sagte sie: »Wie du weißt, besitze ich nur einen Stuhl. Also müssen wir es uns hier bequem machen.« Sie reichte ihm seine Tasse und stellte ihre auf einem flachen Beistelltisch ab. »Lass mich vorher noch die Laufklamotten loswerden und kurz duschen.«
Mit der Tasse in der Hand ließ Falk sich vorsichtig nieder. Eine Weile ließ er sich einlullen vom Prasseln des Regens und dachte darüber nach, was er ihr zumuten konnte. Und wollte. Dabei wünschte er sich nichts sehnlicher, als einmal alles rauszulassen, den ganzen Schrott, den er über die Jahre angesammelt hatte. Und wusste doch, dass das unmöglich war. Denn wenn sie davon erführe, wäre es wohl das Ende.
Nach einigen Minuten kehrte sie zurück, setzte sich ihm gegenüber und fragte ganz direkt: »Hast du mich eigentlich nur geheiratet, um an den Zaster zu kommen?«
Fast widerwillig musste er schmunzeln. Diese Frage zu beantworten war inzwischen seine leichteste Übung.
»Ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebe. Nur dass es so schnell ging, das war nicht geplant.« Er stellte die Tasse neben sich auf den Boden ab. »Das ist die ganze Wahrheit. Aber lass mich der Reihe nach erzählen.« Er richtete sich auf und schloss für einen Moment die Augen.
»Kurz bevor wir uns kennenlernten, hatte ich mich gerade von Josephine getrennt, mal wieder … oder besser gesagt, sie hat sich von mir