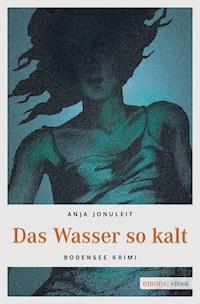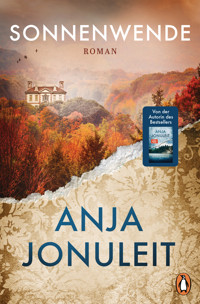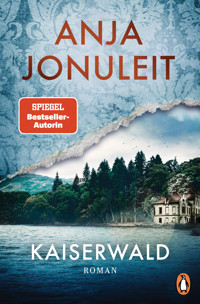9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die dunklen Seiten einer nur scheinbar perfekten Familie Ihr Unbehagen hatte einzig und allein mit dem Anruf zu tun, den sie gestern Abend erhalten hatte. Und mit den Geistern, die dadurch ins Haus gewitscht waren. Warum hatte sie überhaupt den Hörer abgenommen? Liane van der Berg kann auf ein erfolgreiches Leben blicken: Sie gilt als eine der führenden Erziehungsexpertinnen des Landes, ist seit Jahrzehnten glücklich verheiratet und hat wunderbare Kinder. Doch ist Lianes Leben wirklich so perfekt? Ein verstörender Anruf und ein Brief voll gut verborgen geglaubter Geheimnisse bringt alles in Wanken. Und auf einmal ist er wieder da, jener Ostermontag 1968, an dem alles begann … Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? »Der Apfelsammler« »Novemberasche« »Rabenfrauen« »Herbstvergessene« »Die fremde Tochter« »Das letzte Bild«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anja Jonuleit
Das Nachtfräuleinspiel
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Tochter Laura,
die sich intensiv in diese Geschichte eingefunden hat
und der ich viele wertvolle Hinweise und Anregungen verdanke
Teil I
Eine Mutter hat viele Kinder, die schlafen.
Liane van der Berg, Donnerstag, 6. April 2017
Liane van der Berg verbrachte die halbe Nacht lesend. Das war nichts, was sie sich selbst ausgesucht hatte, sondern ein Phänomen, mit dem man es in ihrem Alter eben zu tun bekam. Mit bald 69 war der Schlaf wie ein verzärteltes Gör, das sich schon beim ersten scharfen Ton in sein Schneckenhaus zurückzog und dort für den Rest der Nacht blieb. Verfluchter Lauf des Lebens. Sie hatte sich vor dem Schnarchkonzert ihres Mannes in Gesines altes Zimmer zurückgezogen, das nun als Gästezimmer diente, aber auch das hatte nichts genützt. Zwar war es hier im Zimmer still, aber dafür hörte sie das Geräusch des Windes nun umso lauter. Er ließ das Gerüst rings ums Haus ächzen und knacken, was für Liane fast so klang, als schliche draußen jemand herum und lauere nur darauf, dass sie das Licht löschte, um ins Haus einzudringen. Es war ihr durchaus bewusst, wie unsinnig diese Vorstellung war. Ihr Unbehagen hatte einzig und allein mit dem Anruf zu tun, den sie gestern Abend erhalten hatte. Und mit den Geistern, die dadurch ins Haus gewitscht waren. Warum hatte sie überhaupt den Hörer abgenommen? Sie wusste doch, dass Telefonate so spät am Abend sie nur aufwühlten! Und auch wenn dieses hier nur ein paar Minuten gedauert hatte, so hatte es doch ein schwindelerregendes Gedankenkarussell in Gang gesetzt, das Liane die ganze Nacht über nicht stoppen konnte.
Er habe da einen eigenartigen Brief bekommen, hatte ihr Sohn Matthias in irgendwie misstrauischem Ton gesagt. »Ein ziemlich kryptisches Geschreibsel, in dem du als seit 1968 tätige Familienzerstörerin bezeichnet wirst. Ach, was weiß ich, ich werf den Brief bei dir ein, dann kannst du ihn dir selbst ansehen.«
Nachdem Matthias aufgelegt hatte, war Liane mit dem Telefon in der Hand sitzen geblieben. Erst als ihre Füße eiskalt geworden waren, hatte sie sich daran erinnert, dass sie, als der Anruf kam, eigentlich auf dem Weg in die Badewanne gewesen war. Seit 1968? Was für eine seltsame Anspielung. So viel Zeit war inzwischen vergangen, so viele Jahre, in denen sie nie mehr an damals gedacht hatte. Doch jetzt hatte ihr ein einziges Telefonat klargemacht, dass nichts vergangen war, dass alles noch irgendwo existierte. Konserviert wie die Büchsenpfirsiche, dieses tote Zeug, das Carl sich während des Studiums immer einverleibt hatte. Aber vielleicht hatte dieser ominöse Brief ja auch gar nichts damit zu tun. Sie durfte nicht immer gleich das Schlimmste annehmen. Vielleicht stammte dieser Unfug nur von einem harmlosen Spinner, der den Artikel im Stern gelesen hatte. Darin war nämlich auch von ihrer Zeit in der Kommune die Rede gewesen. Solche Anwürfe von Unbekannten hatte sie schon öfter erlebt. Immerhin war sie eine Person des öffentlichen Lebens. Wer kannte sie nicht, die Familienretterin, die Super-Granny mit dem großen Herzen, die seit zehn Jahren die Erziehungsprobleme anderer Leute löste. Selbst diejenigen, die ihre Sendung nicht anschauten, wussten zumindest, wer sie war.
Nach dem Telefonat war sie aufgestanden und ins Bad gegangen, um die Temperatur des Badewassers zu prüfen, aber das Wasser war immer noch zu heiß gewesen. Seitdem Matthias ihnen diesen Kollektor aufs Dach hatte montieren lassen, kam das Wasser siedend heiß aus der Leitung, zumindest an sonnigen Tagen. Sie hatte etwas kaltes Wasser dazulaufen lassen und war in die Wanne gestiegen, doch die Gedanken an den Brief hatte sie nicht abschütteln können.
Jetzt, als sie sich Stunden später im Bett herumwarf, ärgerte sie sich noch immer darüber, nicht genauer nachgefragt zu haben. Sie hätte Matthias bitten sollen, ihr den Brief vorzulesen. So musste sie bis morgen warten, bis er ihr das Ding in den Briefkasten warf. Was auch mal wieder typisch war. Warum kam er nicht kurz herein, auf eine Tasse Tee oder meinetwegen auch Kaffee? Was hatte sie bitteschön an sich, dass er sie so mied? Andererseits war es ihr in diesem Fall ganz recht, dass er den Brief nur in den Kasten werfen wollte. So konnte sie vermeiden, dass Carl Wind von der Sache bekam. Zuerst einmal musste sie genau wissen, worum es überhaupt ging.
Sie richtete sich auf, knipste die Nachttischlampe an und sah auf die Uhr. Erst drei, dachte sie und arrangierte ihre Kissen um – eins links, eins rechts, eins, auf dem der Kopf zu liegen kam – und löschte wieder das Licht. Mit offenen Augen lag sie da und lauschte dem Rauschen des Windes. Was, wenn dieser Brief nicht nur das Gestammel eines Irren war? Wenn das, was da geschrieben stand, Hand und Fuß hatte? Seit der Titelgeschichte im Stern hatte sie so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie schon lange nicht mehr. Nicht nur auf sich, sondern auf die ganze Familie. Und damit natürlich auch auf Carl, der ebenfalls auf dem Titelbild zu sehen gewesen war. Sie schloss die Augen und atmete ein und wieder aus, tief in den Bauch. Im Geiste versuchte sie zu rekapitulieren, was genau sie in dem Interview gesagt hatte. Über ihre Ehe als Partnerschaft auf Augenhöhe hatte sie gesprochen und über die drei berühmten Ks – darüber, wie sie es geschafft hatte, Kinder, Küche und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Aber nichts in dem Artikel hätte jemanden dazu veranlassen können, in ihrer Vergangenheit herumzuwühlen. Nein, das Interview war fantastisch, ganz und gar gelungen. Es zeichnete ein sehr persönliches Bild von ihr, ohne allzu privat zu werden. Sie hatte die Interviewerin genau in die von ihr gewünschte Richtung lenken können und es sogar geschafft, bestimmte Ereignisse elegant zu umschiffen. So war am Ende ein stimmiger Gesamteindruck entstanden, der perfekt zur öffentlichen Komposition ihres Lebens passte.
Liane seufzte. Und musste auf einmal an den Tag denken, als alles angefangen hatte, an jenen Ostermontag 1968. Wobei es für sie ja schon früher begonnen hatte, schon im Winter davor. In dem Moment, als sie ihn das erste Mal sah.
Liane, Januar 1968
Kennengelernt hatte sie Carl Ende der Sechzigerjahre in München, nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Sie war damals noch ganz neu in der Stadt gewesen, ein Landei. Erst im Sommer war sie endgültig aus Lühe fortgezogen, einem Kaff im Alten Land, und damit dem Dunstkreis ihrer Familie entkommen. An jenem Wintertag machte sie, wie oft in der Mittagspause, einen Spaziergang im Englischen Garten, zusammen mit Mathilde, ihrer einfältigen Kollegin aus dem Kindergarten, mit der sie außer dem Bedürfnis nach frischer Luft und Bewegung kaum etwas gemeinsam hatte.
Der Wind wehte so eisig über die Wiesen, dass auch ihre Kapuzen gegen die Kälte wenig ausrichten konnten, daher beschlossen sie, schon früher als sonst umzukehren und zum Kindergarten zurückzugehen. Sie kamen gerade am Chinesischen Turm vorbei, als Liane ein Pärchen auffiel, offenbar Studenten. Der junge Mann war blond und kräftig und ging, eine Zigarette in der linken Hand, neben einer blonden jungen Frau her, die ein Buch in der Hand hielt und ihn abfragte. Er trug einen braunen Dufflecoat und sie einen wadenlangen Lammfellmantel, und auch wenn die beiden nicht besonders auffällig waren, konnte Liane auf einmal die Augen nicht mehr abwenden. Nicht von ihm jedenfalls, wie er so vor sich hin qualmte und mit gerunzelter Stirn die Lippen bewegte. Und vielleicht war das schon der Moment, in dem Liane beschloss, dass sie diesen Mann haben musste. Ihr jedenfalls kam es später so vor, auch wenn sie das ihm gegenüber niemals zugegeben hätte. Jedenfalls lag da eine Lässigkeit in seiner Haltung, die Lianes Blick festhielt, ein Ausdruck von Entspanntheit und großer Sicherheit, aber dazu kam auch noch etwas anderes, das Liane nicht hätte benennen können. Jedenfalls verspürte sie den albernen Wunsch, dem Mädchen das Buch aus der Hand zu reißen und selbst den Platz an seiner Seite einzunehmen. Und während die stämmige Mathilde neben ihr weiter vor sich hin plapperte, verrenkte sich Liane den Hals und konnte die Augen nicht von ihm lassen.
Von da an ging sie in jeder Mittagspause in den Park, mit oder ohne Mathilde, und drehte ihre Runden so, dass sie etliche Male am Chinesischen Turm vorbeikam. Und tatsächlich sah sie ihn dann und wann wieder, manchmal alleine, manchmal in Begleitung seiner Freundin, und nachdem sie ihn ein paarmal beobachtet hatte, wusste sie auch, woran er sie erinnerte, mit seinem windzerzausten, etwas zu langen Haar: an einen Seemann.
Wenn das Mädchen dabei war, nahm Liane auch sie genauestens unter die Lupe, blieb ein Stück weit entfernt stehen, lehnte sich an einen Baum und betrachtete sie mit tiefer Abneigung. Sie begutachtete ihre Figur, wie sie sich bewegte und wie sie sprach, und träumte sich an ihre Stelle. Manchmal, besonders wenn noch andere junge Leute dabei waren, ging sie so dicht an ihnen vorbei, dass sie Gesprächsfetzen aufschnappte, fremde Worte wie Propädeutikum und Famulatur. Zu Hause schlug sie diese Begriffe in Frau Niethammers vierundzwanzigbändigem Brockhaus nach und fand auf die Art heraus, dass er Medizin studierte.
Als er von einem Tag auf den anderen nicht mehr im Park auftauchte, verfiel sie in einen tiefen Groll. Sie verfluchte ihre Feigheit und ihre Unfähigkeit, etwas zu unternehmen, als noch Zeit dazu gewesen war. Wieso hatte sie nicht die Initiative ergriffen und ihn oder jemand anderen aus seiner Clique angesprochen! Warum hatte sie nicht dafür gesorgt, dass er auf sie aufmerksam wurde! Der Gedanke an das blonde Mädchen störte sie dabei nur am Rande. Fast am meisten ärgerte sie, dass sie sich genau so verhalten hatte, wie ihre Eltern es für richtig gehalten hätten. Ein anständiges Mädchen spricht keinen Jungen an. In ihren Träumen hatte sie schon lange eine ganz andere Vorstellung von sich selbst, aber es wollte ihr einfach nicht gelingen, sich auch entsprechend zu verhalten. Weder bei dem Fremden im Park noch bei ihrer Arbeit mit den Kindern.
Als die Entscheidung anstand, was sie nach der Schule tun sollte, war sie ganz und gar nicht sicher gewesen, ob sie zur Erzieherin taugte. Sie war keine große Kinderfreundin, auch wenn sie mit den Blagen meistens ganz gut zurechtkam. Im Grunde hatten ihre Eltern die Berufswahl für sie getroffen.
»Im Büro ist mit Lianchen ja nichts anzufangen!«, hatte ihre Mutter bei Verwandtentreffen gerne behauptet, auch wenn sie selbst Hausfrau war und nie ein Büro von innen gesehen hatte. Und Lianes Vater unterhielt die Kaffeerunde gerne mit dem humorigen Spruch: »Na ja, Hauptsache, wir haben sie von der Straße!«, was bei Onkel Ernst den immergleichen dümmlichen Lachanfall auslöste.
Liane hasste dieses Gerede und träumte davon, dem reaktionären Dunstkreis ihrer Eltern so bald wie möglich zu entkommen. Insofern war ihr die Ausbildungsstelle beim Hamburger Waldorfkindergarten am Ende doch sehr recht gewesen. Ein Gefühl, das sich verfestigt hatte, als ihr klar wurde, was Waldorfpädagogik überhaupt war. Oh, ihre Eltern wären entsetzt gewesen, wenn sie jemals begriffen hätten, was für ein – in ihren Augen – dumm Tüch da mit den Kindern veranstaltet wurde. Tatsächlich ging es dort ganz anders zu als in den Kindergärten auf dem Land, und das gefiel Liane genauso gut wie das Leben in der großen Stadt. So war sie letztlich doch halbwegs gerne zur Arbeit gegangen und hätte wohl auch dort weitergemacht, wenn man sie nach der Ausbildung hätte übernehmen wollen, was aber nicht der Fall gewesen war. Dieser Umstand hatte sie schier in den Wahnsinn getrieben, denn auf die Art war sie nach dem Ende der Ausbildung doch wieder zu Hause in Lühe gelandet. Dass sie schließlich ausgerechnet in München, gut achthundert Kilometer von ihrem Heimatort entfernt, eine Stelle gefunden hatte, passte ihr daher bestens. Nur handelte es sich leider um einen städtischen Kindergarten, der noch dazu außerordentlich strikt geführt wurde. Liane merkte bald, dass das strenge Regiment der Leiterin ihren Widerspruchsgeist weckte, aber sie fand keinen Weg, etwas dagegen zu tun. Frau Wiegand und auch die meisten anderen Erzieherinnen waren dermaßen fortschrittsfeindlich, dass einem Hören und Sehen verging. Mittags mussten die Kinder zwei Stunden ruhen, und wenn sie auch nur einen winzigen Muckser taten, mussten sie pro gesprochenem Wort fünf Minuten nachschlafen. Wenn ein Kind zu laut sprach, wurde es zum Strafsitzen raus auf den Gang geschickt, wo es dann stocksteif dahocken und den Finger vor die Lippen halten musste. Woher das alles kam, war Liane klar: Die Wiegand hatte natürlich die Indoktrination in der Nazizeit schon mit der Muttermilch aufgesogen. Und auch Lianes Kollegin Elfriede, die in ihrer Jugend Jungmädelscharführerin gewesen war, ließ sich nicht davon überzeugen, den Kindern mehr zuzutrauen und sie einfach mal machen zu lassen, ohne gleich einzugreifen. Diese Haltung erstickte jedes bisschen Eigenständigkeit im Keim und zwängte die Kinder schon früh in ein Gedankenkorsett, aus dem sie sich womöglich zeit ihres Lebens nicht mehr befreien würden. Im Hamburger Waldorfkindergarten dagegen schnitzten sich schon die Kleinsten Stöcke und bearbeiteten Bretter mit Sägen!
An manchen Tagen spürte Liane diese engen Grenzen auch um sich selbst, wie eine Schraubzwinge. Sie fragte sich, ob ihr Berufsleben wohl bis zur Rente in solch tief gespurten Bahnen verlaufen würde, und beneidete den blonden Studenten und seine Freunde glühend um die Aura von Freiheit, die sie umgab.
Annamaria, Montag, 3. Februar 1986
Es ist jeden Morgen dasselbe. Wenn um drei Uhr der Wecker klingelt, würde Annamaria alles darum geben, weiterschlafen zu dürfen, besonders jetzt, wo sie schwanger ist. Aber es hilft ja alles nichts. Sie tastet nach dem Zwieback, den sie auf dem Nachttisch deponiert hat. Schnell was futtern, bevor die Morgenübelkeit sich anpirscht.
Sie mümmelt den Zwieback und denkt darüber nach, wann sie es ihm sagen wird. Ein bisschen Bammel hat sie schon. Aber dann erinnert sie sich wieder daran, dass er einmal zu ihr gesagt hat, wie sehr er sich Kinder wünscht und dass Sabine ihm diesen Wunsch nie erfüllen wird. Weil sie total auf sich und ihre Karriere fixiert ist. Das hat er wortwörtlich gesagt, und schon damals hat sie gedacht, dass irgendwann einmal sie diejenige sein wird, die diesen Traum für ihn wahr macht.
Natürlich ist der Zeitpunkt denkbar ungünstig. Noch ist der Markus ja ihr Lehrer, aber Gott sei Dank stehen die ersten Abiturprüfungen schon für Mitte März an, und mit ein bisschen Glück muss sie gar nicht mehr ins Mündliche. Und mit der Fahrschule ist sie auch schon so weit, dass sie sich bald zur Prüfung anmelden kann. Auch wenn sie den Führerschein natürlich erst im Juli bekommt, zu ihrem achtzehnten Geburtstag. Jedenfalls müsste alles gerade so zu schaffen sein bis zum 24. Juni. Das ist der Tag, den der Arzt ihr als Geburtstermin genannt hat. Das Zeugnis würde sie sich dann eben zuschicken lassen. Aber wie auch immer es ausgeht, ob sie nun ins Mündliche muss oder nicht: Sie hat im Leben schon ganz andere Hürden genommen. Als ehemaliges Heimkind haut sie so schnell nichts um.
Sie schlägt die Decke zurück und bleibt einen Moment lang auf der Bettkante sitzen. Die Morgenübelkeit scheint sie jedenfalls mal wieder überlistet zu haben. Und diese mürbe Schwäche, die die Schwangerschaft mit sich bringt, wird auch noch nachlassen. Das hat zumindest der Arzt gesagt.
Als sie später durch die stillen Straßen geht, friert sie und fühlt sich matt, aber wie immer versucht sie, sich in die gemeinsame Zukunft mit dem Markus hineinzuträumen. Wenn sie erst mit ihm zusammenlebt, wird alles gut sein.
Doch heute wollen die Bilder nicht recht kommen, was vielleicht am Wetter liegt, eisiger Wind und Regen, eine Kombination, die nicht zum Träumen einlädt, zumindest nicht, wenn man morgens um vier Zeitungen austrägt.
Allein zum Abholen der Zeitungen braucht sie heute eine gute Viertelstunde. Weil sie nicht mit dem Rad fahren kann, der alte Göppel hat mal wieder einen Platten. So muss sie die ganze Strecke zu Fuß zurücklegen. Seit sie den Bahnhof dichtgemacht haben, muss sie ja bis zum Senn-Bäck, weil die Zeitungen jetzt immer dort angeliefert werden. Ein Gutes hat die Sache aber: So kommt sie jeden Morgen am Haus vom Markus vorbei, und das ist wunderbar. Denn dann fühlt Annamaria sich ihm so nahe. Ein prickelndes Gefühl, unter seinem Schlafzimmerfenster entlangzugehen, sich ihn vorzustellen, wie er dort liegt und schläft. Sein ruhiger Atem, die Wärme seiner nackten Haut. Weniger prickelnd ist die Vorstellung, dass die Sabine neben ihm liegt. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis er es ihr sagt. Dass er ausziehen wird.
Auf dem Rückweg kommt der schönste Teil ihrer Runde, der Abstecher zum Haus der Glücklichen Familie. Meist bleibt sie, nachdem sie sich den Berg hochgekämpft und die beiden Zeitungen in die Röhre gesteckt hat, noch einen Augenblick lang stehen. Der Hellsternhof, so heißt das alte Fachwerkhaus, nach dem Märchen vom Hellsternmännle, liegt ein ganzes Stück oberhalb des Ortes. Es ist der einzige Haushalt, der nicht den Alb-Boten bekommt. Niemand sonst in Rosenau liest die Frankfurter Allgemeine und die NZZ. Der Mann ist Arzt an der Reutlinger Klinik, das weiß Annamaria schon länger. Und dass das Haus vor Kindern nur so wimmelt. Fünfe sollen es sein! Dabei ist die Frau trotzdem nicht nur Hausfrau. Sie heißt Liane van der Berg, ist Psychologin oder Psychiaterin – wo der Unterschied liegt, begreift Annamaria nicht so ganz – und soll ziemlich bekannt sein, hat die Oma von der Hedi gesagt. Und dass sie Bücher schreibt, über Kinder und Erziehung, und die Oma von der Hedi muss es ja wohl wissen, denn sie weiß alles über jeden im Ort. Was diese Kinder für ein Glück haben, in so einer Umgebung groß werden zu dürfen, denkt Annamaria wie jeden Morgen. Der alte Bauerngarten, das weiß sie aus helleren Tagen, ist wie ein Abenteuerspielplatz, sogar ein Baumhaus mit einer Schaukel drunter gibt es, auch ein Trampolin und eine Wippe. Und obwohl das Haus so weit abseits liegt und alles in Winterdunkel getaucht ist, hat Annamaria keine Angst. Denn sie weiß ja, dass dort, hinter diesen Fenstern, die Glückliche Familie schläft. Genau so eine Familie wird sie auch bald haben, weiß Annamaria, und ein Glücksgefühl durchströmt ihren Körper, so intensiv und stark, dass es fast nicht zum Aushalten ist. Benommen von diesem Gedanken an ihre eigene Zukunft atmet sie tief ein und wieder aus und macht sich dann auf den Rückweg. Was ist der frühe Morgen doch für eine friedliche Zeit, denkt sie. Vielleicht liegt es daran, dass die Gedanken der Menschen noch nicht in der Welt sind, dass alles ruht, auch das Böse.
Wenn sie nachts nach dem Babysitten nach Hause geht, ist es anders. Die Stille wirkt dann bedrohlicher, voll unterdrückter Triebe. Vielleicht weil sie auf dem Heimweg immer am Goldenen Ochsen vorbeikommt, und wenn sie Pech hat, trifft sie ein paar stramme Stammtischler, die wie sie auf dem Nachhauseweg sind, zum Beispiel den Cornelius und seine Kumpels. Dann kann sie sich immer diese zotigen Sprüche anhören, das mag sie gar nicht. Und jetzt, in der Fasnet, wird es noch viel ärger.
Als Annamaria bald darauf die Haustür des alten Bahnwärterhäusles aufschließt, bleibt sie kurz stehen und lauscht. Nichts zu hören aus Sibylles Schlafzimmer. Im Gegensatz zu letzter Nacht, als ihre Pflegemutter mit diesem Typen hereingetorkelt kam und die beiden einen Heidenlärm veranstaltet haben. Wahrscheinlich hat die Sibylle ihm nicht erzählt, dass sie nicht allein im Häusle sind. Jedenfalls hat Annamaria zur Sicherheit ihre Zimmertür abgeschlossen und auch noch die Kommode davorgeschoben, um keine beschissene Überraschung zu erleben. Und dann hat sie sich noch Watte in die Ohren gesteckt. Aber das hat nicht viel genützt, das fürchterliche Knarren des Lattenrosts war trotzdem noch zu hören. Noch ein paar Monate, denkt Annamaria, dann bin ich hier weg.
Sie schleicht in die Küche, schließt die Tür hinter sich und bückt sich, langt hinter den Schrank und zieht ihren Geheimvorrat Kaffee heraus. Wenn sie ihn nicht versteckt, säuft Sibylle ihn nämlich weg. Obwohl Annamaria ihn von ihrem eigenen Geld gekauft hat. Und natürlich kauft Sibylle auch keinen neuen, weil sie alles, was sie hat, in Gin umsetzt. Von Gin bekäme man keine Fahne, hat ihr jemand mal erzählt.
Annamaria dagegen spart jeden Pfennig. 1780DM hat sie schon zusammen. Sie ist erst siebzehn, fühlt sich aber manchmal ganz schön alt. Jedenfalls älter als ihre Pflegemutter. Denn seitdem Sibylle der Mann weggelaufen ist, ist es bei ihnen umgekehrt: Nicht die Pflegemutter kümmert sich um Annamaria, sondern Annamaria um die Pflegemutter. Eigentlich müsste sie die Kohle vom Jugendamt bekommen, nicht Sybille. Aber sie will sich gar nicht beklagen. Denn selbst eine saufende Sybille ist tausendmal besser als das, was Annamaria vorher erlebt hat, in diesem Heim. Das war die schlimmste Zeit in ihrem Leben, und wenn sie auch nur kurz daran zurückdenkt, fängt ihr Herz sofort zu rasen an, so doll, dass sie das Klopfen bis in ihre Kehle spürt.
Annamaria setzt Wasser auf und schaufelt Kaffeepulver in den Filter, stellt sich ans Fenster und schaut hinaus. Sie ist jetzt wieder müde. Dabei fängt der Tag doch gerade erst an. Das rote Signal am Bahnübergang taucht alles in ein komisches Licht, blutig irgendwie. Annamaria sieht die Bäume hin- und herschwanken und beobachtet, wie der Winterwind an der Dachpappe des Schrebergartenhäuschens auf der anderen Seite der Schienen zerrt, mit aller Kraft, so als wollte er das Dach abdecken. Letzte Nacht, als das Gerammel im Schlafzimmer lauter wurde, hat Annamaria mit dem Gedanken gespielt, sich für eine Weile in dem Häuschen einzunisten. Dort, hat sie überlegt, hätte sie wenigstens ihre Ruhe und könnte auch gleich ein bisschen vom Markus träumen. Wie sie dort zusammen gewesen sind, im Sommer. Doch als sie jetzt sieht, wie der Wind an dem Dach reißt, ist sie froh, es nicht getan zu haben.
Da hört sie ein Geräusch im Gang. Scheiße, denkt sie, löscht das Licht und duckt sich unter den Tisch. Schritte steuern auf die Küche zu, die Küchentür geht auf. Einen Augenblick lang ist es still. Annamaria hält den Atem an. Dann, Gott sei Dank, wird die Tür wieder geschlossen und die Schritte entfernen sich. Wahrscheinlich Sibylles Saufkumpan, der das Häfele sucht. Sie wartet noch eine Weile unterm Tisch, bis die Schritte im Bad münden. Glück gehabt, denkt sie. So früh am Morgen hätte sie wirklich keine Lust gehabt, sich das Gehänge von irgendeinem Typen anzusehen, noch vor dem ersten Schluck Kaffee.
Annamaria macht wieder Licht, brüht sich den Kaffee auf und schleicht zurück in ihr Zimmer. Schiebt die Kommode wieder vor die Tür. Der erste Schluck, heiß, aber aus Rücksicht auf das Baby nicht so stark, wie sie ihn gerne hätte, ist wie Balsam. Wenn sie die Abiprüfungen hinter sich hat, wird sie das Kaffeetrinken ganz sein lassen. Aber vorher schafft sie das nicht, da braucht sie sich nichts vorzumachen.
Während die Mutter abwesend ist, kommt die alte Urschel mit ihren beiden Töchtern, den Nachtfräulein, und sie holen drei Kinder, jede eins.
Liane van der Berg, Freitag, 7. April 2017
Das Geräusch von Schritten im Kies holte Liane zurück in die Gegenwart. Sie setzte sich auf und lauschte einen Moment lang in die Dunkelheit, bevor sie auf Zehenspitzen zum Fenster schlich. Vorsichtig schob sie den Vorhang einen Spalt breit zur Seite und spähte hinaus in die vom milchigen Licht der Hoflaterne erhellte Nacht. Nachdem sie sich auch noch mit einem Blick durch das andere Fenster vergewissert hatte, dass niemand zu sehen war, knipste sie die Nachttischleuchte an. Wahrscheinlich der Zeitungsausträger, dachte sie, schließlich war es schon halb fünf Uhr morgens. Seufzend griff sie nach ihrem Morgenmantel, der auf der Polsterbank unter dem Fenster lag, und machte sich auf den Weg nach unten. Vielleicht würde eine Tasse Passionsblumentee helfen. Oder sollte sie sich womöglich eine warme Milch mit Honig gönnen? Das hatte sie schon lange nicht mehr getan, denn sie wusste ja nur zu gut, dass Milch den Körper verschleimte. Aber jetzt würde sie einmal eine Ausnahme machen – vielleicht half ihr das, zurück in den Schlaf zu finden. Wobei sie die Milch natürlich erhitzen musste, was einen zusätzlich negativen Effekt hatte. Bei über 42 Grad wurden die Enzyme zerstört und tote Materie hatte keinen Nährwert mehr. Liane atmete hörbar aus. Es gab eben immer wieder Situationen im Leben, in denen man die Regeln brechen musste.
Während sie den Herd anstellte und einen kleinen Topf aus dem Schrank holte, schaute sie auf die große Pinnwand neben der Küchentür und lenkte ihre Gedanken auf den bevorstehenden Tag. Gleich um neun hatte sie einen Telefontermin mit der Casterin von TV Makers, der Produktionsfirma, für die sie als Familienretterin vor der Kamera stand, mit der Mission, Familien bei der Kindererziehung zu helfen. Die zehnjährige Jubiläumssendung stand an, heute musste die Entscheidung fallen, welche Familie dafür die geeignetste wäre. Wenn sie es schaffte, die Vier-Millionen-Marke zu sprengen, wäre ihr die nächste Staffel sicher.
Sie nahm den Topf vom Herd, schüttete die Milch in ihren Lieblingsbecher aus blau lasiertem Ton – ein Geschenk von Gesine – und tat einen Löffel Honig dazu. Dann setzte sie sich aufs Sofa und breitete eine leichte Decke über ihre Beine, obwohl es im Wohnzimmer noch immer schön warm war. Die Erneuerung des Grundofens war den Aufwand eindeutig wert gewesen. Es hatte eben Vorteile, wenn der eigene Sohn eine Baufirma besaß. Wobei sie damals entsetzt gewesen war, als Matthias die Schule verlassen hatte und zu diesem Ofensetzer in die Lehre gegangen war. Er war schon immer ein Sturkopf gewesen; Gott allein wusste, wie sehr sie sich um diesen Jungen bemüht hatte. Doch bei ihm hatte nichts, aber auch gar nichts geholfen. Nicht das Aufzeigen der Konsequenzen, nicht die Methode der kaputten Schallplatte, noch nicht einmal der Nachdenkraum. Mit seinem Dickkopf hatte er sie an ihre Grenzen gebracht, als Mutter und auch als Pädagogin und Psychologin. Und mit Hortensie war es ähnlich gewesen. Der Älteste und die Jüngste. Sie warf einen kritischen Blick auf das Familienfoto, das in seinem schweren Rahmen aus antikem Silber auf dem Konsoltisch hinter dem Sofa stand. Dann griff sie nach dem Becher und pustete auf die Milch. Dafür hatten die drei anderen Kinder ihre Erwartungen mehr als erfüllt, dachte sie, während sie einen vorsichtigen Schluck nahm. Auf Gesine, Matthias’ Zwillingsschwester, war Liane besonders stolz. Gesine war eine erfolgreiche Geigerin geworden, die sich vor lauter Anfragen gar nicht mehr retten konnte und inzwischen siebzig, manchmal sogar achtzig Konzerte im Jahr gab. Auf vielen großen Bühnen hatte sie schon gespielt, in der Royal Albert Hall in London und auch in New York und Salzburg und St. Petersburg. In dieser Spielzeit war sie Artist in Residence bei der Dresdner Philharmonie. Umso mehr wusste Liane es zu schätzen, dass ihre älteste Tochter einzig wegen der Fotostrecke für den Stern nach Hause geflogen war. Gesine begriff eben, wie wichtig gute PR-Arbeit war. Ruben konnte das als Botschaftsrat zwar auch ermessen, trotzdem hatte Liane ihn deutlich intensiver bitten müssen. Dabei war er zu der Zeit sowieso auf Heimaturlaub in Berlin gewesen. Heimaturlaub, dachte Liane, während sie sich die Hände an dem Becher wärmte, was für ein seltsamer Begriff. Aber so nannte man das eben beim Auswärtigen Amt, wo Ruben gleich nach dem Jurastudium die Laufbahn für den höheren Dienst eingeschlagen hatte. Seit er vor drei Jahren als Kulturattaché an die Deutsche Botschaft in Neu-Delhi versetzt worden war, hatte er sich nicht mehr zu Hause blicken lassen. Doch das nahm sie ihm nicht übel, er war eben mit Leib und Seele Diplomat. Bedauerlich nur, dass er immer noch keine nette Partnerin gefunden hatte, so gut, wie er aussah! Lilo dagegen, überlegte Liane, wobei ihr Blick zurück zu dem Familienfoto wanderte, schien alle paar Monate einen neuen Lebensgefährten zu haben. Der jetzige war ein rachitischer Brillenträger, der sich allen Ernstes in einem Verein für den Schutz der Großtrappe engagierte. Beruflich hatte Lilo immerhin ein glücklicheres Händchen. Als sie im letzten Jahr ihre eigene Praxis als Gynäkologin eröffnet hatte, waren Liane und Carl denn auch den weiten Weg nach Berlin gefahren, um persönlich bei der Praxiseinweihung anwesend zu sein. Wobei es Liane lieber gewesen wäre, ihre Tochter hätte sich für ein Fachgebiet entschieden, bei dem sie nicht hauptamtlich den Unterleib anderer Frauen begutachtete. Na ja, dachte sie, Gynäkologen brauchte man eben auch; das wusste sie als Mutter von fünf Kindern am besten. Wobei sie es während ihrer Schwangerschaften nicht nötig gehabt hatte, dauernd zum Frauenarzt zu rennen, so wie das heute Usus war. Nein, sie hatte keine Angst gehabt, der Natur ihren Lauf zu lassen. Alle ihre fünf Kinder waren auf spontane Art geboren worden und sie hatte weder eine Periduralanästhesie noch einen Kaiserschnitt benötigt. Im Unterschied zu ihrer jüngsten Tochter Hortensie, die gerade mal ein Kind auf die Welt gebracht hatte, und das natürlich per Kaiserschnitt. Dafür war die kleine Juli das einzige Enkelkind, das Liane hatte, und fürs Erste würde es wohl bei dem einen bleiben.
Liane nahm den letzten Schluck Milch und stellte den Becher ab. Eine Weile blieb sie noch so sitzen, doch als ihre Gedanken wieder zu dem Brief zurückkehrten, erhob sie sich ungeduldig, löschte das Licht und räumte den Becher in die Spülmaschine. Meine Güte, dachte sie, was bin ich dünnhäutig geworden. Das lag sicher an der bevorstehenden Jubiläumssendung. Wenn die erst einmal erfolgreich gelaufen wäre, könnte sie wieder ein wenig entspannen.
Den kümmerlichen Rest der Nacht verbrachte sie mit krausen Träumen. Als sie Rufe hörte, war sie verwirrt und begriff erst nach und nach, dass das die Bauarbeiter sein mussten, die draußen auf dem Gerüst herumturnten. Benommen blinzelte sie, sah auf die Uhr und sank zurück auf das Kopfkissen. Wieso um alles in der Welt hatte sie nur von damals geträumt, von Frau Niethammer und Mathilde und von der Studentendemo, in die sie damals geraten war?
Da fiel ihr der unselige Brief wieder ein.
Liane, Ostermontag, 15. April 1968
Bis zu jenem Tag hatten die Studentenunruhen für Liane nur im Fernsehen existiert, wenn sie bei ihrer Zimmerwirtin Frau Niethammer in der Stube saß und mit ihr, umgeben von gehäkelten Schondeckchen und Hummel-Figuren, die Tagesschau anschaute, wo junge Leute mit Plakaten durch die Straßen zogen oder sogenannte Sit-ins veranstalteten. All das war fern und unwirklich, und so traf sie der Tumult, in den sie am Ostermontag des Jahres 1968 geriet, völlig überraschend.
Sie war zu Fuß unterwegs durch Schwabing, als sie plötzlich Lärm hörte, eine laute Stimme, die zwischen den Häuserwänden widerhallte und irgendetwas über Dutschke proklamierte. Dass der Studentenführer Rudi Dutschke in Berlin niedergeschossen worden war, hatte sie in den Nachrichten gehört, und als nun sein Name ertönte, war es ihr gleich klar: Ganz in der Nähe musste eine Demonstration stattfinden, wie in den letzten Tagen seit Gründonnerstag schon so oft.
Liane drehte sich um und ging in die entgegengesetzte Richtung. Sie hatte keine Lust, in eine Rangelei zwischen Studenten und der Polizei zu geraten. Doch an der nächsten Straßenecke sah sie, dass auch hier die Straßen verstopft waren – überall junge Leute, ein paar von ihnen trugen Plakate vor sich her. Liane machte Halt, war einen Moment lang unsicher, was sie tun sollte. Wenn sie pünktlich zurück bei Frau Niethammer sein wollte, die mit belegten Stullen auf ihre Untermieterin und Dr. Kimble auf der Flucht wartete, musste sie wohl oder übel die Schellingstraße überqueren, also mitten durch die Menschenmenge. Liane zögerte. Von Weitem beäugte sie die Demonstranten, hielt nach einer Lücke Ausschau und fragte sich, wo sie am besten durchschlüpfen sollte, wer am harmlosesten aussah. Sie wusste nicht recht, was sie halten sollte von diesen Studenten. Faulpelze und Drückeberger seien das, hatte ihr Vater erst neulich am Telefon wieder geschimpft. Auch für Frau Niethammer waren die Demonstranten unnützes Gesindel, das den lieben langen Tag nichts Besseres zu tun hatte, als der Polizei Ärger zu machen, natürlich auf Kosten der braven Steuerzahler. Und doch konnte Liane, als sie die Leute nun so ansah, nichts besonders Auffälliges oder Gefährliches an ihnen entdecken. Zugegeben, ein paar der jungen Männer hatten vielleicht etwas zu lange Haare, aber das war auch alles.
Nach ein paar Minuten des Zögerns bahnte sie sich also ihren Weg durch die Menge. Sie war schon fast auf der anderen Straßenseite angekommen, als sie ihn sah: den Blonden aus dem Park.
Er lehnte gegen ein Schaufenster, in Jeans und seinem dunkelbraunen Dufflecoat, und drehte sich eine Zigarette. Das blonde Haar war noch länger als im Winter und er sah, wenn das überhaupt möglich war, noch windzerzauster, noch anziehender, noch betörender aus. Plötzlich war alles andere vergessen: Frau Niethammer und die Stullen, die Warnungen ihres Vaters vor dem roten Gesindel, die Schlagzeilen und Nachrichten. Es gab jetzt nur noch ihn. Liane wusste, dass das ihre Chance war: Der Augenblick, auf den sie schon so lange gewartet hatte, wurde ihr hier auf dem Silbertablett präsentiert. Wie ferngesteuert zwängte sie sich zwischen zwei jungen Männern mit Plakaten hindurch und kam neben dem Blonden zum Stehen. Sie lehnte sich ebenfalls gegen das Schaufenster, das, wie sie jetzt sah, zu einer Schusterei gehörte, sah aber in die andere Richtung und versuchte, so zu wirken, als nähme sie jeden Tag an einer Demonstration teil.
»Auch eine?«, hörte sie da plötzlich jemanden sagen und begriff erst mit Verzögerung, dass er sie angesprochen hatte. Ihr Herz fing wie doll zu schlagen an.
»Das erste Mal bei einer Demo?« Er lächelte leicht schief und hielt ihr seinen Tabaksbeutel und die Blättchen hin. Ohne weiter nachzudenken griff Liane danach und begegnete seinem Blick. Nie würde sie diesen Moment vergessen, den ironischen Ausdruck in seinen Augen, die zu einem leisen Lächeln gekräuselten Lippen, das Grau seiner Augen.
Liane hatte noch nie zuvor geraucht, geschweige denn sich selbst eine Zigarette gedreht. Das Äußerste an Ruchlosigkeit war ein Schnaps auf einem Schützenfest gewesen, und auch den hatte sie nur getrunken, weil sie nicht als Spielverderberin dastehen wollte.
Unsicher zupfte sie etwas Tabak heraus und legte ihn auf das Blättchen. War das so richtig? Sicher, sie hatte schon gelegentlich zugesehen, wie Leute sich eine Zigarette drehten, erst neulich wieder, am Bahnhof, aber sie war eine flüchtige Beobachterin und so wusste sie eigentlich nur, dass das Papier irgendwie um den Tabak gewickelt wurde. Unbeholfen presste sie den Tabak mit den Fingern zusammen.
»Das ist viel zu viel«, hörte sie den Blonden neben sich sagen. »Gib her, ich mach’s für dich.«
Liane wurde rot und war heilfroh, dass er mit dem Drehen der Zigarette beschäftigt war und sie nicht ansah.
»Aber wie das mit dem Rauchen geht, das weißt du schon?«, fragte er sie und reichte ihr die fertige Zigarette mit einem frechen Grinsen. Sie hatte schon eine patzige Antwort parat, überlegte es sich aber anders und antwortete ruhig: »Es gibt für alles ein erstes Mal, nicht wahr?« Sie hielt seinem Blick stand, eine Ewigkeit, und konnte sich später an nichts mehr erinnern als an dieses überwältigende, alles verschlingende Gefühl während dieser paar Sekunden, denn mehr konnten es nicht gewesen sein.
Schließlich gab er ihr Feuer und sie sog den Rauch ein, so wie sie dachte, dass es richtig wäre. Eine Weile lang standen sie schweigend nebeneinander und rauchten, bis Liane eine sich steigernde Unruhe um sie her bemerkte. Irgendwo nicht weit entfernt hörte sie laute Stimmen, und auf einmal waren da Polizisten mit Knüppeln, die auf die Studenten eindroschen. Liane sah eine Frau, die von einem Polizisten an den Haaren gezerrt wurde. Und dann ging alles ganz schnell: Jemand schrie auf und Liane sah Steine durch die Luft fliegen. Mehr Menschen schrien, jemand rempelte sie an.
»Jetzt wird’s ungemütlich«, sagte der Blonde und griff nach ihrer Hand. Er zog sie hinter sich her, in den Hauseingang neben der Schusterwerkstatt und auf der Rückseite wieder heraus in einen Hinterhof, wo die Welt auf einmal still war. Aber er blieb nicht stehen, sondern zog sie weiter mit sich, zwischen Büschen und Sträuchern hindurch, vorbei an Wellblechhütten, und half ihr durch ein Loch in einem Maschendrahtzaun. Als sie auf der anderen Seite des Häusergevierts in einem Hof herauskamen, wo zwischen Fahrrädern und Mülltonnen ein Haufen Sperrmüll herumstand, hielt er einen Moment inne und sah sich kurz zu ihr um. Dann nahm er sie wieder bei der Hand und sie liefen durch einen Hintereingang in das Haus hinein, die Treppen nach oben.
Erst als sie im zweiten Stock ankamen, wurde Liane bewusst, was sie da im Begriff war zu tun. Schwer atmend standen sie sich gegenüber, Liane an der Wand und er vor ihr, nur einen halben Schritt entfernt. Er lächelte nicht, jetzt nicht mehr, er sah sie nur an. Ihre Augen waren fast auf gleicher Höhe und seine Pupillen groß und dunkel. Liane fühlte das Adrenalin, das durch ihren Körper pumpte. Kurz dachte sie an das Mädchen, seine Freundin, die im Winter bei ihm gewesen war, doch ihr war klar, dass es keine Rolle spielte, jetzt nicht mehr. Sie war hier bei ihm und würde alles tun, um die andere auszubooten.
Da hörten sie Schritte oben im Treppenhaus. Er griff in seine Jackentasche und zog einen Schlüssel heraus. Lianes Herz schlug wie verrückt weiter. Ein Mann kam von oben, ging grußlos an ihnen vorbei, während der Blonde ihr die Wohnungstür aufhielt. Kurz zögerte Liane. Sie hätte Angst haben sollen und irgendwie hatte sie das auch, doch nichts auf der Welt hätte sie in dem Moment davon abhalten können, mit ihm in die Wohnung zu gehen. Sie sah, wie er sich bückte, sich die Schnürsenkel aufzog und die Schuhe abstreifte. Sie tat es ihm nach, öffnete die Schnallen ihrer Schuhe und betrat dann die Wohnung. Überrascht hielt sie inne.
Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, jedenfalls nicht das, was vor ihr lag: Links und rechts des längsten Korridors, den sie je in einer Privatwohnung gesehen hatte, standen etliche Paar Schuhe, es mussten Dutzende sein. Bei genauerem Hinsehen erkannte Liane ein buntes Sortiment von Frauen-, Männer- und Kinderschuhen. Lebte er etwa mit seiner Familie zusammen? Aus einem Zimmer kam Kindergekreische, so laut und schrill, dass Liane seinen Blick suchte. Doch er winkte ab: »Kinder und Ferien, da ist Zanken an der Tagesordnung.« Er musterte sie kurz, aber aufmerksam und sagte: »Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Was hältst du davon, wenn ich dir erst mal einen Tee hole?«
Der Blonde verschwand durch die nächste Tür und Liane schaute ihm nach. War das eben im Treppenhaus wirklich passiert? Oder hatte sie sich das Ganze nur eingebildet? Verwirrt folgte sie ihm bis zum Türrahmen einer sehr geräumigen Küche. Der Raum wirkte zugleich prächtig und heruntergekommen, wie in einem baufälligen alten Herrschaftshaus. Liane ließ den Blick zu den Fenstern wandern, die höher waren als bei ihr daheim die Türen und sich über die gesamte Breite des Raumes verteilten. Ihr Blick fiel auf eine vollgeschriebene Wand. Stirnrunzelnd entzifferte sie, was da mit bunter Farbe kreuz und quer geschrieben stand: Haut dem Springer auf die Finger stand da und Unter den Talaren Muff von tausend Jahren.
In dem Moment hörte Liane ein Knarzen hinter sich. Sie drehte sich um und erblickte die junge Frau aus dem Park, die den Kopf zur Tür hereinsteckte und Liane kurz taxierte. Gleich darauf lief sie auf den Blonden zu, umarmte ihn von hinten und drückte ihn an sich. Liane versteifte sich. Also waren die beiden tatsächlich noch ein Paar? Wie aus weiter Ferne hörte sie ihn »Mensch, Kathi!« rufen, wobei er ein wenig von dem Tee auf dem Tisch verschüttete.
Wenn er noch mit diesem Mädchen zusammen war, überlegte Liane, wieso hatte er ihr dann eben an der Tür so intensiv in die Augen geschaut? Wäre der Mann von oben nicht dazwischengeplatzt, dann hätte er sie geküsst, da gab es keinen Zweifel.
»Und, wie war’s?« Erwartungsvoll sah Kathi ihn an. »Habt ihr eins auf die Mütze gekriegt?« Liane dagegen ignorierte sie dermaßen auffällig, dass die dieser Ziege am liebsten die Hand hingehalten und eine Begrüßung eingefordert hätte. Trotzdem konnte sie den Blick nicht von Kathi lösen, betrachtete ihr langes blondes Haar, das ihr in seidigen Wellen über den Rücken fiel, und die ausdrucksvollen blauen Augen. Wie zierlich sie ist, dachte Liane neidvoll und kam sich mit ihren fast einsachtzig mal wieder vor wie ein Elefant.
»Ist eskaliert«, antwortete der Blonde lakonisch und drehte sich um.
»Wo sind die anderen?«, fragte Kathi und tat immer noch so, als wäre Liane gar nicht da.
Der Blonde zuckte die Achseln. »Keine Ahnung. Die Bullen sind total ausgerastet. Haben angefangen, mit Knüppeln auf uns einzudreschen.«
»Scheiße.«
»Kannst du laut sagen.«
In dem Moment waren auf dem Gang Stimmen zu hören und kurz darauf betraten zwei Männer die Küche. Der erste, ein vierschrötiger Kerl in einer braunen Cordjacke, blutete am Kopf und steuerte auf den Wasserhahn zu.
»Wo ist Erika?«, fragte der Blonde.
»Diese Faschistenschweine haben sie mitgenommen«, sagte ein großer Dünner mit Brille und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Liane, die sich inzwischen vollkommen fehl am Platz fühlte, hätte am liebsten unauffällig den Rückzug angetreten. Wo war sie hier nur reingeraten? Zwischen den anderen entspann sich eine heftige Diskussion und sie überlegte, ob es nicht am besten wäre zu gehen, unbemerkt, solange die anderen noch redeten. Doch gerade als sie rückwärts zur Tür wollte, sah der Blonde sie an und fragte: »Wie viel Zucker nimmst du?« Zu Lianes Überraschung drehte sich Kathi fast im selben Moment zu ihr um und fragte: »Wer bist du eigentlich?«
»Zwei Löffel«, presste sie hervor und an Kathi gewandt erklärte sie betont würdevoll: »Mein Name ist Liane.« Daraufhin hob diese die Augenbrauen und meinte mit einem Seitenblick auf den Blonden: »Liane? Ist das nicht eine Schlingpflanze? Da musst du ja aufpassen, dass sie dir nicht die Luft abschnürt!«
Liane war sprachlos über so viel Unverschämtheit. Doch bevor ihr eine passende Antwort einfiel, mischte sich schon der Vierschrötige ein: »Du bist gut. Reißt hier Witze und Erika ist wer weiß was passiert!« Er lehnte sich gegen die Spüle und hielt sich ein Geschirrtuch an die Stirn.
»Halt du die Klappe, ich hab Kinderdienst!«
Auf einmal redeten alle durcheinander, bis der Dünne sagte: »Jetzt mal halblang. Wenn ihr euch streitet, hilft das niemandem.«
Kathi ließ das Thema fallen, für das sie sich gerade noch so ereifert hatte, und drehte sich unvermittelt zu Liane um. »Und was studierst du?«, fragte sie mit herausforderndem Blick.
»Ich … äh … studiere nicht«, antwortete Liane unangenehm berührt.
»Ach, Kathi, lass sie in Ruhe mit deiner Fragerei!«, fuhr der Blonde ihr über den Mund. Liane betrachtete die beiden unauffällig. So wie sie miteinander sprachen, waren sie ja vielleicht doch kein Paar mehr. Hoffnung keimte in ihr auf, und während sie noch grübelte, wie diese Leute wohl zueinander standen, ging der Blonde mit den Bechern zur Tür.
»Kommst du?«, fragte er. Verwirrt folgte Liane ihm und verließ die Küche, froh, von dort wegzukommen. Auf dem Weg durch den Korridor hörte sie wieder das Johlen der Kinder hinter einer der Türen. Aus einem anderen Zimmer, dessen Tür weit offen stand, drang Musik: die Ofarims mit Morning of My Life – einem ihrer Lieblingslieder.
Sein Zimmer war groß, mit hoher Decke und den gleichen hohen Fenstern, von deren Rahmen auch hier die Farbe abblätterte. Auf der Fensterbank standen drei Töpfe mit irgendwelchen vor sich hin dümpelnden Pflanzen, eine Kerze in einer leeren Weinflasche und etliche Büchsen mit Pfirsichen. An der Wand hing das Plakat dieses südamerikanischen Freiheitskämpfers, dessen Namen sie vergessen hatte. Darunter stand ein Schreibtisch, ein abgestoßenes Möbel aus dunklem Holz, darauf Bücher, Papier, Stifte, Zigarettentabak, ein überquellender Aschenbecher.
Mit einer Lässigkeit, die Liane nicht empfand, schlenderte sie zu einem der Bücherstapel neben einer Matratze mit zerwühltem Bettzeug. Sie schnappte sich das oberste Buch – Der Steppenwolf von Hermann Hesse – und blätterte darin herum, scheinbar versunken, obwohl sie in diesem Moment nichts weniger interessierte als dieses Buch.
»Hier«, sagte er und reichte ihr den Becher. Sie legte das Buch beiseite und stellte sich neben ihn ans Fenster. Vorsichtig nahm sie einen Schluck von dem Tee, der sehr süß war. Er ließ sie nicht aus den Augen. »Ist dir immer noch kalt?«, fragte er und sie bejahte, aber eigentlich nur, um zu rechtfertigen, dass sie hier in Mantel und Hut herumstand wie in einem Bahnhofs-Wartesaal. Aus den Augenwinkeln sah sie ihn nach einer Flasche greifen, die neben seiner Matratze auf dem Boden stand, und ehe sie sich’s versah, hatte er ihr etwas in den Tee geschüttet. »Trink das mal, da wird dir warm.« Als er die Flasche wieder wegstellte, sah sie, dass es Stroh-Rum war, das Zeug, mit dem ihre Eltern sich jedes Jahr im Sommerurlaub in Österreich eindeckten. Wie ein Vogel nippte sie an dem Tee, als er plötzlich laut auflachte.
»Entschuldige, aber du stehst da wie meine verstorbene Tante Irmgard, die Mesnerin war und alles hier sehr schlimm und verwerflich gefunden hätte. Willst du nicht wenigstens den Hut absetzen?«
Sie sah sich mit seinen Augen, strumpfsockig, aber in dem bis oben hin zugeknöpften Mantel, ärgerte sich über sich selbst und zog schnell alles aus. So würde sie ihn sicher nicht beeindrucken, dachte sie und machte es sich auf dem Boden bequem. Egal, was er mit der Ziege in der Küche hatte: Sie würde diesen Mann für sich gewinnen.
Sie trank den restlichen Tee und wie durch ein Wunder fiel auf einmal alle Befangenheit von ihr ab. Völlig ungeniert zog sie die Klammern aus ihrem Haar und schüttelte es. Sie hielt ihm den leeren Becher hin und fragte keck: »Kann ich noch so einen Zaubertrank haben? Oder kriegst du dann Ärger mit deiner Freundin?«
»Hm?«, fragte er.
»Das Mädchen vorhin … diese Kathi … Sie ist doch deine Freundin?«
Jetzt lächelte er ironisch und senkte dann die Stimme: »Du meinst, wir sind einander versprochen? Im Sinn einer Treuebeziehung?«
»Was soll ich denn sonst damit meinen?« Liane legte den Kopf schief und lächelte ebenfalls.
»Die traditionelle Monogamie …«, sagte er grinsend. Dann nahm er ihr den Becher aus der Hand und verschwand Richtung Küche. Liane ließ ihren Blick durchs Zimmer wandern und lächelte. Sie spürte den Alkohol und es war ganz wunderbar. Alles, was ihr sonst im Weg stand, diese lästigen Hemmungen und Zweifel, alles war wie weggewischt.
Später musste sie noch oft an diesen Moment zurückdenken, in dem ihr Mut, aber auch ihre Skrupellosigkeit erwacht war. Sie stand auf, ging zum Fensterbrett und zündete die Kerze an. Sie löschte das Deckenlicht, stellte sich ans Fenster und sah hinaus in das dunkle Karree des Hinterhofs. Leise summte sie vor sich hin. I fall to pieces … Sie kicherte. Each time I see you again. Wenn er das wüsste! Noch nie war sie sich einer Sache so sicher gewesen. Nie zuvor hatte sie etwas oder jemanden so sehr gewollt wie diesen Mann.
»Was singst du da?«, fragte er und trat neben sie. Er sah sie an, wieder mit diesem amüsierten Ausdruck.
»Oh, nichts … ein albernes Lied.«
Er stellte die Becher auf der Fensterbank ab, tat einen Schuss Rum hinein und reichte ihr einen. Liane setzte sich, mit dem Rücken zur Heizung. Er tat es ihr nach, und als er den Blick langsam über ihr Gesicht und über ihr Haar gleiten ließ, wurde sein Gesichtsausdruck ernst.
»Weißt du eigentlich, wie schön du bist … ohne den Gouvernantendeckel?« Liane stockte der Atem. Am liebsten hätte sie ihn gefragt, ob er das ernst meinte. Aber sie verkniff es sich, erwiderte einfach seinen Blick. Als die alte Nervosität wieder in ihr hochstieg, nahm sie einen großen Schluck Tee und fragte das Nächstbeste, das ihr einfiel: »Ihr wohnt hier also alle zusammen …«, sie überlegte, suchte nach Worten und fuhr dann fort: »du und deine Freunde?«
Doch statt zu antworten, nahm er ihr den Becher weg, legte seine Hand an ihren Hinterkopf und zog sie zu sich her, nicht allzu sanft. Einen Augenblick lang hielt er sie so, sein Gesicht dicht an ihrem, so nah, dass sie seinen Atem auf ihrer Haut spürte. Er roch ganz leicht nach Rum, aber auch nach etwas anderem, nach Holz und Wald und irgendwie fremdländisch.
»Was ist, wenn deine Freundin reinkommt?« Sie rückte ganz leicht von ihm ab.
»Als ob du darauf einen Pfennig geben würdest …« Wieder dieses Grinsen.
»Können wir nicht trotzdem abschließen?«
»Niemand schließt hier ab. Wir haben keine Schlüssel«, flüsterte er, und als er sie zu Boden drückte, war sie erstaunt über seine Kraft. So lag sie da, die Hände über dem Kopf, er über ihr. Nie zuvor hatte jemand sie so angesehen. Liane spürte ihren Körper auf eine Art, wie sie ihn noch nie gespürt hatte, ihre halb geöffneten Lippen, das Heben und Senken ihres Brustkorbs beim Atmen, das Hämmern ihres Herzens. Er legte sich auf sie, mit seinem ganzen Gewicht, und fuhr mit dem Zeigefinger ganz langsam ihre Lippen entlang. Sie schloss die Augen.
»Nein«, sagte er. »Sieh mich an!«
Sie schlug die Augen wieder auf, sah sein Gesicht dicht vor ihrem, bemerkte die kleine Narbe über seiner Oberlippe, fühlte seinen Atem auf ihrem Mund. Dann schob er ihre Bluse hoch.
Erst als sie sich Stunden später von der zerwühlten Matratze erhob, ihre Kleidung zusammenklaubte und sich draußen auf dem Korridor anzog, wurde ihr klar, dass er nicht nur ihre Frage nach seiner Freundin nicht beantwortet hatte, sondern dass sie noch nicht einmal wusste, wie er hieß.
Annamaria, Gumpiger Donnerstag, 6. Februar 1986
Eigentlich wollte Annamaria in diesem Jahr nicht zum Narrensprung gehen und schon gar nicht beim Nachtfräuleinspiel mitmachen. Da verstecken sich die Rosenauer Narren im Ried und die Jungen müssen sie suchen, mit speziellen Bändern am Handgelenk fesseln und sie dann zurückführen. Für jedes Nachtfräulein, das man findet, gibt es ein Rosenweckle und ein Freigetränk. Aber wo es ihr die ganze Woche nicht gelungen ist, mit dem Markus zu sprechen, hofft sie nun darauf, ihn bei der Fasnet zu treffen. Sie weiß ja, wie wichtig ihm das ist. Er ist schon seit Jahren bei den Nachtfräulein, der ältesten Narrenzunft der Gegend. Na ja, und außerdem will sie die Hedi und die Uli nicht enttäuschen, die freuen sich schon so lange auf den Kokolores. Also steht Annamaria jetzt hier, mitten in diesem Hexenkessel. Denn genauso fühlt sich das für sie an, so wie es um sie herum brodelt und knallt und zischt. Einer ruft »Rosenau« und wuschelt ihr Konfetti in die Haare, noch bevor sie mit »Rosenei« antwortet. Und jetzt setzt auch wieder die Lumpenkapelle ein. Bumbumbum, in der Mitte des Rathausplatzes haben sie eine Bühne aufgebaut, darauf sitzen die Musikanten und trommeln und schmettern, was das Zeug hält. Der Rhythmus geht ihr durch Mark und Bein und hat etwas Hypnotisierendes. Trotzdem braucht sie jetzt mal ein bisschen Abstand, also schiebt sie sich durch die Menge bis ganz an den Rand des Platzes. Dort bleibt sie stehen, vor dem Schaufenster vom Senn-Bäck, der zum Glück leer ist. Denn alle, der ganze Ort hat sich auf dem Platz versammelt. Der Gumpige ist ein großer Tag hier, und Rosenau hat nicht nur eine eigene Lumpenkapelle, sondern auch eine Narrenzunft mit vier Figuren, dem Linsenweible, den Donaugrieblern, den Hellsternmännle und den Nachtfräulein. Wobei die Nachtfräulein, das denkt Annamaria jedes Mal, wenn sie eines sieht, wirklich am unheimlichsten sind mit ihren dunklen Gewändern und den bleichen, zu ewigem Lächeln erstarrten Frauengesichtern. Sie findet sie schlimmer als alle anderen Masken, schlimmer als die hexenhaften Linsenweible und schlimmer als die knorrigen Donaugriebler, die einen auch schon das Fürchten lehren. Aber vielleicht liegt das ja auch an der Sage. Von den Nachtfräulein, die die Kinder holen kommen.
»Was machsch hier am Rand, komm vor zu uns!«, brüllt ihr jemand ins Ohr. Das ist die Hedi, ihre beste Freundin, eine schlechte Schülerin, aber eindeutig die mit dem größten Mundwerk. Auch mit den Kerlen ist die Hedi vorne mit dabei. Aber jetzt ist sie ja fest mit dem Cornelius zusammen. Das kann Annamaria gar nicht verstehen, so eine große Gosche, wie der hat. Ein richtiger Grobian ist der. Aber die Hedi stand ja schon immer auf die Krakeeler und die Auffälligen. Die Hedi war es auch, die ihr den Ledermini, die Kreuzkette, die Armbänder und die Netzstrümpfe geliehen hat. Und dann hat sie sie auch noch üppigst mit My Melody eingedieselt. Am Schluss wollte sie auch noch, dass Annamaria die blonde Perücke aufzieht, was die allerdings verweigert hat. »Dann siehst du aber gar nicht aus wie die Madonna!«, hat die Hedi da geschimpft. Doch Annamaria ist standhaft geblieben, sie will schließlich, dass der Markus sie erkennt. Außerdem will sie sich ja nicht verschlechtern. Ihre Lockenmähne ist schließlich ihr ganzes Kapital, wie die Hedi nicht müde wird zu betonen, mit so einem Unterton, der deutlich machen soll, dass Annamaria sonst nicht viel zu bieten hat. Manchmal hat Annamaria wirklich den Eindruck, die Hedi sei irgendwie eifersüchtig auf sie, was völliger Quatsch ist, weil die Hedi einfach super aussieht: blonde Haare, lange Beine, schmale Taille und ganz schön Holz vor der Hütte. Wahrscheinlich ist sie deshalb auch so beliebt bei den Jungs. Aber Annamaria ist halt die Exotischere, mit ihren schwarzen Locken und den dunkelbraunen Augen. Die hat sie von ihren Eltern, Cesare und Rosa De Luca, die aus Süditalien stammten. Vielleicht friert sie ja auch deshalb mehr als andere, den ganzen Winter über. Sie scheint für die Kälte nicht gemacht zu sein. Das hat sie oft gedacht und davon geträumt, dass ihr Vater sie holen kommt, aus Kalabrien oder wo auch immer er sein mochte.
Sie sieht der Hedi hinterher. Das hätte Annamaria sich nie getraut, hier als Olivia Newton-John aufzukreuzen, in einem hautengen pinken Aerobic-Outfit und mit einem Stirnband. Außerdem wäre ihr das viel zu kalt gewesen. Am Schluss hat sie sogar noch eine Wollstrumpfhose unter die Netzstrümpfe gezogen.
Wieder brüllt ihr jemand ins Ohr: »Rosenau!«
Sie zuckt zurück, zieht den Kopf ein und erwartet eine volle Ladung Konfetti. Im Augenwinkel sieht sie die Maske eines Nachtfräuleins, erkennt das dunkle Gewand und das helle Gesicht. Doch das Konfetti bleibt aus. Stattdessen schlingen sich zwei Arme fest um ihre Taille. Sie schreit »Rosenei«, versucht die Hände zu lösen und hofft, noch einmal davonzukommen. Das Häs fühlt sich rau an und riecht nach Kartoffelsack. Das Nachtfräulein packt noch fester zu. »Hab ich dich, du süßes Ding!«, raunt es und drückt sie an sich.
Markus. Das muss der Markus sein! Das ist genau seine Art, mit ihr zu reden, auch wenn seine Stimme unter der Maske ungewohnt dumpf klingt. Annamarias Herz schlägt jetzt ganz schnell und ein überwältigendes Glücksgefühl steigt in ihr auf, so eine überschäumende Euphorie, dass ihr ganz schwindlig wird. Noch nie haben der Markus und sie sich in der Öffentlichkeit berührt. Immer fand alles ganz heimlich statt, in der Schule im Kopierraum, in seinem Auto auf dem Wanderparkplatz. Im Schrebergartenhäusle an der Bahnlinie. Aber jetzt sind sie hier, zusammen, in aller Öffentlichkeit! Natürlich steckt er in seinem Kostüm und hat die Nachtfräuleinmaske überm Gesicht, und doch ist es wie ein Vorgeschmack auf die Zukunft: sie und er zusammen, in Freiheit, Arm in Arm auf der Straße, unter den Augen aller.
Da spürt sie seine Hände, die sich um ihre Pobacken schließen. Ihr wird ganz heiß bei dieser Berührung, sie fühlt sich wagemutig, übermütig, wie in einem Rausch. »Du siehst unglaublich aus«, raunt er ihr ins Ohr.
Sie freut sich, dass er das bemerkt. Immerhin hat sie ewig vor dem Spiegel gestanden, während die Hedi sich das Haar gefönt hat.
»Aber du frierst ja«, sagt der Markus. Er löst die Hände von ihrer Taille, nestelt an seinem Häs herum, klickt den Karabiner auf, an dem seine Feldflasche hängt. Die dürfte er eigentlich gar nicht tragen, weil es gegen die Zunftordnung verstößt. Das hat die Hedi ihr gesagt, weil ausgerechnet der Cornelius auch so ein Ding besitzt, aus dem er immer wieder säuft. Jedenfalls schraubt der Markus jetzt den Deckel von der verbotenen Flasche ab und reicht sie ihr. »Hier, meine Süße!«
Bevor sie begreift, was sie da trinkt, hat sie schon einen großen Schluck genommen. »Das ist ja Peng!«, sagt sie erschrocken, Cognac-Cola, und denkt, dass man in der Schwangerschaft doch keinen Alkohol trinken darf. Aber der Markus weiß bis jetzt ja nichts davon. Sie macht eine Grimasse und hört sein gedämpftes Lachen.
»Na los, nimm ruhig noch einen Schluck, dann wird dir warm!«
Aber der eine reicht, er zieht ihr durch sämtliche Glieder und entfacht ein kleines Feuer in ihrem Magen. Auch spürt sie die Wirkung sofort im Kopf. Sie beobachtet den Markus dabei, wie er sich zum Laden umdreht, damit keiner außer ihr sein Gesicht sieht, seine Maske hochklappt und aus der Feldflasche trinkt. Sie kichert, muss auf einmal richtig lachen.
»Na warte, nachher werd ich dir schon zeigen, was es heißt …«, raunt der Markus ihr ins Ohr.
Der Rest des Satzes geht im Knattern der Ratschen unter, die die Narren und die Jungen zum Aufbruch rufen.
Annamaria hält sich die Ohren zu, doch er nimmt sie an der Hand und ruft ihr ins Ohr: »Wir treffen uns hinter den alten Bienenstöcken!«
Sie sieht ihm hinterher, wie er in der Menge verschwindet. Kurz fragt sie sich, welche Bienenstöcke er wohl meint, die in der Nähe des kleinen Weihers oder die unter den Weiden? Aber die bei den Weiden sind ja schon halb verrottet, denkt sie, also müssen es die anderen sein. Jedenfalls klingen seine Worte für sie wie Musik. Endlich wird sie mal wieder mit ihm alleine sein. Vielleicht schafft sie es sogar, ihm von der Schwangerschaft zu erzählen? Dann macht sie sich selbst auf in Richtung des Traktors, der die Kinder und Jugendlichen ins Ried, zum Nachtfräuleinspiel, bringt.
Sie kommt neben der Hedi zum Sitzen, die noch aufgedrehter wirkt als sonst. Wer weiß, was die schon getankt hat und was die im Ried so vorhat. Sie kennt die Hedi, die ist nicht gerade scharf drauf, durchs – wie sie gerne sagt – scheißöde Ried zu dackeln. Aber heute ist alles anders.
Während der Traktor unter dem Getrommel der Lumpenkapelle vom Platz tuckert und sich auf die übliche Rundfahrt begibt – die Nachtfräulein müssen ja genügend Vorsprung haben, um im Ried ein Versteck zu finden –, fängt die Hedi an zu singen, und Annamaria ist so gut drauf, dass sie mit einstimmt. Kreuzberger Nächte und Rucki Zucki. Vor der Wallfahrtskirche und auch vor dem Ochsen stehen ein paar Närrle, sie winken ihnen zu und rufen: »Rosenau!« So fahren sie eine Viertelstunde herum, bis der Traktor den Planweg in Richtung Ried einschlägt. Von Weitem, hinter einem Waldstück, schimmern die Mauern des Rosenstifts hindurch, wo Annamaria nach dem Tod ihrer Mutter hinkam, bevor die Sibylle und ihr Mann sie aufgenommen haben. Natürlich hatte das Jugendamt erst mal versucht, ihren Vater ausfindig zu machen, aber keiner wusste, wo er war.
Ihre Eltern hatten damals die erste Eisdiele in der ganzen Gegend, das hat man ihr erzählt. Aber die Geschäfte liefen schlecht, die Älbler wollten kein Eis. Also setzte sich ihr Vater wieder nach Kalabrien ab und ihre Mutter musste den Laden dichtmachen. Im Winter darauf war sie an einer Lungenentzündung gestorben.
»He, wie lang soll ich’s dir noch hinhalten?«
Annamaria bemerkt, dass die anderen sie ansehen. Allen voran die Hedi, die ihr eine halb volle Flasche Obstler unter die Nase hält. Sie will schon danach greifen, aber dann fällt ihr wieder ein, dass sie ja gar nicht mehr trinken darf, in ihrem Zustand, und sie gibt die Flasche weiter an die Uli. Da funkelt die Hedi sie böse an: »Bischt dir zu fein, mit uns aus einer Flasch zu trinken, oder was?« Aber die Uli sagt: »Lass sie doch.«
Das kleine Waldstück ist längst außer Sicht, jetzt fahren sie über die Brücke, der Nebenarm der Donau liegt wie tot unter ihnen. Annamaria sieht in das braune Wasser, ein paar Stockenten treiben darauf herum. Ein ganzes Stück entfernt steht ein Graureiher, der sich nun aufschwingt und davonfliegt. Manchmal möchte sie das auch, in den Lüften verschwinden. Aber nicht heute, heute kann Annamaria es kaum erwarten, endlich anzukommen und sich auf die Suche nach dem Markus zu machen, ihrem Nachtfräulein.
»Ist ja echt heiß, mit einem Lehrer! Weißt du überhaupt, wie alt der ist?«, hat die Hedi sie damals gefragt, als Annamaria ihr anvertraute, dass der Markus und sie ein Paar waren. »38! Der ist sogar mir zu alt!«
Dabei hat Annamaria manchmal den Verdacht, dass die Hedi ihn in Wirklichkeit auch gut findet. So kokett, wie sie sich immer benimmt, wenn er sie aufruft. Andererseits macht die Hedi das bei allen gut aussehenden Männern, egal wie alt sie sind. Genau genommen ist die Hedi nur dann eine gute Freundin, wenn sie die Nummer eins ist, das hat Annamaria inzwischen begriffen. Sie nimmt der Hedi das nicht krumm. Weil Annamaria ja nur den einen will, nur den Markus. Alle anderen sind ihr egal.
Das Ried liegt nun offen vor ihnen. Gelb leuchtet das Schilf in den nebligen Wintertag und die alten Hexenbäume stehen am Rand Spalier, dort, wo der tote Arm der Donau verläuft.