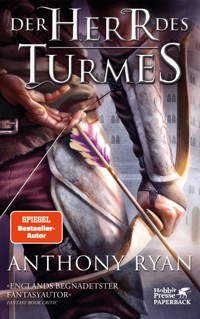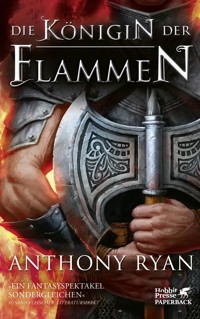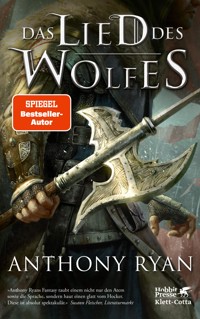
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der neue Zyklus aus der Welt der Rabenschatten Mit »Das Lied des Blutes« – dem ersten Band der Rabenschatten- Serie – eroberte Anthony Ryan die Welt der Fantasy im Sturm. Nun kehrt er mit »Das Lied des Wolfes« zu seinem unvergesslichen Helden Vaelin al Sorna zurück und erzählt ein packendes, neues, episches Abenteuer voller Spannung. Unter Vaelin al Sornas Führung wurden ganze Kaiserreiche besiegt, seine Klinge entschied erbitterte Schlachten – und er stellte sich einer bösen Macht entgegen, die schreckenerregender war als alles, was die Welt bis dahin gesehen hatte. Er verdiente sich eine Unmenge an Ehrentiteln, nur um später in den Nordlanden ein friedvolles Leben zu suchen … Doch von weit über dem Meer verbreiten sich Gerüchte – ein Heer mit dem Namen Stählerne Horde treibt dort sein Unwesen. Es wird von einem Mann angeführt, der sich selbst für einen Gott hält. Als Vaelin erfährt, dass Sherin, die Frau, die er vor Jahren geliebt und verloren hat, der Horde in die Hände gefallen ist, bleibt ihm keine Wahl, er muss wieder einmal in den Kampf ziehen. »Das Lied des Wolfes« ist der Auftakt einer neuen epischen Fantasy-Serie von Anthony Ryan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Anthony Ryan
Das Lied des Wolfes
Rabenklinge 1
Aus dem Englischen übersetzt von Sara Riffel
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Wolf’s Call. A Raven’s Blade Novel« im Verlag ACE Books, New York 2019
© 2019 by Anthony Ryan
Für die deutsche Ausgabe
© 2020, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: © Birgit Gitschier, Augsburg,
unter Verwendung einer Illustration von © Federico Musetti
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98760-7
E-Book ISBN 978-3-608-12015-8
Inhalt
Karten
Erster Teil
Luralyns Bericht Die erste Frage
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zweiter Teil
Luralyns Bericht Die zweite Frage
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Dritter Teil
Luralyns Bericht Die dritte Frage
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Dramatis Personae
Die
Nordlande
der
vereinigten
Königslande
Die
Stahlhast
Das
ehrwürdige
Königreich
Dank
Gewidmet der Erinnerung an meine verstorbene Freundin und einstige Vorgesetzte Dr. Robin Cooper, PhD, die eine großartige Aspektin des dritten Ordens abgegeben hätte.
Karten
Erster Teil
•••
Des Raben Klinge
schneidet tief,
legt meine Sünden frei.
– Seordahnisches Gedicht, anonym –
Luralyns Bericht Die erste Frage
Heutzutage nennen viele meinen Bruder ein Ungeheuer. Seine Taten, die schrecklichen wie die wundersamen, sind für sie das Werk eines übernatürlichen Wesens, das die Gestalt eines Menschen annahm, um furchtbares Unheil über uns alle zu bringen. In den dunklen und elenden Ecken der Welt wird er von manchen noch als Gott bezeichnet, aber das nur in furchtsamem Flüsterton. Interessanterweise sprechen weder Erstere noch Letztere seinen wahren Namen aus, dabei kennen sie ihn so gut wie ich. Kehlbrand, meinen Bruder, den ich trotz allem – trotz der Schlachten und Eroberungen, trotz der Massaker – immer noch liebe. Aber, höre ich dich, werter Leser, fragen, wie kann das sein? Wie kann man einen Mann lieben, der die halbe Welt in Blut gebadet hat?
In dieser ruhigeren Zeit, fern vom Wahnsinn und den Schrecken des Krieges, bleibt mir die Muße, über derlei Fragen nachzudenken. Während die Jahre vergehen und sich in mein einstmals rotbraunes Haar immer mehr Grau mischt, meine Gelenke zunehmend von Schmerzen geplagt werden und ich mich tiefer über die Seiten beugen muss, um zu sehen, was ich schreibe, ist dies die Frage, die mich am meisten beschäftigt.
Sei beruhigt, lieber Leser, liebe Leserin. Ich weiß, du hast dieses Buch nicht aufgeschlagen, um dir das Gejammer einer alten Frau anzuhören. Nein, du möchtest mehr über meinen Bruder erfahren und wie es ihm gelang, die ganze Welt zu verändern. Ich kann seine Geschichte aber nur in Verbindung mit meiner eigenen erzählen, denn zwischen uns bestand ein festes Band. Ein Band, das aus Blut und Bestimmung geknüpft war. Viele Jahre schien es so, als wären wir seelenverwandt, derart ähnlich waren unsere Ziele und unsere Hingabe an unsere heilige Mission. Doch wie ich erfahren musste, ist der Spiegel der schlimmste Lügner, und kein Spiegel bleibt von der Zeit unberührt.
Jahrelang habe ich darüber nachgedacht, wann die Verbindung zwischen Kehlbrand und mir entstanden ist. Vielleicht, als ich mit sieben vom Rücken meines ersten Pferdes fiel und mir eine blutige Schürfwunde am Knie zuzog. Damals war es Kehlbrand – gerade erst zwölf Jahre alt –, der mich tröstete. Die anderen Kinder des Skelds lachten mich aus und warfen Dung auf den schluchzenden Schwächling, mein Bruder dagegen kam und half mir hoch. Selbst damals war er schon langgliedrig und schlank, wie ein geborener Krieger, und einen Kopf größer als ich, was sich auch nicht mehr ändern würde.
»Druhr-Tivarik, kleines Fohlen«, sagte er leise – es war der Name, den die Priester denen gaben, die göttliches Blut in sich trugen – und wischte mir mit dem Daumen die Tränen ab. »Weine nicht.« Dann lächelte er entschuldigend und setzte eine Miene tiefster Verachtung auf. Mit der flachen Hand schlug er mir ins Gesicht. Der Schlag war so hart, dass ich zu Boden fiel und den Eisengeschmack von Blut auf der Zunge wahrnahm.
Einen Moment lang blinzelte ich nur verwirrt, meine Tränen waren jedoch zu meiner Überraschung versiegt. Als ich benommen hochschaute, sah ich Kehlbrand auf die anderen Kinder zumarschieren. Er suchte sich den Größten aus, einen kräftigen Jungen namens Obvar, der ein Jahr älter war als er und mich gerne hänselte.
»Eine Druhr-Tivarik steht über dem Urteil der Sterblichen«, sagte mein Bruder und schlug Obvar mit der Faust ins Gesicht.
Ein langer, blutiger Kampf folgte, der unter dem Nachwuchs des Skelds bald große Berühmtheit erlangte. Dass zuvor ein Kind der Druhr-Tivarik beleidigt worden war, geriet darüber schnell in Vergessenheit. Später wurde mir klar, dass Kehlbrand genau das beabsichtigt hatte, denn die Priester bestraften solche Dinge für gewöhnlich hart. Als es vorbei war, lag Obvar stöhnend und aus mehreren Wunden blutend am Boden, während Kehlbrand, nicht weniger blutüberströmt, noch auf den Beinen war. Wie es bei Jungen häufig geschieht, wurden er und Obvar in der Folgezeit beste Freunde. Sie schworen einander Sattelbruderschaft, die bis zu einem schicksalhaften Tag zwanzig Jahre später bestehen bleiben sollte. Aber, lieber Leser, liebe Leserin, ich möchte nicht vorgreifen.
Für mich bedeutete dieses Ereignis eine wichtige Lektion, wahrhaft verbunden fühlte ich mich Kehlbrand damals jedoch noch nicht. Und seltsamerweise auch nicht an dem Morgen, nachdem ich meinen ersten Wahrtraum hatte. Die Gabe des göttlichen Blutes ist launisch. Auch wenn die Druhr-Tivarik ausschließlich von Müttern geboren werden, die die göttliche Gabe besitzen, wird diese nicht immer weitervererbt. Häufig schlummert sie während der Kindheit gleichsam noch und offenbart sich erst mit dem Übergang ins Erwachsenenalter. So war es bei mir. Zu Beginn meines zwölften Sommers, in der Woche meiner ersten Blutung, hatte ich einen Wahrtraum.
Verzeih mir, lieber Leser, meine dürftigen Fähigkeiten als Schriftstellerin, doch es fällt mir schwer, das schiere Grauen jenes ersten Traumes in Worte zu fassen. Ich verwende diese Bezeichnung, weil mir der Begriff »Vision« zu albern und auch unzureichend erscheint. Der Wahrtraum ist ein Zustand jenseits der Realität, wenngleich er dem Träumer nur allzu real vorkommt. Mit der Verwirrung und den gedämpften Empfindungen eines gewöhnlichen Traums hat er nichts gemein. Die Luft auf der Haut, die Gerüche, die der Wind heranträgt, die Hitze einer Flamme oder das Brennen einer Wunde – all das spürt man klar und deutlich.
In jener Nacht lag ich auf meiner Matte in dem Zelt, das ich mit den anderen Druhr-Tivarik des Skelds teilte, und schlief so tief und fest wie noch nie zuvor in meinem Leben. Es war, als hätte sich ein schwarzer Schleier über meine Augen gelegt und alles Licht und Gefühl ausgesperrt, und als er beiseitegezogen wurde, fand ich mich in einer Szenerie des Grauens wieder.
An die Schreie erinnere ich mich am allerdeutlichsten. Der Schmerz eines Sterbenden ist schwer zu ertragen, besonders wenn man dergleichen noch nie erlebt hat. Damals hatte ich durchaus schon Menschen sterben sehen: Ketzer, Sklaven und Verbrecher, die gegen die Ewigen Gesetze verstoßen hatten; sie wurden gefesselt und vor dem Henker auf die Knie gezwungen. Aber diese Menschen starben schnell – ein rascher Schwerthieb, und ihre Köpfe fielen zu Boden. Ihre Körper, und manchmal auch ihre Gesichter, zuckten noch eine Weile, doch das war meist bald vorbei. Was ich hingegen in dem ersten Wahrtraum sah, war keine Hinrichtung, sondern eine Schlacht.
Ein Todgeweihter lehnte an der Flanke eines Pferdekadavers und starrte ungläubig auf die Eingeweide, die aus seinem Bauch hingen. Er hatte den Mund weit aufgerissen und schrie aus vollem Halse, während er versuchte, mit blutigen Händen die Darmschlingen wieder in seinen Leib zu stopfen. Um uns herum herrschte ein Durcheinander aus donnernden Hufen, klirrenden Klingen und dem schrillen Wiehern ängstlicher Pferde, eingehüllt in dichte Staubwolken.
Damals waren Schlachten in der Eisensteppe keine Seltenheit. Die Stahlhast befanden sich im schmerzhaften Übergang von einem Haufen miteinander verfeindeter Skelds zu einer wahren Nation. Etwa jeden zweiten Monat schnallten die Krieger ihre Bögen an die Pferdesättel und schärften ihre Säbel und Lanzenspitzen, um als Heer loszureiten. Nach Tagen oder Wochen kehrten sie zurück – stets siegreich. An ihren Sätteln baumelten die Köpfe ihrer Gegner. Nachts betranken sie sich dann und erzählten von großen Taten. Der Albtraum, in dem ich mich jetzt befand, hatte mit derartigen Erzählungen jedoch nichts gemein.
Mein Blick huschte von einem Grauen zum nächsten: ein kriechender Mann, aus dessen Beinstümpfen Blut strömte, ein Pferd mit aufgeschlitztem Bauch, das sich am Boden in seinen Eingeweiden und Exkrementen wälzte, und inmitten von alldem Kehlbrand, mein Bruder, mit hoch erhobenem Haupt.
Wie immer in der Schlacht trug er keinen Helm. Sein langer Zopf wirbelte herum, während er gegen mehrere Feinde gleichzeitig kämpfte. Es mussten mindestens ein Dutzend sein; ihre Rüstungen zeigten das Wappen des Rotvogels, das sie als Angehörige des Rikar-Skelds auswies, unseres verhasstesten Gegners. Wieder und wieder griffen ihn seine Feinde an, und er tötete einen nach dem anderen mit seinem Säbel. Mein Bruder bewegte sich wie in einem Tanz, wich geschleuderten Lanzen aus, duckte sich unter Schwerthieben hindurch und ließ eine Spur aus Leichen hinter sich. Er schien unbesiegbar, unaufhaltsam, und mein Herz schwoll vor Stolz an, trotz des Albtraums, der uns umgab. Doch, wie ich danach noch öfter erfahren musste: Kein Krieger ist gänzlich unbesiegbar.
Gerade als Kehlbrand seinen letzten Gegner fällte, einen breitschultrigen Kerl mit groben Gesichtszügen und einer Augenklappe, tauchte ein Bogenschütze der Rikar in den Staubwolken auf. Auf einem weißen Hengst galoppierte er heran, beugte sich tief aus dem Sattel und zielte mit geübtem Blick. Ich rief meinem Bruder eine Warnung zu, doch obwohl ich mit ganzer Kraft schrie, hörte er mich nicht. Im Wahrtraum ist der Träumer Zeuge, aber nicht Beteiligter.
Der Pfeil traf Kehlbrand von hinten in den Hals und durchbohrte ihn, sodass die Stahlspitze vorne ein paar Zoll herausragte. Hätte er einen Helm getragen, hätte er vielleicht überlebt. Er stolperte kurz und starrte mit seltsamem Gleichmut auf die blutrote Spitze. Leichte Überraschung lag auf seinem Gesicht. Dann stürzte er zu Boden und hauchte sein Leben aus.
Ich erwachte schreiend – sehr zur Verärgerung der anderen Kinder. Zwei Tage später traf die Kunde ein, dass die Rikar einem unserer Jagdtrupps aufgelauert hatten und eine Schlacht nötig sei, um die Beleidigung wiedergutzumachen. Ich suchte Kehlbrand auf, der sich mit den anderen Kriegern auf den Kampf vorbereitete. Es war Tradition, dass die Krieger vor dem Aufbruch kleine Geschenke von ihren Angehörigen erhielten, ich erregte daher keine Aufmerksamkeit, als ich mich meinem Bruder näherte. Er betrachtete mich mit amüsierter Überraschung, wusste er doch, dass ich mich von derlei Anlässen sonst eigentlich fernhielt.
»Danke, kleines Fohlen«, sagte er, als ich ihm eine Holzfigur in die Hand drückte: ein selbstgeschnitztes Pferd. Im Schnitzen bin ich, wie ich in aller Bescheidenheit behaupten möchte, schon immer recht geschickt gewesen. »Das ist sehr hübsch …«
Er verstummte, als ich näher herantrat, mich auf die Zehenspitzen stellte und die Arme um seinen Hals legte. »Wenn du den Mann mit der Augenklappe getötet hast, dreh dich um«, flüsterte ich ihm ins Ohr. »Achte auf den Bogenschützen auf dem weißen Pferd.« Ich ließ ihn los und wandte mich zum Gehen, drehte mich dann aber noch einmal um. »Und in Zukunft solltest du lieber einen Helm tragen.«
Mit hämmerndem Herzen lief ich davon. Von dem Wahrtraum hatte ich niemandem erzählt und hatte auch nicht vor, es in Zukunft zu tun. Andere mochten beim kleinsten Anzeichen einer göttlichen Gabe zu den Priestern rennen und ihnen die frohe Kunde überbringen. Aber ich wusste es besser.
Sieben Tage später kehrten die Krieger zurück, während ich in meinem Zelt saß und mit tränenfeuchten Augen durch die offene Klappe nach draußen starrte. Ich weiß noch, dass es mich kaum überraschte, als Kehlbrand auftauchte und sich neben mich setzte. Stattdessen verspürte ich nur grimmige Gewissheit. Mein Bruder war ein waschechter Krieger der Stahlhast, und seine Pflicht war eindeutig. War bei jemandem eine göttliche Gabe zu erkennen, so musste er zum Großen Felsen gebracht und den Priestern übergeben werden.
Kehlbrand betrachtete mich für eine Weile schweigend. Seine Miene war eher nachdenklich als ehrfürchtig. Schließlich sagte er fast tonlos: »Den weißen Hengst habe ich behalten. Als Geschenk für dich.«
Ich nickte und schluckte. Meine Kehle war trocken wie Sand. »Ich werde darauf reiten, wenn du mich zu den Priestern bringst«, sagte ich mit dünner Stimme.
»Warum sollte ich das tun, kleines Fohlen?«, fragte er und umfasste mein Kinn.
»Sie werden es herausfinden. Sie finden es immer heraus …«
»Psst.« Mit dem Daumen wischte er die Tränen weg, die aus meinen Augen quollen, und griff in seinen Rucksack. »Ich habe noch ein Geschenk für dich.«
Der Zahn war lang und weiß und an einer silbernen Kette befestigt. In die Oberfläche waren winzige schwarze Buchstaben eingraviert. Ich erkannte die Schrift der Kaufmannskönige, konnte sie jedoch nicht entziffern. »Aus dem Maul eines weißen Tigers«, sagte Kehlbrand. »Vor einiger Zeit suchte ich eine alte Frau im nördlichen Ödland auf, die sich angeblich mit dem göttlichen Blut auskannte. Sie schwor, mit dieser Kette ließe sich die Gabe vor den Priestern verbergen, und hat mir drei Pferde und ein Goldnugget dafür abgeknöpft. Wie du habe auch ich befürchtet, die Priester könnten mich holen kommen, wenn sich die Gabe je in meinem Blut bemerkbar machte. Da das wohl nie passieren wird«, sagte er und legte mir die Kette um den Hals, die sich metallisch kalt an meine Haut schmiegte, »schenke ich sie jetzt dir.«
Aber selbst das, obwohl es uns einander näherbrachte und uns wahrhaft zu Bruder und Schwester machte – mehr als die Tatsache, dass uns dieselbe Mutter geboren hatte –, war noch nicht der Knoten, der uns endgültig verbinden sollte. Das geschah erst an dem Tag, als der Mestra-Dirhmar, der Große Priester, vor den Augen der versammelten Skelds unseren älteren Bruder tötete.
»Bezeugt das Urteil der Unsichtbaren!«, rief der alte Mann und hob mit knochigen Fäusten das Messer über den Kopf. »Und erkennt, was sie euch lehren! Gnade ist Schwäche! Mitleid ist Feigheit! Weisheit ist Lüge! Ist das Blut schwach, dann lasst es fließen!«
Tehlvar, unser Bruder, lag nackt auf dem Altar. Sein bleicher, groß gewachsener Körper zeugte von den vielen Schlachten, an denen er in seinem Leben teilgenommen hatte. Seine wohlgeformten Muskeln waren von zahllosen Narben übersät. Er zuckte nicht einmal, als das Messer über ihm schwebte. Der Priester wartete, bis der Schatten, den der majestätische Große Fels warf, verschwand und die Sonne genau über dieser Stelle in der Eisensteppe stand. Dann stieß er die gebogene Klinge, in der sich die Mittagssonne spiegelte, nach unten. Sorgsam gezielt, durchbohrte sie direkt Tehlvars Herz. Ein Zittern durchlief den Körper meines Bruders, dann lag er still da.
»Druhr-Tivarik!«, sagte der Mestra-Dirhmar, zog mit angestrengtem Knurren die Klinge aus Tehlvars Körper und hielt sie hoch. Das Blut floss seinen Arm hinab und strömte über seinen nackten Oberkörper. Als Abkömmling des göttlichen Blutes stand ich in den Reihen der Auserwählten zwischen den beiden gewaltigen Steinen, die den östlichen Durchgang bildeten. Ich befand mich nah genug am Altar, um die Ermordung meines Bruders in allen düsteren Einzelheiten mitzuerleben. Ich sah, wie das Blut über die schlaffen Muskeln auf der Brust des Priesters und seine spitz hervortretenden Rippen lief. Wie konnte jemand, der so alt und schwach war und nie eine Schlacht gesehen hatte, einen mächtigen Krieger wie Tehlvar töten?
Er ist der Mestra-Dirhmar, erinnerte ich mich und senkte den Blick, so wie die tausend anderen, die gekommen waren, um dem heiligen Ritual beizuwohnen. Er spricht für die Unsichtbaren. Doch die Worte fühlten sich leer an, meine Unterwürfigkeit war lediglich die einstudierte Reaktion eines abgerichteten Hundes. Während ich gemeinsam mit den versammelten Würdenträgern von hundert Skelds auf die Knie sank und den Kopf zur Erde neigte, regte sich unter meinem Gehorsam ein trotziger Gedanke: Er ist nur ein schwacher alter Mann. Tehlvar war besser.
Dazu muss ich sagen, lieber Leser, liebe Leserin, dass ich Tehlvar nie geliebt hatte. Ich war dreizehn Jahre jünger als er und kannte nur seinen Ruf. Und was für ein Ruf das war! Es hieß, er hätte mehr als fünfzig Männer im Kampf getötet, bevor er zum Skeltir aufstieg. Unter seiner Herrschaft erlangte der Cova-Skeld erst seine Vormachtstellung. Seinem Mut und seiner Leistung in der Schlacht der drei Flüsse ist es zu verdanken, dass die ketzerischen Verräter am göttlichen Blut getötet oder gefangen genommen wurden. Auch wenn einige Konflikte bestehen blieben, waren viele Skelds der Stahlhast inzwischen Verbündete statt Gegner. Dennoch fiel Tehlvar dem Messer des Großen Priesters zum Opfer.
Er wurde zum Felsen gerufen, um die letzte der Drei Fragen zu beantworten und den Segen als Mestra-Skeltir zu erhalten: als Oberhaupt der Hast. Zweimal hatten die Priester ihn schon geholt, um eine Frage zu beantworten, und jedes Mal hatte er eine zufriedenstellende Antwort gegeben. Nicht allen Skeltiren wird eine solche Ehre zuteil, nur den ruhmreichsten. Manchmal vergingen Jahre, ohne dass eine Frage gestellt wurde, und lediglich vier andere Skeltire in der langen Geschichte der Hast hatten jemals zwei Fragen richtig beantwortet, und noch nie einer die dritte. Lange schon warteten wir auf die Ankunft des Mestra-Skeltir, des Anführers, der unsere Herrschaft nicht nur auf die Eisensteppe, sondern auch auf die reichen Länder der Kaufmannskönige im Süden ausweiten würde.
Doch Tehlvars Antwort, allein vor der Gemeinschaft der Priester gesprochen, fern von den Ohren der versammelten Menge, hatte anscheinend nicht genügt. Er war ein Druhr-Tivarik, in seinen Adern floss göttliches Blut, so wie in meinen, doch es hatte sich als schwach erwiesen. Ist das Blut schwach, dann lasst es fließen.
»Kehlbrand Reyerik!«, rief der Mestra-Dirhmar, senkte das Messer und deutete mit der Klinge auf meinen Bruder, der neben mir kniete. »Steh auf und empfange die Weihe!«
Als sich mein Bruder erhob, musste ich gegen den Drang ankämpfen, ihn zurückzuhalten. Obwohl ich damals noch jung war und an die Lügen der Priester glaubte, wusste ich dennoch, dass seine Wahl eher ein Fluch als ein Segen war. Hätte ich in dieser Situation etwas unternommen, dann wäre das allerdings mein Tod gewesen – und kein rascher Tod wie bei Tehlvar. Sich in die Rituale der Priester einzumischen, wurde mit schwerer Folter bestraft. Vielleicht war es also Furcht, die mich damals innehalten ließ. Ich habe nie behauptet, sonderlich mutig zu sein. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Wie die meisten Anwesenden wollte ich, dass es Kehlbrand war. Ich wollte miterleben, wie der wahre Mestra-Skeltir seinen Platz einnahm. Deshalb habe ich ihn nicht zurückgehalten, jedenfalls nicht damals. Das kam erst später.
»Nach dem Blutrecht bist du jetzt Skeltir des Cova-Skelds«, sagte der Priester zu Kehlbrand. »Wie es die Ewigen Gesetze vorschreiben, werden morgen früh Kämpfe stattfinden. Wenn dich ein Krieger von angemessenem Rang besiegt, wird er deinen Platz als Skeltir einnehmen.«
Mit ernster Miene neigte Kehlbrand den Kopf und hob ihn dann wieder, um den Priester erwartungsvoll anzuschauen. Ich sah, wie das Gesicht des alten Mannes vor Wut und Widerwillen rot anlief. Er hätte einfach schweigen können. Mein Bruder war gerade erst Skeltir geworden, es bestand keine Notwendigkeit, ihm sofort die erste Frage zu stellen. Außer dass Kehlbrand längst ruhmreicher war als die meisten anderen, denen eine solche Ehre zuteil geworden war – wie die Mitglieder der Hast nur zu gut wussten.
Der Priester fletschte die gelben Zähne zu einem höhnischen Lächeln, bevor er wieder eine Maske pflichtbewusster Gewissheit aufsetzte. »Wenn du morgen früh überlebst«, sagte er, »dann kehre eine Stunde vor Mittag hierher zurück, um die erste Frage der Unsichtbaren zu beantworten.«
Er ließ den Arm sinken und wandte sich Tehlvars Leiche zu. Sein Gesichtsausdruck bildete einen merkwürdigen Kontrast zu der Maske, die er eben noch zur Schau gestellt hatte. Jetzt wirkte er viel älter – Trauer und Bedauern lagen in seinem Blick, bevor er sich abwandte und mit den niederen Priestern davonschritt.
Allzu ausgedehnte Rituale sind meinem Volk zuwider, und bald schon waren die Vertreter der hundert Skelds zu ihren jeweiligen Lagern zurückgekehrt. Kehlbrand blieb jedoch noch, und ich ebenfalls. Er ging zum Altar und legte unserem Bruder eine Hand auf die Stirn. Mit geschlossenen Augen murmelte er ein paar Abschiedsworte. In den letzten Jahren war er oft an Tehlvars Seite gewesen und hatte dabei so viel Ruhm errungen, dass er ihn als Skeltir sogar hätte herausfordern können. Er hatte es jedoch nie getan.
Ein lautes Rülpsen ließ mich herumfahren. An einem Monolithen lehnte Obvar, mit einem Weinschlauch in der Hand, und schaute mich fragend an.
»Er verabschiedet sich«, sagte ich und wandte mich ab.
»Das fromme Arschloch ist tot«, brummte Obvar und trat zu mir. »Er hört’s nicht mehr, also wozu das Ganze?«
Offenbar eine rhetorische Frage, denn er wartete meine Antwort gar nicht erst ab, sondern hielt mir den Weinschlauch hin. »Willst du?«
Obvar bot mir ständig etwas zu trinken an und darüber hinaus noch andere Dinge. Die Hänseleien unserer Kindheit waren vor ein paar Jahren in ein anderes Interesse übergegangen. Dabei hatte er mir als Tyrann noch besser gefallen denn als Verehrer. Die strikte Ablehnung, die mir auf der Zunge lag, schluckte ich jedoch hinunter, als ich seinen Blick sah. Diesmal lag keine Begierde darin. Im Gegensatz zu Kehlbrand hatte der Größenabstand zwischen uns im Laufe der Jahre zugenommen, und ich musste hochschauen, um seinen Gesichtsausdruck deuten zu können. Er wirkte ausnahmsweise einmal besorgt statt lüstern.
»Gib her«, sagte ich und nahm den Weinschlauch. Der erste Schluck ließ mich überrascht blinzeln. Statt des schweren, blumigen Beerenweins, der bei den Hast sonst getrunken wurde, war dieser viel leichter. Er war reichhaltig und vielfältig, mit einem angenehm erdigen Aroma, und rann wunderbar weich die Kehle hinunter.
»Der ist nicht grad billig, weißt du«, sagte Obvar stirnrunzelnd, als ich einen weiteren großen Schluck nahm.
»Was ist das?«, fragte ich und reichte ihm den Weinschlauch zurück.
»Ich kenne seinen Namen nicht. Er wird aus einer Frucht hergestellt, die in einem fernen Land weit übers Meer wächst. Jedenfalls hat der Kaufmann, dem ich den Wein abgenommen habe, das erzählt. Ich habe ihn am Leben gelassen, unter der Bedingung, dass er nächsten Sommer wiederkommt und noch mehr davon mitbringt. Hab ihm gesagt, ich würde ihn sogar dafür bezahlen. War das nicht nett von mir?«
»Hast du auch die anderen in seiner Karawane am Leben gelassen?«
»Die Jüngeren.« Er zuckte mit den Schultern und trank einen Schluck. »Sklaven sind wertvoll.«
»Du bist widerlich, Obvar.« Die Schärfe deutlicher Abneigung lag in meiner Stimme. Der Weinschlauch hielt auf dem Weg zu seinem Mund kurz inne, und seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
»Achtzehn Sommer alt und noch nicht verheiratet«, sagte er und trat näher heran. Die vertraute Begierde kehrte in seine Züge zurück. »Deine flinke Zunge ist wie immer messerscharf. Ich frage mich, was sie sonst noch so kann.«
Ich maß ihn mit geringschätzigem Blick. Ich hatte keine Angst vor ihm und sah keine Notwendigkeit, das Langmesser in meinem Gürtel zu ziehen. Immerhin war ich eine Druhr-Tivarik. Hatte er sich für die Hänseleien in unserer Kindheit höchstens eine Tracht Prügel eingefangen, so würde eine Beleidigung oder Verletzung nun, da ich im gebärfähigen Alter war, Entehrung und qualvolle Hinrichtung nach sich ziehen. Während wir einander anstarrten und sich der Moment in die Länge zog, fragte ich mich allerdings, ob seine Begierde heute nicht doch über seine Vorsicht siegen würde.
»Wenn dein Bruder der Mestra-Skeltir wird«, nuschelte er mit gebleckten Zähnen, »dann werden wir alle unterwerfen. Wir werden die Länder der Kaufmannskönige bis zum Goldmeer verwüsten, und ich werde in jeder Schlacht an seiner Seite sein. Und wenn das ruhmreiche Gemetzel vorbei und der letzte Blutstropfen geflossen ist, wird er mich fragen, welche Belohnung ich mir für meine Dienste erbitte. Was glaubst du, was ich dann sagen werde?«
»Luralyn.«
Wir schauten zum Altar hin. Kehlbrand stand gegen den Stein gelehnt da und betrachtete Tehlvars Leiche. »Ich hätte gerne deinen Rat«, sagte er und wandte sich dann an Obvar. »Sattelbruder, geh und stille deinen Appetit an einer Sklavin. Lass meine Schwester in Ruhe. Und betrink dich nicht allzu sehr. Morgen früh brauche ich vielleicht dein Schwert.«
Obvar versteifte sich, und ich sah Ärger über seine schmalen, bärtigen Züge huschen. Er fasste sich jedoch sogleich wieder und stieß ein ergebenes Seufzen aus. Sie waren zwar Sattelbrüder, aber Kehlbrand war jetzt der Skeltir.
»Hier«, knurrte Obvar und drückte mir den Weinschlauch in die Hände. »Ein Zeichen meiner Wertschätzung für die Schwester meines Skeltirs.«
Daraufhin stapfte er zum Lager unseres Skelds davon, und ich musste einen Anflug von Mitleid für die arme Sklavin unterdrücken, die an diesem Abend sein Interesse wecken sollte. Sklaven gehören nicht zu den Hast, wiederholte ich im Geiste eines der Ewigen Gesetze, während ich zu Kehlbrand an den Altar trat. Und alles, was nicht zu den Hast gehört, ist Beute.
»Trink einen Schluck«, sagte ich und reichte meinem Bruder den Schlauch. »Der Wein ist gar nicht mal schlecht.«
Er überging mein Angebot und musterte weiter die schlaffen, leeren Gesichtszüge unseres Bruders. Die Lippen des Toten hatten sich zurückgezogen und enthüllten seine Zähne im Spottbild eines Grinsens. Um den Anblick nicht länger ertragen zu müssen, beugte ich mich über den Weinschlauch und nahm noch einen kräftigen Schluck.
»Weißt du, warum die Priester ihn getötet haben, Luralyn?«, fragte Kehlbrand. Wie üblich klang seine Stimme sanft. Mein Bruder schrie nur selten. Selbst während der Duelle, die ich ihn hatte kämpfen sehen, hatte er stets ruhig, fast schon im Flüsterton gesprochen. Dennoch waren seine Worte immer klar zu verstehen.
»Er hat die Frage falsch beantwortet«, erwiderte ich und wischte mir mit dem Ärmel meines schwarzen Baumwollgewands den Mund ab.
»Ich höre keine Trauer in deiner Stimme, kleines Fohlen«, sagte Kehlbrand und drehte sich zu mir um. »Hast du unseren Bruder denn nicht geliebt? Bricht dir sein Tod nicht das Herz?«
Ein zufälliger Zeuge hätte das als ernste Frage verstanden, gefärbt von Trauer über meine offenkundige Gleichgültigkeit. Ich hingegen kannte meinen Bruder gut genug, um den sanften Spott in seiner Stimme zu erkennen.
»Wir stammen aus demselben Schoß«, sagte ich, »hatten jedoch nicht denselben Vater. Ich habe Tehlvar nicht sehr gut gekannt. Aber …« Ich hielt inne und betrachtete die Leiche auf dem Altar. Wieder faszinierten mich seine unzähligen Narben, manche längst verheilt, andere kaum ein paar Wochen alt. Ich wusste, dass Kehlbrands Körper fast gänzlich narbenfrei war. »Es tut mir trotzdem leid, dass er tot ist. Er war ein guter Skeltir, auch wenn er es mit dem Rezitieren der Priesterlehren immer etwas übertrieben hat.«
»Die Priesterlehren«, sagte Kehlbrand und nickte langsam. »Er liebte ihre Lektionen. ›Ich habe die Eisensteppe schon öfter verlassen, Bruder‹, hat er mir mal erzählt. ›Dort draußen leben die Menschen in Unsicherheit und Verwirrung. Sie feiern Schwäche und schwelgen in Gier. Sie machen aus dem Lügen eine Tugend und aus Ehrlichkeit eine Sünde. Wenn der Mestra-Skeltir sich erhebt, wird er all das mit Blut fortwaschen. Die Priester haben es so vorausgesehen.‹«
Er verstummte, legte eine Hand über Tehlvars trübe Augen und schloss seine Lider. »Aber du irrst dich, kleines Fohlen. Sie haben ihn nicht wegen seiner Antwort getötet. Sondern weil er ihnen keine gegeben hat. Er war nicht der Mestra-Skeltir, und das wusste er auch.«
»Er hat Platz für dich gemacht«, sagte ich.
»Ja. Das hat er mir letzte Nacht gesagt. Wir haben uns lange unterhalten, und er hat mir vieles erzählt. Unter anderem hat er mir die Frage genannt, die sie mir morgen stellen werden, und die nächste, die ein Jahr später folgen wird, sollte ich diese erste richtig beantworten.«
Entsetzt starrte ich ihn an. Beinahe wäre mir vor Schreck der Weinschlauch entglitten. Ich musste noch einen Schluck nehmen, um sprechen zu können. »Er hat es dir verraten? Aber das ist Ketzerei!«
Kehlbrands Zähne, die sehr weiß und gerade waren, glänzten, als er ein seltenes Lachen hören ließ. »Beizeiten werde ich dir alles erzählen, was ich letzte Nacht erfahren habe, liebste Schwester. Dann wirst du erkennen, wie absurd deine Worte sind.«
Seine Fröhlichkeit legte sich, und er berührte meine Schulter. »Morgen werden sie mich nach meinem Namen fragen.«
»Aber den kennen sie doch schon: Kehlbrand Reyerik, Skeltir des Cova-Skelds.«
»Nein, sie wollen einen anderen Namen hören. Einen, der eines Mestra-Skeltirs würdig ist. Einen, den die Soldaten der Kaufmannskönige voller Furcht flüstern werden, wenn sie die Hufe der Stahlhast über die Steppe donnern hören. Einen Namen, der uns bis zum Goldmeer und darüber hinaus führen wird.«
Lächelnd streichelte er meine Wange. Ich sah Bedauern in seinem Blick und auch Schuldgefühl, denn er wusste, was er mir mit seiner Bitte abverlangen würde. »Das brauche ich von dir: einen Namen. Luralyn, meine liebste Schwester, es wird Zeit, dass du wieder träumst.«
Auch wenn ich dagegen ankämpfte und es seit meiner Ankunft am Fels erfolgreich vermieden hatte, wanderte mein Blick nun unweigerlich zur Grabstätte. Sie befand sich in der Mitte des Halbkreises aus Monolithen am Großen Felsen. Ein schmuckloser, grauer Steinbunker, zehn Schritt breit und zwölf Fuß hoch, mit einer Öffnung in der Ostwand. Die Öffnung war ein schwarzes Rechteck im grauen Stein, durch das kein Licht nach außen drang. Die Priester bewachten die Grabstätte nicht. Wozu auch? Niemand würde sie freiwillig betreten, es sei denn, es wurde so befohlen.
»Hab keine Angst«, sagte Kehlbrand, als er meinen Blick bemerkte. »Die Priester wissen nichts. Dafür haben wir gesorgt.«
»Sie werden es herausfinden«, sagte ich, unfähig, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. Unwillkürlich wanderte meine Hand unter mein Gewand und umschloss den Tigerzahn mit der Inschrift. »Selbst hiermit. Sie werden es herausfinden.«
»Du überschätzt ihre Fähigkeiten. Sie besitzen höchstens einen Bruchteil der Kräfte, deren sie sich brüsten. Ihre wahre Macht liegt in der Illusion, die sie erschaffen haben, um die Seelen der Menschen gefangen zu nehmen, und alle Illusionen verblassen mit der Zeit. Eine weitere Lektion, die Tehlvar mir letzte Nacht erteilt hat.«
»Sie werden Bescheid wissen!«, beharrte ich und ärgerte mich über die Tränen, die plötzlich in meine Augen traten. Seine Bitte kam mir wie Verrat vor, eine selbstsüchtige Forderung, die das Vertrauen zwischen uns verletzte. Im ganzen Skeld, unter all meinen Geschwistern und Vettern, die ebenfalls von göttlichem Blut waren, kannte er als Einziger die Wahrheit. Sollten die Priester je dahinterkommen, würde ich durch die schwarze Öffnung gehen, und die, die danach wieder herauskam, würde nicht mehr ich sein.
»Sie werden mich zwingen …«
Meine Stimme versagte, als er mich an sich zog und seine Arme wie die Äste eines mächtigen Baums um mich legte. Später folgten noch andere Worte, andere Schwüre und Versprechen, aber inzwischen ist mir klar geworden, dass unser Bund mit dieser Umarmung besiegelt wurde. Von dem Moment an gehörte ich wahrhaft ihm. In seinen Armen verließ mich alle Furcht, und ich wusste, er würde niemals zulassen, dass mir etwas zustieß.
»Sollte einer der Priester etwas Derartiges versuchen, werde ich ihn eigenhändig töten«, flüsterte er mir ins Ohr. »Ich werde diesen Fels in Blut baden und ihre Köpfe auf Pfählen in einem Kreis um die Grabstätte aufstellen, damit alle Hast sie sehen können.« Er löste sich von mir und wischte mir die Tränen ab, so wie er es damals vor vielen Jahren getan hatte, nur dass er mir diesmal keine Ohrfeige gab. »Glaubst du mir das, kleines Fohlen?«
»Ja, Bruder«, sagte ich und drückte meinen Kopf an seine Brust, um dem ruhigen Schlagen seines Herzens zu lauschen. »Ich glaube dir.«
• • •
Einen Wahrtraum heraufzubeschwören, ist nicht weiter schwierig. Und es sind auch keine mystischen Rituale dafür nötig. Entgegen dem Glauben ungebildeter Kulturen braucht es weder Gesänge noch übelriechende Tränke oder das Opfern unschuldiger Tiere. In Wahrheit ist dafür, wie ich in den Jahren seit dem ersten Auftreten meiner Gabe herausgefunden hatte, nur ein sicherer und ruhiger Ort vonnöten. Deshalb verließ ich an dem Abend das Lager der Cova. Die Feierlichkeiten hatten schon früh begonnen, jeder Anstand wurde über Bord geworfen und die Angehörigen des Skelds konsumierten Unmengen von Alkohol und Schnupftabak und gaben sich hemmungslos sinnlichen Gelüsten hin.
Begleitet von Kehlbrand und zwei seiner vertrauenswürdigsten Sattelbrüder ließen wir das laute Fest hinter uns und ritten zwischen den Zelten hindurch in die Weite der Eisensteppe hinaus. Als wir fünf Meilen unter den Sternen geritten waren, erreichten wir eine kleine Anhöhe in der ansonsten flachen Landschaft. Dort errichteten die beiden Krieger ein Zelt, banden ihre Pferde mit langen Leinen an ihren Handgelenken fest und zogen sich in respektvolle Entfernung zurück. Einer schaute nach Osten, der andere nach Westen. Beide hielten ihre Bögen in den Händen und hatten einen Pfeil auf die Sehne gelegt. Ich wusste nicht, ob Kehlbrand ihnen erzählt hatte, was in der Nacht geschehen würde, aber falls ja, dann würden sie nicht darüber sprechen. Wer Kehlbrands Freundschaft gewonnen hatte, war ihm bedingungslos treu.
»Falls dir langweilig wird«, sagte ich und reichte meinem Bruder Obvars Weinschlauch.
»Ah«, sagte er nach einem kleinen Schluck und hob anerkennend die Augenbrauen. »Den kenne ich. Er wird von den Barbaren jenseits des Breiten Meeres aus einer Frucht namens Weintraube gemacht. Sie leben in einem Königreich, das von endlosen Kriegen und vernunftlosem Aberglauben beherrscht wird.« Er legte den Weinschlauch neben das kleine Feuer, das er entzündet hatte. »Sie werden noch froh über den Frieden sein, den wir ihnen bringen werden.«
»Du willst so weit reiten?«
»Ich will um die ganze Welt reiten. Haben die Priester nicht vorausgesehen, dass dies der Weg des Mestra-Skeltirs sein wird?«
Ich verdrehte die Augen und kroch in das Zelt. »Trink ihn nicht ganz aus.«
Ich zog mein Gewand aus Ochsenleder aus und legte mich auf die Felle, die Kehlbrands Sattelbrüder für mich ausgebreitet hatten. Wie immer wehte ein starker Wind über die Steppe und ließ die Zeltwände flattern. Es war ein vertrautes Geräusch, das mich nicht weiter störte, während ich in den friedlichen Geisteszustand verfiel, der den schwarzen Schleier und den Wahrtraum herbeiführen würde.
Nach meiner ersten Erfahrung damit war ich der Gabe lange Zeit ausgewichen, aus Furcht vor dem, was ich sehen würde, wenn sich der Schleier teilte. Aber Neugier – vielleicht die Angewohnheit, die am schwierigsten abzulegen ist – brachte mich doch wieder dazu, ihn zu erkunden. Anfangs waren meine Versuche nur selten von Erfolg gekrönt; im Wahrtraum erhaschte ich kurze Blicke auf Orte und Menschen, die in Kleidung und Sprache so fremdartig waren, dass ich damit nichts anfangen konnte. Erst nach einigem Herumprobieren entdeckte ich, dass der Wahrtraum ein Ziel braucht, eine Frage, die zur Wahrheit führt.
Der Name meines Bruders, flüsterte ich im Geiste, während sich der schwarze Schleier herabsenkte. Wie lautet er?
Prompt teilte sich der Schleier, und ich fand mich auf einer niedrigen Anhöhe wieder. Hohes Gras flüsterte im Abendwind. Der Himmel war von der Dämmerung gefärbt, und im flachen Tal unter mir sah ich zahlreiche Feuer. Ein Heer, erkannte ich und betrachtete die Zeltstadt, die um die Lagerfeuer errichtet war. An den Feuern saßen oder standen Menschen, und daneben waren Rüstungen und Waffen aufgestapelt, die sich von den schwarzen Eisenharnischen und Kettenhemden der Hast stark unterschieden. Die Rüstungen bestanden aus einander überlappenden Stahlplatten, und die Waffen waren Speere mit gebogenen Spitzen, wie sie von den Soldaten der Kaufmannskönige benutzt wurden. Es war das größte Heer, das ich je gesehen hatte, abertausende Mann stark.
»Wer bist du?«
Überrascht schaute ich hoch. Ein Dutzend Schritte entfernt stand eine Frau von fremdartiger Erscheinung. Ihr Gewand, eine bis zu den Knöcheln reichende schwarze Robe mit dem Wappen einer kleinen weißen Flamme auf der Brust, hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ihre Züge glichen nicht denen der Bewohner der Königreiche, stattdessen besaß sie die blauen Augen und die bleiche Haut der Stahlhast. Am meisten verwunderte, ja schockierte mich aber die Tatsache, dass sie mich direkt anschaute. Sie konnte mich sehen.
»Wer bist du?«, fragte sie erneut und betrachtete mit weit aufgerissenen Augen unsere Umgebung. »Wo bin ich?«
Ich konnte sie nur verblüfft anstarren. In früheren Wahrträumen hatte noch nie einer der Menschen, die darin vorkamen, meine Anwesenheit bemerkt. Wie sollten sie auch? Ich war ja nicht wirklich da.
»Hast du mich hierhergerufen?«, fragte die Frau und kam auf mich zu. Statt verwundert wirkte sie mit einem Mal verärgert. Ich rührte mich nicht. Unsicherheit lähmte mich, und ich war von der Tatsache abgelenkt, dass die Frau in der schwarzen Robe keine Schuhe trug. Ihre Füße waren schmutzig, und aus irgendeinem Grund faszinierte mich das.
»Das ist keine Vision des Vaters«, sagte die Frau, »sondern etwas anderes. Das spüre ich!«
Das Betrachten ihrer Füße und die Überraschung ließen mich zu spät reagieren, als sie mit festem Griff meine Arme packte. Ich erinnere mich, dass ihre Augen blutunterlaufen waren. Ihr Gesicht war eigentlich recht hübsch, ihre Haut glatt, wie bei einer Frau knapp über dreißig. Doch ihr dunkles Haar war ungekämmt, und ihr Atem roch leicht sauer, was ebenso wie ihre geröteten Augen nur einen Schluss zuließ: Eine Säuferin. Mein Traum wurde von einer Säuferin mit schmutzigen Füßen gestört.
»Versuche nicht, mich an der Nase herumzuführen, du Hexe!«, zischte sie. »Was für ein dunkler Zauber ist das?«
Es war der dünne, aber übelriechende Hauch ihres Atems, der mich aus meiner Starre erwachen ließ. Angewidert verzog ich das Gesicht, ließ meinen Kopf nach vorn schnellen und rammte meine Stirn gegen ihre Nase. Das hatte sofort die gewünschte Wirkung: Sie ließ mich los und sank stöhnend auf die Knie.
»Du hast gefragt, wer ich bin«, sagte ich, zog das Langmesser aus meinem Gürtel und hielt es ihr an den Hals. »Aber ich möchte zuerst deinen Namen erfahren.«
Mit Befriedigung sah ich, wie sich die Klinge in ihre Haut grub. Wenn wir einander berühren konnten, dann konnten wir uns anscheinend auch verletzen.
»Ich werde dir nichts erzählen, Dienerin des Dunklen«, sagte sie trotzig und mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Ich werde die Liebe des Vaters niemals verraten …«
Sie stieß einen leisen Schrei aus, als ich die Klinge rasch über ihre Wange zog und ihr einen schmalen, aber tiefen Schnitt beibrachte. »Wie kommst du hierher?«, fragte ich. »Wieso kannst du mich sehen? Wie bist du in meinen Traum gelangt?«
Schmerz und Feindseligkeit verschwanden für einen Moment aus ihren Zügen, und sie schaute mich verwundert an. »Du meinst … du bist auch eine Seherin? Aber … du kannst die Liebe des Vaters nicht kennen. Einer wie dir würde er eine solche Gabe niemals anvertrauen …«
»Welcher Vater?«, verlangte ich zu wissen und hielt die Spitze meiner Klinge so, dass sie nur einen Zoll von ihrem Auge entfernt war. »Was redest du da?«
In diesem Moment verschluckte der Klang zahlreicher Hörner meine Worte. Im Heer unten im Tal wurde Alarm gegeben. Ich hob den Blick und sah, wie die Soldaten auf das Signal reagierten. Sie rannten los, um ihre Speere zu holen und ihre Rüstungen anzulegen. Armbrustschützen griffen sich ihre Köcher, und Kavalleristen sattelten ihre angebundenen Pferde.
»Was ist da los?«, fragte die Frau. Mir wurde bewusst, dass ich immer noch das Messer auf ihr Auge gerichtet hielt, und ich trat zurück. Mit einem Mal kam mir das Ganze albern vor.
»Anscheinend eine Schlacht«, erwiderte ich und steckte das Messer ein.
»Wo?« Sie kam auf die Beine und rieb sich die Nase, wobei sie eine Grimasse zog. Der Bluterguss auf ihrer Nase verblasste bereits, und der Schnitt auf ihrer Wange schloss sich. Wunden, die wir einander hier zufügten, waren offenbar nicht von Dauer. »Wer kämpft da?«
»Ich bin mir nicht sicher.« Ich wandte mich um und beobachtete, wie das Heer Aufstellung nahm. »Vermutlich befinden wir uns irgendwo in der südlichen Steppe, nicht weit von der Grenze zu den Ländern der Kaufmannskönige.«
»Kaufmannskönige?«
Ich drehte mich zu ihr um und runzelte verblüfft die Stirn. Sie klang so, als hätte sie tatsächlich keine Ahnung, wovon ich sprach. Aber wie konnte sie noch nie von den Kaufmannskönigen gehört haben? Es waren die reichsten Männer der Welt. »Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns einander vorstellen«, sagte ich.
Sie richtete sich auf und schob selbstgefällig das Kinn vor. »Ich bin Lady Ivinia Morentes aus der Westmark«, sagte sie. »Dienerin der Kirche des Weltvaters und heilige Seherin.« Sie hielt inne, vermutlich um eine dramatische Wirkung zu erzielen. »Bei denen, die in der Gunst des Vaters stehen, bin ich als Gesegnete Jungfrau bekannt.«
Verwundert schüttelte ich den Kopf, hob aber dennoch die Hand zum friedlichen Gruß. »Luralyn Reyerik vom göttlichen Blut, Tochter des Cova-Skelds von den Stahlhast.«
Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen hatte sie offenbar genauso wenig eine Vorstellung davon, wer ich war, wie ich davon, wer sie war. »Du bist …«, sie runzelte zweifelnd die Stirn, »eine Seherin in deinem Volk?«
»Seherin?«
»Du siehst … Dinge. Ereignisse, die in der Zukunft liegen oder die bereits geschehen sind.«
»Manchmal. Ich nenne es Wahrträume.«
»Träume.« Sie schnaubte verächtlich und wandte ihre Aufmerksamkeit dem sich sammelnden Heer zu. »Nein, Mädchen, das sind keine Träume. Es sind Einblicke, die der Vater uns schenkt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum er sie ausgerechnet mit dir teilt.«
Ihr Tonfall ließ meine Hand erneut zu meinem Messer zucken, aber ich beherrschte mich. »Wo sind deine Schuhe?«, fragte ich stattdessen und nickte in Richtung ihrer schwarzen Füße.
»Weltliche Bequemlichkeit steht der Liebe des Vaters im Weg«, sagte sie voll frommer Gewissheit. »Ich habe mich davon freigemacht und führe ein einfaches Leben, ohne den Reichtum und den Müßiggang der Schicht, in die ich hineingeboren wurde. Desto leichter fällt es mir, mich für die Einblicke zu öffnen, die der Vater mir gewährt.«
Ich betrachtete ihre blutunterlaufenen Augen und erinnerte mich an ihren stinkenden Atem. »Du verzichtest also auf die Bequemlichkeit von Schuhwerk, nicht aber auf Alkohol.«
Wut trat in ihr Gesicht, und sie antwortete barsch: »Bei den Ritualen der Kirche wird häufig Wein verwendet, und in den Büchern sind seine wohltuenden Eigenschaften vielfach beschrieben.«
»Ah«, sagte ich säuerlich, »dann bist du also eine Priesterin.«
Sie richtete sich ein wenig auf und verschränkte die Arme. In leicht verbittertem Ton erwiderte sie: »Frauen ist es nach dem Gebot des heiligen Vorlesers nicht erlaubt, das Priesteramt zu bekleiden. Aber ich diene der Kirche besser als jeder Mann. Während du«, sie warf mir einen abschätzenden Seitenblick zu, »offensichtlich eine Ketzerin barbarischer Herkunft bist. Vielleicht hat der Vater dich deshalb hierhergebracht, damit ich dich in seiner Liebe unterweise …«
»Ich habe ein Messer«, erinnerte ich sie und wandte mich dem Tal zu. »Lass uns einfach die Schlacht anschauen, ja? Ich vermute, das ist der Grund, weshalb wir hier sind.«
Das Heer hatte inzwischen nahezu vollständig Aufstellung genommen. Lange Reihen Infanterie waren mit Kompanien von Armbrustschützen durchsetzt, während sich die Kavallerie an den Flanken formierte. Das Tageslicht war inzwischen fast gänzlich geschwunden, und die Szenerie wurde von den Lagerfeuern und den Fackeln in den Händen der berittenen Offiziere erhellt. Abgesehen vom leisen Echo geschriener Befehle war es im Heer merkwürdig still. Angespannte Erwartung lag in der Luft. Ich spürte bei den Männern keinen Kampfeseifer, sondern allein Furcht.
Das Heer war nach Norden ausgerichtet, wo sich eine leere grasbewachsene Ebene in der Dunkelheit erstreckte. Bald spürte ich jedoch ein vertrautes Erzittern der Erde, gefolgt vom Murmeln heranrollenden Donners.
»Du hast mich nach meinem Volk gefragt«, sagte ich zu der Frau. »Du wirst es gleich kennenlernen.«
Das Donnern wurde immer lauter und kündete von einem Heer, das noch weitaus größer war als jenes, das sich vor uns auf der Eisensteppe versammelt hatte. Offenbar sahen sich die Soldaten der vereinten Kraft sämtlicher Skelds der Stahlhast gegenüber. Auch wenn ich mich jetzt, Jahre später, deswegen schäme, muss ich doch zugeben, dass mich die Aussicht mit freudiger Erwartung erfüllte.
Wie groß war deshalb meine Verwunderung, als das Donnern plötzlich verklang und auf der dunklen Ebene kein Heer der Stahlhast erschien. Ich spürte ihre Gegenwart, hörte das Atmen tausender Pferde und Krieger. Ihr Angriff war jedoch aus irgendeinem Grund zum Erliegen gekommen. Dann, nach einer kurzen Pause, tauchte im flackernden Fackelschein eine breite Linie aus etwa zweihundert Reitern auf. Ihre Pferde näherten sich gemächlich, fast schon unbekümmert der inzwischen vollzählig versammelten gegnerischen Armee. Viele der Reiter trugen die Kleidung von Stahlhast-Kriegern, andere dagegen waren völlig ungepanzert und besaßen keine Waffen. Einige, vielleicht ein Drittel, schienen gar nicht zu den Stahlhast zu gehören, sondern trugen die Steppjacken des Grenzvolkes.
Diese Reihe bunt gemischter Reiter blieb ein paar Schritte außerhalb der Reichweite der Armbrüste stehen und musterte die Tausende von Soldaten vor ihnen mit entschlossener Konzentration. Da spürte ich das Summen der Macht, wie ich es früher schon wahrgenommen hatte, wenn die Abkömmlinge des göttlichen Blutes ihre Gaben zum Einsatz brachten. Die Frau nahm es offenbar ebenfalls wahr.
»Das Dunkle«, hauchte sie mit furchtsamer Miene.
Ein lauter Chor von Schreien ließ mich wieder ins Tal hinabschauen, und ich sah mitten in der ersten Reihe des Heeres einen Feuerball aufsteigen. In Flammen gehüllte Menschen wälzten sich am Boden. Fünfzig Schritt weiter östlich wurde eine Gruppe Infanterie von etwa zwanzig Mann plötzlich zu Boden geworfen, als hätte sie die unsichtbare Faust eines Riesen getroffen. Ihre gepanzerten Leiber flogen wie Puppen durch die Luft. Noch mehr Schreie ertönten, als sich die gesamte erste Reihe des Heeres in Chaos auflöste. An einer Stelle stürzten die Soldaten einfach zu Boden und blieben still liegen, an einer anderen fielen sie unerwartet übereinander her und töteten sich in wildem Kampf gegenseitig. Währenddessen blühten überall weitere Feuerkugeln auf, und die unsichtbare Faust schlug wieder und wieder zu.
Bald breitete sich die Verwirrung auch in die nächsten Reihen aus, und die Offiziere rangen darum, die Ordnung aufrechtzuerhalten, während eine Kompanie nach der anderen angesichts der wachsenden Panik den Kopf verlor. In diesem Moment tauchten die Stahlhast auf. Die Reihe der bunt gemischten Reiter wich zur Seite, und eine gewaltige Menge berittener Krieger preschte in Pfeilformation und in vollem Galopp aus der Dunkelheit heran. An ihrer Spitze ritt eine großgewachsene Gestalt auf einem pechschwarzen Hengst, die einen Säbel mit langer Klinge hoch erhoben hielt. Der Mann trug einen Eisenhelm, der mit einem Busch aus langem Pferdehaar geschmückt war. Seine Gesichtszüge waren hinter einem Visier verborgen, aber ich erkannte ihn dennoch sofort.
Der Keil der Stahlhast traf auf die in Unordnung geratene Mitte des gegnerischen Heers und durchstieß sie – so wie heißes Eisen weiches Leder durchbohrt –, um in die panikerfüllten Reihen dahinter vorzudringen. Noch mehr Stahlhast-Krieger kamen aus östlicher und westlicher Richtung angeritten und bohrten sich tief in das Heer hinein. Innerhalb weniger Herzschläge war klar, dass die große Armee verloren war. Auf dem Talboden herrschte ein einziges Blutbad. Trotz des Durcheinanders und der Verwirrung fiel es mir seltsamerweise nicht schwer, den Weg des großgewachsenen Reiters auf dem schwarzen Hengst zu verfolgen. Er ritt in einer Schlangenlinie über das Schlachtfeld und hinterließ eine Spur von Toten und Sterbenden, während er unermüdlich seinen Säbel schwang. Heute füllen sich meine Augen mit Tränen, wenn ich an meinen damaligen Jubel zurückdenke, den Stolz, der beim Anblick des blutigen Rittes meines Bruders in mir anschwoll.
»Vater!«, rief die Frau neben mir und sank auf die Knie. Tränen strömten über ihr zitterndes Gesicht. »Warum hast du mich mit dieser Vision gestraft?«
»Ach, halt den Mund«, fuhr ich sie an, verärgert über die Ablenkung. »Du solltest dich freuen, dass dir die Ehre zuteilwird, das mitanzusehen. Denn genau so soll es sein. Der Mestra-Skeltir wird sich erheben, und nichts kann ihn aufhalten. So ist es lange schon vorhergesagt …«
Ich verstummte, als die großgewachsene Gestalt ihr Pferd zum Stehen brachte. Der Krieger blickte auf eine Gruppe vor ihm kniender Soldaten der Kaufmannskönige hinab, die ihre Waffen beiseitegeworfen und als Zeichen ihrer Unterwerfung die Köpfe zur Erde geneigt hatten. Einen Moment lang betrachtete mein Bruder sie reglos, dann ließ er seinen Hengst vorpreschen, dessen Hufe den Schädel eines der Knienden zerstampften. Gleichzeitig schwang er wieder seinen tödlichen Säbel.
Ich wandte mich ab, um das Schauspiel nicht mitansehen zu müssen. Die Stahlhast nahmen nur selten Gefangene im Kampf, das wusste ich. Die Überlebenden wurden höchstens zu Sklaven gemacht. Mein Bruder handelte also nicht ungewöhnlich. Warum aber hatte er innegehalten? Weidete er sich an der Furcht seiner Gegner?
»Gnade ist Schwäche«, flüsterte ich, in der Hoffnung, der häufig aufgesagte Spruch würde mein hämmerndes Herz beruhigen. »Mitleid ist Feigheit.«
Da spürte ich, wie sich der Wahrtraum aufzulösen begann. Der schwarze Schleier senkte sich wieder über meine Augen, während die Frau neben mir immer noch jammerte. »Warum, Vater? Warum hast du mir diesen Sieg einer Klinge im Dienst des Dunklen gezeigt? Dieses Omen völliger Zerstörung? Wie soll das Heilige gegen solche Bosheit bestehen?«
Der Schleier schloss sich, und die Frau war verschwunden, vielleicht erwachte sie nun wieder in ihrem eigenen Land; womöglich lamentierte sie aber auch bis in alle Ewigkeit im Wahrtraum weiter. Ich weiß nur, dass ich sie nie wiedergesehen habe, weder im Traum noch in Wirklichkeit.
Kehlbrand wartete vor dem Zelt auf mich. Im Schneidersitz saß er am Feuer, und sein Schatten wurde von der aufgehenden Sonne in die Länge gezogen. Auch wenn mir der Traum kurz vorgekommen war, hatte er in Wahrheit mehrere Stunden gedauert. Einen Moment lang stand ich zitternd da, fröstelnd von der kühlen Morgenluft und dem Nachhall des verzweifelten Flehens der Gesegneten Jungfrau.
»Also, kleines Fohlen«, sagte Kehlbrand, stand auf und legte mir einen Wolfspelz um die zitternden Schultern. »Hast du einen Namen für mich?«
»Ja«, sagte ich und ließ mich von seinem Lächeln trösten, das immer schon die Kraft besessen hatte, alle Unsicherheit zu vertreiben. »Ja, Bruder. Den habe ich.«
• • •
Am nächsten Tag ging Kehlbrand zu den Priestern und trat nackt und unbewaffnet vor den Altar, wie es das Ritual verlangte. Gehorsam führten ihn die niederen Priester zum Mestra-Dirhmar, der vor der Grabstätte wartete.
Der Morgen war überraschend ereignisarm geblieben. Für gewöhnlich wurde ein neuer Skeltir von den ruhmreichsten Kriegern des Skelds zum Kampf herausgefordert, aber diesmal trat nur ein einziger an. Es war ein alter Mann namens Irhnar, ein Veteran von fast sechzig Sommern, der beinahe ebenso viele Schlachten geschlagen hatte und in Tehlvar und Kehlbrands Kindheit ihr Mentor gewesen war.
»Warum, alter Wolf?«, hatte Kehlbrand Irhnar gefragt, als dieser vorgetreten war und ihn mit erhobenem Säbel zum Kampf herausgefordert hatte.
»Es bringt Unglück, wenn ein Skeltir ohne Blutvergießen seine Herrschaft beginnt«, hatte der alte Krieger mit einem Schulterzucken gesagt. »Und ich habe es satt, jede Nacht sechsmal zum Pissen aufstehen zu müssen. Also, bringen wir es hinter uns, nicht wahr, Junge?«
Sie hatten gekämpft, und Kehlbrand hatte Irhnar mit einem angemessen blutigen und langen Tod geehrt. Ein rasches Ende wäre eine Beleidigung gewesen.
Nun sah ich Kehlbrand vor dem Mestra-Dirhmar stehen. Die Lippen des Priesters bewegten sich, während er seine Frage stellte. Die Entfernung war zu groß, als dass ich die Antwort meines Bruders hätte verstehen können. Das Gesicht des Priesters sah ich jedoch klar und deutlich. Und auch die Mischung aus Enttäuschung und grimmiger Ergebenheit, als er nickte. Wie immer hatte der Wahrtraum mich nicht in die Irre geführt.
Die niederen Priester brachten das dunkelgrüne Gewand eines Skeltirs und legten es Kehlbrand vor die Füße. Nachdem er es angezogen hatte, ging er mit dem Mestra-Dirhmar zum Altar.
»Hier steht Kehlbrand Reyerik!«, rief der Priester und hob den Arm meines Bruders. »Er wurde heute von den Dienern der Unsichtbaren als Skeltir des Cova-Skelds anerkannt!«
Aus der Menge der versammelten Angehörigen der Stahlhast ertönte ein Jubeln, das vor allem von den Cova stammte. Die anderen Skelds waren zurückhaltender. Während der Jubel anhielt, drehte mein Bruder sich zu dem Priester um und sagte etwas. Die Miene des Mestra-Dirhmar verhärtete sich, und er schüttelte in strikter Ablehnung den Kopf. Da sah ich, dass Kehlbrand das Handgelenk des Priesters packte – so fest, dass dieser zusammenzuckte. Als sich der Jubel gelegt hatte, sprach Kehlbrand erneut, und diesmal hörte ich seine Worte: »Sag es ihnen, alter Mann.«
Der Mestra-Dirhmar biss die Zähne zusammen. Durch Erniedrigung und Schmerz verzerrte sich sein Gesicht zur Grimasse. Selbst damals wusste ich schon, dass dies ein entscheidender Moment war – der Moment, in dem sich zeigte, wer der wahre Herrscher der Hast war.
»Hier steht Kehlbrand Reyerik!«, wiederholte der oberste Priester mit gefletschten Zähnen vor der Menge. Seine Worte waren von der Wut des Besiegten gefärbt. »Von nun an bekannt als die Dunkelklinge!«
Erstes Kapitel
Der Pfeil schlug nur einen Zoll von seinem Kopf entfernt in eine Kiefer ein. Vaelin Al Sorna musterte die Befiederung, die vor seinen Augen vibrierte. Er spürte ein Brennen an der Nase und ein Tröpfeln von Blut, wo die Widerhaken der Spitze ihn gestreift hatten. Er hatte den Schützen nicht gehört und auch nicht das verräterische Sirren der Sehne.
Einem zufälligen Betrachter wäre seine Reaktion schnell vorgekommen: Er rollte sich nach rechts ab, kam mit gezogenem Bogen auf die Knie und schoss in einer fließenden Bewegung einen Pfeil ab. Aber Vaelin selbst wusste, er war zu langsam. Obwohl sich der Pfeil direkt in den Rücken des Bogenschützen bohrte, der soeben weglaufen und ein Horn an die Lippen hatte heben wollen, nun jedoch tot zu Boden fiel. Zu langsam.
Neben ihm raschelte es im Farnkraut, und Ellese erschien, einen Bogen mit auf die Sehne gelegtem Pfeil in der Hand.
»Das Lager, Onkel«, sagte sie, etwas atemlos vor Eifer, und richtete sich auf. »Wir müssen uns beeil …«
Ihre Worte erstarben, als Vaelin ihr eine Hand auf den Mund legte und sie unten hielt. Gleich darauf schoss erneut ein Pfeil aus dem Blätterdach hinab und bohrte sich ein halbes Dutzend Fuß entfernt in den Waldboden. Ein Suchpfeil, hätte Meister Hutril es genannt. Immer nützlich, um seine Beute aufzuscheuchen. Aber heute nicht.
Vaelin schaute in Elleses dunkle, wütende Augen und sah zu den Baumwipfeln hoch, bevor er die Hand von ihrem Mund nahm. Er wird noch nicht das Horn blasen, bedeutete er ihr in der Zeichensprache, die er ihr in den letzten Monaten so mühevoll beigebracht hatte. Damit würde er seine Position verraten. Ich laufe nach rechts. Er drehte sich um und spannte die Muskeln an, um loszupreschen, hielt aber noch einmal kurz inne. Nicht danebenschießen.
Er sprang auf und rannte mit polternden Stiefeln über den Waldboden, in einer Schlangenlinie zwischen den Bäumen hindurch. Diesmal hörte er das Sirren der Bogensehne und warf sich hinter den breiten Stamm einer alten Eibe. Aus den Augenwinkeln sah er Rindensplitter aufspritzen. Eine Sekunde später war eine zweite Sehne zu hören, das Geräusch tiefer und von einer fast melodischen Präzision, die von der Kraft der Waffe und der Fähigkeit der Schützin zeugte. Kurz herrschte Stille, dann stürzte der Schütze aus großer Höhe tot herab und landete mit dumpfem Aufprall auf dem Waldboden.
Vaelin blieb hinter der Eibe und lauschte mit geschlossenen Augen dem Lied des Waldes. Es dauerte nicht lange, bis das Gezwitscher der Vögel, das angesichts der unliebsamen Eindringlinge verstummt war, wieder einsetzte. Im Wind lag nicht länger der Geruch schwitzender, furchtsamer Männer.
Er kam aus seinem Versteck und sah Ellese eilig die Leiche des Gesetzlosen absuchen, den sie mit ihrem Pfeil aus den Baumwipfeln geschossen hatte. Ihre Bewegungen waren schnell und geübt, und ihre Hände zitterten nicht, obwohl sie soeben einem Menschen das Leben genommen hatte. Vaelin wusste, dass sie auch in Cumbrael schon Menschen getötet hatte, während des kurzen und rasch niedergeschlagenen Aufstandes der Söhne der Wahrklinge. Es kümmert sie nicht, hatte Reva in dem Brief geschrieben, den sie zusammen mit ihrer Adoptivtochter nach Norden geschickt hatte. Und das wiederum kümmert mich sehr.
Das Mädchen besaß keinerlei Ähnlichkeit mit Reva, was nicht weiter überraschte, da sie nicht blutsverwandt waren. Elleses Haar war schwarz, und sie hatte dunkle Augen. Sie war vielleicht einen Zoll kleiner als Reva und etwas kräftiger gebaut. Doch die scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber dem Töten war eine Eigenschaft, die in ihrer Familie lag und die sie auch mit dem Mann teilte, den sie Onkel nannte.
»Blausteine«, sagte Ellese, warf den Geldbeutel des Toten beiseite und hielt eine Handvoll blau funkelnder Edelsteine hoch. »In Baumwolltuch gewickelt, damit sie nicht klappern.« Mit schiefgelegtem Kopf betrachtete sie die Leiche des Gesetzlosen. »Zumindest verstand er was von seinem Geschäft.« Sie schaute zu Vaelin hoch und grinste. »Aber nicht genug.«
Vaelin ging in die Hocke und nahm sich den Bogen des Mannes, eine flache Jagdwaffe, wie sie in allen Erzlehen des Reiches verwendet wurde, außer in Cumbrael. Hätte der Kerl einen Langbogen besessen und auch damit umgehen können, dann wäre Vaelin jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit tot.
»Untersuch seine Kopfhaut«, sagte er zu Ellese, die gehorsam dem Toten die Wollmütze abnahm. Darunter kam ein rasierter Schädel zum Vorschein. Mit dem Stiefel drehte Vaelin den Kopf der Leiche herum, bis er gefunden hatte, wonach er suchte: eine plumpe Tätowierung in der Form eines dunkelroten Flecks inmitten von grauen Haarstoppeln. »Die Blutspatzen«, sagte er und trat beiseite.
Der Gesetzlose, den er getötet hatte, lag etwa zwanzig Schritte entfernt mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Vaelins Pfeil ragte beinahe senkrecht aus seinem Rücken. Keuchend vor Anstrengung zog Vaelin den Pfeil heraus, dessen Widerhaken in der Wirbelsäule des Mannes feststeckten, und drehte ihn um.
»Jumin Vek«, sagte er, nachdem er das fleckige, pockennarbige Gesicht kurz betrachtet hatte.
»Du kennst ihn?«, fragte Ellese.
»Allerdings. Ich habe ihn vor vier Jahren auf Befehl der Königin gefangen genommen. Er hatte in Renfael eine Spur aus Mord, Vergewaltigung und Diebstahl hinterlassen, bevor er in den Nordlanden aufgetaucht ist. Ich habe ihn auf ein Schiff verfrachtet, damit sie ihn in Frosthafen hängen könnten.«
»Anscheinend ist ihm die Flucht gelungen.«
Oder er hat sich freigekauft, dachte Vaelin. Das kam inzwischen immer häufiger vor. In den Nordlanden gab es so viel zu stehlen und zu schmuggeln, dass die Gesetzlosen kaum noch Mühe hatten, durch Bestechung straffrei davonzukommen. Als Turmherr und von der Königin eingesetzter Wächter über dieses Land musste Vaelin so oft die Schurken des Reiches wieder einfangen, dass er es mit dem königlichen Verbot der sofortigen Tötung bisweilen nicht mehr ganz so genau nahm.
»Noch ein Blutspatz?«, fragte Ellese.
»Nein.« Vaelin nahm Jumin Veks Mütze ab, und darunter kam ein dunkler, fettiger Haarschopf zum Vorschein. Er packte das Kinn des Mannes und drehte seinen Kopf herum. An seinem Hals kam ein kompliziertes Bild zum Vorschein, das in seine bleiche Haut tätowiert war. »Die Verfluchten Ratten. Ehemalige Soldaten des königlichen Heers, die unehrenhaft entlassen wurden.«
»Wir haben es also heute mit zwei Banden zu tun?«
»Das bezweifle ich. Lord Orven hat einen Großteil der Blutspatzen im letzten Winter ausgelöscht. Anscheinend haben die Ratten ein paar Überlebende bei sich aufgenommen.«
Er erleichterte den glücklosen Jumin Vek um seinen Geldbeutel und fand zwei Goldnuggets und ein paar Blausteine darin.
»Deine Nase blutet, Onkel«, stellte Ellese fest, als er sich wieder aufrichtete.
Vaelin nahm ein Tuch von seinem Gürtel, tränkte es mit Corrbaum-Öl aus einer kleinen Flasche und drückte es auf den Schnitt an seiner Nase. Er musste ein schmerzerfülltes Stöhnen unterdrücken, als das Mittel brennend in die Wunde sickerte. In seiner Jugend hatte es nicht ganz so wehgetan, oder irrte er sich da?
»Hol die anderen«, sagte er zu Ellese und schüttete sich Wasser aus seiner Feldflasche übers Gesicht, um das restliche Blut abzuwaschen. »Wir treffen uns am Rand der Schlucht wieder. Und, Ellese«, fügte er hinzu, als sie sich abwandte. »Die Blausteine.«
Er streckte die Hand aus und sah ihr in die Augen, bis sie ihm mit verärgertem Schnauben die Steine reichte. »Ich jage Abschaum und werde nicht mal dafür bezahlt«, murmelte sie.
»Deine Mutter hat dich hergeschickt, damit du was lernst. Wenn du dir bezahlte Arbeit suchen willst: In der Nordgarde oder in den Minen werden immer Leute gebraucht. Nach dem Gesetz gehören Blausteine und Gold so lange der Königin, bis sie verkauft werden. Das weißt du.« Er steckte die Steine ein und winkte sie fort. »Und jetzt los!«
• • •
Das Lager der Gesetzlosen befand sich an der Ostwand von Ultins Schlucht auf einer halbrunden Freifläche, die von einer Palisade umschlossen war. Der Ort trug den Namen eines der berühmtesten Minenarbeiter der Nordlande, den Vaelin noch vom Befreiungskrieg her in angenehmer Erinnerung hatte.