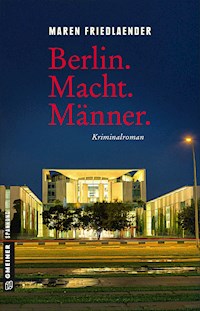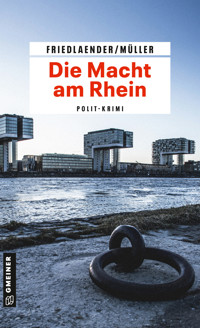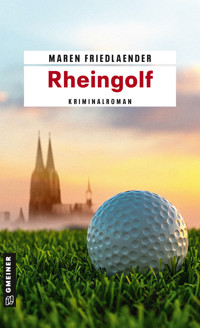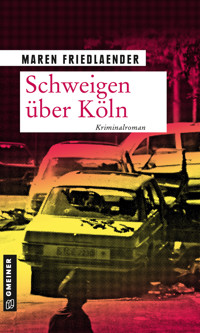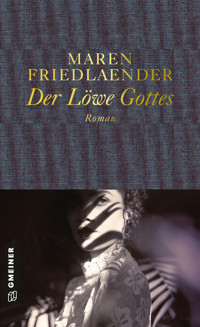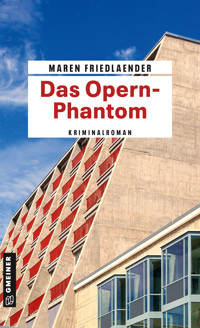
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Theresa Rosenthal
- Sprache: Deutsch
Eine prominente Journalistin liegt tot im Kölner Südpark. Alle Anzeichen deuten auf eine Überdosis Heroin hin. Mord - stellt Kommissarin Rosenthal fest. Eine Spur führt nach Berlin zum Ehemann des Opfers: Kulturstaatssekretär Ruppert. Und plötzlich gibt es eine Verbindung zum Pfusch bei der Kölner Bühnensanierung, wo bereits eine Milliarde Euro versickerte. Da könnte ein Mord sich lohnen. Als eine Mitarbeiterin des Baudezernats tot im Keller der Opernbaustelle liegt, führt eine heiße Spur in die Politik - und zur Mafia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maren Friedlaender
Das OpernPhantom
Kriminalroman
Zum Buch
Oper. Macht. Mord. Eine prominente Journalistin liegt tot im Kölner Südpark. Alle Anzeichen deuten auf eine Überdosis Heroin hin. Mord – stellt Kommissarin Rosenthal fest. Spuren führen nach Berlin zum Ehemann des Opfers: Kulturstaatssekretär Ruppert. Und plötzlich gibt es eine Verbindung zum Pfusch bei der Opernsanierung. Die einst für 2015 geplante Neueröffnung kündigte die Kölner Kulturdezernentin mit dem Satz an: „Das hat die Welt noch nicht gesehen“. Die Kosten addieren sich inzwischen auf eine Milliarde und noch immer ist keine Eröffnung in Sicht. Viel Geld versickert. Da könnte Mord sich lohnen. Was wusste der Vorsitzende des Freundeskreises der Oper und warum wird er überfallen? So viele Verdächtige, wundert sich die Kommissarin, so viele Verwerfungen in Familie, Beruf, im Freundeskreis, so viele Motive. Rosenthal rätselt noch, als eine Mitarbeiterin des Baudezernats tot im Keller der Opernbaustelle liegt. Eine heiße Spur führt in die politische Szene – und zur Mafia.
Maren Friedlaender, geboren in Kiel. Journalistin, unter anderem beim ZDF, Innenpolitik. Die Autorin lebt seit 37 Jahren in Köln und studierte dort Psychologie. Mit dem Fahrrad erobert sie ihre Wohnorte: Hamburg, Wiesbaden, Berlin, Köln – vom Fahrradsattel aus sieht man mehr. Die Entdeckung der Städte durch das Unterwegssein in verschiedenen Welten: schreibend und aktiv in der Politik, unter anderem Mitglied des Kölner Kulturausschusses. Die unterschiedlichen Einblicke in die politische Szene verarbeitete sie in den Krimis: „Berlin. Macht. Männer.“, „Die Macht am Rhein“ (mit Olaf Müller), „Rheingolf“, „Schweigen über Köln“ und „Das Opernphantom“. Ebenfalls bei Gmeiner erschien der Roman „Der Löwe Gottes“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oper_Köln,_Ansicht_Kleiner_Offenbachplatz-8415.jpg), Farbe, Kontrast, Auschnitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
ISBN 978-3-7349-3110-9
Motto
»In dem Haus, in dem du bleiben willst, sei rechtschaffen und stehle nicht.«
Zitat von Benvenuto Cellini
*
Mit der Oper Benvenuto Cellini von Hector Berlioz sollte das renovierte Kölner Opernhaus 2015 feierlich eröffnet werden. Es kam anders.
007 am Rhein
Claudia verließ ihre Wohnung gegen 20 Uhr. Es war dunkel draußen – und das war gut so. Vielleicht irrational, aber sie fühlte sich von der Dunkelheit geschützt. Ihr Auto stand vor der Haustür, ein schwarzer Golf. Sie zögerte einen Moment einzusteigen, ärgerte sich, dass sie für ihre Unternehmung keinen genauen Plan ausgetüftelt hatte. Sie entschied sich gegen den Golf, ging die Marienburger Straße hinunter, vorbei an den erleuchteten Gründerzeitvillen und den Bausünden der 70er-Jahre. Der Krieg hatte in der Stadt eine Schneise der Verwüstung geschlagen, aber die Architekten hatten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beinahe mehr Schäden angerichtet, fand Claudia. Alles war ruhig. Sie begegnete keinem Fußgänger, das war abends meist so im Kölner Stadtteil Marienburg. Nur vereinzelte Hundebesitzer traf man zu dieser Zeit. Sie führten reinrassige Weimaraner an der Leine, alternativ auch adoptierte Straßenhunde aus Rumänien. Claudia hörte keine Schritte hinter sich. Sie drehte sich trotzdem um. Es folgte ihr niemand. Kein Schatten, der plötzlich in einem Hauseingang verschwand. Kein Typ mit Kapuzenshirt, der geschwind hinter eine Hecke huschte. Sie mochte diese Kapuzenteile nicht, mit denen die jungen Leute zurzeit herumliefen. Sie sahen aus wie Hooligans, zumindest wie Gestalten, die etwas zu verbergen hatten, immer etwas bedrohlich. Claudia bog rechts ab in die Goethestraße, lief Richtung Reformationskirche. Vor der Kirche parkte ein Mini von Share now. Spontan entschied sie sich für dieses Fahrzeug. Irgendwie musste sie nach Meschenich kommen. Sie holte ihr Smartphone aus der Jackentasche, öffnete die App, blickte nach allen Seiten und bestieg den Wagen. Bin ich verrückt, fragte sie sich. Leide ich unter Verfolgungswahn? Egal, Informantenschutz stand an erster Stelle. Ihr alter Kollege Mainhardt Graf Nayhauß hatte ihr einst erzählt, wie er jahrelang von einem Mitarbeiter des Innenministeriums mit Informationen gefüttert wurde. Druck von allen Seiten, die Quelle preiszugeben. Er war standhaft geblieben. Ein einziger verratener Informant hatte verheerende Wirkung. Nie wieder gab es Material aus den inneren Zirkeln der Macht. Maini war tot, aber seine Regeln galten bis heute. Auch Claudia hatte man früh in ihrer Karriere wegen Geheimnisverrats angeklagt, mit Bestechungsvorwürfen hatte die Staatsanwaltschaft es versucht und sogar mit Spionage. Lächerlich, alles an den Haaren herbeigezogen, alle Anklagen wurden fallen gelassen. Keine leichte Zeit für investigativ arbeitende Journalisten. Der Staatsapparat wünschte sich Ruhe an der Medienfront. Genau das Gegenteil von dem, was Claudia von gutem Journalismus erwartete.
Sie fuhr zum Verteilerkreis Süd, nahm den Militärring Richtung Norden und bog links ab in die Brühler Straße. Auf der rechten Seite tauchten die Hochhäuser der Kölnberg-Siedlung auf. Einst euphemistisch als Wohnpark benannt und als hochwertiges Immobilienprojekt konzipiert, erlitt diese Wohnanlage einen langsamen, aber stetigen Niedergang. Mittlerweile lebten in den Appartements über 4.000 Menschen aus sozial schwachen Schichten, 4.000 Menschen aus 60 Nationen, mit allen dazugehörigen Problemen. Merkwürdig, dass die Informantin sich in dieser unwirtlichen Gegend angesiedelt hatte. Als Mitarbeiterin des Baudezernats mussten ihr andere Türen offen gestanden haben. Claudia hatte etwas munkeln gehört von finanziellen Problemen, einem Liebhaber, durch den die Verwaltungsangestellte in eine Schieflage geraten war. Alles Gerüchte. Es wurde viel geredet. Die Frau hatte kein Geld verlangt. Vermutlich hatte ihr Gewissen sie zu diesem Schritt getrieben, der heutigen Verabredung. Es gab sie im Land, die Menschen mit einem Gewissen. Den Kontakt hatte Stroebel hergestellt, Felix Stroebel, ein bunter Vogel, einst grünes Urgestein, ob er der Partei noch angehörte, wusste Claudia nicht. Jetzt war er erfolgreicher Unternehmer, Opernfreund und Kunstmäzen mit einem weit verzweigten Netzwerk, soviel sie erfahren hatte, und offensichtlich auch mit einem Gewissen ausgestattet. Ein Mann mit Prinzipien, hatte man ihr gesagt. Ob das stimmte, konnte sie nicht beurteilen, sie war ihm nur ein paar Mal begegnet.
Claudia fuhr an den Hochhäusern vorbei, denn nicht dort wohnte die Informantin, sondern in einem bescheidenen Reihenhaus am Rande des Stadtteils Meschenich. Die Journalistin erreichte die genannte Adresse, überprüfte die Hausnummer und parkte den Mini in einer Seitenstraße. Als sie per App auscheckte, ärgerte sie sich über die eigene Gedankenlosigkeit. Blödsinn, die Sache mit dem Leihwagen. Nun konnte jeder ihre Spur einfach verfolgen. Ganz easy nachweisen, wann und wo sie hier einen Wagen abgestellt hatte. Kurz überlegte sie, die Aktion abzubrechen, aber wer weiß, ob sich eine neue Gelegenheit ergab, ob die Informantin nicht einen Rückzieher machte, es sich anders überlegte. Das Eisen schmieden, solange es heiß war – das hatte Claudia auf der Journalistenschule gelernt. Zögerlich näherte sie sich dem unscheinbaren Haus, von Zweifeln geplagt. Die Neugier siegte. Die Informantin hatte gebeten, nicht an der Vordertür zu klingeln. Es gebe hinten ein Gartentor, das sie unverschlossen lasse, von dort erreiche man die Terrasse. Auf ein Klopfen werde sie öffnen. Forschend blickte sich die Journalistin um. Wie kam sie am schnellsten zur Rückseite der Häuserreihe?
»Suchen Se wat, junge Frau?«
Claudia schreckte zusammen. Eine ältere Frau, mit Lockenwicklern im grauen Haar, schaute aus dem Fenster im Erdgeschoss. Hier hatte die Nachbarschaft offensichtlich alles unter Kontrolle. Im Grunde war dagegen nichts einzuwenden, wenn die Leute aufeinander achtgaben. Gerade im Moment passte es der Journalistin gar nicht.
Claudia wühlte demonstrativ in ihrer Handtasche. »Ich suche hier im Licht nur gerade mein Handy«, stotterte sie. »Wo hab ich es nur?«
»Wat mer net im Däts hät …«, verkündete die Frau am Fenster und teilte damit wohl die Weisheit, was man nicht im Kopf habe, müsse man in den Beinen haben.
Die Alte knallte das Fenster zu, blieb aber hinter der erleuchteten Scheibe stehen, wohl um zu signalisieren, dass sie die Passantin im Auge behalte. Claudia wedelte triumphierend mit dem Handy in der Hand hinüber zu der Aufpasserin und entfernte sich betont gemächlich aus deren Blickfeld. Sie umrundete die Reihe der aneinander gebauten Häuschen, betrat eine kleine Stichstraße, zählte sorgfältig bis vier, da die Grundstücke hinten nicht nummeriert und kaum beleuchtet waren. Das vierte Gartentor war tatsächlich offen. Claudias Herz pochte. Die Szenerie war gespenstisch, zumal es zu nieseln anfing und die feuchte Dunkelheit ihr unter die Haut kroch. Sie fröstelte. Trotzdem ging sie entschlossen auf das erleuchtete Terrassenfenster zu, verharrte einen Moment und klopfte vorsichtig an die Scheibe, die kurz darauf von innen aufgeschoben wurde. Offensichtlich hatte die Bewohnerin hinter der zur Seite geschobenen Gardine auf das Zeichen gewartet. Sie ließ die Besucherin ein, schloss Fenster und Vorhang, bevor sie den Gast begrüßte.
»Frau Rehlinger?«, fragte Claudia.
Die Frau mittleren Alters nickte zustimmend. Brigitte Rehlinger schien allein zu sein. Sie wirkte nervös, entschuldigte sich, dass sie kein Getränk anbiete. Eine nette Frau, überlegte Claudia, ein hübsches Gesicht umrahmt von rötlichen Locken; freundliche Ausstrahlung, vielleicht humorvoll, wenn sie nicht unter Stress stand. Claudia ließ den Blick schweifen. Der Wohnraum war einfach eingerichtet. Nicht geschmacklos, aber auch nicht sehr persönlich oder fantasievoll. Wahrscheinlich IKEA. Der Besuch dauerte wenige Minuten. Claudia erhielt ein paar schriftliche Unterlagen, ausgedruckt auf weißem Papier, dazu ein paar mündliche Informationen.
»Bitte keinen telefonischen Kontakt, keine Nachfragen. Sie finden alles Wichtige auf den Seiten, die Sie in der Hand halten.« Die Frau sagte das nicht resolut, sie machte eher einen verschüchterten, fast gehetzten Eindruck, als wolle sie die Sache schnell hinter sich bringen.
Claudia verstand das. Sie nickte, rollte die Papiere zusammen und stopfte sie in die Innentasche ihres Mantels. Frau Rehlinger öffnete die Terrassentür. Die Besucherin schlüpfte zwischen den Vorhängen hindurch ins Freie, atmete die feuchte Luft, die sie plötzlich als belebend empfand, tief ein. Sie verließ das Grundstück auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war.
Never ever
Brigitte Rehlinger ging am Morgen nach dem Zusammentreffen mit der Journalistin etwas früher als üblich aus dem Haus. Sie hatte schlecht geschlafen. Wieder dieser Feuertraum. Es brannte in ihrer Wohnung, Flammen schlugen ihr aus der Küche entgegen, panisch versuchte sie zu flüchten, fand aber nicht die Haustür. Sie erwachte zitternd, ging ins Bad, um ein Glas Wasser zu trinken. Halb sieben erst, stellte sie mit Blick auf die Uhr fest. Egal, sie wollte nicht zurück ins Bett, wo die erschreckenden Traumbilder sie womöglich erneut verfolgen würden. Ohne Appetit aß sie ein Brot mit Schinken, ließ die Hälfte auf dem Teller liegen, trank ihren Morgenkaffee allein und lustlos. Lorenzo lag noch im Bett. Er war erst weit nach Mitternacht heimgekehrt. Die langen Nächte – sie waren der Nachteil seines sonst von ihm geliebten Berufs als Gastronom.
Beim Schließen der Tür achtete sie sorgsam darauf, beide Türschlösser zu verriegeln, obwohl ihr Freund im Haus war, aber er würde noch mindestens zwei, drei Stunden wie ein Stein schlafen.
Sie schreckte zusammen, als sie Schritte hinter sich hörte.
»So früh schon, Frau Rehlinger?« Es war die Nachbarin Frau Schrankel, die sie in munterem Kölsch begrüßte und ihr einen Briefumschlag überreichte. »Der hing jestern in ihrem Briefkasten. Hab isch rausjenommen – wejen dem Rejen.«
»Danke, Frau Schrankel, das ist sehr nett von Ihnen.« Nett, aber auch immer etwas zu neugierig, befand Brigitte Rehlinger. Das sagte sie nicht laut, sondern machte stattdessen eine belanglose Bemerkung über das feuchtkalte Wetter und verabschiedete sich schnell, bevor die Nachbarin sie in ein langes Gespräch über den Zustand der Welt im Allgemeinen verwickeln konnte.
»Schönen Tach auch«, wünschte Frau Schrankel und zuckelte davon in ihrer geblümten Kittelschürze, ein Kleidungsstück, das Brigitte zuletzt an ihrer eigenen Mutter gesehen hatte. Wo gab es diese Schürzen bloß noch zu kaufen, überlegte sie und betrachtete den Briefumschlag, auf dem nur ihr Name stand, keine Anschrift. Sie riss ihn auf und zog einen weißen Zettel heraus. »AUFHÖREN!«, stand dort in dicken schwarzen Druckbuchstaben – nur dieses Wort. Rehlinger starrte auf die Schrift. Der Zettel zitterte in ihrer Hand. Suchend blickte sie um sich, als vermute sie den Überbringer der Nachricht hinter irgendeinem Busch in der Straße.
Sich mehrfach unruhig umschauend, bestieg sie ihr Auto. Mit Bus und Bahn war es gefühlt eine Weltreise, um von Meschenich zum Willy-Brandt-Platz in Deutz zu kommen, wo sich ihr Büro befand, im Dezernat VI, Planen und Bauen. Also Auto, brummelte sie vor sich hin und fluchte auf die geschätzte Frau Kollegin vom Dezernat Mobilität. Hochtrabender Name für so wenig Verkehrsfluss, bemerkte sie genervt. Immer wieder blickte sie ängstlich in den Rückspiegel. Die Drohung am Morgen lag ihr auf dem Magen. Wer weiß, wozu die Leute, mit denen sie es zu tun hatte, in der Lage waren.
Rehlinger war früh dran und nahm deshalb den kleinen Umweg über die Stadtmitte. Es zog sie zum Offenbachplatz, zur Bühnenbaustelle. Fast wie ein Täter, den es zurück zum Tatort treibt. Dabei fühlte sie sich überhaupt nicht schuldig. Ich habe ein reines Gewissen, munterte sie sich selbst auf und sah sich beim Anblick des Chaos am Offenbachplatz bestätigt. Sie war froh, dass sie die heißen Papiere an die Journalistin übergeben hatte.
»Tach, Herr Ülpenich, alles im Lot?«, begrüßte sie den Pförtner am Wachhäuschen.
»Morgen, Frau Rehlinger, so früh auf den Beinen?«
»Der Gedanke an unser Baby hier hat mich wach gehalten, Herr Ülpenich.«
»Mir kann’s nur recht sein, wenn’s noch etwas dauert mit der Fertigstellung«, grinste der betagte Wachmann. »Den Job hier habe ich bis zu meiner Rente, falls das Werkeln in dem Tempo weitergeht.« Herr Ülpenich war etwa 55 Jahre alt.
Es musste etwas geschehen. Ein Jahr noch bis zur Übergabe an die Bühnenleitung und die Baustelle sah nicht nach fast vollendeter Sanierung aus, eher, als würde gerade ein altes Gebäude abgerissen. Oper und Schauspiel lagen mitten im Stadtzentrum, täglich gingen hier Tausende vorbei, ohne sich für das Debakel zu interessieren. Kurze Aufregung in den lokalen Medien, als die Nachricht kam, das Gesamtprojekt koste nun eine Milliarde Euro. Gab es sie überhaupt noch – die gute alte Million? Es wurde nur noch in Milliarden oder Billiarden gerechnet. Unter den Riesenzahlen konnte sich eh keiner etwas vorstellen. Brötchen für 75 Cent, drei Tomaten 2,50 Euro, damit schlugen sich die Leute herum.
Riesige hölzerne Kabelrollen lagen vor dem Bühneneingang. Ein mindestens 20 Meter hoher Kranlastwagen verrichtete brummend irgendeine Arbeit, die schon vor Monaten hätte erledigt werden müssen. An der Fassade des Schauspielhauses lief das Schmutzwasser herunter, Kacheln waren aus der Wand gerissen. Eröffnung 2024? Never ever, hörte Brigitte Rehlinger sich laut und zornig sagen. Ich habe es richtig gemacht, dachte sie trotzig und flüchtete fast zu ihrem Auto, das sie an der Glockengasse geparkt hatte, dort wo seit zehn Jahren eine Containerstadt für die Arbeiter und Ingenieure der Baustelle installiert war. Schönes Geschäft für den Containerlieferanten.
Das hat die Welt noch nicht gesehen
»Das hat die Welt noch nicht gesehen«, verkündete die Kölner Kulturdezernentin im Juli 2015. Sie meinte die Bühnen am Offenbachplatz, deren Neueröffnung nach Totalsanierung kurz bevorstand. Mit Benvenuto Cellini von Berlioz sollte im Herbst glanzvoll die erste Premiere gefeiert werden. Adios Cellini, hieß es kurz darauf. 253 Millionen Euro waren einst für die Sanierung veranschlagt worden. Nun schrieb man das Jahr 2023, eine Milliarde Gesamtkosten war für das Projekt Bühnen prognostiziert. Eröffnung 2024. Eine Prognose, an die niemand in der Stadt richtig glaubte.
Und in diese Stadt zog es Claudia Ruppert nun. Köln war ihre Heimat. Die Rückkehr hatte verschiedene Gründe. Eine besondere Liebe zur Karnevalshochburg gehörte nicht dazu. An die Oper hatte sie allerdings schöne Erinnerungen aus ihrer Jugend. Mit den Eltern in der Loge – Tosca, Rosenkavalier, Don Giovanni – ja, Don Giovanni, ihm hatte sie sich ganz hingegeben, sie hatte schon als junges Mädchen eine Schwäche für Machos gehabt.
Als Claudia Ruppert den Offenbachplatz nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder betrat, stand sie unter Schock. Mit dem Fahrrad umrundete sie Oper und angrenzendes Schauspielhaus, das nicht saniert wirkte, eher, als drohe der Zusammenbruch. Sie betrachtete die herunterlaufende Farbe an der Dachumrandung des Schauspiels, die bröckelnde rote Backsteinfassade, Dreck hinter hohen Absperrgittern. Wie es innen aussah, konnte der Steuern zahlende Bürger nicht sehen. Claudia hatte einen Besichtigungstermin angemeldet. Einer Journalistin öffneten sich manche, für andere verschlossene Türen.
Von goldenen Löffeln
Claudia Ruppert war mit dem Goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen. Im Alter von zehn Jahren hatte sie ihn an die Wand gepfeffert und gegen alles und jedes rebelliert: gegen die süßen Blümchenkleider von Oilily, in die man sie hineinzwang; gegen die Sonntagsfrisur, für die oben auf ihrem Kopf eine runde Wurst namens Dutt kunstvoll drapiert wurde; die geflochtenen Zöpfe für den Alltag mit den rosa Schleifchen. Das Frisurenproblem hatte sie mit zwei Scherenschnitten erledigt. Claudias Rebellion fand neue Ziele. Sie richtete sich gegen die Besuche im Beichtstuhl, wo ein feister Pfarrer sie über ihre Keuschheitsvergehen in die Inquisition nahm, bevor sie überhaupt wusste, was es mit der so genannten Unkeuschheit auf sich hatte. Später vermutete sie, dass sein Onanieren hinter dem getönten und mit Holz vergitterten Glas in diese Sündenkategorie fiel. Sie spürte seine Erregung, während er nachbohrte, ob sie unkeusche Taten begangen habe. Ihre Freunde suchte Claudia sich selbst aus. Meist wohnten sie im angrenzenden Arbeiterviertel, das in ihrer Heimatstadt Köln merkwürdigerweise direkt an den teuren Villenvorort Marienburg grenzte, in dem Claudia mit Hilfe einer häuslichen Hebamme das Licht der Welt erblickte. Die erwählten Freunde hießen manchmal Chantal oder Kevin, trugen rosa Leggings oder Trainingshosen und führten sie in die Gossensprache ein. Neugierig beobachtete Claudia die Wirkung der Besuche aus dem Arbeitermilieu auf ihre Eltern. Im Alter von 13 Jahren kreierte sie ihre eigene Mode. Eigenhändig zerrissene Jeans trug sie, lange bevor diese von Modedesignern mit gut platzierten ausgefransten Löchern zu sündhaft teuren Preisen feilgeboten wurden.
Claudia rüttelte an Zäunen, trat gegen verschlossene Türen, erhob den Kopf und wurde mindestens so oft einen Kopf kürzer gestutzt; sie brach lustvoll Regeln und weit lustvoller Herzen und war mehrfach an gebrochenem Herzen erstickt, hatte liebend die Liebe verflucht. Vergessen im Rausch gesucht. Von rasender Liebe betrunken, das Beste gesoffen. Auf Herzen gezielt und Herzen getroffen. Singend in den Abgrund geblickt. Bis zum Hals im Dreck versunken, zu den Sternen geschaut. Tausend Schlösser auf Sand gebaut, tausend Schlösser zerstört. Und niemals auf guten Rat gehört. Gott fluchend ins Gesicht gelacht. Gott, der niemals guckt. Was soll’s! Weiter getaumelt, ziellos dem Ziel entgegen. Das war Claudia.
Claudias Familie waren die von Heidens, Privatbankiers seit 1793. Claudias Eltern starben bei einem Autounfall, da war sie 18, das jüngste von drei Kindern, ein Nachkömmling. Ihre Brüder Adrian und Boris waren zehn und zwölf Jahre älter. Warum ihre Eltern im Alphabet nicht weiterkamen und warum zwischen A, B und C so viel Zeit verstrich, erfuhren die Heiden-Sprösslinge nicht. Wahrscheinlich war C die Intelligenteste, trotzdem waren es Claudias zwei Brüder, die die Führung der Bank übernahmen. Es passierte nichts Dramatisches, irgendwie bröselte den jungen Erben das schöne alte Bankhaus unter den Fingern weg. Claudia studierte Finanzwirtschaft in London, wollte es ihren Brüdern beweisen, dass sie als Bankerin etwas taugte. Bevor sie ihren Master-Abschluss präsentieren konnte, war das Unternehmen in die Hände einer britischen Großbank übergegangen, und für die Tochter des Hauses gab es keinen Job mehr. Es blieb für alle Kinder genug übrig, um ein angenehmes Leben zu führen, aber das war nicht Claudias Lebensplan. Sie studierte Kunstgeschichte und wurde Journalistin, in der Hoffnung, dem Schönen und Wahren ans Licht zu verhelfen, zumindest ein Fünkchen Wahrheit aufblitzen zu lassen. Weil sie klug und gebildet war, nahmen die Öffentlich-Rechtlichen sie mit Begeisterung in ihren Funkhäusern auf. Die Linken in den Sendern missverstanden ihren Oppositionsgeist und versuchten, sie zu vereinnahmen. Claudia witterte die Ideologen, links wie rechts. Sie blieb ihrem Gewissen verpflichtet und ihrer Intelligenz, die ihr Vernunft erkennen half. In den zwischenmenschlichen Beziehungen versagte diese Fähigkeit zur Ratio manchmal. Es obsiegte die Rebellin oder die Leidenschaftliche, zum Beispiel bei der Wahl ihres Ehemannes. Zu einer wirklichen Wahl ihrerseits war es gar nicht gekommen.
»Du bist die Frau meines Lebens«, gestand ihr eines Nachts ein Mann in einer Berliner Bar. Sie waren sich auf einem dieser Kunstevents begegnet, die nach der Wiedervereinigung in Mitte und Kreuzberg aus der Erde sprossen. Claudia, die sich auf jedem Parkett bewegen konnte, traf auf den eher kleinbürgerlichen Stefan, den Museumsdirektor mit Einfluss in der Politik. Man munkelte, er berate die Staatsministerin für Kultur. Claudia und Stefan tranken ziemlich viele Aperol Spritz. Das gemeinsame Kind war so schnell unterwegs, dass der kluge, entschlossene Stefan und die intelligente, etwas unstete Claudia keine Chance hatten, sich kennenzulernen. Vielleicht war es auch so: Claudia hatte sich insgeheim, durch den frühen Verlust ihrer Eltern, nach einer eigenen Familie gesehnt. So was kann die Empfängnisbereitschaft einer Frau enorm erhöhen. Tochter Luise kam auf die Welt, und die Liebe zu ihr war so überwältigend, dass Claudia die ersten Haarrisse in der Beziehung zu ihrem Mann nicht bemerkte oder geschickt zukleisterte.
Sie waren das Glamourpaar in der Berliner Szene. Claudia, mit ihren fast 1,80 Metern, den grünen durchdringenden Augen, den feinen Gesichtszügen, in denen diejenigen, die genau hinschauten, Empfindsamkeit und Verletzlichkeit entdeckten. Sie überspielte das mit Humor, Aufmüpfigkeit und der Fähigkeit, Menschen mit bohrenden Fragen zu verunsichern. Sie war der bunteste unter den bunten Berliner Szenevögeln. Stefan, mit seinem kleinbürgerlichen Background, genoss die Abstrahlung dieser schillernden Frau, die jede Gesellschaft schmückte. Er liebte sie und bastelte gleichzeitig unermüdlich an seiner Karriere. Er wollte es sich, der Welt und vor allem seiner schönen Ehefrau beweisen. Zielstrebig steuerte er das Kanzleramt an, Staatssekretär für Kultur und Medien. Der Aufstieg führte über eine Parteizugehörigkeit, zumindest half das Parteibuch. Stefan hatte sich für das der SPD entschieden, bereits in Studentenzeiten.
»Links sein gehört zu meiner DNA. Ich bin in kleinen Verhältnissen aufgewachsen, ich weiß, wie es den kleinen Leuten geht.« So sprach er, während er sich bei Borchardt in der Französischen Straße ein paar Austern servieren ließ, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers. »Ich werde in meinem ganzen Leben für eine gerechtere Welt kämpfen«, dozierte er, während die Auster seinen Hals hinunterrutschte. »Und du gehörst zu uns«, versuchte er seine Frau zu überzeugen, »nicht qua Geburt, aber dein Gewissen ist links verortet.«
»Die Linken wollen keine gerechte Welt, sie wollen eine Welt, in der sie Recht haben«, hatte Claudia sich gegen die Vereinnahmung gewehrt. »Und vor diesem Schlagwort der sogenannten ›kleinen Leute‹ gruselte es mich. Deutschland, ein Volk der ›kleinen Leute‹, erinnert mich an Heinrich Manns Untertan.«
Stefan gelang der Sprung ins Kanzleramt.
Die Haarrisse wurden breiter und waren nicht mehr nur Haarrisse. Claudia tröstete sich mit einigen Affären. Stefan schaute weg oder merkte es nicht. Er liebte sie weiter. Sie brauchte ein paar Monate in der deutschen Hauptstadt, um zu erkennen, wie träge und zäh, wie entpolitisiert und totgemerkelt ihr Heimatland war. 16 Jahre Merkel hatte wie ein Sedativ auf die Bürger des Landes gewirkt.
Sie lernte Sandro Farinesi kennen. Was für ein verrückter Typ, Lebemann, Hasardeur. Die erste Hälfte seines Lebens hatte er als Bonvivant durchtänzelt, sich als Klatsch-Journalist bei einem Boulevard-Blatt durchgeschlagen, was ihn finanziell über Wasser hielt. Für alle darüber hinaus gehenden Kosten kamen Freunde auf, die sich gern mit dem unterhaltsamen italienischstämmigen Grafen amüsierten. Viele schmückten sich mit dem lässigen weltläufigen Conte. Farinesi lebte in Berlin vom Tratsch in der Politszene. Es war erstaunlich, wie offenherzig sich selbst hochrangige Politiker ihm gegenüber äußerten, wissend, dass ihre Plaudereien am nächsten Tag in der Zeitung verwurstet wurden. Manches Geheimnis erfuhr er in den Betten von einsamen Politikergemahlinnen oder Staatssekretärssekretärinnen. Manchmal fiel Farinesi kurzzeitig in Ungnade, aber – oh Wunder – bald tauchte er wieder auf in Begleitung der Politiker, die er gerade durch den Kakao gezogen hatte. Eines Tages war eine Veränderung mit dem Hallodri vor sich gegangen, ausgelöst durch den Tod einer guten Freundin, einer Gräfin Bentlow, angeblich ein Skiunfall. Man munkelte viel in Berlin: die Frau sei ermordet worden, sie sei dem Kanzler zu nahegekommen. Nachweisen konnte man dem Regierungschef nichts. Nun war Berlin, was Tratsch anging, ein Dorf, oder wie Sandro behauptete: »Die Welt ist ein Dorf und Berlin ist die Kneipe.« – Fakt war, dass der Kanzler einige Zeit später seinen Hut nehmen musste. Man hatte ihm eine Verwicklung in ungenehmigte Waffengeschäfte nachgewiesen. Sandro war involviert in diesen Skandal. Welche Rolle er gespielt hatte, wusste keiner genau, man spekulierte, klatschte und verdächtigte. Es war das, was Claudia auf dem Berliner Parkett zugeraunt bekam.
Claudia war Sandro öfter in der Bundespressekonferenz begegnet. Sie waren Kollegen, beide unabhängig genug, um die wirklich kritischen Fragen zu stellen. Manchmal preschte Sandro vor, manchmal war es Claudia, die den Regierungssprecher mit bohrenden Fragen nervte.
2019 trafen sie sich auf dem Bundespresseball. Großer Auftrieb im Hotel Adlon. Der Ball war nach seinen Hochzeiten in Bonn auch in Berlin ein großes Ereignis. Politiker aller Couleur ließen sich blicken, sie hielten Hof, tanzten, manche schlecht, manche gut, und wurden umringt von beilachenden Hofschranzen. Als Mitglied der Pressekonferenz musste man sich anstandshalber zeigen, weil das Fest ein Informationsbasar war. Mit steigendem Alkoholkonsum wurde an den Bars getuschelt, geflüstert, zugeraunt, bis die Ohren heiß glühten. Informationen wurden ausgetauscht unter eins, zwei und drei, die Geheimcodes bei der Nachrichtenverwertung zwischen Journalisten und Politikern. Eins hieß, Information und Urheber durften genannt werden; bei zwei nur die Information mit Umfeld der Quelle; unter drei durfte nichts öffentlich verwertet werden, ausschließlich Informationen für die Hinterköpfe der Journalisten. Wer trotzdem veröffentlichte, flog raus aus dem Nachrichtenkarussell.
Claudia ödete sich, während ihr Mann die Kanzlerin hofierte. Er tanzte sogar mit ihr. Sollte er. Claudia war Sandro nach draußen gefolgt. Er lehnte an der Mauer des Hotels mit einer Lässigkeit, wie sie nur ein italienischer Conte aufbrachte oder vielleicht Marcello Mastroianni, der einen italienischen Conte spielte. Aus der Innentasche seines Smokings zog Sandro eine Packung Zigaretten, bot Claudia eine an. Sie hatte in der Schwangerschaft aufgehört zu rauchen, aber seit Zigaretten verpönt waren, genoss sie es, mit den Rauchern draußen in der Verbannung zu stehen. Es fühlte sich ein bisschen wie zu Schulzeiten an, als die coolen Typen sich in der Raucherecke trafen. Sandro zog ein goldenes Cartier-Feuerzeug aus der Tasche und hielt die Flamme an ihre Zigarette.
»Schönes Feuerzeug«, sagte sie. »Geschenk einer Frau?«
»Mehrerer«, antwortete er und blies den Rauch entspannt in die Nachtluft. »Sie haben zusammengelegt.«
Claudia lachte. Der Conte brachte sie oft zum Lachen, manchmal während der Pressekonferenzen, wenn der Pressesprecher monologisierte. Zwei Frauen traten zum Schwatzen vor das Hotel. Sandro musterte die mit den langen weißblond gefärbten Haaren. Claudia spürte, wie die jüngere Frau ihr Verhalten unter seinen Blicken änderte, laut und exaltiert lachte.
»Blondinen bevorzugt?«, fragte Claudia und bereute beinahe, dass sie ihr natürliches Dunkelblond nicht am Vortag beim Friseur aufgehellt hatte.
»Früher mal«, gestand der Conte. »Heute interessiert mich eher, was da drin vorgeht.« Er tippte zart an ihre Stirn.
»Wie war die schöne Ana Bentlow?«, fragte Claudia unvermittelt und bemerkte, wie Farinesi zusammenzuckte.
»Was hat man Ihnen erzählt?«, wollte er wissen. »Ach«, fuhr er verächtlich fort. »Hören Sie nicht hin. Die Leute reden zu viel.«
»Ihre große Liebe?« Sie blieb hartnäckig.
Farinesi antwortete nicht. Die Augen verrieten seine Qual. Touché, dachte sie.
Er schaute hinüber zum nahegelegenen Brandenburger Tor. »Schön, dieser Blick auf die erleuchtete Quadriga«, lenkte er vom Thema ab.
»Werden Sie mir eines Tages erzählen, wie sich die Geschichte wirklich abgespielt hat?«, beharrte sie.
Als die beiden anderen Frauen zurück ins Hotel gingen, küsste er sie. Er küsste nicht wie ein Draufgänger, eher zart und zurückhaltend. Das überraschte sie. Wie man sich in Menschen täuschte. Das war der Beginn. Viele One-Night-Stands folgten, ohne feste Absichten ihrerseits. Viele One-Night-Stands ergeben am Ende eine Beziehung. Es dauerte Monate, mit kleinen Essen in versteckten Lokalen, mit kurzen Ausflügen, bis sie sich eingestand, dass das mit Sandro mehr als eine Affäre war.
Merkwürdig, dass gerade dieser einstige Hallodri, dieser Lebemann und Frauenheld ihr ins Gewissen redete. »Die Hofberichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, diesen ARD-Gefälligkeitsjournalismus kannst du so nicht weiterbetreiben. Wie fühlst du dich dabei?«
»Total beschissen«, gestand Claudia, die noch im Erwachsenenalter von Kevins Gossensprache zehrte. Sie bekannte Sandro und sich, dass sie zu lange mitgeschwommen war, zwar kritischer als viele der Kollegen in den Medien, aber sie hatte sich der Gruppendynamik nicht völlig entzogen, dieser Anpassung an den Mainstream, einer Berichterstattung, die durch Haltung bestimmt war und nicht einzig und allein den Fakten verpflichtet, so wie sie es einst bei den Altmeistern des Journalismus gelernt hatte.
Es sind nicht die schlechtesten, die zu Revolutionären werden, meist die Feinfühligen, die Feinhörigen, die an der Unzulänglichkeit der Welt leiden. Claudia wusste selbst nicht mehr, wann es sich eingeschlichen hatte, dieses Gefühl, dass mit dem unabhängigen Journalismus etwas im Argen lag.
»Merkel repräsentiert seit fast 16 Jahren den ewigen Murmeltiertag«, spottete Sandro. »Man wacht auf und stellt fest, es ist derselbe Tag. Nichts hat sich geändert. Wir leben denselben Mist von vorn.«
Claudia lachte und wusste, dass er recht hatte. »Jetzt haben wir den Zeitenwende-Scholz, seither kracht ein richtiger Wumms durch das Land.«
»Wir haben eine Verantwortung – als Demokraten, als Elite, als Journalisten«, redete er ihr ins Gewissen. »Ich gebe zu, das sagt eine männliche Hure, die 15 Jahre lang dem Boulevard-Journalismus gedient hat, aber entweder es ist einem egal, wer unser Land regiert, oder man kämpft. Glaube mir, manchmal bin ich so müde, dass mir tatsächlich alles wurscht ist. Innere Emigration, es sich noch ein bisschen gut gehen lassen und danach den Löffel abgeben.«
»Meiner war sogar mal ein goldener; ich konnte nichts damit anfangen«, erinnerte sie sich an ihre Kindheit.
»Ich dachte, als ich jung war, meiner sei ein goldener, bis ich feststellte, dass sogar das Silberbesteck in unserem Schloss in Oberitalien verpfändet war. Mein Vater hat von den letzten veräußerbaren Kostbarkeiten aus dem Familienbesitz gelebt. Das Schloss gehörte sowieso lange der Bank. Ich finde, man hätte mich frühzeitig darauf hinweisen müssen.«
»Du hättest es mit Arbeit versuchen können«, schlug Claudia vor.
»Das sagst du so einfach. Die Farinesi rühren seit Generationen keinen Finger für ihren Lebensunterhalt.«
Er hatte sie nicht lange überreden müssen. Unter Pseudonym schrieb sie für das von unabhängigen Journalisten gegründete Forum Rheinjunker. Bevor sie einschlug, hatte Claudia sich von der Seriosität der Finanziers überzeugt.
»Alle sauber. Ich kenne alle persönlich, die meisten«, beruhigte Sandro sie.
Zu dem Netzwerk gehörten Wirtschaftsleute, ein paar Politiker, Journalisten, die sich um das Land sorgten, eine bessere Politik anmahnten. Es war das, was auch Claudia wollte.
Sie hatte Quellen, gute Quellen, zuverlässige mit internen Informationen. Ihr eigener Mann gehörte dazu. Was Männer halt so erzählen, wenn sie von der Arbeit kommen. Der Fußpfleger berichtet von den eingewachsenen Fußnägeln alter Frauen, der Installateur von der fehlenden Muffe und der Staatssekretär vom Ärger mit den Kollegen und der Kanzlerin. Die Last des Arbeitstages wird bei der Ehefrau abgeladen; bei einem Staatssekretär ist manches davon geheim. Wenn die Last drückt und das Gewissen sich meldet, muss eben die Ehefrau als Zuhörer herhalten. Manchmal geht es darum, sich vor der Gemahlin wichtigzumachen, manchmal darum, die Blessuren des Tages mit dem milden Blick der Ehefrau zu verarzten. Claudia war nicht unbedingt die Frau mit dem milden Blick, sie hatte eher den harten Blick der kritischen Journalistin. Sie fühlte sich der Wahrheit und ihrem Vaterland mehr verpflichtet als ihrem Ehemann.
Der Nachrichtenaustausch im Schlafzimmer der Rupperts nahm zunehmend etwas Beklemmendes an. Stefans Bekenntnisse auf dem Kopfkissen erhielten eine kafkaeske Dimension. Er steckte im Kultursumpf. Und was Claudia berichtete, fügte dem Sumpf genauso viel hinzu, dass er dem Staatssekretär über den Kopf schwappte. Sumpf, richtig fieser, schmuddeliger Sumpf.