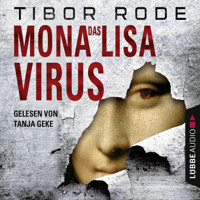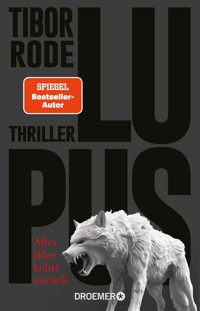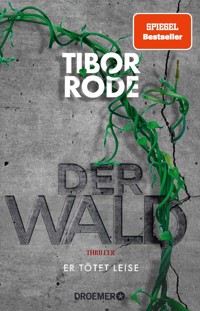9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvoller Code in einer alten Schrift führt den Patentanwalt Robert Weber und die Buchrestauratorin Julia Wall zusammen. Die Lösung des Rätsels verspricht die Erfüllung des Menschheitstraums von ewiger Energie. Doch jemand scheint die Entschlüsselung mit allen Mitteln verhindern zu wollen.
Dreihundert Jahre zuvor: Der Mühlenbauer Johann Bessler, der sich selbst Orffyreus nennt, behauptet, ein Perpetuum mobile erfunden zu haben, eine Maschine, die unendliche Energie liefert. Bald ist Orffyreus seines Lebens nicht mehr sicher. Wer fühlt sich durch seine Erfindung bedroht?
Robert und Julia erkennen, dass nur die Antwort auf diese Frage ihr Leben retten kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 810
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
ÜBER DEN AUTOR
Tibor Rode, 1974 geboren, arbeitet als Autor, Rechtsanwalt, Mediator und Lehrbeauftragter in Hamburg. Mit zwölf Jahren wurde er als jüngster Teilnehmer in das vom Bundesbildungsministerium initiierte Programm »Kreatives Schreiben« aufgenommen. Neben Studium und Beruf war Tibor Rode lange Jahre für verschiedene Medien als Journalist tätig.
Tibor Rode lebt mit Familie und Hund in Schleswig-Holstein.
DAS RAD DER EWIGKEIT ist sein erster Roman.
Tibor Rode
Das Rad der Ewigkeit
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieser Titel wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln Lektorat: Karin Schmidt Textredaktion: Dr. Arno Hoven Umschlag: Illustration Johannes Wiebel, punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Kalim; Shutterstock/Thomas Hartwig Laschon; Shutterstock/siloto E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-2421-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Sandra, Cécilia und Josephine – und M.
»Die Konstruktion der immerwährenden Bewegung ist absolut unmöglich …«Französische Akademie der Wissenschaften, 1775
PROLOG
Vieles, was ich früher für unmöglich hielt, scheint nach den unglaublichen Erlebnissen der vergangenen Monate nun doch möglich zu sein. Dazu gehört auch, dass man mehr als nur ein Leben haben kann. Mein erstes Leben habe ich gemeinsam mit dem Namen Robert Weber hinter mir gelassen. Mein zweites Leben hat gerade begonnen. Und wie jeder Neugeborene werde auch ich nie wieder dorthin zurückkehren können, woher ich gekommen bin. Im Unterschied zu einem Säugling erinnere ich mich jedoch an meine vorherige Existenz – und kann daher erzählen, wie es zu ihrem Ende kam.
Während ich dies aufschreibe, blicke ich über die unendliche Weite eines Meeres. An manchen Tagen, an denen der Wind stillsteht, erscheint nicht weit entfernt von der Küste eine Luftspiegelung, die man für eine kleine Insel halten könnte. Versucht man jedoch mit einem Boot zu ihr überzusetzen, löst sie sich immer mehr auf, je näher man ihr zu kommen scheint.
An Avalon dachten einst die Italiener, als sie eine solche Fata Morgana in der Straße von Messina entdeckten. Avalon, die mystische Insel aus der Artussage: ein Ort, den nur Eingeweihte erreichen können. Ich verstecke mich nun schon seit Monaten vor denen, die an das Unmögliche geglaubt haben. Und wenn ich hier sitze und über all das Abenteuerliche und Fantastische nachdenke, was mir passiert ist – und was ich Ihnen von Beginn an erzählen möchte –, dann kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob nicht ich es bin, der auf Avalon sitzt und zur Küste der Normalsterblichen hinüberschaut. Denn alles um mich herum ist unwirklich geworden.
Vielleicht gerade deshalb erkenne ich heute dort Zeichen, wo ich früher keine sehen konnte.
Als kleiner Junge hätte ich eine Walnusshälfte stundenlang anstarren können, ohne auf die Idee zu kommen, dass sie mit ihrer Form und dem Muster ihrer rauen, von Furchen durchzogenen Oberfläche dem menschlichen Gehirn ähnelt. Ich war als Jugendlicher stolz darauf, die Schale nur mit der Kraft meiner Hand mühelos knacken zu können, wusste aber nicht, dass die Nuss wertvolle Fettsäuren enthält, die ausgerechnet dem Gehirn nützlich sind.
Oder die Herbst-Zeitlose. Ich kannte sie als giftige Pflanze, die ich früher gemeinsam mit meinem Großvater aus dem Waldboden riss, um ihre Knollen meiner Großmutter zu bringen, damit sie daraus ein Hausmittel gegen ihre Gicht herstellen konnte. Was mir damals nicht auffiel, war die Ähnlichkeit zwischen dem Aussehen einer an Gicht erkrankten Zehe und der heilbringenden Knolle.
Es ist diese unscheinbare Signatur der Dinge, die ich erst in jüngster Zeit entdeckt und verstanden habe.
Es war keine Erleuchtung, die mir diese Erkenntnis verschaffte. Auch kein metaphysisches Ereignis im eigentlichen Sinn. Es war die Tatsache, dass mir etwas passierte, was scheinbar jedem von uns hätte geschehen können.
Merkwürdig ist, dass es ausgerechnet mich als Physiker und Patentanwalt traf. Wäre mir der Zusammenhang früher aufgefallen, hätte ich ihn als Zufall abgetan.
Inzwischen weiß ich, dass wir Menschen – wie alle anderen Dinge und Lebewesen auf dieser Erde – eine Signatur besitzen. Und alle Geschehnisse der vergangenen Monate standen im untrennbaren Zusammenhang mit meiner ganz eigenen Signatur.
Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich der Überzeugung, dass Johann Elias Bessler alias Orffyreus und ich mit derselben oder wenigstens einer ganz ähnlichen Signatur geboren wurden – nur dass uns dreihundert Jahre trennen. Es ist daher folgerichtig, dass ich auch über ihn erzähle, denn aufgrund unserer Signaturen sind seine und meine Lebensgeschichte eng miteinander verwoben.
Sollte ich auf meiner Reise nach Avalon – oder während meines Aufenthalts auf dieser sagenumwobenen Insel – doch noch für immer verloren gehen, möchte ich darauf hinweisen, dass nicht nur jeder Anfang unweigerlich auf ein Ende hinführt, sondern in jedem Ende immer auch ein neuer Anfang enthalten ist.
Die Sonne geht nur auf, um im selben Augenblick woanders unterzugehen, und sie geht nur unter, um anderenorts gleichzeitig wieder aufzugehen. Und während Sonne und Erde einen scheinbar ewigen Kreislauf bilden, bin ich auf einen weiteren Beweis für die unendliche Kraft der Natur gestoßen:
Das Perpetuum mobile.
1
Der Mann vor mir schaute mich aus tiefliegenden blauen Augen an. Leicht hätte man den Ausdruck in seinem Blick für Trauer halten können, ich wusste aber, dass es vor allem Müdigkeit war. Die kurz geschnittenen dunkelblonden Haare zeigten an den Schläfen einen ersten Schimmer von Grau, der vor einigen Wochen noch nicht zu erkennen gewesen war; das Gleiche galt für die Falten unter seinen Augen. Daher wirkte derjenige, der mir hier so unverhohlen entgegenstarrte, wie vierzig oder noch älter, doch er war erst zweiunddreißig Jahre, vier Monate und drei Tage alt.
Die Nase war nicht ganz gerade, sondern hatte einen leichten Knick in der Mitte, aber vielleicht fiel dies auch nur mir auf. Mein Gegenüber verzog das Gesicht zu einem gekünstelten Lächeln, das in den Mundwinkeln spannte. Eine Reihe blitzweißer Zähne kam zum Vorschein. Zähne verrieten den Gemütszustand ihres Besitzers nicht, dachte ich. Ich hatte den Mann bereits an den verschiedensten Orten getroffen: in Toiletten, an Seen oder flüchtig beim Schaufensterbummel. Doch heute kam er mir reifer vor. Er trug denselben Anzug wie ich und hatte zudem mit einem Meter zweiundachtzig haargenau meine Körpergröße. Auch unsere Namen waren identisch: Robert Weber. Hinter seinem Rücken öffnete sich plötzlich eine Tür, und ich sah, wie eine junge Frau zu ihm trat. Ihr schwarzes Kostüm betonte ihre atemberaubende Figur, und ihre langen Haare fielen wild über ihre schmalen Schultern. Ich drehte mich um und gab ihr einen Kuss.
»Die Anwälte sind da – mit dem Vertrag!«, sagte sie und ordnete mit einer liebevollen Geste meine Frisur. Sie warf meiner seitenverkehrten Kopie einen flüchtigen, aber verführerischen Blick zu und verschwand durch die Tür, durch die sie gekommen war.
Ich fing mit beiden Händen das kalte Wasser auf, das seit geraumer Zeit vor mir in den Abfluss plätscherte, und warf es mir ins Gesicht. Dann drehte ich den Wasserhahn zu, nahm eines der flauschigen Handtücher und trocknete mir damit Gesicht und Hände. Anschließend verabschiedete ich mich von meinem Spiegelbild im Badezimmer des Empire Riverside Hotels.
Wenn mein Ebenbild und ich uns das nächste Mal wiedersahen, würde ich um dreißig Milliarden und eine Million Euro reicher sein – und erneut auf der Flucht.
Einige Monate zuvor
Es war ein sogenannter italienischer Torpedo, der meine Karriere beenden sollte. Kurioserweise war ich es selbst, der ihn abfeuerte. Dem ging eine Entscheidung voraus, auf welcher Seite ich stehen wollte. Ich hatte die Wahl zwischen der richtigen und der einzig möglichen. Natürlich entschied ich mich für Letzteres.
Alles hatte mit meiner ersten Anstellung als frischgebackener Patentanwalt begonnen.
Wer bei dem Beruf des Patentanwalts an einen Juristen denkt, der irrt. Wer Patentanwalt werden möchte, muss nicht Jura studieren. Erforderlich ist vielmehr ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium.
Ich hatte Physik studiert. Meiner Universitätszeit schloss sich eine Zusatzausbildung in einer Patentanwaltskanzlei und beim Deutschen Patentamt an. Die abschließenden Prüfungen zum Patentanwalt absolvierte ich als einer der besten meines Jahrgangs. Dabei trieb mich nicht der unbedingte Wille an, beruflich ganz nach oben zu kommen, sondern vielmehr der Wunsch, es einmal besser zu haben als meine Eltern. Dies erscheint mir im Nachhinein seltsam, da auch sie bis heute ein recht gutes Leben geführt haben.
Mein Vater hatte jahrzehntelang als Flugzeugmechaniker am Hamburger Flughafen gearbeitet, bis er wegen eines Rückenleidens in Frührente gehen musste. Meine Mutter war Krankenschwester und halbtags in einem evangelischen Krankenhaus tätig. Das Leben in unserer Familie verlief zumeist harmonisch: Wir hatten oft Spaß miteinander und unterstützten uns gegenseitig, und es gab selten Streit. Alles, was wir nicht hatten, war Geld. Merkwürdigerweise führte allein dieser Mangel zu der allgemeinen Annahme, dass es mir einmal besser ergehen müsste als meinen Eltern. Weder mein Vater noch meine Mutter noch irgendein Vorfahre, an den man sich erinnerte, hatte studiert, und so war es von frühester Kindheit an eine ausgemachte Sache, dass ich der Erste aus der Familie Weber sein würde, der eine Universität besuchen sollte. Ich werde niemals den Blick meines Vaters bei der Abschlussfeier der physikalischen Fakultät vergessen. An diesem Tag erhielt nicht nur ich ein Diplom verliehen, sondern auch er. Wie viel größer war der Stolz meiner Eltern, als ich auch noch Anwalt wurde. Ich war der erste Anwalt, den sie persönlich kannten.
Mein guter Abschluss brachte mir ein Angebot der bekanntesten Patentanwaltskanzlei in Hamburg ein, und so begann ich meine Laufbahn in einem Büro in der Hamburger Hafencity. Mein Büro verfügte über bodentiefe Fenster und bot einen fantastischen Ausblick auf die Elbe. Diesen Ausblick ersparte ich mir jedoch bereits nach meinem ersten Arbeitstag: Obwohl ich vier Stockwerke über dem Fluss an einem Schreibtisch saß, löste der Anblick des sich leicht bewegenden Wassers bei mir das gleiche Gefühl von Seekrankheit aus wie bei einer längeren Schiffsfahrt.
Ich weiß nicht, ob die Nähe zu einem Gewässer in mir die Idee zum Abschuss des italienischen Torpedos auslöste. Wahrscheinlicher ist, dass es der unerträgliche Charakter meines ersten eigenen Mandanten war. Er gehörte zu dem Typ Mensch, der als junger Erwachsener ohne große Mühe zu Geld gekommen war und dies vor allem seiner Rücksichtslosigkeit verdankte. Als Anwalt war ich für ihn genauso wenig respekteinflößend wie alle anderen, die er bezahlte – einschließlich seiner Ehefrau. Sie war gut halb so alt wie er und begleitete ihn zu dem Termin in unserer Kanzlei. Begleitet wurde sie wiederum von einem kleinen Schoßhund, der schnüffelnd zwischen unseren Beinen umherirrte. Wir saßen im Konferenzraum der Kanzlei, der Besprechungszimmer und Visitenkarte zugleich war; aufgrund seines atemberaubenden Blicks über das Panorama des Hamburger Hafens erinnerte er eher an eine Aussichtsplattform.
»Sie müssen jemanden zur Räson bringen«, begann mein neuer Mandant das Gespräch und lächelte. Ich schätzte ihn auf etwa siebzig Jahre. Seine Haare wirkten durch den Kontrast zu der typischen Gesichtsbräune eines Golfspielers noch weißer, als sie eh schon waren. Er hatte wohl ursprünglich einen sorgsam gekämmten Scheitel getragen, doch jetzt standen einige Strähnen senkrecht nach oben. Für mich verriet die Frisur, dass er Cabrio-Fahrer war. Auch in unseren Büroräumen hatte er seine Sonnenbrille nicht abgenommen.
Dr. Hans Grünewald, einer der Seniorpartner der Kanzlei, hatte diesen Termin mit diesem Mandanten vereinbart, konnte nun aber nicht selbst an dem Treffen teilnehmen. So durfte ich jetzt zum ersten Mal ganz allein – ohne einen der Seniorpartner an meiner Seite – einen Mandanten betreuen und war deshalb recht angespannt. Dies war auch einer der Gründe, weshalb ich auf seine aggressive Eröffnung zurückhaltend reagierte.
»Erzählen Sie bitte erst einmal, worum es geht«, ersuchte ich ihn.
Er ignorierte meine Bitte. »Ich möchte alles pfänden lassen, was sie besitzt«, erklärte er und grinste selbstgefällig. »Das ist wichtig. Ein Blutbad, ich will ein richtiges Gemetzel. Es muss wehtun!«
Er warf seiner Ehefrau einen Blick zu, als ob er von ihr erwartete, dass sie seine Forderungen bekräftigte. Doch sie lächelte verlegen und beugte sich zur Seite, um ihrem Hund ein Leckerli zu geben.
»Ich bin kein Auftragsmörder oder so etwas«, entgegnete ich etwas ärgerlich.
Das Grinsen im Gesicht meines Mandanten erstarb, und er schaute mich überraschend ernst an. »Nicht?«, fragte er mit gespielter Enttäuschung. »Aber Hans hatte mir doch jemanden mit Killerinstinkt versprochen!«
Sogleich brach er in heftiges Lachen aus.
2
Gera, 1712
Der Platz vor dem Richter’schen Freihaus war überfüllt. Immer mehr Neugierige drängten auf den Nikolaiberg und schoben dabei die in der ersten Reihe Stehenden gegen die aus Holz gefertigte Bühne. Hinten fluchte man, weil vorne scheinbar nicht aufgerückt wurde; vorne stießen die Leute Verwünschungen gegen ihre Hintermänner aus, weil sie zu sehr drückten.
Auf dem Podium vor der Menschenmasse erhob ein Mann seine kräftige Stimme und versuchte, gegen den Lärm anzuschreien. Er war ein gut aussehender Mann im besten Alter und von ungewöhnlich großer Statur. Auf seiner Allongeperücke bildete das Mehl einen weißen Schleier wie Raureif; ein untrügliches Zeichen von Wohlstand, da das Pudern der Perücken mit Mehl gerade erst mit einer kräftigen Steuer belegt worden war. Die Kleidung des Mannes entsprach der eines Adeligen. Über der modischen Kniehose trug er ein weißes Hemd, darüber eine kunstvoll bestickte Weste. Der nur leicht geöffnete, samtblaue Justaucorps fiel gerade bis über die Knie und wies so gut wie keine Taillierung auf. Um den Hals hatte der Mann die obligatorische Cravate gebunden, was in diesem Fall nichts anderes war als ein schneeweißes Halstuch.
»Ihr Bürger von Gera, tretet näher und bestaunt hier in Eurer Stadt eine Premiere. Seid Zeuge, wie der vom Genius erleuchtete Orffyreus – das bin ich – erstmals der Öffentlichkeit das triumphierende Perpetuum mobile präsentiert!«
Die Ankündigung ging in der Geräuschkulisse unter. Auf die Rufe aus den letzten Reihen, was man denn genau präsentieren würde, rief von vorne jemand: »Peter der Mollige«, die hinten Stehenden verstanden »destillierten Äther aus Wolle«. Das Gedränge nahm weiter zu.
Fahrende Händler oder Gaukler kamen gerade in den Sommermonaten immer wieder nach Gera, um ihre Wunderwaren feilzubieten oder gegen ein paar Pfennige aufsehenerregende Attraktionen aus aller Welt zu präsentieren. Nach den verheerenden Bränden, die in den letzten Jahren große Teile der Stadt heimgesucht hatten, gierte das Volk nach jeder Ablenkung, die sich ihm bot.
Der Aussteller, der sich heute an sie wandte, hatte in den beiden Tagen zuvor unter größter Geheimhaltung ein gewaltiges Rad aus Holz auf dem Podium errichtet. Es war so groß wie zwei ausgewachsene Männer und ruhte auf einer Holzachse zwischen zwei starken Pfosten. Dabei maß es in der Tiefe etwa vierzehn Zoll und glich in seinem Aufbau somit eher einer Trommel. Beide Seiten des Rades waren mit dünnen Holzbrettern vernagelt. Von dem Rad führten Streben in das Innere eines Kastens, der mit einem Wachstuch verhängt war, um neugierige Blicke abzuwehren.
Nachdem die Menge sich endlich beruhigt hatte, fuhr der Mann, der sich Orffyreus genannt hatte, mit seiner Ankündigung fort.
»Sogleich, mein wertes Publikum, werde ich, Orffyreus, dieses Rad anstoßen, und zwar mit dieser Hand.« Bei diesen Worten reckte er seine Hand wie ein Ertrinkender in die Höhe und streckte sie theatralisch nach allen Seiten aus. Plötzlich herrschte absolute Stille.
»Das Rad wird sich dann zu drehen beginnen, und zwar in jene Richtung.« Bei diesen Worten wandte der Mann seinen Körper mit einer raschen Bewegung nach links und zeigte in eine der schmalen Gassen hinauf zur Mühle. Alle Blicke folgten seinem Zeigefinger.
»Und dann, verehrte Augenzeugen, wird das Rad sich …« – er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr – »… weiterdrehen.«
Ein Stöhnen ging durchs Publikum.
»Und weiterdrehen …«
Jetzt war nur noch ein deutlich leiseres Raunen zu vernehmen. Dann aber wurden die Zuschauer unruhig und begannen, sich aufgeregt miteinander zu unterhalten.
Ein schlaksiger Kerl, der auf einen Marktstand geklettert war, krakeelte mit heiserer Stimme: »Ein drehendes Rad? Was soll denn daran besonders sein?«
Andere stimmten ihm zu.
Von irgendwo flog ein brauner Kohlkopf auf die Bühne, der Orffyreus aber weit verfehlte.
Der fremde Aussteller erstarrte in diesem Moment. Er schloss die Augen, breitete die Arme aus, als würde er gleich zum Himmel emporfahren, und rief mit donnernder Stimme: »Schweigt, Ihr verdammten Sünder! Sonst wird der Herr Euch alle bestrafen!«
Augenblicklich herrschte wieder gespenstische Ruhe auf dem Platz.
»Das Rad …«, schrie Orffyreus, wobei seine Schlagader und die Sehnen am Hals hervortraten, »dieses Rad, welches ich erfunden habe, wird, wenn es von mir einmal angestoßen wurde, nie wieder anhalten! Es wird sich bis in alle Ewigkeit weiterdrehen! Selbst dann noch …« – er öffnete wieder die Augen und lehnte sich weit nach vorn, wodurch er in das Publikum zu fallen drohte –, »… wenn Ihr alle bereits tot und verfault seid!«
Bei den Worten »tot« und »verfault« stöhnte die Menge auf.
»Was Ihr Unwissenden hier seht, ja sehen dürft, ist ein Perpetuum mobile! Eine Apparatur, in der sich die göttliche Kraft, die Ewigkeit auf Erden manifestiert! Und ich habe sie erfunden! Ich – Orffyreus!« Bei den letzten Worten fasste er sich an die Brust und schaute ergriffen in den bewölkten Himmel.
Erstmals wichen die Zuschauer ein wenig vom Podium zurück, sodass sich die Welle zusammengepresster Leiber nun von vorn nach hinten über den Platz ausbreitete.
»Wenn Ihr also Gott sehen wollt, und zwar hier und jetzt, dann gebt einen kleinen Obolus in die Beutel meiner Gehilfen. Wenn die Beutel ausreichend gefüllt sind, um dem Herrn gerecht zu werden, werde ich mit dieser Hand das Rad anstoßen. Und Ihr werdet Zeuge der göttlichen Energie und Unendlichkeit!«
Wieder zeigte Orffyreus seine Hand, schloss die Augen und verharrte in dieser Pose auf dem Podium, als sei er in Stein gegossen worden. Gleichzeitig drängten sich mit spitzen Ellbogen vier schmutzige Burschen in abgewetzter Kleidung durch die Menge und forderten die Männer und Frauen mit drohenden Gesten auf, ein paar Pfennige in ihre Beutel zu werfen.
Nachdem einige Minuten vergangen waren, wurde die Menge erneut ungeduldig. Und als gar die Rufe und Beschimpfungen wieder zunahmen, blies der Mann auf dem Podium in ein großes Horn, sodass alle zusammenfuhren.
»Die prallen Beutel zeigen mir, dass Ihr gottesfürchtig genug seid. Nun werde ich das Rad anstoßen. Silence, bitte! Attention!«
Als es etwas ruhiger war, schritt der selbsternannte Erfinder zu dem Rad, fasste es auf der linken Seite so weit oben an, wie er nur greifen konnte, und gab ihm einen mächtigen Stoß nach unten. Das Publikum applaudierte. Das Rad nahm zügig an Fahrt auf und erreichte alsbald einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf, sodass es weder langsamer noch schneller wurde. Gespannt starrten die Menschen vor der Bühne auf das Rad, und für einen Augenblick waren nur die klappernden Geräusche aus dem Inneren des Rades zu hören. Orffyreus schritt währenddessen stetig von einem Ende des Podiums zum anderen. Kurz bevor er jeweils kehrtmachte, zeigte er mit einer ausladenden Bewegung seiner Arme erst auf das Rad, dann in den Himmel und schließlich auf sich selbst.
Das Publikum beobachtete dieses Schauspiel einige Zeit, dann griff erneut Unruhe um sich.
»Ich kann hier nicht bis in alle Ewigkeit stehen, um abzuwarten, ob erst ich sterbe oder vorher das Rad stehen bleibt!«, rief ein Mutiger, der auf den Rand eines Brunnens gestiegen war, um einen besseren Blick auf das Rad zu haben.
Schallendes Gelächter brach aus.
»Da sitzt ein Zwerg drin!«, behauptete ein anderer mit lauter Stimme.
Abermals wurde herzhaft gelacht.
»Ja, entfernt das Wachstuch und zeigt uns, was oder wer das Rad antreibt!«, rief eine Frau.
»Ja, zeigt uns das Innere!«
Orffyreus versuchte vergeblich, das Publikum mit beruhigenden Handbewegungen und Gesten zu beschwichtigen. Zwischendurch deutete er immer wieder auf das Rad und in den Himmel.
Ein Knabe, der kaum älter als neun Jahre sein mochte, erklomm schließlich das Podium und rannte unter dem Gejohle der Anwesenden auf das Rad zu, um das Wachstuch herunterzureißen. Kurz bevor er es erreichte, wurde er von zwei Gehilfen, die Orffyreus assistierten, zu Fall gebracht und trotz seiner heftigen Gegenwehr vom Podest in die Zuschauermenge geworfen. Dies ermunterte nun weitere Wagemutige dazu, ebenfalls zu versuchen, auf das Podium zu gelangen, um einen Blick zu riskieren. Verzweifelt traten und schlugen die Gehilfen nach den meuternden Menschen, die von unten nach dem Bühnenrand griffen.
Aus der Menge flogen nun Gemüseabfälle, Fischköpfe und andere Überbleibsel des morgendlichen Markttreibens.
»Scharlatan, Betrüger!« Immer wütender wurden die Rufe aus dem Publikum.
Als die Anzahl derjenigen, die das Podium stürmen wollten, von den oben Stehenden nicht mehr zu bewältigen schien, ergriff Orffyreus eine am Boden bereitliegende schwere Axt. Mit wilden Schwüngen schlug er nach den Aufmüpfigen, die erschrocken zurückwichen.
Dann holte er mit der Axt zu einem mächtigen Hieb aus – gegen sein eigenes, sich immer noch gleichmäßig drehendes Rad. Die scharfe Schneide bohrte sich in das Holz hinein, die runde Konstruktion geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte krachend nach hinten. Der am Rad über Streben befestigte Kasten wurde durch den Sturz ausgehebelt und im hohen Bogen in das Publikum katapultiert. Die vorne Stehenden stoben kreischend auseinander, um dem Geschoss zu entgehen, das auseinanderbrach, als es auf dem Boden aufschlug. Auch das Rad zerbarst am Rande des Podiums in Hunderte Teile, die meterweit in die Menge geschleudert wurden.
Die Panik, welche die Masse auf der Flucht vor den Trümmerteilen erfasst hatte, nutzten Orffyreus und seine Gehilfen. Gemeinsam sprangen sie von der Bühne und bahnten sich den Weg in eine der kleinen Gassen, die sternförmig in alle Richtungen aus der Stadt führten.
Bevor der kleine Trupp um Orffyreus den Platz verließ, griff er einen älteren Mann, der sich ängstlich gegen das Mauerwerk eines Hauses gedrückt hatte, um die Fliehenden passieren zu lassen, am Kragen. Er zog den Greis nahe zu sich heran und schrie ihm ins Gesicht: »Ich wollte Euch ein Stück Gott zeigen, Ihr aber habt nur den Teufel verdient!«
Wütend stieß Orffyreus den Alten von sich weg, sodass er rücklings auf den staubigen Boden fiel, und folgte seinen Knechten in den dunklen Schatten der Gasse.
3
»Ich bin ein guter Patentanwalt«, sagte ich in einem ruhigen, sachlichen Ton. »Schildern Sie mir bitte einfach den Fall, und ich werde sehen, was ich für Sie tun kann.«
»Endlich wird er ärgerlich!«, spottete mein Mandant und drehte sich zu seiner Ehefrau, die jedoch nicht darauf reagierte. »Nun gut«, meinte er daraufhin und richtete den Blick wieder auf mich; hinter der Sonnenbrille konnte ich seine Augen allerdings nur erahnen.
»Ich bin im Besitz eines Patents. Und dieses wird von einem Unternehmen verletzt. Und das müssen Sie bitte beenden.« Er hatte diese Sätze betont leise gesprochen, nun aber fügte er laut aufbrausend hinzu: »Und bei der Gelegenheit beenden Sie das Unternehmen, das mein Patent verletzt, bitte auch gleich mit! Pfänden Sie dort alles, was es zu holen gibt. Ich werde Ihnen eine Liste mit Gegenständen zur Verfügung stellen.«
Er schlug mit der Hand auf den Tisch. Ich registrierte, wie seine Ehefrau kaum merklich den Kopf schüttelte.
Die Geschichte, die ich in der nächsten Stunde mit viel Geduld aus meinem Mandanten wie aus einer alten, trockenen Zitrone herauspresste, unterschied sich nicht allzu sehr von den anderen Geschichten, die wir in der Kanzlei täglich hörten. Lediglich die Art, wie sie erzählt wurde, war lauter und ordinärer.
Der Mandant hatte das Patent vor Jahren von einem Maschinenbauunternehmen erworben. Dessen Betriebsinhaber, der sich mit dem Verkauf des Patents vor der sicheren Insolvenz retten wollte, verstarb kurze Zeit danach. Nun hatte mein Mandant herausgefunden, dass die Ehefrau des Verstorbenen den Betrieb übernommen und die Produktion weitergeführt hatte, ohne sich um den Verlust des Patents zu kümmern. Es war nun die Aufgabe unserer Kanzlei, die Frau abzumahnen und auf Schadensersatz zu verklagen. Ziel sollte es sein, die Patentverletzung zu unterbinden und, so mein Mandant, die Unternehmerin finanziell zu ruinieren. Auf meinen zaghaften Versuch hin, gegen diesen martialischen Wunsch zu intervenieren, hielt er mir einen Vortrag über die freie Marktwirtschaft und einen gesunden Darwinismus in einem solchen System. Schließlich gelang es mir, unter Hinweis auf die letzte Erhöhung unseres Stundenhonorars und die bereits verstrichene Zeit ihn samt Ehefrau und Hund aus dem Konferenzraum und auch aus der Kanzlei zu komplimentieren.
Zurück in meinem Büro schlich ich eine Weile um den Schreibtisch herum und starrte dabei immer wieder aus dem Fenster. Meinem Büro gegenüber lag der Containerhafen, und ich konnte beobachten, wie die riesigen, auf Schienen hin- und herfahrenden Kräne einen riesigen Behälter nach dem anderen von den Schiffen hoben und auf Bahnwaggons oder die Auflieger von Sattelzügen verluden.
Ich musste an Marie denken. Jedes Mal wenn wir von Süden den Elbtunnel erreichten und dabei die riesigen Containertürme passierten, sah sie lange auf die Stapel aus bunten Stahlkästen und wünschte sich, irgendeinen der Container mitnehmen zu können.
»Was da wohl drin ist?«, hatte sie dann gefragt und fast sehnsüchtig hinzugefügt: »Vielleicht Tausende von Schuhe oder ein Auto?«
»Oder eine Ladung trommelnder Batterie-Häschen aus China«, hatte ich grinsend geantwortet.
Marie aber war ernst geblieben. »Es wäre reine Glückssache, wenn man einen auswählt. Wenn man Pech hat, ist er sogar leer.«
Marie und ich waren inzwischen seit über einem Jahr getrennt. Und da sie die Beziehung für mich vollkommen überraschend beendet hatte, tat mir die Erinnerung an sie immer noch weh. Ich hatte schon seit vielen Monaten nichts mehr von ihr gehört. Seit der Trennung hatte ich mir vorgenommen, ihr einen Container ohne Absender zu schenken, sollte ich jemals zu sehr viel Geld kommen. Ich stellte mir vor, wie ich in den Hafen ging, wahllos einen aussuchte und ihn kaufte. Hoffentlich erwischte ich dann keinen leeren.
Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, hatte ich den Schreibtisch ein weiteres Mal umrundet und blickte auf die rote Akte vor mir, die ich von der Patentanwaltsgehilfin zu dem Fall hatte anlegen lassen. Ich schlug sie auf. Ganz oben lag ein Schreiben meines Mandanten, das dieser selbst verfasst hatte, gerichtet an »die Patentverletzerin«. Weiter hieß es: »Dies ist die letzte Warnung. Solltest Du Miststück die Patentverletzung nicht einstellen, werde ich die Angelegenheit meinem Anwalt übergeben und dafür sorgen, dass Du in diesem Leben nicht mehr glücklich wirst. Denk daran, was mit Siggi geschehen ist. Ansgar.« Der Mandant duzte die Gegnerin. Offenbar kannten sie sich persönlich.
Ich tat, was ich niemals zuvor getan hatte. Es war keine übliche und noch nicht einmal eine angebrachte Handlung. Heute kann ich sie mir auch nicht mehr erklären. Vielleicht geschah es aus Trotz gegen meinen so unsympathischen Mandanten. Oder wegen meiner sentimentalen Erinnerungen an Marie kurz zuvor.
Ich griff zum Telefonhörer und wählte eine der in meiner Akte aufgeführten Nummern. Ich wollte schon wieder auflegen, als sich am anderen Ende der Leitung eine ältere, aber immer noch zarte Frauenstimme meldete.
»Ja?«
»Guten Tag, mein Name ist Robert Weber. Ich bin Patentanwalt. Herr Ansgar Kiesewitz hat mich beauftragt. Spreche ich mit Frau Ingrid Söhnke?«
Für einen Moment herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung.
»Legen Sie nicht auf!«, sagte ich schnell, etwas flehender als beabsichtigt. Wieder entstand eine Pause, bevor ich eine Erwiderung zu hören bekam.
»Sie sind also der Mann, der mich zur Strecke bringen soll?«, fragte meine Gesprächspartnerin trocken. Ich war nicht sicher, ob sie dabei verbittert oder süffisant klang.
»Ich bin der Anwalt, der von Herrn Kiesewitz wegen des Patentrechtsstreits beauftragt wurde«, stellte ich etwas umständlich klar. Ich fühlte mich plötzlich unwohl und bereute es schon, dass ich überhaupt angerufen hatte.
»Kiesewitz ist ein Mörder!«, drang es aus dem Hörer.
Ich brauchte einen Moment, bis ich mich wieder gefangen hatte.
»Ich verstehe nicht«, sagte ich.
»Er hat meinen Gatten auf dem Gewissen.«
»Ich verstehe immer noch nicht.«
»Kommen Sie mich besuchen, wenn es Sie wirklich interessiert; dann erkläre ich es Ihnen.«
Ich stockte. Als Patentanwalt war ich ausschließlich meinem Mandanten verpflichtet. Es war mir nicht nur berufsrechtlich verboten, mich über die Maßen mit der Gegenseite zu beschäftigen; es stellte sogar eine Straftat dar, für die ich ins Gefängnis kommen konnte.
»Ich komme«, versprach ich und konnte selbst nicht glauben, was ich hier tat.
»Samstag. Wann, ist egal, ich bin den ganzen Tag hier. Sie fahren auf den Hof und lassen die Betriebshalle links liegen. Dahinter steht ein kleiner Bungalow.«
»Ich werde gegen Nachmittag bei Ihnen sein.«
»Bis dann.«
Meine Gesprächspartnerin legte auf, und ich hörte das kurze Tuten des Besetztzeichens. Mit bedächtigen Bewegungen legte ich den Hörer auf, lehnte mich in meinem Bürostuhl zurück und lockerte meinen Krawattenknoten.
Ich war jung, erfolgreich – und auf dem direkten Weg in die Patentanwaltshölle.
Erstaunlicherweise fühlte ich mich nicht schlecht dabei.
4
Draschwitz, 1714
Seit der missglückten Aufführung in Gera waren zwei Jahre vergangen. Orffyreus hatte in der kleinen Stadt Draschwitz Zuflucht gefunden, die keine Tagesreise von Gera entfernt lag. Mit seiner Frau Barbara, den Kindern Jonas, Elias und David sowie der Magd Anne Rosine Mauersberger war er im leer stehenden Bediensteten-Trakt eines verfallenen Ritterguts untergekommen. Es bot auch genügend Platz für die fünf jungen Männer, die ihn begleiteten und ihm als Gehilfen dienten. Drei waren Waisen. Sie hießen Hannes, Franz und Paul und trugen alle den Nachnamen Moser. Sie waren Brüder, keiner älter als sechzehn Jahre. Orffyreus hatte sie aus einem Zuchthaus in Zittau freigekauft, wo sie wegen Bettelei inhaftiert gewesen waren. Sie zeigten sich dankbar für die zurückgewonnene Freiheit und folgten ihm gegen freie Kost und Logis. Gustav, ein bärbeißiger Knecht Ende zwanzig, hatte bereits Barbaras Vater gedient und war ihnen von deren Familie im Zuge der Mitgift überlassen worden. Ein weiterer Knabe, der sich Xaver nannte und dessen Alter niemand kannte, hatte sich ihnen in Meuselwitz angeschlossen. Er redete kaum, arbeitete aber im Austausch für eine tägliche Mahlzeit hart und zuverlässig.
Ihr neues Zuhause lag etwas versteckt am Rande der kleinen Gemeinde, was Orffyreus nach den Geschehnissen von Gera nur gelegen kam. Im Wirtshaus erzählte man sich, dass der Gutsherr, der Freiherr von Seitz, sein Vermögen in einer einzigen Nacht beim Pharaospiel verloren hatte. Sämtliches Gesinde außer einer einzigen Köchin und einer tauben Magd waren vom Freiherrn schon vor Jahren aus dem Dienst entlassen worden, sodass die ehemaligen Behausungen der Bediensteten verwaist waren.
Als Gegenleistung für die Unterkunft war anstelle eines Mietzinses vereinbart worden, dass Orffyreus, der seine eigene handwerkliche Begabung herausgekehrt hatte, einige dringende Reparaturarbeiten am Dach, an den Ställen und dem Brunnen des Ritterguts vornehmen sollte. Zudem hatte man sich darauf geeinigt, dass Orffyreus die große Scheune auf dem Gutsgelände nutzen durfte, um dort wissenschaftliche Experimente gegen Entgelt vorzuführen. Von den zu erwartenden Einnahmen sollten die Besitzer des Anwesens jeweils den fünften Teil erhalten.
Orffyreus und seine Begleiter hatten nach ihrer Ankunft nur sehr schleppend mit den vereinbarten Instandsetzungsarbeiten an den Gebäuden begonnen. Obwohl Orffyreus mit seinem Gefolge nun bereits seit zwei Jahren dort wohnte, waren sie kaum vorangekommen. Lediglich das Dach des großen Wohnhauses war gleich in den ersten Tagen notdürftig mit Platten vernagelt worden, um die Bewohner vor dem Regen zu schützen.
An den Ställen hatten sie damit begonnen, Holzlatten auszutauschen. Hierfür hatte Orffyreus den Ankauf großer Mengen Holz gefordert, doch der Freiherr und seine Frau benötigten allein ein Jahr, um das Geld dafür aufzubringen. Unter anderem mussten sie Vieh und wertvollen Familienschmuck aus besseren Zeiten veräußern. Orffyreus bot hierbei bereitwillig seine Hilfe an, und so nahm er eines Tages die Tiere und das Goldgeschmeide mit in die Stadt, um alles im Auftrag seiner Gastgeber treuhänderisch zu verkaufen. Jedoch, so berichtete er den enttäuschten Herrschaften nach seiner Rückkehr aus der Stadt, war es ihm wegen des dürftigen Zustands der Tiere und des Alters des Schmucks nicht gelungen, einen guten Preis zu erzielen. Nach Abzug einer kleinen Provision für sich selbst vermochte er kaum zwei Taler an die Verkäufer zu übergeben. Dennoch war zu guter Letzt eine Holzlieferung eingetroffen.
Obwohl dieser Holzstapel, der hinter den Stallungen lagerte, über die Monate stetig abnahm, war an den Ställen fast kein Fortschritt zu erkennen. Es war nur der nachlassenden Sehkraft und dem schlechten Gehör der gealterten Gutsbesitzer zu verdanken, dass diese nicht bemerkten, wie Orffyreus und seine Knechte mit dem Anbruch der Dunkelheit große Mengen der angekauften Bretter in die nahe Scheune schleppten und dort während der Nachtstunden unter lautem Sägen und Hämmern verarbeiteten.
Tagsüber verschwand Orffyreus oft für Stunden mit seiner großen Ledertasche in der Stadt und den umliegenden Dörfern.
Es hatte sich nach seiner Ankunft herumgesprochen, dass er von sich behauptete, nicht nur ein Baumeister, sondern vor allem auch ein erfahrener Mediziner zu sein. Er sei, so erzählte man sich, als Arzt durch Europa gereist und habe selbst Könige schon erfolgreich zur Ader gelassen. Und daher kam es immer wieder vor, dass eine Kutsche den Weg hinaus zum Rittergut fand oder spätabends noch ein Reiter auf einem erschöpften Pferd in den Hof preschte, um mit Orffyreus zur Behandlung eines erkrankten Familienmitglieds oder Herrn davonzueilen.
Diese Tätigkeit brachte Orffyreus einen beträchtlichen Nebenverdienst ein, sodass er und seine Familie in den Unterkünften für die ehemaligen Bediensteten bald fürstlicher lebten als die verarmten Gastgeber im Haupthaus.
An einem der ersten schönen Sommertage im Juli geschah es, dass Orffyreus beim Freiherr und seiner Gattin vorsprach, um das zu fordern, was bei ihnen am wenigsten vorhanden war.
Die beiden hatten Orffyreus im Salon empfangen und eine Tasse Kaffee servieren lassen. Man konnte nur raten, wie es ihnen gelungen war, an die kostbaren Kaffeebohnen zu gelangen. Ihr Genuss war wegen ihrer schadhaften Wirkung für Körper und Geist verboten worden, und seitdem stiegen die Preise in astronomische Höhen.
»Ich bin hocherfreut, Euch eine wichtige Mitteilung machen zu können«, eröffnete der stets fein gekleidete Orffyreus das Gespräch. »Meine Experimente sind nun so weit fortgeschritten, dass wir sie der Öffentlichkeit präsentieren können. Und wie Ihr wisst, haben wir die Abmachung, dass von den Erlösen dieser Vorführungen ein ganzes Fünftel Euch zustehen soll.«
Die Dame des Hauses stimmte dem angedeuteten Vorhaben entzückt zu; und ein großer Teil ihrer Freude bestand darin, dass sich ihr Gast noch an diese bei seiner Ankunft getroffene Abrede erinnerte. Es waren schlimme Zeiten, in denen jeder seinen Gewinn suchte.
»Es ist beruhigend, dass es noch Ehrenmänner wie Euch gibt, welche die Bedeutung des Wortes achten«, merkte sie an. »Offenbar haben wir es hier mit einem solchen zu tun!« Sie lehnte sich zurück und legte ihre Hände in den Schoß.
Ihr Ehemann, der gerne Wein trank und dessen Wangen von roten Äderchen durchzogen waren, warf Orffyreus einen erwartungsfrohen Blick zu.
»Ich rechne aufgrund der Einzigartigkeit meiner Erfindung mit einem erheblichen Vermögen aus den Eintrittsgeldern«, verkündete Orffyreus. »Und ich bin froh, dass ich auf diese Weise ein Stück Eurer überaus großen Gastfreundschaft zurückgeben kann.«
Nun lächelte die Dame verlegen, breitete ihren Fächer aus und versteckte ihr Gesicht dahinter, um sodann kokett hervorzublicken. Ihr Mann leckte sich mit der Zunge aufgeregt die Lippen. Offenbar schien er den angekündigten Geldsegen in seinen Vorstellungen bereits am Spieltisch zu verdoppeln.
»Jedoch«, fuhr der Besucher fort, »ist der Erfolg ernsthaft in Gefahr.«
Ängstlich riss der Mann seine Augen auf, und auch seine Ehefrau ließ erschrocken den Fächer sinken. Zu sehr hatten die letzten Jahre an ihnen gezehrt, und nun drohte sich die Hoffnung auf Geld – die seit Langem erste Aussicht auf neuerlichen Reichtum – wieder in Luft aufzulösen.
Beruhigend legte Orffyreus seine Hände auf je eine Hand seiner Gesprächspartner und senkte verschwörerisch seine Stimme. »Keine Sorge, wir können es noch abwenden.«
In den Blicken des alten Ehepaares keimte Hoffnung auf.
»Das Problem ist, dass dieser Ort hier, wie Ihr selbst wisst, sehr abgelegen ist. Die Menschen müssen davon erfahren, dass hier, auf Eurem Land, eine wissenschaftliche Sensation vorgeführt wird. Nur so können wir sie hierherlocken. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Möglichkeiten geprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Aushänge werden drucken müssen. Auch fliegende Blätter sollten wir verteilen.«
Orffyreus machte eine kurze Pause, um die Wirkung seiner Worte zu überprüfen. Seine Gegenüber sahen ihn weiterhin mit regungsloser Miene an.
»Meine Leute und ich sind gern bereit, diese schwierige Arbeit der Bewerbung auf uns zu nehmen. Jedoch werden wir für die Herstellung der Anschläge und der zu verteilenden Schriften Geld investieren müssen. Ich habe mich erkundigt; der Drucker in Seitz verlangt dafür einen vergleichsweise unwesentlichen Betrag.«
Wieder hielt Orffyreus inne und schaute erst den Freiherrn, dann die Freifrau mit zur Seite geneigtem Kopf an. Immer noch wirkten beide wie Statuen. Vergeblich wartete er auf eine Reaktion von ihnen.
»Leider ist der Betrag nicht so unwesentlich, dass ich allein dafür aufkommen könnte. Auch ist es ja so, dass Ihr von den Erlösen der Vorführung mit profitieren werdet. Hinzu kommt – es ist mir sehr unangenehm, darauf hinweisen zu müssen –, dass ich natürlich die Investitionen für den Bau meiner Erfindung in den vergangenen Monaten auch schon allein getragen habe.« Orffyreus senkte bei diesen letzten Worten seinen Blick zu Boden, als sei es ihm tatsächlich unangenehm, darüber zu sprechen. »Allein das viele Holz, welches ich für den Bau meiner Apparatur benötigte, hat meine Ersparnisse fast zur Gänze aufgezehrt.«
In die Dame des Hauses kehrte zuerst das Leben zurück.
»Aber nein, Inventore, das muss Euch nicht unangenehm sein. Wir wissen zu schätzen, was Ihr für uns tut!«
»Keineswegs wollen wir uns von Euch aushalten lassen, Inventore«, stimmte auch ihr Ehemann mit ein.
»Das habe ich nicht behauptet«, empörte sich Orffyreus und machte eine abwehrende Handbewegung.
»Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir bei allen Mühen und Investitionen, die Ihr hattet, die Kosten für den Druck dieser Reklame-Blätter übernehmen«, erklärte nun der Gutsbesitzer und schaute dabei etwas unsicher zu seiner Frau.
»Naturellement!«, bestätigte diese sogleich und blickte ihrerseits mit gespielter Beschämung auf die abgenutzten Holzdielen des Salons, in denen der Holzbock hauste.
»Nur habe ich zuvor eine Frage, Herr Inventore, wenn Ihr erlaubt«, warf der Gutsbesitzer ein.
»Fragt, mein Herr.«
»Was genau ist eigentlich Eure Erfindung?«
»Eine sehr gute Frage«, lobte Orffyreus. Dann beugte er sich vor, blickte kurz nach links und rechts, als würde er sichergehen wollen, dass man unbeobachtet war, und antwortete mit flüsternder Stimme: »Es handelt sich wahrhaftig um ein triumphierendes Perpetuum mobile.«
»Wahrhaftig!«, wiederholte der Mann mit lauter Stimme und schlug sich mit den Händen auf die Schenkel, die in einer speckigen Kniehose aus grünem Samt steckten.
Und seine Frau rief etwas unsicher, dafür aber mit übertriebener Verzückung: »Ein triumphierendes! Und dies hier bei uns in Draschwitz! Welche Ehre!«
Es war deutlich zu spüren, dass beide noch niemals zuvor von diesem lateinischen Begriff gehört hatten und sich auch nicht das Geringste darunter vorstellen konnten. Doch offenbar verbat Ihnen ihre Stellung, diese Wissenslücke zuzugeben. Wenn das Geld in diesem Hause schon knapp war – die Bildung sollte es nicht auch sein. Der Gast, der geübt darin war, die Reaktionen seiner Mitmenschen auf den lateinischen Namen seiner Erfindung zu deuten, bemerkte dies selbstverständlich. Er dachte aber nicht daran, diesen Mangel an Wissen jetzt auszugleichen.
»Ich darf doch darauf vertrauen, dass Ihr dieses Geheimnis noch eine kurze Zeit für Euch bewahrt?«, fragte er stattdessen.
»Naturellement!«, bestätigten beide mit gespielter Empörung.
»Zurück zum Geld«, sagte Orffyreus plötzlich in einem sehr harschen Tonfall, der seine beiden Gesprächspartner zusammenfahren ließ. »Mir ist bekannt, dass die finanzielle Lage bei Euch derzeit ein wenig, wie soll ich sagen, angespannt ist. Wenn Ihr nicht in der Lage seid, das Geld für die Werbung aufzubringen, könnte ich mein Perpetuum mobile auch woanders ausstellen. Zentraler. Dann würde ich Euch Unannehmlichkeiten ersparen. Nur Eure Beteiligung – die wäre dann natürlich hinfällig.«
»Das kommt gar nicht infrage!«, riefen nun beide wie aus einem Munde und erhoben sich, so als wollten sie Orffyreus am Gehen hindern.
»Wie Euch vielleicht aufgefallen sein mag, haben wir aktuell einen, na ja, kleinen Engpass, was die Liquidität angeht«, fuhr der Freiherr erregt fort. »Aber wir besorgen Euch das Geld.« Er wandte sich an seine Ehefrau. »Emalia, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du dich von deiner Kette mit dem Anhänger trennst.« Er hielt seiner Gattin die offene Hand entgegen.
Sie fasste sich unvermittelt an ihr Dekolleté und stieß einen schrillen Schrei aus. »Nein, die ist von meiner Frau Mutter. Das letzte Erinnerungsstück! Nicht diese Kette!«
Flehentlich sah sie zu ihrem Mann herüber und dann sich im Raum um, so als suchte sie etwas anderes, was noch versilbert werden konnte. Viel war indes nicht mehr vorhanden, da die beiden das wertvolle Mobiliar bereits vor langer Zeit versetzt hatten, um verschiedene Gläubiger zu befriedigen.
Unerwartet sprang Orffyreus ihr zur Seite. »Meine Dame, nie würde ich verlangen, dass Ihr dieses wertvolle Erbstück, dieses Kleinod Eurer geliebten Frau Mutter – der Herr hab sie selig –, verkauft!«
Die Frau stieß einen erleichterten Seufzer aus und umklammerte weiter mit der linken Hand den Anhänger, der an einer Goldkette um ihren Hals hing, gleich so, als müsse sie ihn beschützen.
»Wie wäre es, wenn ich Euch, und bitte versteht dies ausschließlich als Zeichen meiner Dankbarkeit und meiner Ehrerbietung, einen Kredit gewähre?«, fragte Orffyreus nun.
»Einen Kredit?«, entgegnete der Hausherr. »Wie sollen wir Euch glaubhaft zusagen, diesen zurückzuzahlen?«
»Oh, gar nicht!«, antwortete Orffyreus.
»Gar nicht?«, wiederholte der Freiherr irritiert.
»Ganz genau. Ich gewähre Euch einen Kredit. Ihr zahlt ihn zurück, indem ich Euch in der ersten Zeit der bald beginnenden Vorführungen – sagen wir, in den ersten sechs Monaten – das Euch zustehende Fünftel an den Einnahmen nicht auszahle, sondern es mit dem Darlehen verrechne. Danach erhaltet Ihr dann Monat für Monat Euren Anteil. Euch verbleibt somit noch immer genügend Zeit, um mit Eurer Beteiligung ein Vermögen anzuhäufen!« Orffyreus hatte seinen Einfall mit freudiger Stimme verkündet und blickte nun mit einem gespannten Grinsen in die Gesichter seiner Gastgeber. Nachdem die beiden einen Augenblick gebraucht hatten, um den Vorschlag zu verstehen, breitete sich auch auf ihren Gesichtern endlich Freude aus.
»Das würdet Ihr für uns tun, Inventore?«, fragte die Freiherrin.
»Wir stehen in Eurer Schuld«, sagte ihr Ehemann und vollzog im Sitzen eine angedeutete Verbeugung.
»Nicht doch. Ihr habt mich und meine Familie hier so selbstlos und warmherzig aufgenommen«, wehrte Orffyreus ab und erhob sich mit einem Sprung von seinem Sitzplatz.
Auch seine Gastgeber quälten sich aus den durchgesessenen Polstern ihrer Stühle.
»Schön, dass wir das geklärt haben«, sagte Orffyreus, griff nach seinem Mantel und machte Anstalten zu gehen. Plötzlich hielt er inne, als hätte er etwas vergessen.
»Ach, eins noch. Ich würde es für angebracht halten, wenn wir angesichts der Bedeutung des Perpetuum mobile während der Vorführungen ein Kreuz in der Scheune aufhängen.«
»Ein Kreuz?«, rief die Dame erstaunt.
»Ich denke, Ihr führt ein gottesfürchtiges Haus. Und Ihr wisst, dass sich nirgends die Kraft des Schöpfers so rein, so unvermittelt zeigt wie in einem funktionierenden Perpetuum mobile, das ewige Bewegung verspricht.«
Für einen kurzen Augenblick schienen seine Gesprächspartner verstört zu sein. Diesmal fand der Freiherr zuerst die Contenance wieder.
»Naturellement sind wir ein gottesfürchtiges Haus. Und naturellement ist es von größter Notwendigkeit, neben Eurem Pertu Nobile ein Kreuz aufzustellen. Ich könnte mir, offen gestanden, keine Präsentation ohne ein solches vorstellen.«
»Es freut mich, dass wir auch hier einig sind«, stellte Orffyreus zufrieden fest. »Da es Eure Scheune ist und das Kreuz mit Sicherheit dauerhaft hier auf Eurem Gut verbleiben wird, wäre ich dankbar, wenn Ihr diese kleine Anschaffung noch übernehmen könntet.«
»Nachdem Ihr uns in den anderen Dingen so entgegengekommen seid, wie könnten wir da ablehnen?«, sagte der Mann und wandte sich zu seiner Frau um. Ehe diese zu einer Reaktion in der Lage war, griff er nach ihrem Anhänger und riss ihn mit einem Ruck, der die Kette zum Reißen brachte, von ihrem Hals. Sie schrie auf und fasste sich an das Dekolleté, doch es war zu spät. Augenblicklich füllten sich ihre Augen mit Tränen.
»Nehmt dieses und erwerbt von dem Verkaufserlös ein Kreuz, welches Ihr für angemessen erachtet, mein Herr!« Der Freiherr hielt Orffyreus den Anhänger hin, von dem die zerrissene Kette herabhing.
Ohne zu zögern, griff er mit einer schnellen Bewegung zu. Er machte einen großen Schritt nach vorn und gab der nun von einem Weinkrampf geschüttelten Dame des Hauses einen sanften Kuss auf die Stirn.
»Es ist für Gott, meine Dame«, tröstete er sie mit warmherziger Stimme. »Ich werde für Eure Mutter beten. Ich durfte sie nicht kennenlernen, bin aber sicher, sie hätte es so gewollt.«
Die Freifrau jammerte bei diesen Worten noch lauter auf, um sich anschließend einem verzweifelten Schluchzen hinzugeben.
Orffyreus marschierte zur Tür, öffnete sie und drehte sich noch einmal um. Mit einer galanten Bewegung vollführte er eine angedeutete Verbeugung und verabschiedete sich dann beim Hinausgehen mit den Worten: »Ich empfehle mich!«
»Vielen Dank, Ihr seid sehr großzügig!«, rief der Hausherr ihm hinterher, bevor die Tür ins Schloss fiel. Dann überließ er seine weinende Frau sich selbst und eilte zu seinem bescheidenen Weinlager, um rasch eine Flasche vom Roten zu entkorken.
5
Der Kassierer an der Tankstelle in Göttingen hatte mir erklärt, wo ich die Maschinenbaufirma Söhnke & Söhne finden würde. Sie lag versteckt in einer kleinen Seitenstraße hinter einer Gärtnerei. Ich bog nun in die schmale Hofeinfahrt ein und hielt kurz meinen Wagen an.
Es war Samstagmittag, und der Betrieb lag verlassen vor mir. Das Unternehmen schien seine besten Jahre schon seit längerer Zeit hinter sich zu haben. Das Fabrikgebäude bestand aus rotem Backstein, der von der Witterung stark angegriffen war, und wirkte in seiner Bauweise wie ein Relikt aus einer anderen Epoche. Davor lagerten Holzpaletten, die mit wenig Sorgfalt hochkant nebeneinandergestellt worden waren; einige von ihnen waren bereits wieder umgestürzt. Überall auf dem Hof lagen zerschnittene Nylon-Banderolen. Mit ihnen war offenbar die angelieferte Ware gesichert gewesen, und nach dem Entfernen hatte man sie einfach achtlos auf den Boden geworfen.
Im Schritttempo fuhr ich weiter. Nach einigen Metern gab das Fabrikgebäude den Blick auf einen Bungalow frei. Er war in keinem besseren Zustand als das Fabrikgebäude und strahlte auf den ersten Blick eine gewisse Traurigkeit aus. Vielleicht lag es an den halb heruntergelassenen Rollos, die etwas von halb geschlossenen Augen hatten. Vor dem Bungalow befand sich ein schmales Blumenbeet, das schon lange nicht mehr gepflegt worden war. Direkt daneben parkte ich und stieg aus.
Für einen Moment machte ich mir Gedanken darüber, ob überhaupt jemand da war, weil ich mein Kommen erst für den Nachmittag angekündigt hatte: Ich war schneller hergekommen, als ich vermutet hatte, denn die von mir erwarteten Staus waren ausgeblieben, und die Fahrt von Hamburg nach Göttingen hatte nur etwa drei Stunden gedauert. Doch kaum hatte ich meine Autotür zugeschlagen, öffnete sich schon die Haustür des Bungalows. Heraus trat eine zierliche Frau. Ich schätzte sie auf Ende fünfzig. Sie blickte mich aus wachen, stahlblauen Augen ohne jede Feindseligkeit an. Als junge Frau musste sie sehr hübsch gewesen sein. Das Leben war jedoch nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Ihre blonden Haare waren von ersten grauen Strähnen durchzogen. Um die Augen herum hatten sich kleine und größere Falten eingegraben, die von traurigen Erlebnissen zeugten. Sie kam mit energischen Schritten auf mich zu und hielt mir ihre Hand entgegen. Ihre gesamte Körperhaltung war nicht ohne Stolz, ihr Händedruck fest.
»Ich bin ein wenig früh«, sagte ich entschuldigend.
»Kommen Sie herein, ich habe einen frischen Kaffee für Sie, und wenn Sie sich benehmen, auch ein Stück Kuchen.«
Sie drehte sich um und marschierte mit einem solchen Tempo zurück ins Haus, dass ich Mühe hatte, ihr zu folgen. Kaum hatten wir die Türschwelle überschritten, schienen wir in eine andere Welt gekommen zu sein. So vernachlässigt es draußen auf dem Hof gewirkt hatte, so penibel ordentlich und aufgeräumt war das Innere des Bungalows. Er bestand aus nur drei Räumen. Die Hausherrin führte mich in das Wohnzimmer. Dort war bereits für zwei Personen eingedeckt. Wir setzten uns, und sie schenkte mir Kaffee ein.
»Ich denke, Sie trinken ihn schwarz«, erklärte sie und schaute mich dabei mit einem durchdringenden Blick an. Ich nickte, und sie musterte mich einen langen Augenblick. »Ist es üblich, dass Sie die Gegner Ihrer Mandanten persönlich aufsuchen?«
Ich schüttelte den Kopf und nahm, auch aus Verlegenheit, einen Schluck vom Kaffee.
»Brauche ich für diese Unterredung einen Rechtsanwalt?«, fragte sie. »Ich könnte jemanden anrufen. Er kommt auch am Samstag: ein Freund meines verstorbenen Ehemannes.« Dann fügte sie mit entwaffnender Ehrlichkeit hinzu: »Ein lieber Kerl, aber leider kein besonders guter Anwalt.«
Ich schüttelte abermals den Kopf. »Nein, ich denke, es ist nicht notwendig.«
Meine Gastgeberin nickte zufrieden. Sie nahm den Tortenheber und gab jedem von uns ein Stück von einem Apfelkuchen, der in der Mitte des Tisches stand.
»Ich habe keine Sahne«, sagte sie mit einem Lächeln. »Ich hoffe, es schmeckt Ihnen auch ohne.«
»Das ist gut«, entgegnete ich, erwiderte ihr Lächeln und legte meine rechte Hand auf meinen Bauch. »Also … Sie sagten am Telefon, mein Mandant, Herr Kiesewitz, sei ein Mörder?«
Sie zögerte. Schon befürchtete ich, sie würde zurückrudern.
»Nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Vergewaltiger und Betrüger«, bemerkte sie nüchtern.
Ich atmete tief durch und legte die Kuchengabel auf dem Teller ab. »Sie müssen wissen … er ist mein Mandant. Ich habe nur die Fakten des aktuellen Falls zu berücksichtigen …«
Sie lachte auf. »Wenn es so wäre, dann hätten Sie sich wohl nicht die Mühe gemacht, hierherzufahren!«
Ich wusste nicht, was ich darauf entgegnen sollte.
»Ich hole mir einen Cognac, und dann erzähle ich Ihnen, was Sie über Ihren Mandanten wissen müssen«, fuhr sie fort. »Möchten Sie auch einen?«
Ich hob abwehrend die Arme. »Ich muss noch fahren.«
Sie ging zu der Anrichte am anderen Ende des Zimmers, öffnete die Schranktür und schenkte etwas ein. Dann kam sie mit zwei Gläsern zurück und stellte eines vor mir ab. Als sie merkte, dass ich protestieren wollte, legte sie mir für einen kurzen Moment beschwichtigend die Hand auf den Unterarm.
»Lassen Sie«, sagte sie. »Sie werden ihn brauchen.«
Sie setzte sich und schaute mich lange schweigend an. Offenbar suchte sie nach einem geeigneten Anfang für ihre Geschichte.
»Es gab eine Zeit, als Ihr Mandant und mein Siggi befreundet gewesen sind. Sie wuchsen in derselben Gegend auf. Es war keine schöne Gegend.«
Ich lauschte, ohne mich zu bewegen.
»Eines Tages zerstörte etwas diese Freundschaft«, fuhr sie fort. Ich blickte sie fragend an, und sie zeigte auf sich selbst. »Ich. Wir lernten uns an einem Tanzabend kennen. Eine Freundin von mir war auch dabei. Aber Ansgar und Siggi interessierten sich nur für mich. Ich mochte beide gern, damals war Ansgar noch … anders.« Sie verzog angewidert das Gesicht. »Aber ich verliebte mich in Siggi.«
Tief atmete ich durch. Ich hatte nicht damit gerechnet, in ein Liebesdrama verwickelt zu werden. Schon begann ich zu bereuen, den Weg nach Göttingen auf mich genommen zu haben. Ich blickte auf den halb leeren Kaffee vor mir, den Rest Kuchen auf meinem Teller. Was zum Teufel machte ich hier? Ich war Patentanwalt.
»Ansgar ist nie damit zurechtgekommen, dass ich mich gegen ihn und für Siggi entschieden habe. Er brach den Kontakt zu uns ab. Eines Tages traf ich ihn auf dem Geburtstag einer Freundin wieder. Ich war dort ohne Siggi hingegangen. Siggi hatte die Firma von seinem Vater übernommen. Sie stand eigentlich ständig vor dem Bankrott, und Siggi musste zu dieser Zeit viel arbeiten. Ansgar hingegen fiel das Geld nur so zu. Ich vermute, weil er unehrlichen Geschäften nicht abgeneigt war. An jenem Abend wurde viel getrunken. Ansgar und ich waren da keine Ausnahme. Irgendwann gingen alle Gäste fort; nur wir beide blieben noch da. Die Gastgeber hatten sich irgendwohin zurückgezogen, vermutlich zum Vögeln.«
Beim letzten Wort zuckte ich zusammen. Ich versuchte vergeblich, meine Reaktion zu verbergen. Für einen kurzen Moment huschte ein Lächeln über ihre Lippen, erstarb aber sofort wieder.
»Ansgar fiel über mich her. Ich versuchte mich zu wehren – schrie, biss ihn. Aber ich war zu betrunken. Er hat mich vergewaltigt.«
Ich spürte, wie ein Schauer über meinen Rücken lief, und sah meinen Mandanten vor mir, wie er vor einigen Tagen noch mit seiner getönten Brille und seiner jungen Frau in meinem Konferenzraum gesessen hatte. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte.
»Haben Sie ihn angezeigt?«, fragte ich schließlich.
Sie machte ein verächtliches Geräusch. »Nein, habe ich nicht. Wer hätte mir schon geglaubt? Das Wort einer stark betrunkenen jungen Frau zählt nicht viel. Zumal ich früher auch kein Kind von Traurigkeit war.«
»Und Siggi … Entschuldigung, ich meine Ihren Mann?«, fragte ich.
»Er hat Ansgar fast totgeschlagen. Ich musste ihm gar nicht viel erzählen. Er hatte nur meine Verletzungen gesehen und mich gefragt: ›Wer?‹ Kaum hatte ich den Namen genannt, stürmte er los. Er erwischte ihn zu Hause in seinem Bett, wo er seinen Rausch ausschlief. Er hat die Tür eingetreten und mit einer Nachttischlampe auf ihn eingeprügelt. Ansgar überlebte nur, weil ein Nachbar eingriff. Ansgar kam ins Krankenhaus. Er verlor sein rechtes Auge.«
Deswegen also die Sonnenbrille, dachte ich.
Sie nahm einen Schluck von ihrem Cognac. »Siggi musste ins Gefängnis. Ein Jahr saß er ab.«
»Und die Vergewaltigung?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ansgar wollte Rache. Er lauerte auf die Gelegenheit, sich an Siggi zu rächen. Und er bekam sie.«
Ich spürte, wie die Anspannung in mir wuchs. Nun schienen wir zu dem Punkt zu kommen, der für meinen Fall eine entscheidende Rolle spielte.
»Während Siggis Haft hatte ich das Unternehmen weitergeführt und sogar ausgebaut«, fuhr sie fort. »Nachdem Siggi endlich frei war, wuchs unser Betrieb zu einem mittelständischen Unternehmen mittlerer Größe. In guten Zeiten waren bis zu hundertzwanzig Arbeiter und Angestellte bei uns beschäftigt. In Vollzeit!« Stolz schwang aus ihrer Stimme. »Die meisten unserer Kunden kamen aus Asien. Daher traf uns die Asienkrise besonders hart. Plötzlich hatten wir riesige Außenstände und gerieten in Zahlungsschwierigkeiten. Wir brauchten dringend Kapital. Doch die Banken verlangten horrende Darlehenszinsen und sperrten gleichzeitig unsere Kreditlinien.«
»Lassen Sie mich raten«, unterbrach ich sie. »In dieser Phase kam Ansgar um die Ecke.«
Sie lächelte bitter. »Nicht direkt. Wir hätten niemals mit Ansgar Geschäfte gemacht, und das wusste er. Aber es kam ein Investor aus Bayern, der Interesse zeigte, bei uns einzusteigen, und zwar zu besten Konditionen. Wir hatten gar keine andere Wahl, als nach dem rettenden Strohhalm zu greifen.« Sie stockte. »Doch schon bald kam das böse Erwachen. Der Investor verkaufte sein Darlehen weiter …«
»… und zwar an Ansgar«, beendete ich den Satz.
Sie nickte. »Wir dachten, dies sei nicht möglich. Aber die Verträge, die wir in aller Eile geschlossen hatten, gaben das her. Ich sagte ja, unser Anwalt ist nicht besonders gut.« Ein bitteres Lächeln huschte über ihre Lippen. »Plötzlich war Ansgar unser größter Gläubiger.«
Ich konnte die Verzweiflung nachempfinden, die damals in diesem Wohnzimmer geherrscht haben musste.
»Kurz darauf saß er dort, wo Sie jetzt sitzen. Auf genau dem Platz. Und hier, auf meiner Seite, saßen ich und … Siggi.«
Ich fühlte mich plötzlich unwohl auf meinem Sitz.
»Ansgar hatte alles genau geplant. Er drohte damit, das Darlehen sofort fällig zu stellen. Auch dies ließen die Verträge zu. Dann wären wir auf einen Schlag pleitegegangen, und alle Mitarbeiter hätten ihren Arbeitsplatz verloren. Jedoch ließ er uns einen Ausweg …«
»Was forderte er?«, fragte ich.
Meine Gesprächspartnerin stockte. »Unser Unternehmen … und mich.«
»Sie?«, rief ich ungläubig.
»Ja, mich. Er hatte nicht vergessen, was damals passiert war, und er konnte nie die Demütigung ertragen, dass ich mich für Siggi und nicht für ihn entschieden hatte.« Danach schwieg sie eine lange Zeit.
Schließlich wagte ich, die Frage zu stellen: »Und wie … haben Sie sich entschieden?«
Sie schlug die Augen nieder und schaute auf den Teller vor ihr. »Es ging um Arbeitsplätze, um unsere Mitarbeiter. Deren Familien, Kinder …«
Irgendwo im Flur hörte ich das gleichmäßige Ticken einer Uhr, das mir zuvor noch nicht aufgefallen war.
»Auch mussten wir alle unsere Patente an ihn übertragen, auch das für die medizinischen Cerclagen, die wir herstellten: unser wichtigstes Patent, um das wir uns nun streiten.«
Ich stieß die Luft aus, die ich während ihrer vorangegangenen Sätze angehalten hatte.
»Siggi brachte sich ein Jahr später um«, fuhr sie schließlich fort. Sie sprach ganz nüchtern, fast emotionslos, sodass ich schauderte. »Er kam mit der Situation nicht mehr zurecht. Meine Besuche bei Ansgar … Manchmal kam er auch hierher, und Siggi musste dann für ein oder zwei Stunden das Haus verlassen. Und eines Abends kam mein Mann nicht mehr zurück. Ich fand ihn drüben in der Fabrik – er hatte sich an einer der Heizstangen aufgehängt. Mit seinem Gürtel.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das Haus, in dem wir saßen, das alte Fabrikgebäude, das ich durch das Fenster sehen konnte, die zu einem festen Charaktermerkmal erstarrte Trauer meiner Gesprächspartnerin: All dies ließ mich die Geschichte nachfühlen.
»Was ist mit Ihren Söhnen?«, fragte ich schließlich, um die eingetretene Stille zu unterbrechen.
»Welche Söhne?«, entgegnete sie verwundert.
»Der Firmenname: Söhnke & Söhne …«
Sie lächelte. »Es gibt keine. Siggi und sein verstorbener Bruder waren die Söhne. Sein Vater hat das Unternehmen gegründet.«
Ich nickte. Eine Weile schwiegen wir.
»Was passierte nach dem Tod Ihres Ehemannes?«
»Ich erhielt eine sehr große Summe ausbezahlt. Siggi hatte mehrere Lebensversicherungen.«
»Ich dachte immer, bei Selbstmord zahlt eine Versicherung nicht …«, hielt ich entgegen, fand meinen Einwurf aber noch im selben Augenblick unpassend. »Man kam zu dem Ergebnis, dass Siggi sich in einem ›die freie Willensbildung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit‹ befand. In diesem Fall wird gezahlt. Mit dem Geld konnte ich die Darlehen bei Ansgar sofort ablösen. Insofern hat Siggi mit seinem Tod sein Unternehmen und seine Mitarbeiter gerettet – und mich.«
Ich atmete tief durch. »Und das Patent?«
»Ansgar hatte die Übertragung ›unbedingt gestaltet‹. Sie war nicht mehr rückgängig zu machen. Uns jedoch hatte Ansgar erklärt, dass wir die Patente nur zur Sicherung des Darlehens übertragen würden. Auch das war gelogen.«
Ich war tief in meinem Sessel zusammengesunken.
Meine Gastgeberin warf mir ein gequältes Lächeln zu. »Jetzt kennen Sie die Wahrheit über Ihren Mandanten.« Sie zeigte auf den Rest Apfelkuchen vor mir. »Essen Sie. Ich habe ihn extra für Sie gebacken.«
Ich schaute auf den Apfelkuchen und das gut gefüllte Cognac-Glas, das danebenstand. Ich griff nach dem Schwenker und leerte ihn in einem Zug.
»Sehen Sie«, sagte meine Gastgeberin. »Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie werden es brauchen.«
6
Draschwitz, 1714
Auf dem Rittergut herrschte großes Getümmel. Die Einfahrt zum Hof war zugestellt mit Kutschen und Pferden, um die sich ein Gehilfe des Orffyreus kümmerte, der ihnen etwas Heu und ein wenig schmutziges Wasser aus den Regenfässern vorsetzte. Vor der Scheune bildete sich eine lange Schlange, und Orffyreus’ Frau Barbara war eifrig damit beschäftigt, am Eingang Eintrittskarten zu verkaufen.
In der Scheune wies die in ein schneeweißes Kleid mit ausladendem Dekolleté gekleidete Magd den zahlreich Erschienen Plätze zu. Aus Holzlatten genagelte Bänke standen im Halbkreis um einen mit Sägespänen ausgelegten Platz und bildeten so eine Art Manege. Es war bereits der zehnte Tag der Vorführungen, und das Interesse schien nicht abzureißen. Immer wieder kam es vor, dass Neugierige wegen Überfüllung der Scheune abgewiesen werden mussten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: