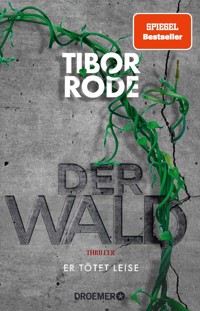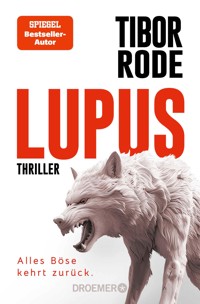
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Deutschland hat noch niemals ein Wolf einen Menschen angegriffen. Bis jetzt? »Wer einen intelligenten deutschen Thriller sucht, wird spannend und perfekt unterhalten.« CulturMag Tibor Rode ist »die deutsche Antwort auf das amerikanische Bestseller-Duo Preston & Child« www.denglers-buchkritik.de »Lupus« von Tibor Rode ist ein filmreifer Wissenschaftsthriller im Spannungsfeld zwischen Mensch, Technik und Natur. Ohne jede Spur verschwinden nachts Jäger auf der Pirsch – so auch der Vater von Tierärztin Jenny Rausch. Zeitgleich häufen sich Angriffe scheinbar wild gewordener Wölfe in deutschen Wäldern. Die Kameras auf einem eigens eingerichteten und von KI gesteuerten Schutzzaun zeichnen seltsame Daten auf, was Staatsanwalt Frederik Bach auf den Plan ruft. Sind die vermissten Jäger tatsächlich Wölfen zum Opfer gefallen oder hat man es mit Mord zu tun? Staatsanwalt Bach und Jenny geraten in einen Strudel aus Ereignissen, die Verbrechen während der Nazi-Zeit, eines der bestgehüteten Geheimnisse der DDR-Diktatur und ein Familiendrama miteinander verknüpfen. Antworten finden die beiden schließlich in Jennys eigener Vergangenheit – und auf der gefährlichsten Insel der Welt. Wissenschaftlich fundierter Nervenkitzel für Fans der Öko-Thriller von Frank Schätzing, Marc Elsberg oder Wolf Harlander Tibor Rodes Thriller ist hoch spannend, mitreißend geschrieben und beängstigend gut recherchiert. »Spätestens jetzt wird klar, ›Lupus‹ ist ein waschechter Rode-Thriller und gehört zum Besten, der derzeit zu lesen oder zu hören ist.« n-tv.de Entdecken Sie auch seinen Spiegel-Bestseller »Der Wald« »›Der Wald‹ ist der perfekte Stoff für einen ökologischen Katastrophen-Thriller, wie sie einst Hollywood-Legende Roland Emmerich verfilmt hat.« denglers-buchkritik.de über Der Wald »Wer bislang noch nicht wusste, was ein Pageturner ist, der weiß es spätestens nach der Lektüre! Brandaktuell, im wahrsten Sinn des Wortes!« n-tv.deüberDer Wald
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tibor Rode
Lupus
Alles Böse kehrt zurück.Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ohne jede Spur verschwinden nachts Jäger auf der Pirsch – so auch der Vater von Tierärztin Jenny Rausch. Zeitgleich häufen sich Angriffe scheinbar wild gewordener Wölfe in deutschen Wäldern. Die Kameras auf einem eigens eingerichteten und von KI gesteuerten Schutzzaun zeichnen seltsame Daten auf, was Staatsanwalt Frederik Bach auf den Plan ruft. Sind die vermissten Jäger tatsächlich Wölfen zum Opfer gefallen, oder hat man es mit Mord zu tun? Staatsanwalt Bach und Jenny geraten in einen Strudel aus Ereignissen, die Verbrechen während der Nazi-Zeit, eines der bestgehüteten Geheimnisse der DDR-Diktatur und ein Familiendrama miteinander verknüpfen. Antworten finden die beiden schließlich in Jennys eigener Vergangenheit – und auf der gefährlichsten Insel der Welt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Anmerkung
Motto
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
Epilog
Nachwort
Sämtliche handelnden Personen, Namen, Orte und Vereinigungen in diesem Buch entspringen allein der Fantasie des Autors. Alles in diesem Buch ist Fiktion.
»Jeder Jäger wird einmal ein Hase, früher oder später, denn die Ewigkeit ist lang.«
Wilhelm Busch
Für meine Mutter Gondel
Prolog
Lauf in den Wald!«, hatte Vater gerufen. Alex spürte die Panik. Aber auch, dass er keinen Widerspruch duldete. Ungewohnt streng hatte er geklungen, die Hintertür aufgerissen und Alex hinaus in den Garten gelassen, nein gestoßen. Und dann, noch bevor die Tür sich wieder ganz schloss, erklang der Schrei. Ein Laut voller Verzweiflung und Schmerz. Und so rannte Alex los, hinaus in die Dunkelheit. »Unser kleiner Märchenwald«, hatte Mutter die Bäume am Ende ihres Gartens immer genannt. Bei dem Gedanken an Mama spürte Alex ein Stechen in der Seite. Oder kam es vom Laufen? Irgendetwas war mit ihr geschehen. Doch die Bilder wollten nicht mehr zurückkommen. Gerade eben hatte Alex noch gewusst, warum Papa so gebrüllt hatte, warum dessen Hände ganz rot und klebrig gewesen waren. Doch jetzt war dort in Alex’ Gedanken nur noch das Bild eines großen schwarzen Mauls, das Ähnlichkeit mit der Kiefernreihe hatte, die in diesem Moment vor Alex auftauchte. Kühle Luft und der Geruch nach Moos und feuchter Erde drangen aus dem Gehölz. Wieder ertönte aus Richtung des Hauses ein Schrei, der mittendrin erstarb.
Alex blieb stehen und lauschte. Das Haus lag nun ganz still und friedlich dort, alle Fenster waren beleuchtet. Plötzlich klapperte etwas. War das die Hintertür? Alex nahm wieder Tempo auf und lief noch schneller, ließ das Fußballtor, das Vater für die Geschwister aus Dachlatten gezimmert hatte, links liegen und überlegte kurz, sich im Schuppen zu verstecken, in dem Vater seine Werkstatt hatte. Aber Vater hatte befohlen, in den Wald zu laufen. Und so gehorchten die kurzen Beine eher, als der Kopf es tat, und rannten weiter und weiter. Als endlich der vertraute Trampelpfad in Sicht kam, verließen Alex die Kräfte. Die letzten Schritte gerieten zu einem Stolpern, dann knickten die Knie ein. Der weiche Waldboden verstärkte das Gefühl, dass nun, wo der schützende Wald erreicht war, alles gut werden würde. Der Herzschlag beruhigte sich, und das Pochen in den Schläfen ließ langsam nach. Alex rollte sich zusammen und schloss die Augen, wollte einschlafen, damit das Ganze nur ein Traum war. Als die Kälte Alex schließlich wieder weckte, war das einzige Geräusch im Wald das gleichmäßige, laute Atmen. Alex hielt die Luft an, doch das Atemgeräusch verstummte nicht. Langsam öffnete Alex die Augen und erstarrte. Keine drei Meter entfernt stand ein riesiges Tier. Sein silberfarbenes Fell glänzte im bläulichen Licht des Vollmondes. Schwer atmend, mit angelegten spitzen Ohren und gesenktem Kopf betrachtete es Alex aus gelb funkelnden Augen. Die Nasenflügel bewegten sich auf und ab, als es versuchte, Witterung aufzunehmen.
In diesem Moment fiel ein Schuss.
1
Nicht immer verzogen sich mit den Wolken auch alle Sorgen. Manchmal zeigten sich im grellen Licht der Sonne erst neue Probleme. So war es ihr heute ergangen. Es war der erste Morgen seit Tagen, an dem es nicht regnete und der sie trotzdem mit einer bösen Überraschung begrüßt hatte. Ein Schlagloch rüttelte sie durch. In Jennys Rücken verschob sich etwas, ein stechender Schmerz zog von den Schulterblättern bis ins Brustbein, was ihren Ärger auf ihren Vater noch verstärkte.
»Landwirtschaftlicher Verkehr frei« hatte ein Schild am Anfang des Weges die Durchfahrt für alle anderen verboten. Auch wenn ihr alter Toyota wie ein Geländewagen aussah, war er nicht wirklich für diese Art von Wirtschaftswegen gebaut. Hier fuhren Trecker, Mähdrescher und ab und zu der Landrover ihres Vaters. Doch heute zeigten sich in dem vom Niederschlag der letzten Tage aufgeweichten Boden mehr Reifenspuren als üblich.
Irritierend war auch der Zaun, der die Straße seit Anfang des Weges nach links begrenzte und der ihr noch nie zuvor aufgefallen war. Offenbar war er neu errichtet, was auch der frische Baumschnitt verriet, der alle paar Meter zum Abtransport bereitlag. Der Zaun selbst war aus eisernen Gitterstäben, deren dunkle Lackierung in der Sonne schwarz glänzte. Er war bestimmt zwei Meter hoch und oben beinahe waagrecht nach vorn gebogen, vermutlich, um das Überklettern unmöglich zu machen. Auf der Krone glaubte sie Stacheldraht zu erkennen. Zudem sah sie in regelmäßigen Abständen Kameras. Ein wenig erinnerte sie das Ganze an die alten DDR-Grenzanlagen, die sie nur von Fotos und Erzählungen kannte. Was war der Zweck dieser Einhegung? Soweit sie wusste, waren hier nichts als Wiesen und Weiden. Erneut versank der Vorderreifen in einer Kuhle, und sie schlug mit der Stirn gegen die Sonnenblende. Sie schaute in den Rückspiegel, unter ihrem Pony bildete sich eine kleine rote Beule.
»Fuchsrote Haare, rehbraune Augen. Meine kleine Jägerin«, so hatte Jo sie immer beschrieben und ihr dabei stolz über den Hinterkopf gestrichen, was sie nicht gemocht hatte. Sie wusste, dass ihr Blick auf andere manchmal etwas melancholisch wirkte und ihr das ein ums andere Mal besorgte Nachfragen bescherte, ob mit ihr alles in Ordnung sei. Meist war es das, aber nicht heute. Sie fand selbst, dass sie besonders müde dreinblickte. Am Morgen hatte sie noch nicht einmal Make-up auftragen können, womit sie sonst ihre vielen Sommersprossen verbarg.
Normalerweise hätte sie um diese Uhrzeit auch schon lange in der Tierklinik sein sollen, würde jetzt im OP-Raum stehen und den Winkel des Tibiaplateaus eines Labradors auf etwa fünf Grad drehen, um das gerissene Kreuzband zu ersetzen. Stattdessen irrte sie auf der Suche nach Joachim durchs Gelände. Nur durch Zufall hatte sie am Morgen bemerkt, dass er in der Nacht nicht nach Hause gekommen war. Wie so oft war er am gestrigen Abend bei einbrechender Dunkelheit hinaus zur Jagd gefahren. Sie hatte ihm noch eine Thermoskanne mit heißem Apfelsaft gefüllt und, wenn auch widerwillig, ein paar Sandwiches für seine Brotdose bereitet. Danach hatte er sich verabschiedet und war vom Hof gefahren. Sie genoss die Abende, an denen sie allein zu Hause war. In der ersten Zeit, nachdem sie mit ihren nun zweiundvierzig Jahren zurück nach Waldenow auf den elterlichen Hof gezogen war, war sie über Joachims Gesellschaft noch froh gewesen. Anfangs hatten ihre Gespräche, meist ging es um Politik, sie noch von dem alles einnehmenden Liebeskummer abgelenkt. Aber seit sie vor Kurzem die Wahrheit erfahren hatte, konnte sie die Gegenwart des Mannes, den alle nur Jo nannten, nicht mehr gut ertragen. Am liebsten wäre sie sofort wieder ausgezogen, doch so einfach war es nicht. So war sie also gestern Abend allein gewesen, hatte sich in der Mikrowelle etwas Popcorn zubereitet, auf dem Tablet noch eine schwedische Krimiserie weitergeschaut und war um kurz vor Mitternacht schließlich über ihrer Bettlektüre eingenickt.
Es war nicht Jo, den sie heute Morgen als Erstes vermisst hatte, sondern der Weimaraner Bruno, der Jagdhund ihres Vaters. Schlief sein Herrchen nach einer langen Nacht im Wald bis zum Mittag, ließ sie ihn morgens, bevor sie zur Arbeit fuhr, in den Garten. Doch heute Morgen hatte Bruno sie nicht in der Küche freudig begrüßt, und sie hatte ihn nirgendwo im Haus entdecken können. Als sie auf der Suche nach ihm schließlich die Tür zum Schlafraum ihres Vaters geöffnet hatte, fand sie auch dessen Bett unberührt. Für einen kurzen Moment dachte sie, Jo sei bereits am frühen Morgen wieder aufgebrochen, vielleicht zur Nachsuche von in der Nacht angeschossenem Wild. Doch dann sah sie in dem Schränkchen in der Küche nach: Die Herztabletten waren mit den Wochentagen von Montag bis Sonntag beschriftet, und die Tablette für heute lag noch dort. Seit der Herzoperation vor zwei Jahren gehörte es zu Jos unverzichtbarer Routine, die kleine Pille jeden Morgen sofort nach dem Aufstehen zu nehmen. Ihre erste Reaktion war ein Gefühl von Ärger, wie sie es in den vergangenen Tagen Jo gegenüber so oft empfunden hatte. Doch dann kamen die düsteren Gedanken. Was, wenn ihm etwas zugestoßen war?
Obwohl sie sich zuletzt emotional von ihm entfernt hatte, konnte sie ein Gefühl der Verantwortung für ihn nicht ganz verleugnen. Noch nicht. Und vor allem hatte sie noch so viele dringende Fragen an ihn. Ein Anruf auf seinem Mobiltelefon blieb unbeantwortet, sodass sie auf seiner Mailbox eine Rückrufbitte hinterließ. Und so war sie schließlich, nachdem sie auch die Garage leer vorgefunden hatte, aufgebrochen. Sie hatte Jo schon oft auf der Jagd begleitet und kannte seine bevorzugten Reviere. Nachdem vorgestern, mit dem letzten Tag im August, die Schonzeit für die Hirsche geendet hatte und Jo einige Tage zuvor von einem kapitalen Zwölfender geschwärmt hatte, vermutete sie, dass er zur Hirschkanzel beim alten Wasserturm in Loitz hinausgefahren war. Nun holperte ihr betagter Wagen über den einzigen Weg, der dort hinführte. Die Straße war eng und kurvenreich, sodass sie Jos Fahrzeug, wenn er es denn tatsächlich am Ende dieses Weges geparkt hatte, noch nicht sehen konnte.
Ihr Handy begann summend auf der Ablage hinter dem Schalthebel zu tanzen. Sie überlegte, mit welchen Worten sie Jo zusammenstauchen würde. Letztlich war auch dies eine Episode seines grenzenlosen Egoismus: Offenbar besaß er nicht genügend Empathie, um sich das Ausmaß ihrer Sorgen vorzustellen. Vielleicht war es aber auch eine Reaktion auf ihre Streitereien in den vergangenen Tagen. Vermutlich wollte er, dass sie sich sorgte, wollte er ihr beweisen, dass sie ohne ihn nicht sein konnte. Doch da irrte er sich gewaltig. Sie griff nach dem Telefon, aber es war nicht Jo, der anrief, sondern eine unbekannte Nummer, deren letzte Ziffern sie unter einem Fleck auf dem Display nicht erkennen konnte. Sie lenkte mit der einen Hand, rubbelte den Dreck mit dem Ärmel ihrer Bluse weg und drückte den grünen Annahmebutton.
»Hallo?«, meldete sie sich skeptisch.
»Mit wem spreche ich?«, fragte eine routiniert klingende Männerstimme. Der Tonfall des Anrufers ließ in ihr eine böse Ahnung aufsteigen. Sie verlangsamte die Fahrt.
»Wer spricht denn dort?«, fragte sie zurück.
»Mein Name ist Frederik Bach. Von der Staatsanwaltschaft in Stralsund. Spreche ich mit Jennifer Rausch?«
Sie spürte, wie ihr Herz schneller schlug.
»Ja.«
»Joachim Rausch ist Ihr Vater?«
In ihrem Hals bildete sich ein Kloß.
»Ja.« Die böse Vorahnung schien zur Gewissheit zu werden. Sie bremste ab und blieb stehen.
»Wissen Sie, wo wir Ihren Vater erreichen können?«
Sie stutzte. »Nein«, entgegnete sie irritiert.
»Sie haben keinen Kontakt? Keine Handynummer oder Ähnliches?«
»Nein, ich meine, doch. Es ist nur so, dass er heute Nacht nicht nach Hause gekommen ist.«
Eine kurze Pause entstand.
»Was ist passiert?«, brach es aus ihr heraus. »Warum wollen Sie meinen Vater sprechen? Und woher haben Sie meine Nummer?«
In diesem Moment schreckte sie zusammen, als direkt hinter ihr das Heulen einer Polizeisirene ertönte. Sie schaute in den Rückspiegel und sah hinter sich einen dunklen BMW mit aufgesetztem Blaulicht auf dem Dach, der ihr nun zusätzlich mit der Lichthupe Signale gab. Die Schlammpiste war zum Überholen zu eng.
»Was zum Teufel ist hier los?«, stieß Jenny hervor, während sie wieder anfuhr.
2
Die Antwort auf ihre Frage erhielt sie hinter der nächsten Wegbiegung: Dort parkte der dunkelgrüne Geländewagen ihres Vaters, sofort zu erkennen an den ersten vier Buchstaben des Kennzeichens VG für Vorpommern-Greifswald, gefolgt von JO für dessen Vornamen und der Zahl 1950 – sein Geburtsjahr. Für einen skurrilen Anblick sorgte das rot-weiße Absperrband, das um beide Außenspiegel und den gesamten Wagen herumgewickelt worden war. Als sie zwei geparkte Streifenwagen und dahinter weitere parkende Autos entdeckte, fühlte sie denselben Schmerz in der Brust wie beim Durchfahren des Schlaglochs vor einigen Minuten. Sie rollte aus und parkte ebenfalls an der Seite, direkt vor dem Landrover. Sofort wurde sie von ihrem Hintermann überholt, der weiterfuhr und neben dem Streifenwagen anhielt. Jetzt erst sah sie auf der Heckscheibe den Schriftzug »Hundeführer«. Der Fahrer stieg aus und eilte zu einer kleinen Gruppe am Straßenrand. Ihr Blick fiel auf zwei uniformierte Polizisten. Einer war riesig, hatte aber ein Milchgesicht, der andere war kleiner und deutlich älter – beängstigend waren die Maschinenpistolen, die beide schussbereit vor ihrer Brust hielten.
»Sind Sie das mit dem Toyota?«, tönte die Stimme aus dem Handy, welches sie noch immer in der Hand hielt. Aus der Gruppe löste sich eine Person, die wie sie selbst ein Mobiltelefon am Ohr hielt, und kam auf sie zu. Er trug einen Anzug aus mintgrünem Cordstoff, hatte braun gelockte Haare und ein Gesicht, dessen schmale Wangen die markante Kiefer- und Kinnpartie noch hervorhoben. Sie schätzte ihn auf knapp über vierzig. Als er vor ihr stand, fielen ihr seine Augen auf, die gegen die noch tief stehende Sonne passend zur Farbe des Anzugs grün strahlten. Bemerkenswert war zudem der schmale Oberlippenbart, der sie an französische Mantel-und-Degen-Filme erinnerte und den man wohl eher in den Hipsterhochburgen von Berlin als hier im beschaulichen Vorpommern erwartet hätte. Sein Händedruck war kräftig. Allerdings verrieten dunkle Schatten unter seinen Augen, dass er zuletzt nicht viel geschlafen hatte.
»Frederik Bach mein Name, wie schon am Telefon gesagt, bin ich der zuständige Staatsanwalt.«
»Was ist hier los?«, begrüßte sie ihn ohne Umschweife und steckte ihr Handy in die Jackentasche. Sie zeigte auf den Landrover. »Wo ist mein Vater, und wo ist Bruno?«
»Bruno?«
»Der Hund meines Vaters!«
»Ich erkläre Ihnen alles«, sagte ihr Gegenüber. Der Klang seiner Stimme war gleichermaßen beschwichtigend wie bestimmt. Aber sie hatte keine Zeit, auf Erklärungen zu warten.
»Das hier ist das Fahrzeug meines Vaters. Er ist gestern Abend zur Jagd gegangen und nicht wieder heimgekommen. Ich suche ihn. Er hatte seinen Jagdhund Bruno dabei.« Sie deutete mit wachsender Sorge auf die beiden Polizisten mit den Pistolen im Anschlag. »Sagen Sie mir bitte, was hier los ist!«
Ihr Gesprächspartner zögerte kurz. »Der Hund ist im Kofferraum«, sagte er dann. »Kommen Sie bitte mit.« Er ging voran und führte sie zu den anderen. Während sie dem Mann folgte, breitete sich ein lähmendes Gefühl von Angst in ihr aus. Seit ihrer Kindheit war sie mit Vierbeinern besser klargekommen als mit Zweibeinern. Ihre Sorgen um Jo hatten sie nach dem, was sie zuletzt erfahren hatte, selbst überrascht. Aber jetzt bemerkte sie, dass ein großer Teil ihrer Befürchtungen Bruno galt. Er war in den vergangenen Wochen ihr stiller Vertrauter gewesen, ihr Tröster, ihr Seelenretter. Sollte ihm etwas zugestoßen sein, würde etwas in ihr zerbrechen. In diesem Moment ertönte über ihr das Knattern eines Hubschraubers. Er flog nicht besonders hoch.
»Das ist Jennifer Rausch, die Tochter des Halters«, stellte der Staatsanwalt sie der kleinen Gruppe vor. Einer von ihnen war der Hundeführer, der sie vor einigen Minuten auf der Anfahrt noch bedrängt hatte.
»Das Auto gehört meinem Vater«, bestätigte sie.
»Ich meinte den Halter des Hundes.« Der Staatsanwalt trat an das Fahrzeug, formte die Hände zum Trichter und versuchte, durch die getönte Heckscheibe zu schauen, ohne dabei das Glas der Scheibe zu berühren. Aus dem Inneren ertönte ein dumpfes Bellen. Jenny spürte, wie ein Gefühl der Erleichterung sie durchströmte. »Oh, mein Gott, Bruno!«, rief sie aus und machte einen Schritt auf den Kofferraum zu. In der verdunkelten Heckscheibe konnte sie nur ihr eigenes Spiegelbild erkennen: Sie sah größer aus als ihre knapp 1,70 Meter, aber auch schmaler als in Wirklichkeit. Zwar war sie dank der einen oder anderen gemeinsamen Joggingrunde mit Bruno entlang der Peene gut in Form, aber die letzte Zeit nach der Trennung von René und dem Aufarbeiten ihrer Familiengeschichte hatte sie wenig Appetit verspürt und abgenommen. Sie wollte den Kofferraum öffnen, um Bruno zu befreien, doch der Staatsanwalt hielt ihren Arm sanft zurück. Erneut ertönte ein leises Bellen, diesmal gefolgt von einem lang gezogenen Jaulen.
»Wir müssen ihn da sofort rausholen!«, sagte sie.
»Haben Sie einen Schlüssel für den Wagen?«
Sie schüttelte den Kopf. Zwischen seinen Zähnen bemerkte sie ein Kaugummi.
»Wir dürfen keine potenziellen Spuren am Fahrzeug verwischen.«
»Bruno ist vielleicht seit gestern Abend dort drin, und das ohne Wasser!«
»Sie hat recht!«, mischte sich der Hundeführer ein. »Hier geht das Tierwohl vor.«
»Sind die von der Spurensicherung denn mit der Heckscheibe fertig?«, fragte der Staatsanwalt einen der Streifenbeamten, der bejahte. »Dann legen Sie los!«
Jenny beobachtete, wie der Polizeibeamte zum Kofferraum des geparkten Streifenwagens ging und mit einem neonorangen Nothammer, wie sie ihn aus öffentlichen Linienbussen kannte, zurückkehrte. Der Hundeführer blickte erneut durch die getönte Heckscheibe. »Ich denke, wir können es wagen, das Sicherheitsglas sollte für den Hund keine Gefahr darstellen.« Der Polizeibeamte trat heran und schlug mit Wucht gegen die Scheibe, die erst beim zweiten Schlag mit einem explosiven Knall zersprang. Mit gezielten kleineren Schlägen hämmerte der Beamte danach die Glasreste aus dem Rahmen, während Bruno laut zu bellen begann. Jenny lief zum Heck und schaute durch das nun weitestgehend fensterlose Heck in das Fahrzeuginnere. Als Bruno sie durch die Gitter seiner Hundebox erkannte, begann er sofort, laut zu jaulen, wobei sein Schwänzchen mit festen Schlägen gegen das Innere der Box schlug. Jenny wollte hineingreifen, um die Tür zu öffnen, wurde jedoch abermals gestoppt. »Nichts anfassen!«, ermahnte Bach. »Der Hund könnte Spurenträger sein. Wir sollten ihn zuerst in der Box zur Untersuchung nach Greifswald bringen.«
»Er muss etwas trinken!«, protestierte Jenny, während sie seinen Zustand mit dem fachmännischen Blick der Tierärztin prüfte. Auch wenn er aufgeregt und vermutlich etwas dehydriert war, wirkten seine Augen wach und aktiv. Der Hundeführer verschwand und kam mit einer faltbaren Gummischale wieder, in die er aus einer PET-Flasche einen halben Liter Wasser füllte. Dann hielt er sie so an die Box, dass Bruno durch die Gitterstäbe trinken konnte. Gierig schlabberte er beinahe die gesamte Schale leer.
»Scheint so, als ob er tatsächlich seit gestern Abend hier eingesperrt war«, kommentierte Jenny.
Sie spürte den Drang, Bruno zu befreien und zu trösten, ihn mit sich zu nehmen. Ärger stieg in ihr auf. »Was soll das hier alles bedeuten?«, wandte sie sich an den Staatsanwalt.
»Ich habe das Auto samt Inhalt als möglichen Tatort beschlagnahmt.«
»Möglicher Tatort? Was soll das bedeuten? Was ist mit meinem Vater geschehen?«
»Das wissen wir nicht. Eine Joggerin hat heute Morgen die Polizei informiert, wegen des hier abgestellten Autos und des darin zurückgelassenen, heulenden Hundes. Das kam ihr ungewöhnlich vor.«
Wieder knatterten die Rotoren des Hubschraubers, der mittlerweile über ihren Köpfen eine kleine Runde geflogen war.
Jenny schaute nach oben. »Ist der wegen uns hier?«
»Sie suchen die Gegend mit einer Wärmebildkamera ab.«
»Wegen eines geparkten Autos und eines darin eingesperrten Hundes so einen Aufmarsch?«, fragte Jenny.
»Sie haben recht«, entgegnete ihr Gegenüber. Er stockte. Sie sah, wie er versuchte, sie zu schonen.
»Sagen Sie schon!«
»Wir haben auch Blut gefunden«, sagte der Staatsanwalt. »Viel Blut.«
3
Erst jetzt bemerkte Jenny das Blut an der Wagentür. Zuvor hatte ihre ganze Aufmerksamkeit Bruno gegolten, der nun zwar nicht mehr verdursten würde, aber noch immer leise vor sich hin jaulend in seiner Box ausharrte. Der Landrover Defender hatte eine dunkelgraue Farbe, und das ebenfalls dunkel oxidierte Blut war auf dem Metalliclack gegen das Licht der aufsteigenden Sonne nur zu erkennen, wenn man danach suchte. Es war rund um den Griff der hinteren Tür verteilt, und auch an der Fahrertür waren einzelne Schlieren zu erkennen.
»Im Innenraum ist noch mehr«, bemerkte der Staatsanwalt. »Aber besorgniserregend ist vor allem dies …« Er führte sie an dem geparkten VW-Bus mit dem Behördenkennzeichen vorbei zu einer Fläche neben der Straße. Nun sah sie einige Meter entfernt einen Mann und eine Frau in den typisch weißen Anzügen der Spurensicherung, die gerade dabei waren, etwas neben dem Weg zu untersuchen. Sie trugen weiße Haarnetze, Mundschutze und hatten über ihre Schuhe große blaue Stulpen gezogen. Die Frau fotografierte etwas, während der Mann neben einem Alukoffer hockte und mit einem Tupfer und einem Röhrchen hantierte. Sie machte einen weiteren Schritt nach vorn und erkannte nun, wovon der Staatsanwalt gesprochen hatte. Als Tierärztin und Jägerin war sie den Anblick von Blut gewohnt, aber das hier war etwas anderes: Das war ein Blutbad in freier Natur. Hier hatte jemand oder etwas große Mengen an Blut verloren. Es klebte an den hohen Grashalmen, war aber auch in die Spurrinnen des Weges hineingelaufen und dort zu einem blutigen Brei aus Schlamm angetrocknet. Wenn man genau hinsah, erkannte man nach hinten weg sogar so etwas wie eine Schleifspur.
»Ist das menschliches Blut?«, wollte sie wissen.
»Das wissen wir noch nicht.«
»Sie glauben, mein Vater …?« Sie beendete den Satz nicht.
»Wir glauben gar nichts. Um eine Gewalttat auszuschließen, habe ich Sie angerufen. Sie wissen also nicht, wo Ihr Vater sein könnte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wie gesagt, ich kam selbst hierher, um ihn zu suchen. Ich habe ihn gestern Abend zum letzten Mal gesehen, als er zur Jagd losfuhr.«
»Um wie viel Uhr?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Gegen 22 Uhr, schätze ich.«
»Das passt«, murmelte der Staatsanwalt.
»Was passt?«
»Die Uhrzeit stimmt mit der elektronischen Parkscheibe Ihres Vaters überein. Sie klebt an der Innenseite der Windschutzscheibe seines Autos und zeigt 23 Uhr.«
»Elektronische Parkscheibe?«
»Die Dinger stammen, glaube ich, aus Dänemark. Da sie, wie für Parkscheiben erlaubt, bei Ankunft die Zeit immer automatisch bis zur nächsten halben oder vollen Stunde vorstellt, heißt das, dass Ihr Vater den Wagen hier zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr abgestellt haben muss. Hätte er den Wagen danach noch einmal bewegt, hätte sich die Uhrzeit auf der Parkscheibe neu eingestellt. Wissen Sie, wo er nach seiner Ankunft hier hingegangen sein könnte?«
»Sind Sie Jäger?«, fragte sie Bach.
Der verzog das Gesicht. »Tiere töten ist nicht so meins.«
Jenny wollte etwas entgegnen, verkniff es sich aber, sie hatten Wichtigeres zu tun. »Wenn er hier parkt, geht er meist als Erstes zum Hochsitz. Er lässt dann Bruno erst einmal im Auto, damit sein Geruch das Wild nicht verscheucht. Ebenso die Tasche mit den Handschuhen, dem Messer und dem anderen Zeugs zum Aufbrechen des geschossenen Wilds. Ich habe die Tasche neben Bruno im Kofferraum gesehen. Wenn er etwas schießt, kommt er zurück, holt Bruno und die Tasche. Daher vermute ich, er ist nicht zurückgekommen.«
»Wissen Sie, wo der Hochsitz ist?«
Sie nickte. »Ich kann hingehen und nachschauen.« Sie sah das Zögern in Bachs moosgrünen Augen. »Was? Lassen Sie mich raten: Ich soll keine Spuren verwischen.«
»Das auch.«
»Und was noch? Befürchten Sie, hier läuft ein Killer herum?«
»Kein Killer, aber es gab in den vergangenen Tagen Gerüchte.«
»Was für Gerüchte? Muss man Ihnen denn jedes Wort aus der Nase ziehen?«
»Es wurde ein Wolf gesichtet.«
»Ein Wolf?«
»Er soll keine Scheu vor Menschen haben.«
Jenny stockte, als ihr bewusst wurde, was ihr Gesprächspartner da gerade andeuten wollte. »Das viele Blut, mein verschwundener Vater – Sie glauben, ein Wolf könnte ihn getötet haben? Daher also der ganze Aufwand!« Sie schaute in den Himmel, vom Hubschrauber war nichts mehr zu sehen, aber sie hörte ihn noch weiter entfernt. Die Kaubewegungen der Kiefermuskeln ihres Gegenübers wurden schneller. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken.
»Wie gesagt, derzeit glauben wir noch gar nichts«, wiegelte er ab. »Ich werde den Wolfsbeauftragten vom Veterinäramt einschalten, vielleicht sollten wir auf ihn warten, bevor Sie hier nun allein herumlaufen.«
»Das wird nicht nötig sein«, sagte Jenny bestimmt.
»Wieso das?« Bach hob irritiert die Augenbrauen.
»Ich bin die Wolfsbeauftragte des Landkreises.«
4
Das kann nicht sein!« Brian Auster, der IT-Chef des kleinen Unternehmens Fenceattack am Stadtrand von Potsdam beugte sich hinunter, um selbst auf den Monitor zu schauen. Eine der Werkstudentinnen, die sich hier ein paar Euro dazuverdienten, hatte eine halbe Stunde vorher Alarm geschlagen. Nun zeigte sie auf die Spalte, die mit dem Begriff »Predator« überschrieben war.
»Das kann nicht sein«, murmelte Brian Auster erneut und öffnete mit der Maus ein Fenster auf dem Bildschirm, in das er einige Befehle eintippte. Sie standen im Kontrollcenter von Fenceattack, einem noch jungen Start-up, das sich mit einem Haufen Venture-Capital und Fördergeldern der Europäischen Union einem der international politisch brisantesten Themen des gesellschaftlichen Diskurses gewidmet hatte – dem Human-wildlife conflict, dem Zusammentreffen von Menschen und Wildtieren. Genauer gesagt, hatte das Unternehmen sich damit beschäftigt, wie man diesen Konflikt lösen könnte: indem man Zäune baut. Dabei war ihr innovatives Produkt kein Zaun im herkömmlichen Sinne, sondern man warb mit der Bezeichnung eines »modularen, autonomen und intelligenten Weideschutzzauns zur Erkennung und Vergrämung von Wildtieren«. Einer ihrer Hauptabsatzmärkte war Deutschland, wo die Diskussion um die Rückkehr der Wölfe zuletzt eskaliert war. Zu viele Weidetierhalter hatten in den vergangenen Jahren feststellen müssen, dass normale Zäune Wölfe nicht aufhielten, selbst wenn sie Strom führten. Wölfe konnten springen, vor allem aber waren sie schlau und lernten rasch dazu. Bekam ein Wolf erst einmal spitz, dass ein Stromschlag ihn nicht tötet, war das nächtliche Mahl aus frischen Lämmern, Rindern oder sogar Pferden zu verlockend, um ihn vom Überqueren des Zauns abzuhalten.
Also brauchte man eine Barriere, die intelligenter war als der Wolf. Und hier kam Fenceattack ins Spiel. Mittels Kameras und künstlicher Intelligenz konnte der Zaun nicht nur erkennen, welche Tierart vor ihm auftauchte, sondern er war auch in der Lage, einzelne Wölfe voneinander zu unterscheiden. Der Zaun wusste somit genau, welcher Wolf wann schon einmal versucht hatte, bei ihm anzuklopfen. Wurde ein Wolf am Tag zuvor mit Strom vertrieben, dann nutzte der Zaun für dieses Tier heute Lichtblitze, morgen einen auf Wölfe optimierten Ultraschall-Impuls, übermorgen sonderte der Zaun einen Duftabwehrstoff ab, und am Tag darauf machte er Lärm. Vor allem aber protokollierte die installierte Software alle Ereignisse einer Nacht, was auch das Tracking von Wolfspopulationen ermöglichte. Mehr als fünfundsechzig Kilometer Zaun zur Abschreckung von Wildtieren hatte Fenceattack bislang in verschiedenen Teilen der Welt errichtet, fünfunddreißig Kilometer davon in Deutschland, und man befand sich noch immer in der Betatest-Phase. Die Werkstudentin war seit dem Morgen damit beschäftigt, die nächtlichen Aufzeichnungen der Zäune aus dem nordöstlichen Teil Deutschlands auszuwerten, und hatte eine halbe Stunde nach Dienstbeginn aufgeregt ihren direkten Vorgesetzten informiert. Der hatte nun die gespeicherten Kameraaufnahmen des betroffenen Zaunabschnitts in der Nähe von Waldenow herangezoomt und beugte sich noch weiter vor, sodass er beinahe den Bildschirm berührte.
»Im hohen Gras kaum zu erkennen«, resümierte er.
»Ich finde, hier sieht man die wolfstypische Schnauze sehr schön«, widersprach die Studentin, während sie das Bild anhielt. »Nimmt man die jungen Birken als Maßstab, wirkt er allerdings sehr groß, viel zu groß für einen Wolf.«
»Aktivieren Sie jetzt noch einmal das Live-Tracking-Tool«, sagte Auster.
Sie tat, wie ihr geheißen, und über die Aufzeichnungen legte sich eine transparente Maske mit einer virtuellen Sucherscheibe in der Mitte, die an ein Fadenkreuz erinnerte. Während der Rechner arbeitete, war es rot, dann wurde es grün, was bedeutete, dass die millionenschwere Software von Fenceattack unter dem Einsatz der modernsten neuronalen Netze der KI-Forschung das Objekt eindeutig identifiziert hatte. IT-Chef und Studentin schauten erneut ungläubig auf das Ergebnis, das in der Mitte der Bildschirmanzeige grün blinkte: Wolfsmensch.
5
Sie sind die Wolfsbeauftragte?«, stellte der Staatsanwalt überrascht fest. Zuvor hatte er den milchgesichtigen Polizisten und dessen Kollegen mit den Maschinenpistolen im Anschlag zur Absuche des von Jenny beschriebenen Hochsitzes geschickt, was bei ihr eine grundsätzliche Nervosität auslöste. Was, wenn Jo dort tatsächlich tot aufgefunden wurde? Seine Herztabletten hatte sie noch in der Gesäßtasche. Was, wenn er sie nicht mehr brauchen würde? Bei diesem Gedanken stieg wieder die Scham der vergangenen Stunde in ihr hoch. In ihrem Kopf herrschte Gefühlschaos. Sie hatte in den letzten Tagen, nachdem sie die Wahrheit herausgefunden hatte, versucht, den Mann zu hassen, um den sie sich jetzt wohl öffentlich sorgen sollte, obwohl ihr nicht danach war, schließlich war es ihr Vater.
»Ich bin Tierärztin, Amtsveterinärin und seit voriger Woche die neue Wolfsbeauftragte des Landkreises Vorpommern. Und mir ist von den Wolfssichtungen, von denen Sie sprechen, nichts bekannt«, versuchte sie ihre Gedanken abzuschütteln. »Als Wolfsbeauftragte werden mir in der Regel alle Wolfsbegegnungen und auch Schäden gemeldet.«
»Die Joggerin, die den Wagen Ihres Vaters aufgefunden hat, hat berichtet, dass sie einen Wolf gesehen hat. Er stand dort.« Bach zeigte auf eine Lücke in der Böschung, hinter der ein abgemähtes Stoppelfeld zu erkennen war.
»Sie meinte, er war sehr groß, etwa wie ein Kalb, habe hohe Schultern gehabt, und das Fell sei rötlich braun gewesen. Die Beine seien dafür sehr kurz gewesen. Er sei nicht davongelaufen, auch nicht, als sie geklatscht und geschrien habe. Erst als sie einen Stein aufgehoben und in seine Richtung geworfen habe, habe er sich plötzlich zurückgezogen und sei dort in den Wald verschwunden.«
Jenny versuchte, das Gehörte zu verarbeiten.
»Die Joggerin meinte auch, der Wolf sei wohl der Grund dafür, dass der Hund Ihres Vaters wie wahnsinnig angeschlagen habe. Nur deshalb war ihr der Landrover als ungewöhnlich aufgefallen. Wer lässt am frühen Morgen seinen Hund allein im Auto zurück?«
»Und weil Sie hinter allem einen möglichen Wolfsangriff vermuten, so ein Aufwand?«
»Tatsächlich gab es in dieser Gegend in den vergangenen Tagen wohl mehrere Wolfssichtungen.« Bach drehte sich um und rief einen der verbleibenden Polizisten bei seinem Namen, der daraufhin zu ihnen herüberkam. Er war kleiner als Jenny und drahtig, seine Haut braun gegerbt, eher wie bei einem Gärtner.
»Piet, erzähl mal, was du mir vorhin berichtet hast.«
Der Polizist nahm seine Mütze ab und gab Jenny die Hand. »Ich hoffe, wir finden Ihren Vater. Ich kenne Jo schon lange, und er ist ein feiner Kerl.« Er sprach mit breitem norddeutschem Akzent.
»Frau Rausch ist im Landkreis für die Wölfe zuständig.«
»Ich weiß«, sagte Piet, was bei Bach eine überraschte Reaktion auslöste. »Erzähl ihr von den Wolfssichtungen!«
Piet schien kurz zu zögern. »Wie ich sagte, vielleicht ist es nur Gedöns. Keine Ahnung, was man darauf geben kann. Kennen Sie das ›Fortschritt‹? Die alte Kneipe an der B 109?«
Sie schüttelte den Kopf, wobei ihr Blick immer wieder in die Richtung abglitt, in die die beiden Polizisten auf der Suche nach Jo verschwunden waren.
»Dort bin ich manchmal nach Feierabend. Also ziemlich oft. Und der Jo, Ihr alter Herr, der auch.«
Die Kneipe meinte er. Sie wusste, dass Jo abends gern auf ein Bier verschwand, aber nicht, wie die Gaststätte hieß.
»Jedenfalls haben dort in den letzten Tagen einige erzählt, dass sie einem Wolf begegnet sind.«
Stolpe an der Peene
Vor einigen Tagen
Nach dem gemeinsamen Frühstück und dem anschließenden Zähneputzen im Gebäude des evangelischen Kindergartens machten sich die »Zapfenzwerge« auf in den nahen Wald. Es waren dreizehn Kinder, weshalb sich jeweils zwei der Kleinen an den Händchen hielten und eine der Betreuerinnen mit einem hellblonden Mädchen das Schlusslicht bildeten. Eine weitere Betreuerin ging voran und zog in einem Bollerwagen den Proviant für den Tag hinter sich her. Der Schülerpraktikant sicherte das Grüppchen vorschriftsmäßig zur Straßenseite ab. Alle Kinder trugen neongelbe Westen, auf denen neben einem gemalten Tannenzapfen und einem stilisierten Zwerg auch das Logo einer Versicherung abgebildet war, deren örtliche Agentur die Warnkleidung spendiert hatte.
Es war eine sogenannte »Waldkindergartengruppe«, was bedeutete, dass man die meiste Zeit draußen im Freien verbrachte. So konnten die Kleinen von früh auf die Natur erforschen und erleben. Anders als ihre stubenhockenden Kameraden nutzten sie zum pädagogischen Spielen die Materialien, die die Natur ihnen zur Verfügung stellte. Sie beobachteten Pflanzen und Tiere, spielten mit Stöcken, matschten im Schlamm und kletterten auf Bäume. Und wenn sie nicht gerade auf dem Weg in den Wald oder zurück in den Kindergarten waren, durften sie sich vollkommen frei bewegen und lernten so früh Selbstständigkeit. In täglich geübter Routine warteten die Sprösslinge an der Ampel, bis diese Grün zeigte, überquerten in Zweierreihe die Landstraße, steuerten auf den etwas versteckten Waldweg zu und passierten die Schranke, die unbefugten Fahrzeugen den Zutritt zum Naturschutzgebiet versperrte.
Zu ihrer Linken erstreckte sich im Übergang zum moorigen Gelände hohes Schilfgras, von dem die Kinder gelernt hatten, dass es den Bibern als Deckung diente. Zur Rechten säumte hinter einem schmalen Graben ein Wall mit Weiden den Weg, deren knorrige Stämme das ein oder andere Märchengesicht verbargen. Die Gruppe näherte sich bereits der Abzweigung, wo es über die alte Holzbrücke, über den Nebenlauf der Peene, vorbei am morschen Aussichtsturm zu der Holzhütte ging, die der Kindergartengruppe tagsüber als Basislager diente, als die Betreuerin, die voranging, abrupt stehen blieb und den Finger an den Mund legte. Auch die Kinder stoppten. Sie kannten diese Geste bereits, wenn sie versuchten, auf ihrem Weg Geräusche der meist unsichtbaren Biber wahrzunehmen. Doch heute schaute die Betreuerin nicht zur Schilfseite, in der sich die Biberburgen verbargen, sondern in Richtung einer der Weiden, wohinter sich nur grüne Wiesen erstreckten. Einen Moment bewegte sich niemand, dann löste die Betreuerin sich aus der Erstarrung und deutete weiterzugehen.
»Was ist los?«, rief ihre Kollegin von hinten.
»Ich dachte, ich hätte etwas gehört!« Die Betreuerin zog mit einem kräftigen Ruck am Griff des Bollerwagens, damit er im matschigen Grund wieder Fahrt aufnahm. Nach wenigen Metern wiederholte sich das Prozedere. Wieder starrte die Betreuerin auf die Reihe der Bäume neben ihnen, um herauszufinden, was sie gehört hatte.
Und dann erschien er. Vielleicht lag es an der erhöhten Position oder daran, dass neben den Kleinsten auf dieser Welt alles andere ohnehin größer wirkte, aber er war riesig. Ein gewaltiger Schädel mit dreieckigen, oben abgerundeten Ohren, dem wolfstypischen, dunklen Gesicht, begleitet von hellen Partien seitlich des Mauls und an der Kehle. Dazu ein gedrungener Körper mit kräftigen Beinen. Er schaute aus zwei mandelförmigen Augen auf die kleine Gruppe und begann zu knurren. Es war ein drohendes Geräusch, das seine Wirkung nicht verfehlte.
Zwei der Kinder begannen erschrocken aufzuheulen, ein anderes zu weinen. Verängstigt wich die Gruppe zurück, die Betreuerin, die das Tier entdeckt hatte, blieb eisern stehen und machte sogar einen Schritt auf das Tier zu. Sie wedelte mit den Händen und schrie den Wolf mit sich überschlagender Stimme an, rief, er solle sie in Ruhe lassen, dahin gehen, wo der Pfeffer wächst, sich trollen. Doch das schien den Wolf nicht zu beeindrucken, im Gegenteil: Er senkte den Kopf, was den Blick auf seine im Nacken aufgestellten Haare freigab, und begann, mit den Zähnen zu fletschen, wobei vier beängstigend lange Reißzähne zum Vorschein kamen.
Die Kinder schoben sich kreischend enger zusammen, nun weinten beinahe alle. Das mit zitternder Stimme vorgetragene »Bleibt ruhig, und bewegt euch nicht« der zweiten Betreuerin am Ende der Gruppe kam zu spät. Zwei der größeren Jungs drehten sich plötzlich wie auf Kommando um und begannen, in die Richtung davonzurennen, aus der sie gekommen waren. Dies blieb von dem Wolf nicht unbemerkt. Er hob den Kopf, bewegte die Ohren und verfolgte die beiden Jungs mit seinem Blick. Plötzlich schnellte er zur Seite, um den beiden nun von der Gruppe getrennten Knirpsen nachzusetzen, als ein lauter Knall über die Wiese hallte. Der Wolf stoppte mitten in der Bewegung, drehte eine erschrockene Pirouette und rannte mit großen Sätzen in die andere Richtung davon.
»Der Knall kam von einem Vogelschreckgerät auf den Feldern dahinter«, beendete Piet seine Erzählung. »Vielleicht hat er den Jungs das Leben gerettet. Den Kindern ist am Ende nichts passiert. Aber der Vater von einem der Jungen kommt regelmäßig ins ›Fortschritt‹ und hat dort von dem Vorfall berichtet. Die Gruppe ist sofort zurück in den Kindergarten, und für diese Woche sind alle Waldausflüge gestrichen.«
»Warum weiß ich als Wolfsbeauftragte nichts davon?«, fragte Jenny.
»Die Leitung des Kindergartens wollte wohl den Ball flach halten. In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Versuche, deren Mittel für die Waldgruppe zu kürzen. Aber im ›Fortschritt‹ hängen abends auch immer ein paar Erntehelfer aus Polen rum, und die sind dem Tier ein, zwei Tage später auch begegnet. Sie meinten, es sei kein normaler Wolf, sondern viel größer. Ein richtiger Kaventsmann.«
Sie hörte von alldem zum ersten Mal, auch ihr Vater hatte ihr nichts davon erzählt. Obwohl er wusste, dass sie nun beim Kreis für die Wölfe zuständig war. Auch darüber hatten sie zuletzt gestritten. »Und Jo war dabei, als das erzählt wurde?«, versicherte sie sich.
»Ja!«
»Und was hat er dazu gesagt?«
Der Polizist zuckte mit den Schultern. »Sie wissen, wie er ist. Er meint selten, was er sagt. Ist impulsiv.«
Sie warf dem Polizisten einen auffordernden Blick zu.
»Also Jo meinte, wenn er den vor die Flinte bekommt, schießt er den ab und vergräbt ihn. Das sei der einzige Weg, mit den Viechern umzugehen. Allerdings müsse man aufpassen, dass er keinen Tracker trägt. Sonst würde irgendwann seine Tochter vor der Tür stehen, also Sie.« Nun wirkte er verlegen. »Kneipengedöns. Wie ich schon sagte.«
Sie spürte Wut in sich aufsteigen. Und sie wusste, dass Jo es todernst gemeint hatte.
»Selbst wenn ein Wolf meinen Vater angegriffen hätte, wo ist dann seine Leiche geblieben?«, fragte sie. »Wölfe verschleppen ihre Beute manchmal bis zu zwanzig, selten vierhundert Meter weit ins Dickicht.« Sie schaute sich um. Der Weg war zwar von Gebüsch gesäumt, aber wirkliche Verstecke gab es nicht. »Aber sie nehmen sie nicht kilometerweit mit.«
»In einer Doku habe ich gesehen, dass sie ihre Beute manchmal komplett auffressen, mit Haut und Haaren«, sagte Piet. »Oder andere Aasfresser erledigen den Rest.«
Bei diesen Worten wurde ihr übel. Piet hatte recht, sie wusste, dass Wölfe beispielsweise auch die Keulen erlegter Schafe abtrennten und für den Nachwuchs mitnahmen. Aber dass von einem Wolfsriss gar nichts übrig blieb, kam wohl höchstens bei kleineren Beutetieren vor.
»Wenn wir neben dem Auto einer vermissten Person eine riesige Blutlache im Sand finden und eine Zeugin in unmittelbarer Nähe einen Wolf angetroffen hat, schließen wir erst einmal nichts aus. Ich habe eine Hundertschaft aus Stralsund angefordert, um die nähere Umgebung zu durchkämmen«, sagte Bach.
In diesem Moment kam Unruhe auf. Einer der Streifenpolizisten ging zu ihnen herüber und sprach dabei etwas in sein Funkgerät, das an seiner Schulter befestigt war.
»Das waren Benno und Arnd. Sie haben beim Hochsitz etwas gefunden!«, unterbrach er ihr Gespräch.
Jenny spürte, wie ihr flau wurde, sie griff nach Bachs Arm, der sie festhielt. Dabei rutschte der Ärmel seines Sakkos hoch und gab den Blick auf die Ausläufer eines großflächigen Tattoos frei.
»Was haben sie gefunden?«, fragte er.
Mit unschlüssiger Miene blickte der Polizist zwischen Jenny und dem Staatsanwalt hin und her. »Sie sollten es sich besser selbst anschauen.«
6
Spät kam er auf die Weide. Das Leben als Schäfer war nicht immer einfach: Er hatte nicht nur neunundsiebzig Schafe zu hüten, sondern hatte auch noch drei Kinder und eine Frau. Da Letztere bereits morgens um sechs aus dem Haus musste, um pünktlich um 7 Uhr bei ihrer Arbeitsstelle in der Zuckerfabrik zu sein, oblag es ihm, sich morgens um die Kinder zu kümmern: Wecken, Anziehen, Frühstück machen, Zähneputzen, Brotdosen befüllen, zur Bushaltestelle fahren, den Kleinsten in die Kita bringen. Am Morgen war die Routine von dem Arztbesuch des Mittleren unterbrochen, dessen Impfungen aufgefrischt werden mussten. Trotz Termin hatten sie warten müssen, und erst nachdem er ihn am Schulzentrum abgesetzt hatte, konnte er endlich zur Weide fahren. Auch wenn Schäfer heutzutage nicht mehr bei den Tieren auf der Weide übernachteten, hatte es seinen Grund, dass viele seiner Kollegen aus dem Verband alleinstehend waren. Schafe oder Familie, das war für viele ein Entweder-oder. Und auch sie hatten finanziell zu kämpfen. Der Weidevertrag saß ihm im Nacken, die Kosten uferten aus, und die finanzielle Unterstützung vom Staat blieb aus.
Er steuerte seinen weißen Bulli rückwärts auf den Feldweg, um den Anhänger mit den Möhren an das Gatter heranzufahren. Mittendrin stockte er und starrte in den Außenspiegel, erstaunt über das, was er sah. Oder besser über das, was er nicht sah: kein einziges Schaf. Normalerweise kamen die Tiere herangelaufen, wenn sie seinen Motor hörten, aber nicht heute. Eine böse Vorahnung stieg in ihm auf. Er riss die Handbremse hoch und stieg aus. Keines der Schafe war zu sehen. Weder die Heidschnucken noch die Rhönschafe, die er zur Deckzeit voneinander trennte. Die Zucht von Rhönschafen, einer gefährdeten Rasse, war seine Spezialität. Sie waren nicht so massig wie die gewöhnlichen Heidschnucken und daher leichter zu handhaben. Er passierte den Wolfsschutzzaun, den er bereits vor Wochen montiert hatte, ein einfacher Zaun mit viertausend Volt Strom, der billig in der Anschaffung war, aber bislang seinen Dienst getan hatte, und öffnete das Gatter. Die Weide war ein typisches Pfeifenstielgrundstück, das zunächst schmal zwischen zwei städtischen Wiesen mit altem Baumbestand verlief und sich erst weiter unten verbreiterte, bis es schließlich am Flussufer der Peene endete.
Er hetzte über die Weide, die hier weitestgehend abgegrast war, rutschte bei jedem Schritt aus den Gummistiefeln, die im Winter zu eng und im Sommer zu groß waren. Das erste Schaf fand er im Knick. Den Kehlbiss erkannte er sofort. Die meisten seiner Schafe hatten keine Namen, sondern nur gelbe Marken im Ohr mit Nummern, dies war Nummer 2341, ein Mutterschaf. Der Bauch war geöffnet, der Pansen lag einige Meter entfernt, ein Bein fehlte komplett. Er schaute auf und sah keine drei Meter weiter den nächsten Kadaver und dahinter noch einen. Die Luft blieb ihm weg. Er lief weiter hinab in Richtung des Flusses und begann, im Geiste die Anzahl der Leichen zu zählen, die er dabei passierte. Ein weiteres Tier mit aufgerissenem Bauch, aus dem die Gedärme herausquollen, bewegte sich noch. Er stoppte kurz und übergab sich mitten auf die Wiese. Als er wieder hochschaute, sah er ein Jungtier, das hinkend mit verletzter Flanke Schutz hinter einem der Bäume suchte und dabei den Elektrozaun berührte, woraufhin es zu Boden stürzte und auf dem Rücken liegen blieb.
Panisch griff er nach seinem Telefon, suchte im Laufen nach der Nummer der Tierklinik und wählte. Jetzt erblickte er die Gruppe von Schafen, die dicht gedrängt am Ufer der Peene standen. Auf den ersten Blick zählte er nicht mehr als zwei Dutzend. Neunundsiebzig minus vierundzwanzig Tiere … das konnte doch nicht sein. Als er die Schafe fast erreicht hatte, stoben sie ängstlich auseinander und gaben den Blick auf den Fluss frei, in dem er weitere tote Tiere treiben sah. Von irgendwo ertönte ein klägliches, verzweifeltes Mäh. Er spürte, wie sich etwas tief in ihm drin zusammenballte, explosionsartig in seiner Brust ausbreitete und schließlich als verzweifelter Schrei aus seiner Kehle brach.
»Hallo? Wer ist da, bitte?«, kam eine Stimme aus dem Handy, das er noch immer in der Hand hielt. Jetzt erst realisierte er, dass es die Tierklinik war, deren Nummer er eben gewählt hatte. »Ich brauche Hilfe«, stammelte er völlig außer Atem in sein Mobiltelefon, während er in die gebrochenen Augen eines auf der Wasseroberfläche treibenden Kadavers blickte. Es war Trude, sein Leitschaf. »Ist Frau Doktor Rausch da? Sie muss sofort kommen!«
7
Jenny spürte, wie ihr Mobiltelefon in der Tasche vibrierte, aber sie ignorierte es. Als sie den Blick des Polizisten gesehen hatte, wusste sie Bescheid. Als Tierärztin behandelte sie zwar Tiere, ihre größten Kämpfe trug sie allerdings mit deren Besitzern aus. Ungefiltert bekam sie deren Emotionen ab, meist war es Sorge, manchmal Wut und nicht selten Trauer. Sie wusste, wie es ist, wenn man schlechte Nachrichten zu überbringen hat, und vermutlich setzte sie dabei denselben Blick mit dieser Mischung aus Mitleid, Trost und Härte auf wie der Polizist, als er eben zu ihnen herübergekommen war und von dem Fund am Hochsitz berichtet hatte. Und hätte sie es ihm nicht schon vom Gesicht abgelesen, hätte sie es sich spätestens zusammenreimen können, als die beiden Rechtsmediziner keine zehn Meter entfernt damit begannen, ihre Ausrüstung zusammenzupacken – vermutlich um sich auf den Weg zu einem weiteren möglichen Tatort zu machen. Bach und der Polizist waren einige Meter weiter gegangen und hatten kurz leise miteinander geredet. Nun kam Bach mit ernster Miene zu ihr zurück.
»Ich will ihn sehen«, sagte sie, bevor er etwas sagen konnte.
»Sie haben ihn unter dem Hochsitz gefunden. Gewehr und Fernglas liegen neben ihm«, entgegnete Bach. »Er ist offenbar schon gestern Abend beim Besteigen des Hochsitzes verstorben. Mein aufrichtiges Beileid. Es tut mir leid.«
Sie atmete tief durch, wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Wahrscheinlich erwartete man von ihr, dass sie weinend zusammenbrach. Aber sie empfand keine Trauer.
»Hatte Ihr Vater Vorerkrankungen?«
Sie holte die Packung mit den Tabletten hervor und hielt sie in die Luft. »Probleme mit dem Herzen«, kommentierte sie.
Bach nickte, wobei er nachdenklich weiter auf seinem Kaugummi herumkaute.
»Und das viele Blut?«, fragte sie.
»Die Kollegen sagen, die Leiche ist weitestgehend unversehrt. Vermutlich stammt das Blut hier von einem verletzten Wild, das von dem Wolf gerissen wurde, den die Joggerin gesehen hat. Das werden wir testen. Also eher ein Unfall und kein Verbrechen.«
Erneut atmete sie tief ein. Sie fühlte plötzlich eine große Leere in sich. »Kann ich ihn sehen?«
»Warum nicht? Wir müssen ohnehin auf den Bestatter warten. Ich begleite Sie.« Gemeinsam liefen sie den Pfad entlang, den Jenny zuletzt im Winter mit ihrem Vater gegangen war, als sie zusammen auf der Jagd gewesen waren.
Plötzlich fiel ihr wieder der schwarze Zaun auf, den sie bereits auf der Fahrt hierher gesehen hatte und der beim letzten Mal noch nicht hier gestanden hatte. Er begrenzte die Wiesen und Felder vor ihnen. Nun sah sie auch deutlich die Kameras sowie weitere elektrische Installationen am Zaun, die sie sich nicht erklären konnte.
»Vorsicht, der führt Strom!«, sagte der Polizeibeamte, der vor ihnen ging und dem ihr Interesse für den Zaun nicht verborgen geblieben war. Der Hinweis war überflüssig, denn alle paar Meter wiesen Schilder auf die elektrische Spannung hin.
»Wofür ist der?«, fragte sie.
»Weideschutz«, entgegnete der Polizeibeamte. »Eine Firma aus Brandenburg hat hier einige Kilometer Zaun zum Test aufgestellt. Ich habe neulich einen der Schwertransporte begleitet, die die Zaunstücke hergebracht haben.«
Das musste ganz schön teuer sein, dachte Jenny.
»Sind Sie sicher, dass Sie sich das antun wollen?«, fragte Bach, der schräg vor ihr ging. »Ich meine, das mit Ihrem Vater. Sie können auch zurückbleiben.«
»Ich will ihn sehen«, entgegnete sie entschlossen. Sie hatte keine Ahnung, was der Anblick bei ihr auslösen würde, aber irgendetwas in ihr verlangte nach der endgültigen Bestätigung.
»Ich habe meinen Vater im vergangenen Jahr verloren«, sagte Bach.
»Das tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Er hatte bis auf einige harte Jahre ein gutes Leben. Aber mit dem Verlust des Vaters kommen nicht nur die Trauer und die vielen Erinnerungen an die glücklichen Tage aus der Kindheit. Es wird einem klar, dass man selbst zur nächsten Generation gehört, die dran ist. Seitdem lebe ich bewusster. Genieße die schönen Momente mehr.«
Jenny sagte nichts, sondern versuchte stattdessen, sich an schöne Momente ihrer Kindheit zu erinnern. Tatsächlich gab es einige davon. Sie hatte im Großen und Ganzen eine gute Kindheit gehabt, wenn auch keine liebevolle. Das machte es für sie umso schwerer, die Wahrheit zu ertragen. In diesem Moment spürte sie ein Bedauern. Es war ihr noch so viel unklar, sie hatte noch so viele Fragen an Jo. Und nun stahl er sich einfach so davon? Esther, Jos Frau, war bereits lange tot, sie konnte ihre Fragen also auch nicht mehr beantworten. Als ihr dies bewusst wurde, stieg Panik in ihr auf. Was, wenn sie nun nicht mehr die ganze Wahrheit erfahren würde? Wenn nun niemand mehr lebte, der all ihre Fragen beantworten konnte? Sie beschleunigte den Schritt, überquerte die Lichtung, auf der Jo in der Vergangenheit wohl dem einen oder anderen Wildschwein aufgelauert hatte, suchte die Lücke im Dickicht und betrat das Feld. Bach geriet neben ihr außer Atem, so schnell lief sie nun. Jo war tot, sagte sie zu sich selbst. Wie sehr sie auch rannte, sie würde den Tod nicht mehr überholen können.
Zu ihrer Rechten sah man in einiger Entfernung schon die beiden Polizisten, die rauchend am Fuß des Hochsitzes warteten. Als sie sie erblickten, drückten sie ihre Zigaretten an den Stelen der Kanzel aus.
»Dort vorn«, sagte einer der beiden. Es war ein Jägerstand der besseren Sorte. Nicht selbst gezimmert, sondern aus edlem Lärchenholz gefertigt, das in der Sonne gelblich schimmerte. Sie wusste, dass ein Teil von Jos Abfindung, die er beim Ausscheiden aus dem Institut bekommen und gut angelegt hatte, in den Bau dieses Hochsitzes geflossen war. Die Leiter bestand aus massiven, eingelassenen Sprossen, die Kanzel selbst ähnelte eher einer Gartenhütte auf Stelzen und war von unten nicht einsehbar. Sie brauchte einen Moment, bis sie den Körper am Fuße der Leiter auf dem Boden entdeckte. Mit wackeligen Knien näherte sie sich. Der Körper lag bäuchlings auf dem Boden. Als sie ihn genauer erkennen konnte, fühlte sie Erleichterung, wofür sie sich abermals sofort schämte. Zu braunen Jagdstiefeln trug der Tote Kniestrümpfe und Lederhose, obenherum eine Lodenkotze, den ärmellosen Umhang, den man auch Wetterfleck nannte und den vor allem traditionelle Jäger bevorzugten. In diesem Fall schien er zerrissen. Neben dem kahlen Kopf der Leiche, der blass und blau aussah und nur noch von einem grauen Haarkranz umgeben war, lag ein Jägerhut mit Gamsbart. Halb unter dem Körper erkannte sie eine Bockbüchse. Sie wagte einen weiteren Schritt nach vorn und erkannte erst jetzt die kleine Wunde kurz hinter der Schläfe. Es sah beinahe so aus, als würde das halbe Ohr fehlen.
Auch Bach schien die Wunde entdeckt zu haben. »Die Verletzung ist zu klein, um das viele Blut vorn zu erklären. Stammt vermutlich vom Sturz von der Leiter.«
»Oder Tierfraß«, mutmaßte sie.
»Die Leiche wird natürlich obduziert, aber erst mal sieht alles nach einem Unfall aus.«
Jenny schaute die Leiter hinauf und erstarrte, als sie die Außenwand des Hochsitzes sah. »Was zum Teufel …?«, sagte sie und zeigte auf ein hellrotes Graffiti, das sich beinahe über die gesamte Außenwand des Hochsitzes erstreckte. An den jeweiligen Enden war die noch feuchte Farbe nach dem Auftragen nach unten verlaufen.
»Mörder!«, las Bach laut ab.
»Und ein Hakenkreuz!«, stellte sie fest. »Das ist neu!«
»Vandalismus auf Hochsitzen ist leider nicht neu. Da haben wir hier jedes Jahr ein Dutzend Fälle. In Blesewitz ist vergangenes Jahr sogar einer angezündet worden.« Bach wandte sich zu ihr. »Ich lasse Sie einen Moment mit Ihrem Vater allein, damit Sie Abschied nehmen können.«
Jenny schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig.«
Bach warf ihr einen irritierten Blick zu.
Jenny schaute auf den Toten. »Das ist nicht mein Vater.«
8
Das Peenetal erstreckte sich idyllisch vom Kummerower See bis hinauf zur Mündung des Peenestroms, der als Meeresarm der Ostsee die Insel Usedom vom Festland trennte. Gespeist wurde es vom Fluss Peene, dessen Bett vor zehntausend Jahren als Schmelzrinne der abziehenden Gletscher in den Grund der Moränen geschliffen wurde. Entlang des Laufs der Peene erstreckten sich heute weite Moore, Wälder und Wiesen, die zahlreichen seltenen Tierarten wie Amphibien, Vögeln und Kleintieren Unterschlupf boten. Mit der nahen Ostsee als gigantischem Wärmespeicher waren die Sommer hier im Peenetal wärmer und länger und die Winter milder und kürzer. Und so war es auch im September noch sommerlich warm, wenn auch nicht mehr so heiß wie im Juli und August. Die Sonne hatte mittlerweile auch die letzten Wolken am Himmel verscheucht. Es war ein herrlicher Tag geworden, was so gar nicht zu Jennys Gemütszustand passen wollte. Auf dem Weg in die Tierklinik hatte sie ihr Mobiltelefon auf laut gestellt und die Nachrichten abgehört, danach sofort in der Klinik angerufen. Sie parkte hinter der Klinik und betrat die Räume mithilfe der Zugangsapp auf ihrem Smartphone durch den Hintereingang. Die Digitalisierung machte auch vor den Tierärzten nicht halt, was ihr ganz und gar nicht behagte.
»Wir hatten uns schon Sorgen gemacht«, begrüßte Mona, eine ihrer vier Tierarzthelferinnen, sie. »Heute Morgen war hier schon Chaos. Phillip ist bedient! Die Putzfrau hat vergessen, die Mülleimer zu entleeren, und muss wohl auch noch das Jod umgeworfen haben. Die Schweinerei durfte also ich beseitigen. Und dann tauchst du nicht auf, und er muss deine OP übernehmen!«
Sie erklärte Mona in kurzen Worten, was geschehen war, dann erzählte Mona ihr von Helges Anruf. »Er war ganz aufgelöst«, berichtete die Tierarzthelferin ihr, »geradezu panisch.«
Daraufhin war Jenny auf direktem Wege zu dessen Weide gefahren. Mona hatte ihr noch gesagt, dass Helge Schulze von einem »Schlachtfeld« auf seiner Weide gesprochen hatte.
Die Schafherde graste keine zwei Kilometer entfernt von dem Hochsitz, an dem sie soeben den unbekannten Toten gefunden hatten. Nachdem sie verkündet hatte, dass der Tote nicht ihr Vater ist, hatte der Staatsanwalt den Tatort sofort abgesperrt und die Ermittlungen wieder aufgenommen. Tatsache war, dass ihr Vater dennoch spurlos verschwunden war. Und wegen des unbekannten Toten war sein Verschwinden jetzt umso rätselhafter. Sie glaubte, an der Reaktion des Staatsanwalts auf die Tatsache, dass der Tote nicht ihr Vater war, mehr als nur Erstaunen abgelesen zu haben: Ihr Vater war plötzlich nicht nur noch ein etwaiges Opfer, sondern auch ein potenzieller Verdächtiger. Denn neben der Möglichkeit, dass jemand es auf zwei Jäger abgesehen hatte, wobei niemand überhaupt wusste, wer der tote Mann am Hochsitz war, bestand auch die Möglichkeit, dass Jo etwas mit dessen Tod zu tun hatte und deswegen nun untergetaucht war. Bach hatte diesen Verdacht nicht laut ausgesprochen, aber allein, dass sie selbst die zweite Möglichkeit nicht ganz auszuschließen vermochte, führte bei ihr erneut zu Gewissensbissen. War es normal, dass sie Jo nun schon einen Mord zutraute? Oder war sie mittlerweile paranoid? Sie hatte über die Jahre gelernt, dass sie eher zu hart mit sich selbst war als zu milde. Aber sie musste auch erkennen, dass sie in den letzten Wochen ihren inneren Kompass verloren hatte.
Nun bog sie auf die kurvenreiche Straße ab, die zu Helge Schulzes Weide führte. Sie kannte Helge schon seit ihrer Kindheit, denn sie waren zusammen zur Schule gegangen. Doch nach der zehnten Klasse hatten sich ihre Wege getrennt: Sie hatte Abitur gemacht und er im Schafzuchtbetrieb seines Vaters angefangen, den er bereits in jungen Jahren hatte übernehmen müssen. Zuletzt war sie bei ihm auf der Weide gewesen, um einen Befall von Nasendasseln zu bekämpfen. Das waren Fliegen, die ihre Eier in den Schleimhäuten und Nebenhöhlen der Tiere ablegten, wo die Larven sich einnisteten und manchmal bis ins Gehirn vordrangen. Die Nasendasseln nisteten sich ein, wie die Wahrheit es tat, wenn man sie einmal erkannt hatte, dachte sie. Es war ein Zufall, der sie zur Wahrheit geführt hatte, und er hatte mit der roten Kiste zu tun, die hinten in ihrem Kofferraum lag und die sie hoffentlich jetzt nicht brauchen würde.
Sie sah Helge Schulze bereits von Weitem. Er stand am Gatter und hob die Hand. Normalerweise war er ein groß gewachsener Mann, doch jetzt wirkte er klein und krumm, beinahe so, als sei er in der Mitte durchgebrochen. Sie fuhr so nahe wie möglich an ihn heran, um die Straße für den Verkehr frei zu halten, und stieg aus. Erst jetzt sah sie, dass Helges Kleidung rot getränkt war und er in der rechten Hand ein blutiges Messer hielt. Erschrocken blieb sie stehen. »Ich musste sie töten!«, rief er ihr zu und begann zu schluchzen.
9
Sie saßen nebeneinander auf Helges Anhänger und tranken Pfefferminztee aus dessen Thermoskanne. Mit Wasser aus der Tränke hatte sie Helges Hände gesäubert und den Mann erst einmal beruhigt. Dann hatten sie das Massaker besichtigt. Insgesamt hatte sie fünfundfünfzig tote Schafe gezählt. Nachdem sie nicht zu erreichen gewesen war, hatte Helge selbst einige der noch lebenden, aber schwer verletzten Tiere erlöst. Gemeinsam hatten sie noch ein Schaf gefunden, das sich in Panik in dem Weidezaun verfangen hatte und das sie sofort hatte einschläfern müssen. Danach hatte sie die Wunden der überlebenden Tiere versorgt, wobei sie nicht sicher war, ob es alle schaffen würden. Vier der Schafe hatte sie für den Abtransport in die Tierklinik vorbereitet, sie warteten auf einen mit Helge befreundeten Schäfer, der aus Greifswald mit seinem Schafanhänger auf dem Weg zu ihnen war.
Helge starrte ins Leere. Sie bemerkte, dass der Becher in seiner Hand noch immer zitterte. Jenny schaute auf den Ärmel ihrer Bluse, an dem Blut war.
»Ich helfe dir beim Ausfüllen der Formulare«, sagte sie. »Im roten Kasten im Kofferraum habe ich das Set für die DNA-Proben. Sobald das Rissgutachten vorliegt und feststeht, dass das ein Wolf war, erhältst du eine Entschädigung. Wir müssen noch deinen Wolfsschutzzaun fotografieren. Die Einhaltung des Mindestschutzes ist Voraussetzung für die Auszahlung der Entschädigung. Sei froh, dass du einen hast, auch wenn er in diesem Fall nichts genützt hat, garantiert er dir zumindest Schadensersatz.«
Helge entgegnete nichts, sondern starrte weiter geradeaus.
»Das Wichtigste ist, dass wir das innerhalb von vierundzwanzig Stunden weitergeben.«
»Ich erhalte keine Entschädigung«, sagte er schließlich.
»Bitte?« Sie glaubte, nicht richtig verstanden zu haben.
»Ich habe das Wasser nicht ausgekoppelt, damit die Tiere dort trinken können.«
Sie erinnerte sich an die Tiere, die auf der Flucht im Fluss ertrunken waren. Gemeinsam hatten sie vergeblich versucht, alle Kadaver aus dem Wasser zu bergen, mussten aber auf Helges Kollegen warten, der eine Wathose mitbringen wollte. Helge hatte recht: Weiden mussten von allen Seiten eingezäunt werden, auch zur Flussseite, es sei denn, man besaß Herdenschutzhunde. Und das tat Helge nicht. Sie musste durch die Sache mit ihrem Vater so durcheinander sein, dass ihr das nicht gleich aufgefallen war. Helge würde keine Entschädigung bekommen.
»Ich bin am Ende«, sagte Helge.
Sie legte ihre Hand auf seine Schulter. »Ich kann dir etwas Geld leihen, um neue Schafe zu kaufen.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich meine hier oben.« Er tippte auf seine Schläfe. »Ich will das nie wieder erleben. Weißt du, dass ich Trude großgezogen habe? Mit der Flasche!« Tränen stiegen in seine Augen. »Meine Kinder haben sie geliebt! Als sie ein Lamm war, haben sie mit ihr gespielt. Wie soll ich es ihnen beibringen? Dass ein Wolf sie getötet, nein zerfleischt hat. Er hat ihr das Fell heruntergerissen, ich habe ihre Gedärme gesehen.«
Sie musste an Bruno denken. Nur widerwillig hatte sie sich damit einverstanden erklärt, dass der Hundeführer ihn in die Gerichtsmedizin nach Greifswald brachte, damit eventuelle Spuren an ihm ausgewertet werden konnten. Sie hielt dies für unnütz: Ihr Vater hatte ihn im Auto gelassen, wie er es immer tat, bis er etwas geschossen hatte. Außer dem Kofferraum hatte Bruno seit gestern Abend nichts zu sehen bekommen. Sie hatten vereinbart, dass sie ihn nachher abholte. Sie schaute auf die Uhr. Das hier würde noch eine Weile dauern.
»Fünfundfünfzig tote Tiere! Was war das für ein Monster?«, sagte Helge nun. Er drehte sich zu Jenny.
»Es gibt keine Monster«, entgegnete sie.
»Doch, die gibt es! Mein Großvater hat eins gesehen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Er war damals in Gristow stationiert. Nicht weit von hier entfernt. Er hat uns Kindern oft davon erzählt.«
Gristow, 1944
»