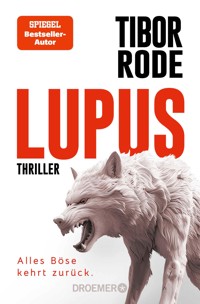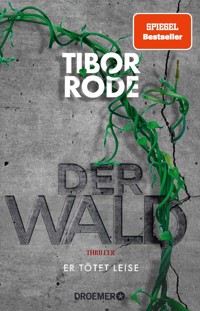
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn Natur & Technik sich gegen uns verbünden? Tibor Rodes wissenschaftlich top recherchierter What-if-Thriller handelt von der Intelligenz der Pflanzen, selbstlernenden Algorithmen, einem zerstörerischen Ökosystem – und dem möglichen Ende der Menschheit. Der Wald schlägt zurück - ein packender Ökothriller Weltweit sorgen anonym verschickte Postsendungen für Aufruhr: Tausende Menschen erhalten scheinbar harmlose Päckchen mit Saatgut. Zwar warnen die Behörden davor, die Samen einzupflanzen, doch da ist es schon zu spät. Eine bislang unbekannte, invasive Pflanze breitet sich in rasantem Tempo aus – und bringt auf der ganzen Welt Krankheit und Tod. Denn sie selbst und ihre Pollen sind hochgradig gefährlich. Der Botaniker Marcus Holland, der auf dem Gebiet der Pflanzen-Neurobiologie forscht, ist überzeugt, dass wir die pflanzliche Intelligenz bislang unterschätzen. Umso mehr fasziniert ihn der Eindringling und jagt ihm gleichzeitig Angst ein. Seine Suche nach dem Ursprung der Päckchen mit den angsteinflößenden Samen führen ihn und die Archäobiologin Waverly Park von Kanada über China zurück nach Deutschland, wo sie eine schier unglaubliche Entdeckung machen ... Mensch, Technik und Natur - What-if-Umweltthriller in Bestform Was Johann Wolfgang von Goethe – vielleicht – mit dem Ende der Menschheit zu tun hat, und was in Sachen Digitalisierung der Natur heute bereits möglich ist, verrät Tibor Rodes brillanter Wissenschaftsthriller - zum Staunen und zum Mitfiebern spannend. Ein Umweltthriller über den Kampf zwischen Menschheit und Natur, der die Welt, wie sie bisher existiert, in Frage stellt. Wer an den spekulativen What if- oder Ökothrillern von Frank Schätzing, Wolf Harlander oder Marc Elsberg Freude hatte, wird hier in bester Weise unterhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tibor Rode
Der Wald
ThrillerEr tötet leise
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
2023 sorgen weltweit anonyme Postsendungen für Aufruhr: Tausende Menschen erhalten Päckchen mit Saatgut. Zwar warnen die Behörden davor, die Samen einzupflanzen, doch da ist es schon zu spät. Eine bislang unbekannte, invasive Pflanze breitet sich in rasantem Tempo aus – und bringt weltweit Zerstörung und Tod. Der Förster Marcus Holland, der überzeugt ist, dass wir pflanzliche Intelligenz bislang unterschätzen, ist ebenso erschrocken wie fasziniert von dem Eindringling. Seine Suche nach dem Ursprung der Päckchen führt ihn und die Archäobotanikerin Waverly Park von Kanada über China zurück nach Deutschland, wo sie eine schier unglaubliche Entdeckung machen …
Inhaltsübersicht
Anmerkung
Widmung
Motto
Prolog, Mai 2023
3 Monate später
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
Epilog
Nachwort des Autors
Sämtliche handelnden Personen, Namen, Orte und Vereinigungen in diesem Buch entspringen allein der Fantasie des Autors. Alles in diesem Buch ist Fiktion, bis auf diejenigen Fakten, die absolut unglaublich erscheinen, diese sind weitestgehend wahr.
Für meinen Vater
Das Aufkommen superintelligenter KI wäre entweder das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann.
Stephen Hawking
Prolog, Mai 2023
Das Päckchen kam mit der Post. Kaum größer als ein Briefumschlag und so leicht, als sei es leer. Es enthielt kein Anschreiben, keinen Absender, nur zwei durchsichtige Tütchen mit etwas, das Anette Walters, deren Name als Empfänger auf dem Paket stand, als Pflanzensamen identifizierte. Anette Walters besaß eine mittelgroße Farm in Cottonwood, Minnesota, inmitten des »Grain Belt«, der sogenannten Kornkammer der Vereinigten Staaten, und war mit der wundersamen Kraft des Pflanzenwachstums vertraut. Neben dem kommerziellen Anbau von Weizen, Hafer, Soja und Mais auf ihren saftigen Ackerflächen, die bis hinab zum Cottonwood Lake reichten, bewirtschaftete sie auch ein Gemüsebeet hinter der Scheune für den Eigenbedarf. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie Post von den großen Agrarunternehmen erhielt oder auch von den Riesengemüse-Shows aus dem Matanuska-Susitna Valley, die ihre neuesten Rekordzüchtungen anpriesen. Und so machte sie sich wenig Gedanken darüber, dass jemand offenbar vergessen hatte, dem Päckchen das obligatorische Werbeschreiben beizulegen. Vielmehr war sie neugierig, was aus den Samen wuchs, denn sie hatte in ihrem Leben eine Menge Saatkörner gesehen, aber niemals zuvor welche wie diese. Farbe und Größe erinnerten an eine Kidneybohne, doch die Oberfläche war merkwürdig geschuppt wie bei einem kleinen Käfer und das Rot der Samen so leuchtend, dass sie in einem Reflex aus Urzeiten kurz zögerte, sie anzufassen. Sie pflanzte die Samen an einem sonnigen Samstagabend in ihrem Gemüsebeet in bester Lyon-County-Erde ein und vergaß nicht, etwas von dem besonders stickstoffreichen Fledermausguano aus Ägypten dazuzutun. An den folgenden Tagen brauten sich am Horizont für die Jahreszeit untypisch graue Regenwolken zusammen und sorgten für ein schwülwarmes Klima, das jede Arbeit auf der Farm zur Qual machte. Und weil sich mit dem Wetterumschwung Anette Walters’ Asthma zurückmeldete, nutzte sie die kurze Pause vom Sommer, um im 14,5 Meilen entfernten Marshall den Arzt aufzusuchen und einige Besorgungen zu machen. Das etwas mildere Klima in der Stadt und die kurze Auszeit von der harten Feldarbeit taten Lunge und Rücken gut. Da ihr Bruder und dessen Frau in Marshall ein großes Haus besaßen und sie ihre drei Nichten ohnehin zu selten sah, blieb sie über das Wochenende dort.
Im Leben einer Pflanze sind wenige Tage normalerweise nur ein Augenzwinkern, doch als Anette Walters gegen Abend zu ihrer Farm zurückkehrte, schienen in dem Beet hinter der Scheune Wochen vergangen: Aus den unbekannten Samen waren innerhalb einer guten Woche Pflanzen gewachsen, die ihr bereits bis zur Hüfte reichten: feste Stängel von der Stärke eines Kinderarms und große, ausladende Blätter, deren Form an einen Baseballhandschuh erinnerte. Die Gärtnerin in ihr plädierte dafür, die Pflanzen herauszureißen, denn sie wusste, dass in der Natur alles Eilige meist Gefahr bedeutete. Doch dann fiel ihr Blick auf die ersten, prallen Knospen, die sich zwischen den Blättern bildeten und mit ihren feinen Härchen an kleine Seeigel erinnerten, und es siegte in ihr die Neugierde, welche Blütenpracht zum Vorschein kommen würde. Diesen Entschluss musste sie irgendwann revidiert haben, viel später, als die Pflanzen lange blühten.
Ihr Bruder fand Anette Walters’ Leiche an genau dieser Stelle im Garten, nachdem er sie tagelang nicht hatte erreichen können. Neben ihr lag eine Motorsäge. Sie hatte Verbrennungen an den Händen und starrte mit leeren Augen in den blauen Himmel. Der Arzt konnte die Brandblasen ebenso wenig erklären wie die Tatsache, dass Pflanzen erste Wurzeln im Leichnam geschlagen hatten, und diagnostizierte einen Asthmaanfall als Todesursache. Die Tote wurde nach Marshall gebracht und dort auf Geheiß des Bruders bald eingeäschert. Die Farm blieb verlassen zurück, da der Bruder weder Zeit noch Kraft fand, sich alsbald um den Verkauf zu kümmern. Dabei hätte sich jeder Kaufinteressent, der die lange Zufahrt zur Farm hinaufgefahren wäre, schon von Weitem gewundert, was für eine Pflanze das war, die einen großen Teil der Fläche hinter der Scheune überwucherte und deren Blüten auch aus der Ferne weiß in der Sonne Minnesotas glänzten.
Zur gleichen Zeit wurde 7600 Kilometer entfernt, im österreichischen Bezirk Pinzgau in der Gemeinde Maria Alm im schönen Ortsteil Hintermoos, der Briefkasten des Holzhauses der Familie Enzinger geöffnet. Wie jeden Tag in den Sommerferien durfte die kleine Sophie die Post hereinholen. Auf dem Weg in die Küche, in der sich die Mutter anlässlich des Geburtstages von Sophies großer Schwester an Salzburger Nockerln und anderen Köstlichkeiten versuchte, erregte zwischen den langweiligen Briefen ein schmales Päckchen aus grauer Plastikfolie Sophies Aufmerksamkeit. Obwohl sie gerade erst sechs Jahre alt geworden war, konnte sie bereits lesen, und in den Ferien hatte sie gelernt, auf Briefen nach dem Absender zu suchen. Doch auf diesem Packerl fand sie keinen. Zurück in der Küche, nahm sie das Kuchlmesser, das die Mutter gerade benutzt hatte, und schnitt das Päckchen auf, schön vorsichtig, weg vom Körper, wie die große Schwester es ihr gezeigt hatte. Zum Vorschein kamen zwei durchsichtige Tütchen. Sie hielt sie gegen die Sonne, die vom nahen Hochkönigmassiv herab durch das Fenster schien. Das Sonnenlicht verstärkte das feurige Rot der Steinchen in der Tüte.
»Das sind keine Steinchen«, sagte die Mutter, als sie Sophie die Tüte aus der Hand nahm und sie vor ihrem Gesicht hin und her drehte, »das sind Houbulln!«
»Houbulln?«, fragte Sophie, die die Burgenländer Mundart ihrer Mutter oft nicht verstand.
»Samenkapseln, zum Einpflanzen«, erklärte sie und deutete auf das Päckchen. »Ist denn da kein Schreiben bei gewesen?«
Sophie reichte ihr das aufgerissene Päckchen. Kein Anschreiben, kein Absender. Die Mutter zuckte mit den Achseln, als es hinter ihr anfing, laut zu zischen, und sie sich fluchend der angebrannten Butter zuwandte. Sophie rutschte derweil mit dem Tütchen in der Hand vom Stuhl und verschwand unbeachtet durch die Hintertür in den kleinen Kräutergarten hinter der Küche, in dem sie vor nicht allzu langer Zeit mit der Mutter und der Schwester Bärlauch, Minze und Lavendel gepflanzt hatte. Sie strich mit der Hand über den Lavendel und roch an ihren Fingern. Dann nahm sie das kleine Schäufelchen aus der alten Obstkiste, die mittlerweile zur Aufbewahrung von Gartengeräten diente, und grub neben dem Bärlauch ein kleines Loch in die Erde, in das sie die roten Samen hineinfallen ließ, um hinterher alles wieder glatt zu streichen. Wie von der Mutter gelernt, nahm sie die eiserne Gießkanne und besprengte die Stelle mit Wasser. Das Plastik entsorgte sie vorschriftsmäßig in der gelben Mülltonne neben der Küchentür. Im nächsten Moment weckte die Katze des Nachbarn ihre Aufmerksamkeit, und sie lief ihr nach, um sie endlich zu streicheln.
In den folgenden Tagen legte der Sommer im Pinzgau noch einmal an Kraft zu und zwang die Bewohner in die Häuser oder die Berge. Die Familie Enzinger zog es in eine Hütte kurz vor der Mittelstation am Arlberg, die von der Großmutter geerbt und Gott sei Dank behalten worden war.
So bemerkte niemand, wie im Garten der Familie Enzinger zunächst der Bärlauch starb und nach ihm der Lavendel und auch die Minze.
»Der Baum wünscht Ruhe, aber der Wind hört nicht auf«, stöhnte Huang Shihao. Er hievte die grüne Kiste vom Tresen und trug sie zu den anderen im Lager, auf denen das Logo der China Post, 中国 邮政, prangte.
»Du mit deinen Sprichwörtern«, entgegnete seine Kollegin Li. »War er schon wieder da?«
Huang kam aus dem Lager und schaute zur Tür des kleinen Postamts, welches in einer Straße etwas außerhalb von Hangzhou in der Provinz Zhejiang gelegen war. Als er sicher war, dass sie allein waren, hob er verschwörerisch die Augenbrauen. »Unheimlich ist, was in den Päckchen drin ist.«
Li riss die Augen auf. »Du hast doch nicht …?«
Huang zuckte mit den Schultern. »Ganz vorsichtig. Und hinterher habe ich es fein säuberlich verschlossen. Niemand wird es bemerken.«
Seine Kollegin bemühte sich, einen tadelnden Blick aufzusetzen. »Wenn die das in der Zentrale mitbekommen, werden sie dich feuern und der Polizei melden!«
»Unsinn!«, entgegnete Huang beinahe ärgerlich. »Wenn jemand so viele Päckchen ins Ausland versendet, ist es meine Pflicht als Leiter dieses Postamts, hineinzuschauen. Die Zentrale hat uns angewiesen, die Augen aufzuhalten und Verdächtiges zu melden.«
Li schüttelte den Kopf und schaute nun ihrerseits zur Tür. Sie waren weiterhin allein. Es war kurz vor Feierabend, um diese Zeit kamen nur noch selten Kunden.
»Und was war drin?«, fragte sie.
Huang lächelte. »Das darf ich dir nicht sagen. Postgeheimnis.«
»Nun sag schon!«
Abermals blickte Huang sich verschwörerisch um. Dann machte er einen Schritt auf Li zu, fasste in seine Hosentasche und holte einen kleinen feuerroten Gegenstand hervor.
»Das hast du nicht getan!«, entfuhr es Li.
Wieder grinste Huang. »Keine Sorge, da waren viele drin, es fällt nicht auf.«
Li nahm den Gegenstand und betrachtete ihn skeptisch. »Was ist das?«
Huang zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sieht aus wie eine – Bohne.«
»War ein Schreiben dabei?«
Er schüttelte den Kopf. »Kein Anschreiben.«
»Und kein Absender«, ergänzte Li.
»Ich wüsste gern, wer der Mann ist, der die Päckchen bringt. Vielleicht sollten wir ihm einmal hinterherfahren«, sagte Huang.
»Lieber nicht«, sagte Li und schaute besorgt.
Huang nahm ihr derweil die kleine Bohne ab und steckte sie wieder in die Hosentasche. »Na los, wir haben noch genug zu sortieren, gleich kommt der Fahrer.«
Li presste die Lippen zusammen und folgte ihrem Kollegen widerwillig.
»Bohnen!«, stieß sie aus. »Es sind ja nur Bohnen.«
»Aber wer verschickt so viele Bohnen in die weite Welt?«, entgegnete Huang und fügte an: »1032!«
»Was soll das sein?«
»Die grauen Päckchen. 1032 Stück mit denen von heute. Und in jedem sind zwei Tütchen mit einer Handvoll Bohnen.«
»Bohnen?«
»Vielleicht pflanze ich sie ein«, ächzte Huang, während er nach einer weiteren Kiste griff, um sie auf eine andere zu stapeln.
»Lieber nicht! Und so wie ich dich kenne, lässt du sie vermutlich eingehen!«
Huang stellte die Kiste ab und drückte den Rücken durch. »Warum bist du immer so böse zu mir?«, sagte er mit gespielt beleidigter Miene.
Li lachte. »Du weißt doch: ›Wer Böses sät, wird Böses ernten.‹«
3 Monate später
1
Holland
Dicht gedrängt saß das Publikum im Powers Book Store. Hinter dem Auditorium aus Klappstühlen erstreckten sich die unendlichen Reihen von Bücherregalen, die einen ganzen Straßenblock einnahmen und den Buchladen zum angeblich größten der Welt machten.
Der heutige Gast kam aus Deutschland und hatte die letzte Stunde in nahezu perfektem Englisch aus seinem frisch in den USA erschienenen Buch The Intelligence of Plants gelesen.
»In unserer Kultur rangieren Pflanzen auf der untersten Stufe der Lebewesen«, tönte Marcus Hollands Stimme aus den provisorisch aufgestellten Lautsprechern. Selten hatten die Lesungen in Oregons Buchparadies so viele Besucher wie heute.
Zuletzt hatte »The German Ranger«, wie er am Anfang nicht ohne Augenzwinkern vorgestellt worden war, sich in Rage geredet.
»Würden morgen sämtliche Pflanzen von der Erde verschwinden, wäre die Menschheit bald dezimiert. Verschwinden hingegen wir Menschen, würden die Pflanzen binnen kürzester Zeit all das zurückerobern, was wir der Natur weggenommen haben!«
Er griff nach dem Wasserglas und nahm einen Schluck. Zur olivgrünen Hose trug er ein weißes Hemd und ein lässiges Jackett. Sein kantiges Gesicht wies die Art von Sonnenbräune auf, die im Freien arbeitende Menschen am Abend mit nach Hause brachten. Die Haare waren sehr kurz geschnitten, um erste Anzeichen einer fliehenden Stirn zu kaschieren, was aber nicht zuletzt wegen der Bräune eher attraktiv daherkam. Vom Erscheinungsbild wirkte er jedenfalls nicht wie ein Autor, der im Dunklen seines Arbeitszimmers Bücher schrieb. Dies war Teil seines Erfolgs in zahlreichen Ländern, und nun auch in den USA. Und so prangte sein Porträt auch auf einem großen Plakat, das die Mitarbeiter vom Powers Book Store hinter dem Rednerpult aufgespannt hatten, nicht ohne eine der provokantesten Aussagen seines Buches als Teaser mit aufzudrucken:
Plants are the true rulers – Pflanzen sind die wahren Herrscher.
»Würden Sie auf einem fremden Planeten landen und eine einzige Lebensform dort würde mehr als neunundneunzig Prozent aller Bioorganismen stellen – würden Sie dann nicht auch sagen, diese Lebensform beherrscht den Planeten?« Holland machte eine kurze Pause, um seine Worte wirken zu lassen. »Ganz recht: Die Pflanzen stellen mindestens neunundneunzig Prozent der Biomasse auf unserer Erde.«
Ein Tuscheln ging durch den Raum, während Holland erneut zum Wasserglas griff.
»Pflanzen stehen zudem am Anfang unserer Nahrungskette«, fuhr er fort. »Mais, Reis, Weizen, Kartoffeln und Soja ernähren Milliarden von Menschen. Der Großteil unserer fossilen Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Gas ist über Jahrtausende von geologischen Zeitaltern durch Sonnenenergie und pflanzliche Organismen erschaffen worden. Die Mehrzahl unserer Arzneimittel wird aus pflanzlichen Molekülen gewonnen oder nach deren Vorbild nachgebildet. Und dann wäre da noch so eine Kleinigkeit wie die Fotosynthese, ohne die wir Menschen nicht überleben könnten … Und dennoch gestehen wir Pflanzen keinerlei Rechte zu, sondern behandeln sie kaum anders als Steine. So gesteht weltweit allein die Verfassung der Schweiz den Pflanzen Würde zu. Dies muss sich ändern! Vielen Dank!«
Marcus Holland nickte und lächelte ein wenig verlegen, als Applaus aufbrandete.
»Herzlichen Dank für den leidenschaftlichen Vortrag«, übernahm der Manager des Bookstores die Moderation. »Ich denke, ich habe zu Beginn nicht zu viel versprochen, als ich einen ganz neuen Blinkwinkel auf die Welt der Pflanzen ankündigte. Mr Holland, wenn ich es richtig verstanden habe, dann behaupten Sie in Ihrem Buch, Pflanzen würden auch über Intelligenz, Synapsen und so etwas wie ein Gehirnverfügen. Sie schreiben, Pflanzen seien wie wir Menschen in der Lage, zu sehen, zu schmecken und zu kommunizieren?«
»Das ist richtig«, bestätigte Holland. »Pflanzen besitzen allerdings keine Organe, also auch kein Gehirn. Sie ernähren sich ohne Mund, atmen ohne Lungen und kommunizieren beispielsweise über Duftstoffe oder Elektroimpulse mit anderen Pflanzen und der Tierwelt. Nach neuesten Erkenntnissen existiert unter der Erde sogar ein weitverzweigtes Pilzgeflecht, über das Bäume und Pflanzen miteinander Nährstoffe und Informationen austauschen. Man nennt es auch Wood Wide Web.«
»Dann haben die Pflanzen also ihr eigenes Internet!«, stellte der Moderator fest. Vereinzelte Lacher kamen aus dem Publikum.
»Jedenfalls verstehe ich nicht, warum wir Pflanzen bei all dieser Komplexität, die sie in ihrem Verhalten zeigen, nicht auch ein gewisses Denkvermögen zubilligen wollen. Die Antwort ist einfach: Weil wir Menschen Sorge davor haben, einem so mächtigen Organismus wie den Pflanzen intellektuelle Fähigkeiten zuzusprechen. Es ist wie mit den Computern. Auch hier haben wir lange Zeit nicht wahrhaben wollen, dass deren künstliche Intelligenz unserer schon sehr bald überlegen sein wird. Supercomputer schlagen uns heute schon im Schach. Und es fehlt nicht mehr viel, dann werden die Maschinen, die wir selbst erschaffen haben, uns an der Spitze der Evolution ablösen.«
Der Manager des Buchshops schaute auf die Moderationskarten in seiner Hand. »Man muss allerdings ehrlich sagen, und auch das gehört zu so einem Abend, dass es eine gewaltige Gegenmeinung zu Ihren Thesen gibt, Mr Holland. Schon 2017 haben sich unter dem Vorsitz des Nobelpreisträgers und Vorsitzenden der National Academy of Sciences Edgar Mortensen führende Wissenschaftler von über dreißig Institutionen gegen eine von Ihnen angeblich vorgenommene ›Vermenschlichung der Pflanzenwelt‹ gewandt. Gerade heute erschien im Boston Globe ein Interview mit Edgar Mortensen, der darin auch auf Ihr neues Werk eingeht. Er nennt Sie in dem Interview den ›Deutschen Pflanzenbeschwörer‹. Er sagt, sorry, das sind seine Worte, Sie seien ein Populist, ein Scharlatan. Was würden Sie ihm entgegnen, Mr Holland?«
Holland begann zu schmunzeln. »Ich bin für das Interview von Mr Mortensen wirklich dankbar. Bessere PR für mein Buch konnte ich nicht haben.«
Wieder gab es Lacher im Publikum.
»Nein, im Ernst, die Aussagen Mortensens zeigen, gegen welche Widerstände wir in der jungen Disziplin der Pflanzenneurologie noch immer zu kämpfen haben. Und wie wütend die Proteste gegen unsere Thesen mittlerweile sind. Die Wahrheit ist aber: Wir sind abhängig von der Pflanzenwelt, und das macht offenbar Menschen wie Mr Mortensen und anderen Wissenschaftlern Angst. Zudem fällt es ihnen schwer, ihre alten Denkmuster zu verlassen. Meine Behauptungen in dem Buch sind allesamt wissenschaftlich belegt.«
Die Zuhörer begannen begeistert zu klatschen.
»Ich denke, ein paar Fragen können wir zulassen, oder?«
Holland bejahte und schaute neugierig ins Auditorium, wo sich mehrere Hände in die Luft reckten. Der Buchhändler deutete auf eine Frau in der allerersten Reihe, die sich erhob. Sie war Anfang zwanzig und trug ein auffälliges schwarzes Kleid mit aufgedruckten rosa Kirschblüten, was ihr eventuell die Gunst der ersten Frage verschafft hatte. Eine Helferin übergab ihr ein Mikrofon.
»Guten Tag, Mr Holland«, sagte sie mit leiser Stimme.
»Bitte das Mikro näher an den Mund«, intervenierte der Moderator. Sie tat, wie ihr geheißen. »Ich möchte gern Ihre Meinung zu der invasiven Pflanze hören, die sich derzeit überall auf der Welt ausbreitet.«
Holland sah irritiert zum Moderator, als wolle er sich versichern, dass er richtig gehört hatte. Der zuckte mit den Schultern. »Ich weiß leider nicht, was Sie meinen«, sagte Holland und kniff die Augen zusammen, um gegen das Licht des Scheinwerfers, der auf sie gerichtet war, etwas zu erkennen.
»Vielleicht eine andere Frage«, sagte der Buchhändler und ließ seinen Blick durch die Reihen wandern.
»Verzeihung!«, rief die junge Frau, die noch immer stand. »Ich habe eine weitere Frage an Mr Holland.«
An Hals und Dekolleté der Frau hatten sich hektische Flecken gebildet. »Wenn man Ihre Theorie von den Pflanzen als wahre Herrscher dieses Planeten zu Ende denkt, wäre es dann nicht besser, man würde die Menschheit ausrotten und diesen Planeten endgültig den Pflanzen überlassen?«
Ein echauffiertes Raunen ging durch die Reihen. »Ich bitte Sie!«, intervenierte der Manager des Bookstores. »Wir wollen heute Abend über die Intelligenz der Pflanzen sprechen und keine klimapolitische Diskussion eröffnen.«
Holland hob beschwichtigend die Hand. »Schon gut!«, sprach er mit ruhiger Stimme ins Mikrofon und wandte sich direkt an die Frau, die noch immer mit hochrotem Kopf in der ersten Reihe stand.
»Wenn ich mehr Rechte für Pflanzen fordere, bedeutet das nicht, dass ich gleichzeitig den Rückzug oder gar Untergang der Menschheit propagiere. Es geht gerade nicht darum, dass sich eine Spezies auf diesem Planeten durchsetzt, sondern dass wir lernen, zusammenzuleben und voneinander zu profitieren!«
Die Frau reckte erneut ihren Arm in die Höhe.
»Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort!«, sagte der Moderator mit einem symbolischen Blick auf seine Uhr. »Es ist spät, und wir sollten die Veranstaltung hier beenden. Mr Holland steht Ihnen allerdings gleich noch im Foyer für Fotos und Fragen zur Verfügung. Und ich bin sicher, er wird Ihnen auch das eine oder andere Buch signieren.«
Kaum verhallte der abschließende Applaus, entstand Unruhe, als die Zuhörer zum Ausgang drängten, um am Büchertisch die Ersten zu sein. Holland trat hinter dem Rednerpult hervor und suchte nach einem Mitarbeiter des Buchgeschäfts, der ihn durch eine Seitentür ins Foyer lotsen sollte. In diesem Augenblick trat die Frau im schwarzen Kleid aus der ersten Reihe hervor und steuerte unbeirrt auf ihn zu. Holland deutete auf den Ausgang, vor dem sich bereits eine Traube von Besuchern gebildet hatte. »Ich muss mit Ihnen reden!« Abrupt blieb er stehen und wandte sich der Frau zu, die offenbar, wie er, Deutsche war. Jemand legte eine Hand auf Hollands Arm und schob ihn weiter in Richtung Tür. Er versuchte, sich zu befreien. »Bitte!« Sie klang flehentlich. »Er will Sie töten!«, rief sie nun auf Englisch und hob die Hand, in der sie einen schwarzen Gegenstand hielt. In diesem Moment rief hinter ihm jemand: »Sie hat eine Pistole!« Instinktiv riss Holland die Arme hoch, als auf das Geräusch zweier Schüsse panische Schreie folgten. Der erwartete Schmerz blieb aus. Als er die Augen wieder öffnete, sah er die Frau auf dem Boden liegen. Um ihr Kleid bildete sich eine rasch wachsende Blutlache. Holland trat erschrocken einen Schritt zurück und sah zu seiner Rechten einen Mann, der mit einer Waffe in der Hand auf die Frau zielte und sich zu ihr hinunterbeugte.
Dann spürte er, wie ihm plötzlich schlecht wurde und seine Knie nachgaben, bevor Powers Book Store sich zu drehen begann und er in eine unwillkommene Dunkelheit abglitt.
2
Holland
»Mr Holland?«
Als sein Name gerufen wurde, kam er wieder zu sich. Er öffnete die Augen und schaute in das runde Gesicht des Managers von Powers Book Store, das keine zwei Handbreit über seinem schwebte. Er hob seinen Arm, der sich ungewöhnlich schwer anfühlte, und strich sich mit der Hand über die Stirn, die nass und kalt war. Auf dem Gesicht über ihm breitete sich ein Lächeln aus. »Sorry, ich habe Ihnen ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet.« Er spürte, wie das Blut zurück in seinen Kopf schoss, und versuchte, sich langsam aufzurichten. Er lag auf einer Ledercouch, die er bereits bei seiner Ankunft in Powers Book Store im Büro der Geschäftsleitung gesehen hatte. Sofort fiel ihm der Anblick der auf dem Boden liegenden Frau wieder ein – und die Blutlache. Der Manager drückte ihn sanft zurück auf das Kissen unter seinem Nacken. »Machen Sie langsam, Sie waren lange weggetreten.«
»Die Frau …«, stammelte er.
»Polizei und Ambulanz sind vor Ort. Alles ist unter Kontrolle. Sie sind nicht mehr in Gefahr.«
Er schloss kurz die Augen, um zu verstehen, was passiert war, sah die Frau, wie sie die Hand hob und etwas auf ihn richtete. Dann waren die beiden Schüsse gefallen.
»Bin ich verletzt?«, fragte er.
»Nur eine Beule am Hinterkopf, weil Sie hart auf dem Boden aufgeschlagen sind. Ansonsten scheinen Sie okay zu sein.«
»Die Schüsse«, brachte er hervor. Sein Mund fühlte sich so trocken an, als hätte er auf einer Scheibe Toastbrot gekaut. Langsam richtete er sich auf, was eine Welle von Schmerzen in seinem Schädel auslöste. »Es ist alles gut«, sagte der Buchhändler. »Niemand außer der Frau wurde verletzt.«
Er griff hinter sich. »Bevor ich es vergesse, hier sind Ihre Sachen! Die haben Sie bei Ihrem Sturz verloren.«
Er reichte ihm sein Buch, aus dem er gelesen hatte, einen Montblanc-Kugelschreiber, den er zum Signieren hatte nutzen wollen, und ein kleines schwarzes Büchlein. Holland nahm die Sachen und legte sie neben sich ab. Er wollte etwas sagen, aber er vergaß es sofort wieder. Sein Kopf fühlte sich an, als habe man Zement hineingegossen.
»Die Frau, ist sie tot?«, fragte er.
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und ein Mann im schwarzen Anzug trat herein, in der Hand hielt er einen Eisbeutel, den er ihm übergab. Dankbar presste Holland ihn gegen seinen Hinterkopf.
Der Buchhändler erhob sich und machte dem Mann Platz, der sich einen der Sessel nahm und ihn neben die Couch zog. Er wirkte nicht besonders groß, aber stämmig, der kurze Bürstenhaarschnitt verlieh ihm ein quadratisches Gesicht. Über seine eine Wange zog sich eine Narbe, die auf einen Unfall oder Kampferfahrung schließen ließ. Holland erinnerte sich daran, ihn mit der Waffe über der Frau am Boden gesehen zu haben.
»Mein Name ist Rick Dechambeau, vom Department of Homeland Security, kurz DHS«, stellte er sich vor. Er sprach leise, aber bestimmt.
»Sie haben auf die Frau geschossen«, brachte Holland hervor. Seine Hand wurde langsam kalt vom Eis.
»Sie wollte Sie angreifen. Können Sie sich erinnern? Sie rief, dass sie Sie töten will!«
»Sie kam auf mich zu und hat irgendetwas zu mir gesagt«, dachte er laut.
»Und was?«
»Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe es auch nicht richtig verstanden.«
»Versuchen Sie sich zu erinnern, vielleicht ist es wichtig.«
Holland schüttelte rasch mit dem Kopf, was er jedoch sofort wieder bereute.
»Hat sie auf mich geschossen?«, fragte er.
Dechambeau nickte. »Aber ich war schneller. So wie es aussieht, sind Sie vor Schreck in Ohnmacht gefallen.«
»Ist sie … tot?«, wiederholte er seine Frage.
Dechambeau nickte, jedoch ohne eine Spur des Bedauerns in seiner Miene.
»Oh, mein Gott, das ist schrecklich!«, brachte Holland hervor. »Ich verstehe nicht, warum wollte sie mich töten?«
»Das wird die Polizei ermitteln.«
»Hatte sie eine Waffe?«
»So sieht es aus.«
Holland schüttelte den Kopf, was in seinen Schläfen schmerzte. Es gab immer wieder hitzige Diskussionen bei seinen Lesungen, auch sehr emotionale. Ganz offensichtlich berührte das Thema Pflanzen die Menschen tief im Inneren. Aber dass jemand versuchen könnte, ihm wegen seiner Thesen auf der Bühne etwas anzutun, hatte er bislang für unmöglich gehalten.
»Ich denke, Sie haben Glück gehabt.«
Holland empfand das Wort »Glück« im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen irgendwie als unpassend. Für einen Moment versuchte er, seine Gedanken zu sortieren.
»Warum waren Sie überhaupt dort?«
Er hatte den Mann im Lesesaal noch nicht einmal gesehen.
Dechambeau lächelte erneut. »Ich bin im Auftrag von Homeland Security nach Portland gekommen, um mit Ihnen zu sprechen.«
Dechambeau griff neben sich und holte ein Smart Tablet hervor. Er strich über den Bildschirm und hielt es ihm entgegen.
»Fällt Ihnen hierzu irgendetwas ein?«
Das Tablet zeigte das Foto einer Pflanze in freier Natur. Holland nahm das Tablet und kniff die Augen zusammen, um es besser erkennen zu können. Er vergrößerte das Bild.
»Stängel und Wuchshöhe, auch Blattstiel und Blattspreite erinnern an Heracleum mantegazzianum, dazu passen allerdings nicht die Blüten und die Frucht. Ich bin offen gestanden gerade nicht in der Stimmung für Bilderrätsel. Was ist das?«
»Wir hatten gehofft, Sie könnten uns das sagen.«
Holland stand noch immer unter Schock. »Sie sind im Auftrag von Homeland Security zu meiner Lesung gekommen, um mir diese Pflanze zu zeigen?«
Dechambeau überging Hollands Frage, nahm sein Tablet und wischte zu einem anderen Foto. »Sagt Ihnen dann dies vielleicht etwas?«
»Sieht aus wie ein Samen der roten Bohne. Phaseolus vulgaris«, schoss es aus Holland heraus. »Aber auch nur auf den ersten Blick. Wenn man genauer hinschaut, erkennt man Unterschiede. Sorry, aber ich scheine gerade nicht in bester Verfassung zu sein.«
Er gab das Gerät zurück. Immerhin half ihm die Kühle des Eisbeutels dabei, wieder klar im Kopf zu werden. »Verzeihen Sie, aber Sie kommen zu meiner Lesung, erschießen vor meinen Augen eine Frau und zeigen mir nun Fotos von mir völlig unbekannten Pflanzen und Samen. Was geht hier vor?«
»Ich möchte Sie bitten, mich zu begleiten, Mr Holland.«
»Sie begleiten? Bin ich verhaftet?«
Dechambeau musste lächeln. »Nein, natürlich nicht. Am Flugplatz wartet eine Maschine auf uns beide. Wir fliegen nach Cottonwood, Minnesota. Dort werden wir Ihnen alles erklären.«
»Ich habe morgen und übermorgen weitere Lesungen an der Ostküste. Aber ich vermute, ich kann nicht Nein sagen, oder?«
»Wir leben in einem freien Land, Sir. Aber damit das so bleibt, gibt es unsere Behörde. Daher wäre es sehr wichtig, dass Sie mitkommen.«
»Was sagt die Polizei dazu? Ich meine, eine Frau wurde getötet.«
»Machen Sie sich darum keine Sorgen, die werden uns gehen lassen.«
Holland überlegte kurz, dann erhob er sich langsam und legte den Eisbeutel auf dem Tisch ab. Seine Beine fühlten sich wackelig an. »Es war das viele Blut«, sagte er und erntete einen verständnislosen Blick des DHS-Agenten. »Weshalb ich ohnmächtig geworden bin. Ich kann kein Blut sehen. Jedenfalls nicht so viel. Nicht mehr.«
»Ich verspreche Ihnen, in Minnesota warten keine Blutlachen auf uns.«
»Sondern?«
Dechambeau zuckte mit den Achseln. »Wenn man manchem Pessimisten glauben darf, vielleicht der Anfang vom Ende der Welt.«
3
Waverly
Waverly Park hielt dem grimmigen Blick Friedrich des Großen stand. Von seinem Ehrenplatz auf einem der Bücherregale im Forschungssaal des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz versuchte das Standbild des Preußenkönigs, ihr schon den ganzen Tag über Angst zu machen. Aber sie ließ sich nicht einschüchtern. Weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft. Dabei hatte sie allen Grund dazu: Vor ihr lag ein über zweihundert Jahre alter Foliant voller verschlüsselter Geheimtexte, im Laptop daneben wartete die Software SCANDBOX auf ihre Eingaben. Bei der Namensgebung hatten die kanadischen Entwickler ihre ganze Kreativität bewiesen. Der Name der Software SCANDBOX stand einerseits für einen virtuellen Speicher, gefüllt mit Tausenden eingescannten Dokumenten, andererseits für die Schwedenkiste, aus der die Dokumente stammten.
Bis Waverly zu dem Forschungsprojekt gestoßen war, hatte sie noch nie von der Schwedenkiste gehört. Die legendäre Geheimtruhe geisterte durch die Jahrhunderte, bis sie schließlich hier im Archiv in Berlin-Dahlem ihr vorläufiges Zuhause gefunden hatte. Anfang des 19. Jahrhunderts war sie, vollgepackt mit geheimen Akten, Briefen, Manuskripten und Mitgliederlisten eines berühmten Geheimbundes, von Sachsen nach Schweden geschafft worden, was der Kiste auch ihren Namen einbrachte. Nachdem die Schwedenkiste ein halbes Jahrhundert später aus Skandinavien nach Deutschland zurückkehrte, wurde sie bald von den Nazis beschlagnahmt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erbeutete die Rote Armee die Kiste und entführte sie nach Moskau. Erst Jahrzehnte später gelangte sie in die DDR und wurde dort mit dem Fall der Mauer von der Wissenschaft wiederentdeckt und ausgewertet.
Weil der Bauchnabel größer war als der Bauch, wie ihre koreanische Großmutter immer sagte, weil der Aufwand größer war als der Nutzen, hatte man sich mit der Software SCANDBOX zur Analyse des Inhalts der Kiste die Hilfe künstlicher Intelligenz gesichert – und seit acht Wochen auch die ihre.
Die Erforschung und Auslegung alter botanischer Berichte gehörte zu ihrem Forschungsgebiet. Sie war Archäologin mit dem Spezialgebiet Botanik, was sie zur Teildisziplin der Archäobotanik geführt hatte. Prähistorische Tier- und Pflanzenreste waren ihr Metier, sie lieferten wertvolle Erkenntnisse über Ernährung, Lebensweise und die Umwelt früherer Epochen. Und weil bei Ausgrabungen leider die besten Funde von Pflanzen- und Tierresten in den Latrinenabfällen gemacht wurden – das feuchte Milieu und das regelmäßige Kalken der Latrinen konservierte die Abfälle für Jahrtausende –, nannten die Kollegen sie, wenn man sie ärgern wollte, auch »Madame Toilette«. Nicht besonders freundlich, Respekt musste man sich erst verdienen. Dabei war dieses Forschungsprojekt ihre letzte Chance: Das Stipendium der Deutschen Forschungsgesellschaft lief bald aus. Wenn sie nicht langsam einmal spektakuläre Ergebnisse lieferte, die ihr eine Verlängerung des Stipendiums oder sogar eine Beschäftigung an einem der renommierten Institute bescherten, würde ihre Tätigkeit als Archäologin bald genauso Geschichte sein wie die Handschrift mit der Signatur »PK FM6.2 D 30 Nr. 43« vor ihr. Es war eine von vielen Handschriften in der Schwedenkiste, die sich mit Biologie und Botanik befassten. Der Text war in Zahlen codiert, wobei einzelne Ziffern für Buchstaben standen. In der Kiste hatte man auch Tafeln zum Dechiffrieren gefunden. Aber diese Mühe musste sie sich nicht machen: Die künstliche Intelligenz hinter SCANDBOX digitalisierte und archivierte nicht nur, sondern entschlüsselte auch. Und so konnte sie den Text vor sich im Laptop ohne Probleme lesen. Es handelte sich um einen Brief vom 20. Mai 1788, den der Verfasser namens Abaris geschickt hatte.
»Verehrter Meister,
bin ich nun mehr in der vorzüglichen Lage, Euch endlich mitteilen zu können, dass ich ihrer Habhaft werden konnte. Es war der Überredenskunst viel und der Drohungen wenig von Nöten.«
Sie stoppte und drehte sich zu dem Mann im Anzug am anderen Ende des Saals um. Zum ersten Mal war er ihr gestern aufgefallen, als er gemeinsam mit ihr als einer der Ersten den Saal betreten hatte. Einmal, als sie die Toilette besucht und sich dann einen Zitronentee aus dem Automaten im Foyer geholt hatte, hatte er mit ihrem Mantel in der Hand an ihrem Arbeitsplatz gestanden, und für einen Moment hatte sie geglaubt, dass er die Papiere auf ihrem Tisch betrachtete. »Er ist von der Lehne gerutscht«, hatte er stattdessen mit einem freundlichen Lächeln gesagt und ihr den Mantel in die Hand gedrückt. Gestern Abend allerdings hatte sie ihn in der Ehrbar gesehen, wo sie, wenn sie nicht gerade auf einer Ausgrabungsexpedition war, kellnerte. Er war allein, in einer Ecke des Lokals, die in den Zuständigkeitsbereich einer Kollegin fiel. Auch das konnte Zufall sein. Aber Berlin war groß. Und dass der Mann ausgerechnet in dem Lokal auftauchte, in dem sie bediente, gefiel ihr nicht. Jetzt saß er da, versunken in irgendeine Lektüre, und schien sie nicht zu beachten. Sie schüttelte sich und widmete sich wieder dem Text:
»Ein guter Mönch kennt seinen Herrn. Und wenn auch noch gefangen, in zwei Tränen Gottes, so bin ich doch frohen Mutes, dass ich bald in der Lage sein werde, sie Euch in wahrhaftiger Gestalt zu präsentieren: Die Urpflanze!«
Bei dem Wort Urpflanze begannen ihre Wangen zu glühen.
Als sie aufschaute, war der Mann verschwunden.
4
Holland
Nach einem dreistündigen Flug landeten sie auf dem Southwest Minnesota Regional Airport in Marshall.
Ein Polizeiwagen hatte sie vom Buchladen direkt in sein Hotel gebracht, damit er sein Reisegepäck holen konnte. Danach waren sie zum Flughafen gerast, wo auf dem Rollfeld bereits ein kleiner Embraer-Privatjet auf sie wartete.
Er hatte vergeblich versucht, seine Nachbarin in Deutschland zu erreichen, die sich während seiner Abwesenheit zu Hause um seinen Sohn Otto, seine beiden Katzen und die Sussex-Hühner kümmerte. Otto und er bewohnten seit einem guten Jahr ein kleines Holzhaus am Üdersee in der Schorfheide, weil sie beide nach dem Tod von Ottos Mutter die Leere des gemeinsamen Reihenhauses nicht mehr hatten ertragen können. Zudem grenzte ihr neues Zuhause direkt an seinen Wald, sodass er kürzere Wege zur Arbeit hatte und sich so besser um Otto kümmern konnte. Otto war gerade vierzehn Jahre alt geworden. Ein schwieriges Alter für sie beide. Holland wusste, dass der halbe Mann versuchte, seine Trauer vor ihm zu verbergen. Die Jugendpsychologin, die sie zuletzt aufgesucht hatten, meinte, dies sei in Ordnung. Jeder müsse seinen Weg der Trauer finden. Es war für ihn nicht einfach, die Arbeit und die Erziehung von Otto unter einen Hut zu bringen, aber sie bekamen es mittlerweile gut hin. Dabei half, dass auch Otto sich gern im Wald aufhielt. Die einzige Nachbarin, eine pensionierte ehemalige Sonderschullehrerin, kümmerte sich rührend um sie beide und auch um Otto und die Tiere, wenn er einmal wie jetzt auf Reisen war. So wie es aussah, mussten sie zu Hause nun noch eine Weile ohne ihn auskommen.
Es war mitten in der Nacht, und der Abend im Powers Book Store hatte ihn Kraft gekostet, nicht nur weil die mutmaßliche Gehirnerschütterung schmerzte. Konnte man den Augenzeugenberichten glauben, war er nur knapp dem Tod entkommen. Für ihn kein Grund zur Freude, zumal direkt vor seinen Augen eine junge Frau gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Frage nach dem Warum ließ ihm keine Ruhe, und nachdem auch Dechambeau sich nicht gesprächiger zeigte, war Holland nach dem Start schließlich eingeschlafen.
Als sie landeten, war es bereits hell, was ihn zunächst irritierte, bis er begriff, dass es eine gut zweistündige Zeitverschiebung zu Portland gab.
Dechambeau ließ ihn kurz in der Ankunftshalle warten.
Holland entdeckte eine Frau in einem grünen Kittel, die damit beschäftigt war, Blätter von einem Schwertfarn zu schneiden. Die Pflanze stand im großen Abstand mit Artgenossen vor der riesigen Scheibe, die den Wartebereich vom Flugfeld abtrennte. Die Blätter waren gelb-braun verfärbt, und die Wedel hingen noch mehr, als dies bei dieser Pflanze ohnehin der Fall war.
»Damit werden Sie keinen Erfolg haben«, sagte er zu der älteren Dame, die Gärtnerkleidung trug. Offenbar war sie hier für die Pflanzenpflege zuständig.
»Wie bitte?«, fragte sie.
»Mit dem Schneiden der Blätter zerstören Sie den Farn nur. Er steht zu nahe an der aufgeheizten Glasscheibe, wodurch die Luft austrocknet. Und er bekommt zu viel Wärme durch die Sonne, die im Spätsommer tiefer steht und den Farn förmlich verbrennt. Schwertfarne mögen es zwar feucht und hell, aber sie vertragen nur indirektes Licht.«
Die Frau hielt inne und schaute auf die Schere in ihrer Hand.
»Nehmen Sie etwas Niemöl. Das ist perfekt zur Befeuchtung der Blätter geeignet und schützt sie zudem vor Krankheiten. Und stellen Sie die Pflanzen näher zusammen. Sie werden in der Gruppe durch Transpiration ein optimales Mikroklima für sich erschaffen.«
»Wollen wir?«, fragte Dechambeau. Er leitete ihn zu einem Notausgang, der sie direkt auf das Flugfeld führte. Es war mitten ins Nirgendwo gebaut, und außer ein paar kleinen Privatflugzeugen stand auf dem Flugplatz nur noch ein schwarzer Hubschrauber, auf den Dechambeau zusteuerte.
»Wir fliegen mit dem Helikopter?«, fragte Holland.
»Die Einsatzzentrale ist gute zwanzig Meilen entfernt«, entgegnete Dechambeau. »Zudem haben wir so Gelegenheit, uns das Problem aus der Luft anzuschauen.«
»Einsatzzentrale! Jetzt hören Sie auf mit dem Versteckspiel und rücken Sie mit den Fakten raus«, sagte Holland ärgerlich und blieb wie angewurzelt stehen. »Oder ich bin weg!« Dechambeau schaute über Hollands Schulter auf das leere Rollfeld und konnte sich ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen. »Sie sind weg? Wohin denn?«
Holland blieb ernst. »Sagen Sie mir endlich, was los ist!«
»Es geht um die Pflanze, die ich Ihnen gezeigt habe. Wir haben hier im Nordosten ein gravierendes Problem mit ihr. Und so wie es aussieht, nicht nur hier.«
»Ein gravierendes Problem?«
»Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. In weniger als einer Viertelstunde sind wir dort.«
Dechambeau öffnete die Tür des Hubschraubers, begrüßte den Piloten, und Holland rutschte widerwillig auf die Rückbank. Dechambeau reichte ihm ein Headset, und der Helikopter hob ab. Sie flogen den Highway entlang über unbebautes Gelände, das aus Weiden und Ackerflächen bestand. Ein See, eine Tankstelle, ein Baseballfeld neben einer Highschool. Das war’s.
Dechambeau reckte den Kopf. »Jetzt kommt es!«, kündigte er an und gab dem Piloten vor ihm einen Klaps auf die Schulter, damit dieser tiefer ging. Der Helikopter beschrieb eine Kurve, in der Holland gegen das Fenster gepresst wurde. Er sah eine lang gestreckte Zufahrt, an deren Ende das Dach eines Hauses zu erkennen war. Dechambeau lehnte sich zu ihm hinüber und zeigte nach unten.
»Was zur Hölle ist das?«, stieß Holland aus.
»Das Problem!«, entgegnete Dechambeau.
Holland streckte sich. Ohne Zweifel war das unter ihnen einmal eine Farm gewesen. Eine Farm, die früher wie aus dem Bilderbuch oder dem Spiel »Hay Day«, einem Handyspiel, das Otto den ganzen Tag über zockte, ausgesehen haben musste. Mit der typischen Anordnung von Wohnhaus, Scheune, Ställen und Silo. Sogar die Silhouette eines Traktors konnte man von oben unter dem Urwald aus Pflanzen erahnen. Allerdings ragte nur noch ein Teil der Motorhaube heraus, denn er war wie alles andere von Pflanzen überwuchert. Es sah aus, als wäre die Farm seit einem halben Jahrhundert verlassen und als hätte die Natur sich in dieser Zeit all das zurückgeholt, was einst ihr gehörte. Zwischen den einzelnen Gebäuden war kein Boden zu sehen, so dicht war der Urwald aus Pflanzen, die bereits damit begonnen hatten, an der Fassade des Farmhauses hinaufzuklettern. Obwohl sie die Farm in gut hundert Meter Höhe überflogen, glaubte er, die Pflanze zu erkennen, die Dechambeau ihm auf dem Foto gezeigt hatte. Der Helikopter gewann wieder an Höhe, und nun sah Holland, dass die Pflanzen in langen Ausläufern auch bereits die Felder um die Farm herum besiedelten. Aus der Luft bot sich das Bild eines gigantischen Kreises aus Blättern, der an eine dicht bewachsene, grüne Insel erinnerte. Außen herum befand sich ein breiter, schwarzer Rand. Als habe man einen schwarzen Kreis um die grüne Insel gezogen.
»Was ist das Schwarze?«, fragte Holland.
»Eine Feuerschneise. Um die weitere Ausbreitung der Pflanzen zu stoppen«, entgegnete Dechambeau. Der Helikopter drehte ab, und am Rand der Schneise sah er zwei Personen in gelben Schutzanzügen mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken, die neben einem Feuerwehrwagen standen. Es waren Schutzanzüge, wie man sie aus apokalyptischen Filmen über Pandemien oder Strahlenkatastrophen kannte. Der Leiterwagen war eines von sechs Feuerwehrfahrzeugen, die um die Szenerie herum verteilt waren und jeweils im hohen Bogen eine Wasserfontäne über die Pflanzen spritzten.
Er zeigte auf die Männer in den Schutzanzügen und sah Dechambeau fragend an.
»Sie tötet«, entgegnete dieser. Holland war nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte, und deutete auf die Kopfhörer des Headsets.
»Sie tötet!«, wiederholte Dechambeau. »Die Pflanze! Sie breitet sich immer weiter aus. Und so ziemlich alles an ihr ist tödlich. Sie ist ein Killer!«
Abermals gab er dem Piloten ein Zeichen, und der Hubschrauber beschleunigte in Richtung eines silbern glänzenden Punktes am Horizont. Holland drehte sich um und sah, wie die grüne Insel hinter ihnen langsam kleiner wurde.
Jetzt war es also so weit. Er hatte gehofft, dass sie noch ein wenig mehr Zeit haben würden.
5
Ava
Sie rang nach Luft und starrte auf den Stamm der Hemlocktanne vor ihr. AN stand für ihren Namen: Ava Nahanee.
Das mittlerweile getrocknete Blut an ihrem Daumennagel zeugte davon, wie sie die Initialen vor einer gefühlten Ewigkeit mithilfe eines spitzen Steins in die Rinde geritzt hatte.
Sie war im Kreis gelaufen.
Tränen stiegen in ihr auf, aber sie war zu erschöpft zum Weinen. Auch hätte es nichts genützt, denn dieser Wald war anders als andere Wälder. Er spendete keinen Trost. Seit Stunden hatte sie das Gefühl, dass die Bäume um sie herum enger und enger zusammenrückten, um sie zu erdrücken. Kein Sonnenstrahl drang durch das dichte Dach der sich berührenden Baumkronen. Ihre Lungen brannten, die Knie schmerzten vom ständigen Hinfallen. Äste, Nadeln und Dornen hatten ihre Arme und Beine zerkratzt, hatten versucht, sie auf jedem Meter, den sie zurücklegte, um von diesem schrecklichen Ort zu fliehen, aufzuhalten. Und nun stand sie wieder hier, an ihrem heutigen Ausgangspunkt, und konnte nicht glauben, dass sie im Kreis gelaufen war. Ihr Mund war ausgetrocknet vor Durst, und das Hungergefühl in ihrem Magen war regelmäßigen Krämpfen gewichen. Sie versuchte, sich zu erinnern, in welche Richtung sie von hier gelaufen war, versuchte, sich zu orientieren, doch dieser Wald verschluckte alles, auch die Himmelsrichtungen. Sie lehnte sich gegen den Baum und rutschte hinunter auf den Waldboden, der sich kalt und nass und feindlich anfühlte. In der Luft lag der leicht ätherische Geruch von Schierling und Zedernholz, Moos und feuchter Erde. Doch dies alles zusammen duftete für sie nicht mehr wie das erste Mal, als sie diesen Wald voller Faszination betreten hatte. Heute fand sie, es stank.
Sie musste sich konzentrieren. Niemand kannte sich so gut mit der Natur, mit Wäldern, mit Bäumen aus wie ihre indigenen Vorfahren. Irgendwo, tief in ihrem Inneren, musste sie ererbte Fähigkeiten besitzen, um diesem Albtraum zu entkommen. Sie hielt den Atem an und lauschte. Da war es wieder, das feine Surren, das man für einen aufgeschreckten Bienenschwarm hätte halten können, das aber keines natürlichen Ursprungs war. Er suchte nach ihr. Sie sprang zurück auf die Füße, befragte ihren Orientierungssinn, der ihr riet, nach links zu laufen, und folgte dann ihrem Instinkt in die entgegengesetzte Richtung.
6
Holland
Der silberne Punkt am Horizont entpuppte sich als ein riesiges Gewächshaus, in dem sich die Sonnenstrahlen spiegelten. Es war das Zentrum einer beeindruckenden mobilen Kleinstadt, die offenbar erst vor Kurzem am Rande von Cottonwood errichtet worden war. Aus der Luft hatte Holland zudem eine Reihe von Straßensperren gesehen, die die Gegend zum Sperrgebiet machten. Der Hubschrauber landete auf den Stoppeln eines abgemähten Weizenfeldes, wo sie von zwei Männern in Empfang genommen wurden. Dechambeau stellte ihn vor, was unnötig war, da er offenbar bereits erwartet wurde. Jedenfalls dankte der ältere der beiden, ein hagerer Mann mit grauen Schläfen und der Ausstrahlung eines Footballtrainers, ihm dafür, dass er den weiten Weg von Portland in Kauf genommen hatte. »Und das nach all dem, was in der Buchhandlung geschehen ist«, ergänzte der Mann, bevor er sich ihm als Frank Smith, Direktor von Homeland Security, vorstellte.
»Gut, dass unser Mann vor Ort war und die Attentäterin stoppen konnte!« Smith legte Dechambeau seine Hand auf die muskulöse Schulter und drückte einmal anerkennend zu.
»Allerdings!«, bemerkte Holland, als ein Golfcart vorfuhr und die kleine Gruppe einsammelte, wobei Dechambeau zurückblieb.
»Ich weiß nicht, was Rick Ihnen bereits erzählt hat«, sagte Smith, während sie zielsicher auf den Mittelpunkt der Ansammlung von Zelten, Vans und Wohnmobilen zuhielten. Auf dem Gelände herrschte aufgeregte Betriebsamkeit. Frauen und Männer in Businesskleidung mischten sich mit anderen in Arbeitskleidung. Einige trugen auch den typischen grünen Dress von Gärtnern.
»Er hat mir gar nichts erzählt«, entgegnete Holland. »Wir sind auf dem Weg hierher allerdings über eine Farm geflogen, die als solche kaum mehr zu erkennen war, weil sie vollständig von Pflanzen überwuchert war. Und er sagte etwas von einem Problem. Ich denke, es geht um die Pflanzen?«
Smith legte die Stirn in Falten. Vielleicht hatte Dechambeau damit schon mehr gesagt, als er befugt gewesen war. Das störte Holland aber nicht. Aus seiner Sicht war es aufgrund der dünnen Faktenlage ein Wunder, dass er sich überhaupt bereit erklärt hatte, mit herzukommen. Als deutscher Staatsangehöriger und Autor auf Lesereise in den USA fühlte er sich der amerikanischen Homeland Security zu nichts verpflichtet. Wenn er ehrlich war, hatte er Dechambeau weniger aus Pflichtgefühl als aus Neugierde begleitet, vielleicht ein wenig aus Dankbarkeit, weil dieser ihm augenscheinlich das Leben gerettet hatte. Es waren aber vor allem die Fotos gewesen, die Dechambeau ihm in Portland gezeigt hatte. Er war nicht nur »The German Ranger«, wie sein Verlag ihn hier in den USA werbewirksam vermarktete, also nicht nur Förster oder, wie man es im Amtsdeutsch nannte, Forstrevierleiter, sondern hatte neben dem Studium der Forstwissenschaften an der Universität in Wien auch Botanik studiert. Als Botaniker wusste er Pflanzen einzuordnen, kannte sämtliche Bestimmungsschlüssel. Aber die Pflanze, die ihm Dechambeau in Portland auf dem Foto gezeigt hatte, ließ sich nicht bestimmen. Sie wirkte so, als habe man sie aus mehreren Gewächsen verschiedener Familien zusammengestellt. Und dann der Samen, den nur Laien für eine Bohne halten konnten. Auch er war, falls nicht das Ergebnis von Photoshop, einzigartig.
»Da wären wir«, sagte Smith, als sie vor dem riesigen Zelt hielten. Das Ganze erinnerte Holland an ein Lager römischer Legionen, kurz vor Beginn der entscheidenden Schlacht. Dazu passten allerdings nicht die vielen, teilweise armdicken Kabelstränge, die überall über dem Boden verliefen und bei denen man aufpassen musste, dass man nicht darüber stolperte.
Sie betraten das Zelt. Drinnen bekam er die Erklärung für die vielen Kabel draußen: Eine riesige Wand aus Monitoren erhob sich am hinteren Ende des Innenraumes, davor sah er die Rücken von zwei Leuten, die die Bildschirme beobachteten. Die Monitore zeigten Bilder von der Farm, die sie überflogen hatten, aber auch Arbeiter, die Bäume fällten, auf einem der Bildschirme brannte ein Feuer.
»Kommen Sie hier herüber, Mr Holland«, sagte Smith und deutete auf einen langen Tisch, der als Konferenztisch diente und an dem bereits mehrere Leute saßen, die Holland erst jetzt bemerkte.
»Das ist Marcus Holland, ›The German Ranger‹«, stellte Smith ihn vor, und wieder klang es so, als wüssten bereits alle Anwesenden Bescheid, wer er war und warum er hier war.
Smith zeigte auf eine Frau, die ihre rötlichen Haare streng nach hinten gebunden hatte und Holland mit einem kaum merklichen Nicken begrüßte. »Mrs French vom US-Landwirtschaftsministerium USDA.« Neben ihr saß Dechambeau, wie auch immer er es geschafft hatte, vor ihnen hier zu sein. »Rick kennen Sie ja bereits. Er ist unser Mann für Bioterrorismus beim DHS.«
Bei dem Wort Bioterrorismus schwante Holland nichts Gutes.
»Daneben haben wir Miss Meyers, die eine Professur an der University of California innehat und das DHS in Washington als Biologin berät. Also eine Kollegin von Ihnen. Sie hat uns auch auf die Idee gebracht, Sie dazuzuholen.« Greta Meyers erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich bin froh, dass Sie da sind, Mr Holland!« Sie war groß gewachsen und nicht zu schlank, was ihr ein sehr weibliches Aussehen verlieh. Ihr Blick war offen, ihr Händedruck sanft, aber bestimmt. »Kennen wir uns?«, fragte er. Er spürte, wie er verlegen wurde. Nicht weil Greta Meyers attraktiv war, sondern weil die Kollegin ihn offensichtlich wegen seiner Expertise empfohlen hatte, er hingegen weder ihren Namen noch ihr Gesicht einordnen konnte. Seit einigen Jahren war er auf vielen Kongressen zu Gast, und es passierte ihm immer wieder, dass Kollegen aus dem Bereich der Biologie oder Botanik ihn mit Namen ansprachen, ohne dass er selbst einen Namen zu dem Gesicht hatte. Das Schicksal vieler Redner oder Medienleute, die regelmäßig vor einer anonymen Masse von Zuhörern auftraten.
»Wir haben uns bislang noch nicht persönlich kennengelernt. Aber ich habe Ihre Aufsätze im International Journal of BotanyStudies gelesen und zuletzt auch Ihr Buch! Großartig!«
»Herzlichen Dank«, sagte er und rang sich ein Lächeln ab.
»Ich habe gehört, was in Portland geschehen ist, und es tut mir schrecklich leid«, fügte sie hinzu. »Das muss ein großer Schreck für Sie gewesen sein. Leider gibt es auch hier bei uns immer wieder ein paar Verrückte.« Das Bild der jungen Frau kam ihm vor Augen. Sie hatte eher verängstigt als verrückt gewirkt.
»Und hier haben wir Mr Pierce vom US-Grenzschutz und Mrs McSally vom U.S. Postal Service«, unterbrach Smith ihre Konversation. Der Herr mit dem schütteren weißen Haar, der Ähnlichkeit mit dem US-Präsidenten hatte, und die Dame, die nur wenig jünger schien, bedachten ihn ebenfalls nur mit einem kaum merklichen Nicken. Holland hatte keine Ahnung, wie der US-Grenzschutz und ein Vertreter der amerikanischen Post in diese Runde passten. Vermutlich würde er es gleich erfahren. Bioterrorismus hallte es in seinem Kopf wider.
»Am besten bringen wir Sie kurz auf den Stand, Mr Holland, dann müssen wir gemeinsam Entscheidungen treffen.«
Smith deutete auf einen freien Stuhl inmitten der Runde, auf dem Holland Platz nahm.
Von hinten trat ein Mitarbeiter an Smith heran und reichte ihm ein Blatt Papier. Smith überflog es, zog die Augenbrauen sorgenvoll zusammen und legte es dann zusammengefaltet in ein dickes Notizbuch mit ledernem Einband auf dem Tisch vor ihm. »Vielleicht beginnen Sie, Mrs McSally?«, erteilte Smith der Dame von der US-Post überraschenderweise als Erstes das Wort.
»Gern!« Sie räusperte sich. »Gut drei Monate ist es her, dass Päckchen wie dieses zum ersten Mal in den USA auftauchten.« Sie griff zur Seite und schob einen großen Plastikbeutel über den Tisch zu Holland. Er schien an allen Seiten zugeschweißt. Darin befand sich ein deutlich kleinerer, grauer Plastikbeutel mit Adressaufkleber. Eine Adresse in Georgia.
»Dies ist ein Päckchen, das wir in Zusammenarbeit mit dem US-Grenzschutz vor drei Tagen abgefangen haben, das also niemals zugestellt wurde. Andere wurden leider ausgeliefert, wie viele, wissen wir nicht. Sie enthalten keinen Absender und kein Anschreiben.«
»In jedem der Päckchen befinden sich nur zwei Tütchen wie diese«, mischte sich der Mann vom US-Grenzschutz ein und schob nun auch einen vakuumierten Plastikbeutel zu Holland herüber. Darin waren, ebenfalls luftdicht eingeschweißt, zwei durchsichtige Tütchen, in denen Holland die roten Samen von Dechambeaus Foto wiedererkannte. »Darf ich?«, fragte er, bevor er den Beutel nahm und die Samen gegen das Licht hielt. Er betastete sie. Sie waren hart wie Stein. Durch die Schichten aus Plastik fuhr er mit dem Nagel seines Zeigefingers über die schuppige Oberfläche. Einer der Samen war aufgeschnitten und gab den Blick auf sein Inneres im Querschnitt frei. Normalerweise konnte man anhand eines Samens Pflanzenfamilie und oft sogar die genaue Gattung und Art bestimmen. Ging er im Geiste die verschiedenen Bestimmungsschlüssel durch, landete er bei diesen Exemplaren in einer Sackgasse. Die Form erinnerte an die Klausen von Lippenblütlern. Die schuppenartige Oberfläche mit viel Fantasie an die regelmäßigen Einsenkungen von Samen der Nachtschattengewächse. Die knallrote Farbe wiederum war äußerst ungewöhnlich. Er hätte ein Mikroskop gebraucht, um die Samen genauer zu untersuchen.
»Keine uns bekannten Samen«, kommentierte seine Kollegin Greta Meyers von der Seite, als habe sie seine Gedanken erraten. »Wir haben sie im Labor untersucht und so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich stehe im Austausch mit Kollegen in Europa und Asien, und dort herrscht dieselbe Ratlosigkeit.« Holland verstand dies nur allzu gut.
»Insgesamt sind uns in den USA bis heute 287 Päckchen mit solchen Samen bekannt geworden«, erhob erstmals die Frau vom USDA, dem US-Landwirtschaftsministerium, die Stimme. »Wir schätzen aber, die Dunkelziffer ist viel größer, da natürlich nur die wenigsten Empfänger den Erhalt einer solchen anonymen Sendung melden.«
Holland ließ seinen Blick durch die Runde schweifen. Aufgrund der bisherigen Informationen fügte sich in seinem Kopf langsam ein Puzzle zusammen, das ihm überhaupt nicht gefiel.
»Wir haben die Samen auf Krankheiten untersucht, wie etwa Pospiviroid, auch auf Schädlinge, wie Samenkäfer oder Wespenlarven. Das war alles unauffällig, außer einigen Keimen, die uns bislang unbekannt waren«, fuhr die Vertreterin des USDA fort. »Aber wir haben die Samen auch in einem DNA-Labor untersuchen lassen, um herauszufinden, ob sie Pathogene enthalten, die potenziell eine Bedrohung für unsere US-Pflanzen darstellen.« Sie senkte die Stimme. »Und leider war das Ergebnis sehr beunruhigend.«
7
Die Schaufel des Caterpillar grub sich in den Boden und beförderte eine neue Ladung des Erdreichs nach oben. »Und siehst du schon etwas?«, rief der Arbeiter, der den Minibagger bediente. Sein massiger Körper war viel zu groß für den schmalen Sitz, über dem orangefarbenen T-Shirt trug er eine neongelbe Weste.
Sein Kollege stand tief gebeugt über dem Loch und nutzte die Pause, um mit der Schaufel nachzuarbeiten. »Was ist das für ein weißes Zeug in der Erde? Das ist widerlich!« Er stocherte im Aushub. Einer der langen weißen Fäden blieb an seiner Schaufel hängen, und er zog ihn in die Länge.
»Sieht aus wie ein … Spinnennetz!«
»Oder dieses Zeug, womit man Halloween dekoriert!«
Ein weiteres Mal fuhr der Baggerlöffel hinab und hob gute fünfzig Liter Boden heraus. »Stopp!«, rief der Kollege an der Grube. Auf seiner Weste prangte der Schriftzug von GRAND TELECOMMUNICATIONS, der Firma, die für den Landing Point hier in der Wall Township verantwortlich war. Nicht weniger als drei der großen Unterseekabel, die Europa und die USA miteinander verbinden, kamen hier, in der Kleinstadt in New Jersey, an. Seit gestern Abend machte TA-2, welches Internetdaten aus Großbritannien an die US-Ostküste schickte, Probleme, und auch die Durchmessung von Apollo, der Glasfaserstrecke, die aus Marseille anlandete, hatte Auffälligkeiten ergeben. Also musste nachgeschaut werden. Der Arbeiter lehnte die Schaufel an seinen Bauch und wischte sich mit einem Handtuch, das er über die Schulter trug, den Schweiß und Dreck aus dem Gesicht. Die Menschen glaubten immer, das Internet käme aus den Wolken oder der Luft zu ihnen. Dabei gab es ein ganz reales irdisches Netz: Über 1,2 Millionen Kilometer Glasfaserstrecke verliefen allein unter den Weltmeeren, um Datenpakete durch Kabel zu schicken. Wall Township war einer der großen Knotenpunkte der USA und verband das amerikanische Festland nicht nur mit Europa, sondern auch mit Brasilien. Wieder beugte er sich vor und starrte in das Loch. Die ersten Stränge der Glasfaserkabel waren in Sicht gekommen.
»Holy Shit, was ist das denn?«, rief er aus.
Sein Kollege mühte sich vom Sitz des Baggers, zog die Hose hoch und kam zu ihm. Gemeinsam starrten sie auf die gartenschlauchdicken Glasfaserkabel in der Erdwanne, um die sich jeweils ein dichtes Netz weißer Fäden geflochten hatte.
»Ich denke, wir müssen mal telefonieren!«
8
Holland
»Sie sagten, Sie sind mit Rick bereits über die Farm der Walters geflogen. Von dort kam die allererste Meldung. Ein Immobilienmakler wollte die Farm besuchen, um ihren Wert zu schätzen. Sie sollte im Auftrag des Bruders der vor Kurzem verstorbenen Besitzerin verkauft werden. Als der Makler dort ankam, hatte er Probleme, die Farm überhaupt zu finden, da alles völlig überwuchert war. Er rief den Bruder an, der sofort hinfuhr. Und als sie gemeinsam versuchten, den Eingang zum Haus mit einer Sense, die der Bruder auf dem Wagen hatte, frei zu schlagen, verätzte der Pflanzensaft das Gesicht des Maklers, er liegt noch heute in einer Spezialklinik in Minneapolis und wird vermutlich auf einer Seite das Augenlicht verlieren. Den Bruder erwischte es weniger schlimm, er bekam ein paar Dornenstiche ab, aber auch er musste zur Behandlung ins Hospital. Das Krankenhaus meldete den Vorfall der Polizei, die Polizei dem Ministerium für Landwirtschaft von Minnesota und dieses wiederum dem Landwirtschaftsministerium. Die vom USDA schickten schließlich jemanden vorbei, um sich die Situation vor Ort anzuschauen, und der gute Mann erkannte, dass hier etwas nicht stimmte. Zum Glück zählte jemand im Ministerium eins und eins zusammen und benachrichtigte uns bei Homeland Security. Und nun sitzen wir hier, statt mit unseren Enkeln zum Baseballspiel zu gehen.« Smith schenkte sich aus einer Karaffe Wasser in ein Glas, das er in einem Zug austrank. Er hielt Holland ein Glas entgegen, der dankend ablehnte.
»Dem Bruder fiel jedenfalls ein, dass seine Schwester vor einigen Monaten bei einem Besuch in Marshall erzählt hatte, ein Päckchen mit unbekannten Samen ohne Absender und ohne Anschreiben erhalten und die Samen im Gemüsebeet hinter dem Haus eingepflanzt zu haben. Sie erzählte es, weil sie solche Samen noch niemals zuvor gesehen hatte«, fuhr er fort. »Zu diesem Zeitpunkt mehrten sich auch beim USDA bereits die Berichte von lokalen Landwirtschaftsministerien aus zahlreichen Bundesstaaten, bei denen sich besorgte Bürger wegen des Erhalts ebensolcher Päckchen aus Übersee gemeldet hatten.« Wieder stockte Smith. »Die Walters-Farm ist also leider nicht der einzige Hotspot. Wir haben mittlerweile Berichte von«, er schlug sein Notizbuch auf und schaute hinein, »dreiundvierzig Orten, an denen es Probleme mit diesen Pflanzen gibt. Bis heute aber nirgends in solch einer Dimension wie hier, auf der Walters-Farm in Cottonwood. Die tote Besitzerin Anette Walters scheint eine der Ersten gewesen zu sein, die Samen zugesandt bekam – und sie einpflanzte. Und der Boden hier ist sehr fruchtbar, zudem haben wir auf der Farm Guanodünger gefunden, der das schnelle Wachstum weiter gefördert haben kann. Deshalb sind wir also alle hier. Wir hätten aber genauso gut irgendwo in Georgia oder Idaho oder in Washington sitzen können.«
»Und es ist unklar, um was für eine Pflanze es sich handelt?«, bemerkte Holland. Smith nickte und gab die Frage weiter an Meyers. »Es scheint so, als wenn niemand zuvor eine solche Pflanze gesehen hat«, bestätigte sie. »Wir haben sie natürlich eingehend untersucht und … wie soll ich sagen? …« Greta Meyers suchte nach Worten. »Sie ist gefährlich für die Gesundheit von Mensch und Tier. Nahezu alle Teile, außer den Früchten, sind giftig, und zwar offenbar nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, selbst für Vögel. Die Früchte sind so extrem glucosehaltig, dass sie für Tiere auf Dauer ebenfalls gesundheitsschädlich sind. Zudem ist der Saft der Pflanze ätzend. Er enthält nicht nur die vom Riesenbärenklau oder Schierlingskraut bekannten fototoxischen Furocumarine, die in Verbindung mit Sonnenlicht zu Verbrennungen auf der Haut führen, sondern tatsächlich Chlorwasserstoff, der in Oxonium- und Chloridionen protolysiert ist.«
»Salzsäure?«, fragte Holland.