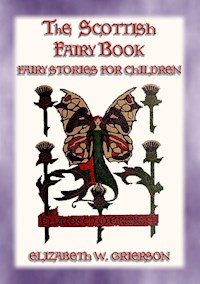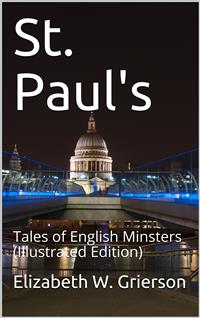Das schottische Märchenbuch
Elizabeth W. Grierson
Copyright © 2025 Michael Pick
All rights reservedThe characters and events portrayed in this book are fictitious. Any similarity to real persons, living or dead, is coincidental and not intended by the author.No part of this book may be reproduced, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without express written permission of the publisher.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898
[email protected]Das schottische Märchenbuch
ELIZABETH W. GRIERSON
Neu aus dem Englischen von M. Pick
Vorwort
Es gibt, grob gesagt, zwei verschiedene Arten schottischer Märchen.
Es gibt das, was man „keltische Geschichten“ nennen könnte, die jahrhundertelang mündlich von professionellen Geschichtenerzählern weitergegeben wurden, die von Clanchan zu Clanchan in den „Highlands und Inseln“ zogen und sich für die Nacht eine Unterkunft verdienten, indem sie für Unterhaltung sorgten, und die jetzt von Campbell of Isla und anderen für uns gesammelt und klassifiziert wurden.
Diese Geschichten, die auch im Norden Irlands verbreitet sind, sind wild und fantastisch und sehr oft etwas eintönig, und ihre Themen sind seltsam ähnlich. Sie erzählen fast immer von einem Helden oder einer Heldin, die sich auf eine gefährliche Suche begeben und denen Riesen begegnen, im Allgemeinen drei an der Zahl, die einer nach dem anderen erscheinen; mit denen sie seltsame Dialoge führen und die sie schließlich töten. Die meisten von ihnen sind ziemlich lang, und obwohl sie ihre eigene besondere Faszination haben, unterscheiden sie sich deutlich von den gewöhnlichen Märchen.
Diese letzteren haben in Schottland ebenfalls ihren eigenen Charakter, denn es gibt kein Land, in dem bis vor relativ kurzer Zeit so fest an die Existenz von Geistern und Kobolden geglaubt wurde.
Als Beweis dafür können wir uns Hoggs Erzählung „Der Wollsammler“ ansehen und erkennen, wie der Landsmann Barnaby den Glauben seiner Zeit zum Ausdruck bringt. „Ihr müsst aufpassen, wie ihr die Existenz von Feen, Kobolden und Erscheinungen bestreiten wollt! Ihr könnt genauso gut das Evangelium des Heiligen Matthäus bestreiten.“
Vielleicht war es das öde und strenge Klima in ihren Ländern und die Strenge ihrer religiösen Überzeugungen, die unsere schottischen Vorfahren dazu brachten, die Geister, an die sie so fest glaubten, größtenteils als boshaft und heimtückisch anzusehen.
Ihre Bogies, ihre Hexen, ihre Kelpies, ja sogar ihre Feenkönigin selbst, standen angeblich im Bunde mit dem Teufel und waren, wie Thomas von Ercildoune beinahe zu seinem Schaden herausfand, gezwungen, alle sieben Jahre eine „Sühnestrafe für die Hölle“ zu zahlen. Es war also nicht verwunderlich, dass diese unheimlichen Wesen gefürchtet wurden.
Doch neben dieser dunklen und düsteren Ansicht finden wir auch Anklänge von Verspieltheit und Heiterkeit. Die Feenkönigin stand vielleicht im Bunde mit Satan, doch ihre Untertanen waren nicht alle an dasselbe Gesetz gebunden, und es werden viele bezaubernde Geschichten über die „Sith“ oder Schweigsamen erzählt, von denen man immer mit Respekt sprach, falls sie in Hörweite waren. Sie errichteten ihre Behausungen unter einem felsigen Hügel und kamen um Mitternacht heraus, um auf dem taufeuchten Rasen zu tanzen.
Ähnlich sind die Geschichten über eine geheimnisvolle Region unter dem Meer, „weit unter der Wohnstätte der Fische“, wo eine seltsame Rasse von Wesen lebte, die in ihrem eigenen Land den Menschen sehr ähnelten und von so überragender Schönheit waren, dass sie die Herzen aller bezauberten, die sie sahen. Man sprach von ihnen als Meerjungfrauen und Meermänner, und da ihre Lungen nicht zum Atmen unter Wasser geeignet waren, besaßen sie die außergewöhnliche Fähigkeit, in die Haut von Fischen oder Meerestieren einzudringen und auf diese Weise von ihrer Wohnstätte in unsere Oberwelt zu gelangen, wo sie mit sterblichen Menschen Zwiesprache hielten und nicht selten versuchten, sie ins Verderben zu locken.
In der Volksmundssprache werden Meermenschen immer mit Fischschwänzen dargestellt; in der schottischen Folklore kommen sie ebenso häufig in Form von Robben vor.
Dann stoßen wir häufig auf den Brownie, jenes seltsame, freundliche, liebenswerte Geschöpf mit seinem zottigen, ungepflegten Aussehen, halb Mensch, halb Tier, von dem man sagte, er sei der auserwählte Helfer des Menschen bei der Plackerei, die die Sünde mit sich bringt, und dem deshalb verboten war, Lohn zu erhalten. Er arbeitete immer dann, wenn niemand zusah, und verschwand, wenn man ihn bemerkte.
Es gibt auch, wie in allen anderen Ländern, Tiergeschichten, in denen die Tiere mit der Fähigkeit der Sprache ausgestattet sind; und unheimliche Zaubergeschichten; und nicht zuletzt gibt es die legendären Geschichten, viele davon halb real, halb mythisch, die man auf den Seiten von Hogg und Leyden und vor allem in Sir Walter Scotts „Border Minstrelsy“ findet.
Bei der Vorbereitung dieses Buches habe ich versucht, eine repräsentative Sammlung aus diesen verschiedenen Klassen schottischer Folklore zusammenzustellen, wobei ich, wenn möglich, die am wenigsten bekannten Geschichten herausgegriffen habe, in der Hoffnung, dass zumindest einige davon für die Kinder dieser Generation neu sein könnten.
Es könnte einige dieser Kinder interessieren, dass James IV., als er ein kleiner Junge war, vor fast vierhundert Jahren, auf dem Schoß seines Lehrers Sir David Lindsay saß und einigen der gleichen Geschichten lauschte, die hier niedergeschrieben sind: der Geschichte von Thomas dem Reimer, dem Red-Etin und dem schwarzen Bullen von Norroway.
Obwohl ich die Geschichte jedes Mal in meinen eigenen Worten erzählt habe, verdanke ich die Originale Campbells „Popular Tales of the Western Highlands“, Leydens Poems, Hoggs Poems, Scotts „Border Minstrelsy“, Chambers‘ „Popular Rhymes of Scotland“, „The Folklore Journal“ usw.
Elizabeth W. Grierson
Whitchesters, Hawick, N.B., 12. April 1910.
Thomas the Rhymer
Unter allen jungen Galanten im Schottland des 13. Jahrhunderts gab es keinen, der liebenswürdiger und weltmännischer war als Thomas Learmont, Laird von Schloss Ercildoune in Berwickshire.
Er liebte Bücher, Poesie und Musik, was in jenen Tagen ein ungewöhnlicher Geschmack war; und vor allem liebte er es, die Natur zu studieren und die Gewohnheiten der Tiere und Vögel zu beobachten, die in den Feldern und Wäldern rund um sein Haus lebten.
Nun geschah es, dass Thomas an einem sonnigen Maimorgen seinen Turm von Ercildoune verließ und in die Wälder rund um den Huntly Burn wanderte, einen kleinen Bach, der von den Hängen der Eildon Hills herunterrauschte. Es war ein herrlicher Morgen – frisch, hell und warm, und alles war so schön, dass es aussah wie das Paradies.
Die zarten Blätter brachen aus ihren Hüllen und bedeckten alle Bäume mit einem frischen, weichen Mantel aus Grün; und zwischen dem Moosteppich unter den Füßen des jungen Mannes wandten gelbe Primeln und sternenklare Anemonen ihre Gesichter dem Morgenhimmel zu.
Die kleinen Vögel sangen, als ob ihnen die Kehlen platzen würden, und Hunderte von Insekten flogen im Sonnenschein hin und her; während unten am Bachufer die Wasserratten mit den leuchtenden Augen ihre Nasen aus ihren Löchern steckten, als wüssten sie, dass der Sommer gekommen war, und wollten an allem, was geschah, teilhaben.
Thomas war von all dem so glücklich, dass er sich an die Wurzel eines Baumes warf, um die Lebewesen um ihn herum zu beobachten.
Als er dort lag, hörte er das Trampeln der Hufe eines Pferdes, das sich seinen Weg durch die Büsche bahnte; und als er aufblickte, sah er die schönste Dame, die er je gesehen hatte, auf einem grauen Zelter auf ihn zureiten.
Sie trug ein Jagdkleid aus glänzender Seide in der Farbe des frischen Frühlingsgrases; und von ihren Schultern hing ein Samtmantel, der genau zum Reitrock passte. Ihr gelbes Haar, das wie wallendes Gold aussah, hing locker um ihre Schultern, und auf ihrem Kopf funkelte ein Diadem aus Edelsteinen, das wie Feuer im Sonnenlicht blitzte.
Ihr Sattel war aus reinem Elfenbein und ihre Satteldecke aus blutrotem Satin, während ihre Sattelgurte aus kordelter Seide und ihre Steigbügel aus geschliffenem Kristall waren. Die Zügel ihres Pferdes waren aus getriebenem Gold und alle mit kleinen silbernen Glöckchen behangen, sodass sie beim Ritt Geräusche wie Feenmusik machte.
Offenbar war sie auf die Jagd aus, denn sie trug ein Jagdhorn und ein Bündel Pfeile; und sie führte sieben Windhunde an der Leine, während ebenso viele Spürhunde frei neben ihrem Pferd liefen.
Während sie das Tal hinunterritt, summte sie ein Stück aus einem alten schottischen Lied; und sie hatte eine so königliche Haltung und ihr Kleid war so prächtig, dass Thomas am liebsten am Wegesrand niedergekniet und sie angebetet hätte, denn er dachte, es müsse die Heilige Jungfrau selbst sein.
Aber als die Reiterin zu ihm kam und seine Gedanken verstand, schüttelte sie traurig den Kopf.
„Ich bin nicht die Heilige Frau, wie du denkst“, sagte sie. „Die Menschen nennen mich Königin, aber sie kommt aus einem ganz anderen Land; denn ich bin die Königin des Märchenlandes und nicht die Königin des Himmels.“
Und es schien wirklich so, als ob das, was sie sagte, wahr wäre; denn von diesem Moment an war es, als ob ein Zauber über Thomas gelegt worden wäre, der ihn Klugheit, Vorsicht und den gesunden Menschenverstand selbst vergessen ließ.
Denn er wusste, dass es für Sterbliche gefährlich war, sich mit Feen einzulassen, und doch war er von der Schönheit der Dame so hingerissen, dass er sie anflehte, ihm einen Kuss zu geben. Das war genau, was sie wollte, denn sie wusste, dass sie ihn in ihrer Macht hätte, wenn sie ihn nur einmal küsste.
Und zum Entsetzen des jungen Mannes erlebte sie, kaum dass sich ihre Lippen berührt hatten, eine furchtbare Veränderung. Denn ihr wunderschöner Mantel und ihr Reitrock aus Seide schienen zu verblassen und sie blieb in ein langes graues Gewand gehüllt zurück, das genau die Farbe von Asche hatte. Auch ihre Schönheit schien zu verblassen und sie wurde alt und blass; und, was das Schlimmste war, die Hälfte ihres üppigen gelben Haares wurde vor seinen Augen grau. Sie sah das Erstaunen und die Angst des armen Mannes und brach in spöttisches Lachen aus.
„Ich bin jetzt nicht mehr so schön anzusehen wie am Anfang“, sagte sie, „aber das ist nicht so wichtig, denn du hast dich verkauft, Thomas, um sieben lange Jahre lang mein Diener zu sein. Denn wer die Feenkönigin küsst, muss mit ihr ins Feenland gehen und ihr dort dienen, bis diese Zeit vorbei ist.“
Als er diese Worte hörte, fiel der arme Thomas auf die Knie und flehte um Gnade. Aber Gnade konnte er nicht erlangen. Die Elfenkönigin lachte ihm nur ins Gesicht und brachte ihren Apfelschimmel-Zelter dicht an ihn heran.
„Nein, nein“, sagte sie als Antwort auf seine Bitten. „Du hast um den Kuss gebeten, und jetzt musst du den Preis dafür zahlen. Also trödel nicht länger, sondern steig hinter mich, denn es ist höchste Zeit, dass ich weg bin.“
So stieg Thomas mit vielen Seufzern und Ächzen des Schreckens hinter sie; und sobald er das getan hatte, schüttelte sie die Zügel, und das graue Ross galoppierte davon.
Immer weiter ging es, schneller als der Wind, bis sie das Land der Lebenden hinter sich ließen und an den Rand einer großen Wüste kamen, die sich trocken, kahl und öde bis zum Rand des fernen Horizonts vor ihnen erstreckte.
Zumindest schien es den müden Augen von Thomas von Ercildoune so, und er fragte sich, ob er und sein seltsamer Begleiter diese Wüste durchqueren mussten[5] und wenn ja, ob es irgendeine Chance gab, die andere Seite lebend zu erreichen.
Doch die Feenkönigin zog plötzlich die Zügel an, und der graue Zelter stoppte in seinem wilden Lauf.
„Jetzt musst du zur Erde hinabsteigen, Thomas“, sagte die Dame und blickte über ihre Schulter auf ihre unglückliche Gefangene, „und dich niederlassen und deinen Kopf auf mein Knie legen, und ich werde dir verborgene Dinge zeigen, die für sterbliche Augen unsichtbar sind.“
Also stieg Thomas ab, setzte sich hin und legte seinen Kopf auf das Knie der Feenkönigin. Und siehe, als er noch einmal über die Wüste blickte, schien alles anders. Denn er sah jetzt drei Straßen, die durch sie führten, die ihm vorher nicht aufgefallen waren, und jede dieser drei Straßen war anders.
Eine von ihnen war breit und eben und eben und verlief geradeaus über den Sand, so dass niemand, der auf ihr reiste, den Weg verlieren konnte.
Und die zweite Straße war so anders als die erste, wie es nur möglich war. Sie war schmal und kurvenreich und lang. Auf der einen Seite war eine Dornhecke und auf der anderen eine Dornenhecke. Und diese Hecken wuchsen so hoch und ihre Zweige waren so wild und verworren, dass diejenigen, die auf dieser Straße reisten, Schwierigkeiten hatten, ihre Reise überhaupt fortzusetzen.
Und die dritte Straße war anders als alle anderen. Es war eine schöne, schöne Straße, die sich zwischen Adlerfarn, Heidekraut und goldgelbem Ginster einen Hügel hinaufschlängelte, und es sah aus, als ob es eine angenehme Reise wäre, diesen Weg zu nehmen.
„Nun“, sagte die Feenkönigin, „wenn du willst, werde ich dir sagen, wohin diese drei Straßen führen. Die erste Straße ist, wie du siehst, breit und eben und bequem, und viele wählen sie als Reiseweg. Aber obwohl es eine gute Straße ist, führt sie zu einem bösen Ende, und die Leute, die sie wählen, bereuen ihre Wahl für immer.“
„Und was die schmale Straße betrifft, die ganz von Dornen und Disteln versperrt und versperrt ist, so gibt es nur wenige, die sich die Mühe machen zu fragen, wohin sie führt. Aber wenn sie fragten, würden vielleicht mehr von ihnen dazu bewegt, sich auf sie zu begeben. Denn dies ist die Straße der Rechtschaffenheit; und obwohl es hart und mühsam ist, endet es doch in einer glorreichen Stadt, die die Stadt des Großen Königs genannt wird.“
„Und die dritte Straße – die schöne Straße – die zwischen den Farnen den Abhang hinaufführt und kein Sterblicher weiß wohin, aber ich weiß, wohin sie führt, Thomas – denn sie führt ins schöne Elfenland; und diese Straße nehmen wir.“
„Und merk dir das, Thomas, wenn du jemals hoffst, deinen eigenen Turm von Ercildoune wiederzusehen, dann pass auf deine Zunge auf, wenn wir das Ende unserer Reise erreichen, und sprich kein einziges Wort zu irgendjemandem außer mir – denn der Sterbliche, der im Feenland vorschnell seine Lippen öffnet, muss für immer dort bleiben.“
Dann bat sie ihn, wieder auf ihren Zelter zu steigen, und sie ritten weiter. Die farnige Straße war jedoch nicht mehr so schön wie am Anfang. Denn sie waren noch nicht sehr weit geritten, als sie sie in eine enge Schlucht führte, die direkt unter die Erde zu führen schien, wo es keinen Lichtstrahl gab, der sie leitete, und wo die Luft feucht und schwer war. Es gab ein Geräusch von rauschendem Wasser überall, und schließlich stürzte sich der graue Zelter direkt hinein; und es kroch kalt und frostig zuerst über Thomas' Füße und dann über seine Knie.
Sein Mut war langsam geschwunden, seit er vom Tageslicht getrennt worden war, aber jetzt gab er sich verloren; denn es schien ihm sicher, dass sein seltsamer Begleiter und er das Ende ihrer Reise nie sicher erreichen würden.
Er fiel in einer Art Ohnmacht nach vorne; und wenn er nicht das aschgraue Kleid der Fee festgehalten hätte, wäre er, wette ich, von seinem Sitz gefallen und ertrunken.
Aber alle Dinge, seien sie gut oder schlecht, vergehen mit der Zeit, und schließlich begann die Dunkelheit aufzuhellen, und das Licht wurde stärker, bis sie wieder im hellen Sonnenschein waren.
Da fasste Thomas Mut und blickte auf; und siehe, sie ritten durch einen wunderschönen Obstgarten, wo Äpfel und Birnen, Datteln und Feigen und Weinbeeren in Hülle und Fülle wuchsen. Und seine Zunge war so ausgetrocknet und ausgedörrt, und er fühlte sich so schwach, dass er sich nach etwas von der Frucht sehnte, um wieder zu Kräften zu kommen.
Er streckte seine Hand aus, um etwas davon zu pflücken, aber seine Gefährtin drehte sich im Sattel um und verbot es ihm.
„Hier gibt es nichts, was du gefahrlos essen kannst“, sagte sie, „außer einem Apfel, den ich dir gleich geben werde. Wenn du irgendetwas anderes anrührst, bist du dazu verpflichtet, für immer im Märchenland zu bleiben.“
Der arme Thomas musste sich also so gut er konnte zurückhalten, und sie ritten langsam weiter, bis sie zu einem kleinen Baum kamen, der ganz mit roten Äpfeln bedeckt war. Die Feenkönigin bückte sich, pflückte einen und reichte ihn ihrem Gefährten.
„Das kann ich dir geben“, sagte sie, „und ich tue es gern, denn diese Äpfel sind die Äpfel der Wahrheit, und wer sie isst, erhält diese Belohnung, dass seine Lippen nie mehr eine Lüge erfinden können.“
Thomas nahm den Apfel und aß ihn, und für immer ruhte die Gnade der Wahrheit auf seinen Lippen, und deshalb nannten ihn die Menschen in späteren Jahren „den Wahren Thomas“.
Sie hatten nur noch ein kleines Stück zurückzulegen, bevor sie ein prächtiges Schloss erblickten, das auf einem Hügel stand.
„Dort ist mein Wohnsitz“, sagte die Königin und zeigte stolz darauf. „Dort wohnt mein Herr und alle Adligen seines Hofes. Und da mein Herr ein wechselhaftes Gemüt hat und keine Zuneigung für fremde Galane zeigt, die er in meiner Gesellschaft sieht, bitte ich dich um deinetwillen und um meinetwillen, kein Wort zu jemandem zu sagen, der mit dir spricht. Und wenn mich jemand fragt, wer und was du bist, werde ich ihm sagen, dass du stumm bist. So wirst du in der Menge unbemerkt bleiben.“
Mit diesen Worten erhob die Dame ihr Jagdhorn und blies einen lauten und durchdringenden Stoß. Und als sie dies tat, erlebte sie erneut eine wunderbare Veränderung. Denn ihr hässliches, aschebedecktes Kleid fiel von ihr ab, das Grau in ihrem Haar verschwand, und sie erschien wieder in ihrem grünen Reitrock und Mantel, und ihr Gesicht wurde jung und schön.
Und auch Thomas erlebte eine wunderbare Veränderung. denn als er zufällig nach unten blickte, sah er, dass seine grobe Landkleidung in einen Anzug aus feinem braunen Stoff verwandelt worden war und dass er an den Füßen Satinschuhe trug.
Sofort ertönte das Horn, die Türen des Schlosses flogen auf und der König eilte hinaus, um die Königin zu treffen, begleitet von so vielen Rittern und Damen, Minnesängern und Pagen, dass Thomas, der aus seinem Zelter geglitten war, keine Schwierigkeiten hatte, ihren Wünschen nachzukommen und unbemerkt ins Schloss zu gelangen.
Alle schienen sehr froh, die Königin wiederzusehen, und sie drängten sich in ihrem Gefolge in die Große Halle, und sie sprach gnädig mit ihnen allen und erlaubte ihnen, ihr die Hand zu küssen. Dann ging sie mit ihrem Mann zu einem Podium am anderen Ende des riesigen Raumes, wo zwei Throne standen, auf denen sich das königliche Paar niederließ, um den nun beginnenden Festlichkeiten zuzuschauen.
Der arme Thomas stand unterdessen weit weg am anderen Ende der Halle und fühlte sich sehr einsam, war aber fasziniert von der außergewöhnlichen Szene, die er betrachtete.
Denn obwohl all die feinen Damen, Höflinge und Ritter in einem Teil der Halle tanzten, kamen und gingen in einem anderen Teil Jäger, die große Hirsche mit Geweih hereintrugen, die sie offenbar bei der Jagd erlegt hatten, und sie in Haufen auf den Boden warfen. Und Reihen von Köchen standen neben den toten Tieren, zerlegten sie in Stücke und trugen die Stücke zum Kochen weg.
Alles in allem war es eine so seltsame, fantastische Szene, dass Thomas nicht darauf achtete, wie die Zeit verging, sondern stand und starrte und starrte, ohne ein Wort mit irgendjemandem zu sprechen. Dies ging drei lange Tage so, dann erhob sich die Königin von ihrem Thron, trat vom Podest und durchquerte die Halle zu der Stelle, wo er stand.
„Es ist Zeit aufzusteigen und zu reiten, Thomas“, sagte sie, „wenn du das schöne Schloss von Ercildoune jemals wiedersehen willst.“
Thomas sah sie erstaunt an. „Du sprachst von sieben langen Jahren, Lady“, rief er aus, „und ich bin erst seit drei Tagen hier.“
Die Königin lächelte. „Die Zeit vergeht schnell im Märchenland, mein Freund“, antwortete sie. „Du glaubst, du wärst erst seit drei Tagen hier. Es ist sieben Jahre her, seit wir uns getroffen haben. Und nun ist es Zeit für dich zu gehen. Ich hätte dich gern länger bei mir gehabt, aber ich wage es nicht, deinetwegen zuliebe. Jedes siebte Jahr kommt ein böser Geist aus den Regionen der Dunkelheit und nimmt einen unserer Anhänger mit sich, wen auch immer er sich aussucht. Und da du ein guter Kerl bist, fürchte ich, er könnte dich wählen.“
„Da ich also nicht zulassen möchte, dass dir etwas zustößt, werde ich dich noch heute Nacht in dein eigenes Land zurückbringen.“
Wieder einmal wurde der graue Zelter gebracht, und Thomas und die Königin bestiegen ihn. Und so, wie sie gekommen waren, kehrten sie zum Eildon-Baum in der Nähe des Huntly Burn zurück.
Dann verabschiedete sich die Königin von Thomas, und als Abschiedsgeschenk bat er sie, ihm etwas zu geben, das die Leute wissen ließe, dass er wirklich im Märchenland gewesen war.
„Ich habe dir bereits die Gabe der Wahrheit gegeben“, antwortete sie. „Ich werde dir jetzt die Gaben der Prophezeiung und Poesie geben, damit du die Zukunft vorhersagen und auch wundersame Verse schreiben kannst. Und neben diesen unsichtbaren Gaben gibt es hier etwas, das Sterbliche mit eigenen Augen sehen können – eine Harfe, die im Märchenland hergestellt wurde. Leb wohl, mein Freund. Eines Tages werde ich vielleicht wiederkommen, um dich zu holen.“
Mit diesen Worten verschwand die Dame, und Thomas blieb allein zurück. Ehrlich gesagt, empfand er es ein wenig traurig, sich von einem so strahlenden Wesen zu trennen und an den gewöhnlichen Ort der Menschen zurückzukehren.
Danach lebte er viele lange Jahre in seinem Schloss Ercildoune, und der Ruhm seiner Poesie und seiner Prophezeiungen verbreitete sich im ganzen Land, sodass die Leute ihn den Wahren Thomas und Thomas den Reimer nannten.
Ich kann Ihnen nicht alle Prophezeiungen aufschreiben, die Thomas äußerte und die mit großer Sicherheit eintrafen, aber ich werde Ihnen ein oder zwei nennen.
Er sagte die Schlacht von Bannockburn mit diesen Worten voraus:
„Der Brand von Breid wird rin fou reid“,
die an jenem schrecklichen Tag eintrat, als die Wasser des kleinen Bannockburn vom Blut der besiegten Engländer gerötet wurden.
Er sagte auch die Vereinigung der Kronen von England und Schottland unter einem Prinzen voraus, der der Sohn einer französischen Königin war und in dessen Adern noch das Blut von Bruce floss.
„Eine französische Königin wird die Sonne gebären; sie wird ganz Britannien bis zum Meer regieren, so nah wie der neunte Grad ist“, was 1603 wahr wurde, als König James, Sohn von Maria, Königin der Schotten, Monarch beider Länder wurde.
Vierzehn lange Jahre vergingen, und die Leute begannen zu vergessen, dass Thomas der Reimer jemals im Märchenland gewesen war; aber schließlich kam der Tag, an dem Schottland mit England im Krieg war und die schottische Armee an den Ufern des Tweed ruhte, nicht weit vom Turm von Ercildoune.
Und der Herr des Turmes beschloss, ein Fest zu veranstalten und alle Adligen und Barone, die die Armee anführten, zum Abendessen einzuladen.
Dieses Fest blieb lange in Erinnerung.
Denn der Laird von Ercildoune sorgte dafür, dass alles so prächtig war, wie es nur sein konnte. Als das Mahl beendet war, erhob er sich von seinem Platz, nahm seine Elfenharfe und sang seinen versammelten Gästen ein Lied nach dem anderen aus längst vergangenen Tagen vor.
Die Gäste hörten atemlos zu, denn sie hatten das Gefühl, nie wieder solch wunderbare Musik hören zu können. Und so geschah es.
Denn noch in derselben Nacht, nachdem alle Adligen in ihre Zelte zurückgekehrt waren, sah ein Soldat auf Wache im Mondlicht einen schneeweißen Hirsch und eine Hirschkuh langsam die Straße entlanglaufen, die am Lager vorbeiführte.
Die Tiere hatten etwas so Ungewöhnliches an sich, dass er seinen Offizier rief, um sie sich anzusehen. Und der Offizier rief seine Offizierskollegen, und bald war eine ganze Menschenmenge da, die den stummen Kreaturen leise folgte, die feierlich weitergingen, als würden sie den Takt einer Musik halten, die für sterbliche Ohren unhörbar war.
„Das hat etwas Unheimliches an sich“, sagte schließlich ein Soldat. „Lasst uns nach Thomas von Ercildoune schicken, vielleicht kann er uns sagen, ob es ein Omen ist oder nicht.“
„Ja, schickt nach Thomas von Ercildoune“, riefen alle auf einmal. Also wurde eilig ein kleiner Page zum alten Turm geschickt, um den Reimer aus seinem Schlaf zu wecken.
Als er die Nachricht des Jungen hörte, wurde das Gesicht des Sehers ernst und verstört.
„Es ist eine Vorladung“, sagte er leise, „eine Vorladung von der Königin des Feenlandes. Ich habe lange darauf gewartet, und endlich ist sie gekommen.“
Und als er hinausging, schloss er sich nicht der kleinen Gruppe wartender Männer an, sondern ging geradewegs auf den schneeweißen Hirsch und die Hirschkuh zu. Sobald er sie erreicht hatte, blieben sie einen Augenblick stehen, als wollten sie ihn begrüßen. Dann gingen alle drei langsam ein steiles Ufer hinab, das zum kleinen Fluss Leader abfiel, und verschwanden in seinen schäumenden Wassern, denn der Strom führte Hochwasser.
Und obwohl man sorgfältig suchte, fand man keine Spur von Thomas von Ercildoune. Und bis zum heutigen Tag glauben die Landleute, dass der Hirsch und die Hirschkuh Boten der Elfenkönigin waren und dass er mit ihnen ins Feenland zurückkehrte.
Goldbaum und Silberbaum
In vergangenen Tagen lebte eine kleine Prinzessin namens Goldbaum, und sie war eines der hübschesten Kinder auf der ganzen Welt.
Obwohl ihre Mutter gestorben war, hatte sie ein sehr glückliches Leben, denn ihr Vater liebte sie innig und dachte, dass nichts zu viel Mühe war, solange es seiner kleinen Tochter Freude bereitete. Aber nach und nach heiratete er wieder, und dann begannen die Sorgen der kleinen Prinzessin.
Denn seine neue Frau, die merkwürdigerweise Silberbaum hieß, war sehr schön, aber sie war auch sehr eifersüchtig, und sie machte sich ganz unglücklich aus Angst, eines Tages jemanden zu treffen, der besser aussah als sie selbst.
Als sie feststellte, dass ihre Stieftochter so unglaublich hübsch war, konnte sie sie sofort nicht leiden und sah sie immer an und fragte sich, ob die Leute sie hübscher finden würden, als sie war. Und weil sie tief in ihrem Herzen befürchtete, dass sie dies tun würden, war sie wirklich sehr unfreundlich zu dem armen Mädchen.
Endlich, eines Tages, als Prinzessin Goldbaum ganz erwachsen war, machten die beiden Damen einen Spaziergang zu einem kleinen Brunnen, der, umgeben von Bäumen, mitten in einem tiefen Tal lag.
Nun war das Wasser in diesem Brunnen so klar, dass jeder, der hineinschaute, sein Gesicht auf der Oberfläche gespiegelt sah; und die stolze Königin kam gern und spähte in die Tiefe, so dass sie ihr eigenes Bild im Wasser gespiegelt sehen konnte.
Aber heute, als sie hineinschaute, was sah sie anderes als eine kleine Forelle, die nicht weit von der Oberfläche entfernt ruhig hin und her schwamm.
„Forelle, Forelle, beantworte mir diese eine Frage“, sagte die Königin. „Bin ich nicht die schönste Frau der Welt?“
„Nein, das bist du wirklich nicht“, antwortete die Forelle sofort und sprang aus dem Wasser, während sie sprach, um eine Fliege zu verschlucken.
„Wer ist denn die schönste Frau?“, fragte die enttäuschte Königin, denn sie hatte eine ganz andere Antwort erwartet.
„Deine Stieftochter, die Prinzessin Goldbaum, ohne Zweifel“, sagte der kleine Fisch; dann tauchte er, erschrocken über den finsteren Ausdruck auf dem Gesicht der eifersüchtigen Königin, auf den Grund des Brunnens.
Es war kein Wunder, dass er das tat, denn der Gesichtsausdruck der Königin war nicht angenehm anzusehen, als sie einen wütenden Blick auf ihre schöne junge Stieftochter warf, die ein Stückchen entfernt damit beschäftigt war, Blumen zu pflücken.
Tatsächlich ärgerte sie der Gedanke, dass irgendjemand sagen könnte, das Mädchen sei hübscher als sie, so sehr, dass sie völlig die Selbstbeherrschung verlor. Als sie nach Hause kam, ging sie in heftiger Wut in ihr Zimmer, warf sich aufs Bett und erklärte, dass sie sich wirklich sehr krank fühle.
Vergebens fragte Prinzessin Goldbaum sie, was los sei und ob sie etwas für sie tun könne. Sie ließ nicht zu, dass das arme Mädchen sie berührte, sondern stieß sie von sich, als wäre sie etwas Böses. So musste die Prinzessin sie schließlich allein lassen und das Zimmer verlassen, wobei sie sich wirklich sehr traurig fühlte.
Nach einer Weile kam der König von seiner Jagd nach Hause und fragte sofort nach der Königin. Ihm wurde gesagt, dass sie plötzlich krank geworden sei und in ihrem eigenen Zimmer auf dem Bett liege und dass niemand, nicht einmal der Hofarzt, der hastig herbeigerufen worden war, herausfinden konnte, was mit ihr los sei.
In großer Sorge – denn er liebte sie wirklich – trat der König an ihr Bett und fragte die Königin, wie sie sich fühle und ob er irgendetwas tun könne, um sie zu beruhigen.
„Ja, es gibt eine Sache, die du tun könntest“, antwortete sie barsch, „aber ich weiß ganz genau, dass du es nicht tun wirst, auch wenn es das einzige ist, was mich heilen kann.“
„Nein“, sagte der König, „ich verdiene bessere Worte aus deinem Mund als diese; denn du weißt, dass ich dir alles geben würde, worum du bittest, selbst es die Hälfte meines Königreichs.“
„Dann gib mir das Herz deiner Tochter zu essen“, rief die Königin, „denn wenn ich das nicht bekomme, werde ich sterben, und zwar bald.“
Sie sprach so wild und sah ihn so seltsam an, dass der arme König wirklich dachte, sie sei verrückt, und er wusste nicht, was er tun sollte. Er verließ das Zimmer und ging in großer Not den Korridor auf und ab, bis ihm schließlich einfiel, dass am selben Morgen der Sohn eines großen Königs aus einem Land weit über dem Meer angekommen war und um die Hand seiner Tochter angehalten hatte.
„Hier ist ein Ausweg aus der Schwierigkeit“, sagte er zu sich selbst. „Diese Hochzeit gefällt mir gut, und ich werde sie sofort feiern lassen. Wenn meine Tochter dann sicher außer Landes ist, werde ich einen Jungen den Hügel hinaufschicken, und er wird einen Ziegenbock töten, und ich werde sein Herz vorbereiten und zurechtschneiden lassen und es meiner Frau hinaufschicken. Vielleicht wird der Anblick sie von diesem Wahnsinn heilen.“
Also ließ er den seltsamen Prinzen vor sich rufen und erzählte ihm, wie die Königin plötzlich krank geworden sei, was ihr das Gehirn zugesetzt und sie die Prinzessin nicht leiden lassen habe, und wie es ihm scheine, als wäre es eine gute Sache, wenn die Hochzeit mit Einwilligung des Mädchens sofort stattfinden könne, damit die Königin allein gelassen würde, um sich von ihrer seltsamen Krankheit zu erholen.
Nun war der Prinz entzückt, seine Braut so leicht zu gewinnen, und die Prinzessin war froh, dem Hass ihrer Stiefmutter zu entkommen, also fand die Hochzeit sofort statt und das frisch vermählte Paar machte sich auf den Weg übers Meer in das Land des Prinzen.
Dann schickte der König einen Jungen den Berg hinauf, um einen Ziegenbock zu töten; und als er getötet war, befahl er, sein Herz auszunehmen und zu kochen und es auf einer silbernen Platte in das Zimmer der Königin zu schicken. Und die böse Frau kostete es, weil sie glaubte, es sei das Herz ihrer Stieftochter; und als sie das getan hatte, erhob sie sich aus ihrem Bett und ging im Schloss umher, wobei sie so gesund und munter aussah wie immer.
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Hochzeit von Prinzessin Goldbaum, die so schnell zustande gekommen war, ein großer Erfolg war; denn der Prinz, den sie geheiratet hatte, war reich und groß und mächtig, und er liebte sie innig, und sie war glücklich wie der Tag lang war.
So ging alles ein Jahr lang friedlich weiter. Königin Silberbaum war zufrieden und glücklich, weil sie dachte, ihre Stieftochter sei tot; während die Prinzessin die ganze Zeit über glücklich und wohlhabend in ihrem neuen Heim war.
Doch am Ende des Jahres begab sich die Königin zufällig noch einmal zum Brunnen in dem kleinen Tal, um ihr Gesicht im Wasser gespiegelt zu sehen.
Und es begab sich auch, dass dieselbe kleine Forelle vor und zurück schwamm, genau wie im Jahr zuvor. Und die törichte Königin beschloss, diesmal eine bessere Antwort auf ihre Frage zu bekommen als beim letzten Mal.
„Forelle, Forelle“, flüsterte sie und lehnte sich über den Rand des Brunnens, „bin ich nicht die schönste Frau der Welt?“
„Bei meiner Treue, das bist du nicht“, antwortete die Forelle auf ihre sehr direkte Art.
„Wer ist denn die schönste Frau?“, fragte die Königin, und ihr Gesicht wurde blass bei dem Gedanken, dass sie noch eine weitere Rivalin hatte.
„Na, die Stieftochter Eurer Majestät, Prinzessin Goldbaum, ganz bestimmt“, antwortete die Forelle.
Die Königin warf ihren Kopf mit einem Seufzer der Erleichterung zurück. „Nun, jedenfalls können die Leute sie jetzt nicht mehr bewundern“, sagte sie, „denn es ist ein Jahr her, dass sie gestorben ist. Ich habe ihr Herz zum Abendessen gegessen.“
„Bist du dir da sicher, Eure Majestät?“, fragte die Forelle mit einem Augenzwinkern. „Mir scheint, es ist erst ein Jahr her, dass sie den tapferen jungen Prinzen geheiratet hat, der aus dem Ausland kam, um ihre Hand anzuhalten, und mit ihm in sein eigenes Land zurückkehrte.“
Als die Königin diese Worte hörte, wurde sie ganz kalt vor Wut, denn sie wusste, dass ihr Mann sie betrogen hatte; und sie erhob sich von ihren Knien und ging geradewegs nach Hause in den Palast, und sie verbarg ihren Ärger so gut sie konnte und fragte ihn, ob er befehlen würde, das Langschiff klarzumachen, da sie ihre liebe Stieftochter besuchen wollte, denn es war so lange her, dass sie sie gesehen hatte.
Der König war etwas überrascht über ihre Bitte, aber er war nur zu froh, dass sie ihren Hass auf seine Tochter überwunden hatte, und er gab den Befehl, das Langschiff sofort klarzumachen.
Bald raste es über das Wasser, sein Bug in Richtung des Landes gewandt, wo die Prinzessin lebte, gesteuert von der Königin selbst; denn sie kannte den Kurs, den das Boot nehmen sollte, und sie hatte es so eilig, das Ziel ihrer Reise zu erreichen, dass sie niemand anderem das Ruder überließ.
Nun war Prinzessin Goldbaum an diesem Tag zufällig allein, denn ihr Mann war auf die Jagd gegangen. Und als sie aus einem der Schlossfenster schaute, sah sie ein Boot über das Meer auf den Anlegeplatz zusegeln. Sie erkannte es als das Langschiff ihres Vaters und ahnte nur zu gut, wen es an Bord hatte.
Sie war bei diesem Gedanken fast außer sich vor Angst, denn sie wusste, dass Königin Silberbaum sich nicht aus gutem Grund die Mühe gemacht hatte, sie zu besuchen, und sie hatte das Gefühl, dass sie fast alles hergegeben hätte, was sie besaß, wenn ihr Mann nur zu Hause geblieben wäre. In ihrer Not eilte sie in die Dienerhalle.
„Oh, was soll ich tun, was soll ich tun?“, rief sie, „denn ich sehe das Langschiff meines Vaters über das Meer kommen, und ich weiß, dass meine Stiefmutter an Bord ist. Und wenn sie die Gelegenheit dazu hat, wird sie mich töten, denn sie hasst mich mehr als alles andere auf der Erde.“
Nun verehrten die Diener den Boden, auf den ihre junge Herrin trat, denn sie war immer freundlich und rücksichtsvoll zu ihnen, und als sie sahen, wie verängstigt sie war, und ihre mitleiderregenden Worte hörten, drängten sie sich um sie, als wollten sie sie vor allem Schaden schützen, der ihr drohte.
„Habt keine Angst, Eure Hoheit“, riefen sie; „Wir werden dich notfalls mit unserem Leben verteidigen. Aber falls deine Stiefmutter die Macht haben sollte, dich mit einem bösen Zauber zu belegen, werden wir dich in die große Stiefmütterchenkammer sperren, dann kann sie dir überhaupt nicht nahe kommen.“
Die Stiefmütterchenkammer war ein Tresorraum, der sich in einem eigenen Teil des Schlosses befand, und ihre Tür war so dick, dass niemand sie aufbrechen konnte; und die Prinzessin wusste, dass sie, wenn sie erst einmal in dem Raum war, mit der dicken Eichentür zwischen ihr und ihrer Stiefmutter, vollkommen sicher vor allem Unheil sein würde, das diese böse Frau anrichten könnte.
Also stimmte sie dem Vorschlag ihrer treuen Diener zu und ließ sich von ihnen in die Stiefmütterchenkammer sperren.
So kam es, dass Königin Silberbaum, als sie an der großen Tür des Schlosses ankam und dem Lakaien, der sie öffnete, befahl, sie zu seiner königlichen Herrin zu bringen, ihr mit einer tiefen Verbeugung sagte, dass das unmöglich sei, weil die Prinzessin im Tresorraum des Schlosses eingesperrt sei und nicht herauskommen könne, weil niemand wisse, wo der Schlüssel sei.
(Was durchaus wahr war, denn der alte Butler hatte ihn um den Hals des Lieblingsschäferhundes des Prinzen gebunden und ihn in die Berge geschickt, um seinen Herrn zu suchen.)
„Bring mich zur Tür des Gemachs“, befahl die Königin. „Wenigstens kann ich durch sie mit meiner lieben Tochter sprechen.“ Und der Lakai, der nicht sah, was daraus möglicherweise entstehen könnte, tat, was ihm geheißen wurde.
„Wenn der Schlüssel wirklich verloren ist und du nicht herauskommen kannst, um mich zu begrüßen, liebe Goldbaum“, sagte die betrügerische Königin, „stecke wenigstens deinen kleinen Finger durch das Schlüsselloch, damit ich ihn küssen kann.“
Die Prinzessin tat dies, ohne zu träumen, dass ihr durch eine so einfache Handlung Böses widerfahren könnte. Aber es geschah. Denn anstatt den winzigen Finger zu küssen, stach ihre Stiefmutter ihn mit einer vergifteten Nadel, und das Gift war so tödlich, dass die arme Prinzessin, bevor sie einen einzigen Schrei ausstoßen konnte, wie tot auf den Boden fiel.
Als sie den Aufprall hörte, huschte ein zufriedenes Lächeln über das Gesicht von Königin Silberbaum. „Jetzt kann ich sagen, dass ich die schönste Frau der Welt bin“, flüsterte sie; und sie ging zurück zu dem Lakaien, der am Ende des Ganges wartete, und sagte ihm, dass sie ihrer Tochter alles gesagt habe, was sie zu sagen habe, und dass sie nun nach Hause zurückkehren müsse.