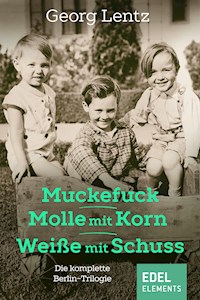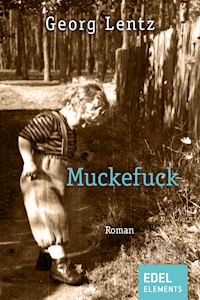3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Mittelpunkt des legendären Kultromans von Georg Lentz steht eine typische Berliner Vorstadtkneipe mit angeschlossenem Kino – in der bewegten Zeit zwischen Inflation und Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein einmaliges, atmosphärisch dichtes Portrait der kleinbürgerlichen Berliner Gesellschaft in dieser Zeit zwischen Anpassung, passivem Widerstand und Überlebenswillen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Georg Lentz
Das Schützenhaus
Roman
Edel Elements
Copyright dieser Ausgabe © 2012 by Edel Elements einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. www.edel.com Copyright der Originalausgabe © 1988 by Georg Lentz
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-028-9
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
1
Niemals werde ich den Tag vergessen, an dem wir das Schützenhaus besuchten. Der frühere Besitzer war gestorben, das Anwesen verwaist. Mein Vater hatte sich in den Kopf gesetzt, das Schützenhaus zu neuem Leben zu erwecken. »Ich will das«, hatte er gesagt, zu unser aller Erstaunen, denn er war nicht der Energischste. »Du?« hatte denn auch Deli gefragt, meine Tante, die die Mutterstelle bei uns einnahm, »ausgerechnet du? Walter Pommrehnke, der nie in seinem Leben einen Finger krumm gemacht hat?«
Sie lehnte in der Tür zum Schlafzimmer, damals wohnten wir Königstraße, zwei Treppen, eine weitläufige Wohnung gegenüber dem Park, mit Zentralheizung. In das Schlafzimmer meines Vaters führte eine Doppeltür. Sie stand meistens offen, beide Flügel, mein Vater liebte es, im Bett zu liegen. Er verbrachte ganze Tage im Bett. Die Nächte sowieso, aber morgens, wenn er sich rasiert hatte, legte er sich wieder hin, rauchte eine Zigarre und las die Zeitungen. »Lokal-Anzeiger«, »Morgenpost«. Manchmal, wenn jemand sie ihm mitbrachte, die »Berliner Zeitung«.
Deli hieß mit vollem Namen Adele. Sie hätte es gern gehabt, wenn wir sie so genannt hätten, das betonte sie zuweilen. Doch jeder nannte sie Deli. Sogar die Lieferanten nannten sie »Frau Deli«. Meine Tante war nach dem Tod meiner Mutter zu uns gekommen, mit Anneli, ihrer Tochter, einem verhärmten, blassen Mädchen. Einen Vater zu Anneli gab es nicht. In Tante Delis Schilderungen wechselte diese Bezugsperson, einmal war es ein Brasilianer, einmal Nikko der Teufelsgeiger, Primas einer ungarischen Salonkapelle, die durchgereist war, oder gar der Geheimrat – »Gott hab ihn selig« –, bei dem Tante Deli in Stellung gewesen war. In ihren Erzählungen hieß das: »Ich habe ihm das Haus geführt.« Meistens fügte sie an, daß dort allerdings solche Lümmel wie wir, mein Bruder Joachim und ich, der kleine Hansi, in die Schranken gewiesen worden wären. »Wie es hier zugeht – der Herr Geheimrat hätte das nie geduldet.«
Der Herr Geheimrat war verblichen, unsere Mutter lag auf dem Friedhof an der Waldfriedenstraße, Joachim bastelte in seiner Dunkelkammer im Keller. Ich malte mit Wasserfarben, Flugzeuge vornehmlich, denn ein berühmter Mitbewohner dieses Mietshauses – das übrigens uns gehörte –, Günther Plüschow, war mit seiner Silbercondor über Feuerland geflogen, oder ich hatte die Erlebnisse des Roten Barons, des Jagdfliegers Manfred von Richthof en, verschlungen, damals las ich drei oder vier Bücher pro Woche und malte rote Fokker-Dreidecker. So genau weiß ich das nicht mehr, in der Erinnerung verschiebt sich manches.
Genau weiß ich jedoch, wie Tante Deli in der Tür lehnte, im Schlafzimmer mein Vater im Bett, Zigarre in der Hand, der Rauch zog schräg zum Fenster hinüber, das einen Schlitz breit offenstand. »Du? Walter Pommrehnke, der nie in seinem Leben einen Finger krumm gemacht hat?«
Mein Vater wedelte mit seiner Zigarre, er saß aufrecht im Bett, viele Kissen im Rücken, und unter dem Bett sah die schokoladenfarbene Schnauze unseres Hundes hervor, eines Hühnerhundes namens Zeppelin, Anneli rief ihn Zellepin. Tante Deli, wenn sie ihre Monologe hielt, verharrte in der Tür, wechselte allenfalls Stand- und Spielbein. Sie dort in der Tür, mein Vater im Bett: Das war ihre Art, Dinge zu besprechen. Wobei es nicht nötig war, daß mein Vater ein einziges Wort sagte, es genügte, wenn er brummte. Das Brummen hielt Tante Deli in Gang. »Ich möchte wissen, was das für ein Wirt ist, der seinen Hintern nicht aus der Furzmulle hochkriegt. Meinst du, die verlegen dir den Zapfhahn ans Bett? Und wenn Schützenfest ist oder eine Hochzeit oder Veranstaltungen, Vereine zum Beispiel. Da kommen hundert Gäste oder noch mehr. Der Herr Wirt liegt dann im Bett und raucht seine Zigarre. Meinst du, damit ist es zu schaffen? Ich weiß, du spekulierst drauf, daß ich eingreife. Deli für alles, wie? Deli, die schon dem Herrn Geheimrat die Wirtschaft gemacht hat, sie ist ja darauf angewiesen, eine arme Verwandte mit unehelichem Kind. Ich will dir mal was sagen, an jedem Finger könnte ich zehn haben. Zehn Männer, jawohl. Mit Freuden würden sie mich nehmen, mit Anneli.«
Mein Vater grinste. Ich drückte mich hinten im schlecht beleuchteten Flur herum, ließ die Farben eintrocknen auf meiner Malerei, das Bild würde versaut sein, Aquarellfarben muß man schnell bearbeiten, das hatte mir unser Zeichenlehrer beigebracht.
Tante Deli wechselte Stand- und Spielbein, dann fuhr sie fort: »Wenn du denkst, du hast eine billige Arbeitskraft an mir, so hast du dich in den Finger geschnitten. Ich bin zu dir gekommen nach dem Tod von Lucie, deiner Frau, meiner Schwester immerhin. Weshalb ist Lucie krank geworden und gestorben? Nein, nein, ich will dich nicht beschuldigen. Lucie war immer schwach. Dabei fällt mir ein, ich muß Mohrrüben kaufen, die Jungs sind blasser als meine Anneli. Großstadtluft. Ich glaube, sie sind rachitisch. Englische Krankheit. Das ist möglich, oder? Die Großstadtluft. Wir sollen hier eine richtige Dunstglocke haben, die Sonne kommt nicht durch. In der ›Morgenpost‹ stand ein langer Artikel. Sag mal, du bist wirklich entschlossen, willst das Schützenhaus übernehmen?«
Mein Vater nickte. Die Zigarre wippte auf und nieder wie ein Schlagbaum. Im Licht, das durch die hohen Fenster fiel, leuchteten seine blauen Augen. »Wer rastet, der rostet«, sagte Vater. »Als Nachkomme von Millionenbauer Pommrehnke das Erbe verprassen, das liegt mir nicht.«
Eine Rede solcher Länge hatte ich selten aus Vaters Mund vernommen, außer, er berichtete über seine Erlebnisse als Leibgarde-Husar. Daß er sich hinter einem Sprichwort verschanzte, bewies mir, daß er ernst machen würde. Vergleichsmöglichkeiten standen mir offen. Bevor Vater mir oder Joachim eine runterhaute, sagte er jedesmal: »Unverhofft kommt oft.«
Nun das Schützenhaus. Bedeutete das Umzug? Wir lebten behaglich hier, das Haus in der Königstraße gehörte uns, ein paar andere die Straße hinauf ebenfalls und eine Mietskaserne in der Großgörschenstraße. Großvater Pommrehnke, der »Millionenbauer«, hatte sein Geld gut angelegt, als er den Hof an Bauspekulanten verkaufte. Die Stadt dehnte sich aus, die Bauern trennten sich von ihren Äckern. Meistens lebten sie danach flott, in wenigen Jahren schmolz das Geld dahin.
Anders mein Großvater, er legte an. Kaufte Mietshäuser aus Pleiten, manchen Bauherren war das Geld ausgegangen. Er hatte auch mit dem Verkauf seines Hofes gewartet, bis rings umher die Rohbauten der Häuser aufschossen, die Spekulanten die Lücken dazwischen ärgerten und sie schließlich eine, wie Großvater sagte, schwindelnde Summe boten.
Diese Einzelheiten waren mir vertraut, oft wurde darüber geredet, mindestens kamen sie wiederholt in Tante Delis Monologen vor. Und auch Großvater und Großmutter, die wir in den Sommerferien regelmäßig besuchten, sprachen gern über jene Tage des – heute würde man sagen – Baubooms.
Natürlich war mir, genau wie Joachim und Anneli, dies alles bekannt, aber es hatte keine Bedeutung für mich, blieb ohne Zusammenhang, entzog sich meiner Beurteilungsmöglichkeit. An jenem Tag jedoch spürte ich, daß unser Leben sich verändern würde, daß diese Veränderung etwas mit dem Willen meines Vaters zu tun hatte und nicht mit »den Umständen«. Mein Vater sagte zuweilen, den Umständen entsprechend gehe es uns gut.
Ich schlich zu meinem Bruder Joachim hinunter. Ausnahmsweise ließ er mich gleich ein, als ich an die Tür seiner Dunkelkammer klopfte. Rotes Licht beleuchtete seine Hände. Im Fixierbad schwamm die Vergrößerung eines Fotos: der Kopf einer Libelle. Joachim hatte sie im Sommer fotografiert, als wir bei den Großeltern in Lindow waren, mit einer selbstgebastelten Vorsatzlinse. »Schau dir die Augen an«, sagte Joachim. »Der Mist ist, daß man so eine Fotografie nur wenigen zeigen, sie allenfalls drucken kann. In der ›Berliner Illustrierten‹. Aber ob die auf meine Fotos warten? Man muß Filme drehen. Man muß das filmen, verstehst du? Und in einem Saal zeigen. Tausenden muß man das zeigen.« Er kniff mich in den Arm, die andere Hand bewegte mittels einer Wäscheklammer das Foto im Fixierbad. Joachim hatte die Klammer der Länge nach gespalten. Mit darübergezogenen Gummiringen bewegte er sie wie chinesische Eßstäbchen.
Mich interessierte sein Steckenpferd nicht. »Stell dir vor«, flüsterte ich überflüssigerweise, »Vater will das alte Schützenhaus kaufen und Gastwirt werden. Tante Deli hat Schiß, daß sie die Arbeit machen muß.«
Joachim sah mich durch seine Brille an, er trug eine Korrekturbrille wegen seiner Schielerei. Man wußte trotz der Brille nicht genau, wohin er blickte, aber da er mir das Gesicht zuwandte, rot beschienen und wie aus Wachs, nahm ich an, daß er mich im Fokus hatte. »Ist doch Klasse«, sagte mein Bruder. Er nahm das Bild der Libelle aus dem Fixierer und warf es ins Wasserbad. »Unheimlich Klasse.« Er knipste die normale Birne über dem Waschtisch an, das Licht blitzte auf seinem linken Brillenglas. »Verstehst du nicht?«
Ich verstand nicht. »Guck mal«, sagte Joachim mit einer Geduld, die ich vorher nicht an ihm beobachtet hatte, »das Schützenhaus hat doch einen Saal?«
»Zwei. Einen großen Saal, sagt Tante Deli, und einen kleinen, eine Art Hinterzimmer, wo sie die Hochzeit gefeiert haben, als die Schlanstedtsche heiratete.«
»Eben. Wozu dient ein Saal?« Joachim kniff mich in den Arm, es tat weh.
»Laß das«, sagte ich. »Ein Saal dient zum Tanzen, zum Feiern. Die Erwachsenen betrinken sich, und sie werden laut, dann singen sie ›Die blauen Dragoner, sie reiten‹, und manche fallen unter den Tisch. Manche Männer fassen auch den Frauen vorne ins Kleid.«
Joachim lachte. »Was du schon alles weißt.«
»Knallkopp«, murmelte ich. Er war zwölf, ich zehn. »Zwei Säle«, sagte ich. »Wieso interessieren dich die?«
»Hast du gehört, wann sie hinwollen? Besichtigen sie das Schützenhaus?«
»Heute nachmittag, glaube ich.«
Joachim öffnete die Tür. »Wir gehen mit. Ich will wissen, ob man in dem Saal Kino machen kann. Erst einmal im kleinen Saal, später im großen.«
Das Bild von der Libelle schwamm unbeachtet im Wasser. »Willst du es nicht aufhängen? Zum Trocknen?« fragte ich.
Joachim winkte ab. »Später. Ich muß jetzt das Ohr am Puls der Zeit haben.«
Er redete oft so geschraubt, ich wußte nicht, was er meinte und wo er diese Ausdrücke herhatte.
Meine Tante stand immer noch in der Tür, als ich aus Joachims Dunkelkammer zurückkam. »Wenn du das Schützenhaus im Hellen sehen willst, solltest du deinen Hintern aus den Federn wuchten«, ermahnte sie meinen Vater. Sie löste sich von ihrem Platz, ging auf das Bett zu. Mein Vater legte die Zigarre in den Aschbecher auf dem Nachttisch. Zeppelin rückte unter dem Bett vor, ein paar Zentimeter, sein Kopf wurde sichtbar, die krause Schokoladennase. Er knurrte.
Zeppelin knurrte Tante Deli an. Mein Vater nahm einen seiner Pantoffeln, die vor dem Bett standen, und schlug Zeppelin auf die Nase. Ein Klaps nur. Zeppelin kroch unter dem Bett hervor und beschnupperte meine Tante, als habe er nie jenes Zeichen des Abscheus gezeigt, als habe er nie geknurrt. So weit ging Zeppelin allerdings nicht, daß er mit dem Schwanz gewedelt hätte. Tante Deli schlug die Decke zurück, mein Vater wälzte sich aus dem Bett. Er trug ein Nachthemd mit blauweiß gebördelten Nähten. Ein langes Nachthemd. Unter dem Saum sahen die Füße hervor, käsig, die großen Zehen mit starken Fußnägeln. Er fuhr in die Pantoffeln. Joachim und ich standen jetzt in der Tür, dort, wo vorher Tante Deli Posten gefaßt hatte – einer ihrer Ausdrücke: »Ich fasse da Posten, bis du aufstehst.« Oder: »Ich fasse hier Posten, bis die Frage des Wirtschaftsgeldes geklärt ist.«
Mein Vater schlurfte an uns vorbei ins Badezimmer, wir mußten einen Schritt zurücktreten. Dann hörten wir, wie er das Rasiermesser auf dem Lederriemen wetzte. Tante Deli schüttelte die Kissen auf. Von der Zigarre im Aschbecher stieg ein Rauchfaden auf, immer dünner werdend.
Die wenigen Male, da wir die Wohnung verließen, geschah es in immer gleicher Gruppierung. Vorneweg Hef Zeppelin, die Nase am Boden, verfolgt von der hüpfenden Anneli, die wiederholt ihr »Zellepin« in die Natur hinausschrie. Dahinter mein Vater, einen erkalteten Zigarrenstummel im Mundwinkel. Ab und zu brummte er, niemand wußte, ob dieses Brummen Behagen oder Mißbehagen ausdrückte. Entfernte sich Zeppelin, so blieb mein Vater stehen, nahm die Zigarre aus dem Mund und pfiff. Befand sich Zeppelin in Wurfweite, nahm mein Vater einen Stein auf und warf ihn in Richtung des Hundes. Mein Vater konnte weit werfen. Manchmal verrechnete sich Zeppelin und wurde getroffen. Er jaulte, Anneli stürzte zu ihm hin, kniete sich neben ihn und umarmte ihn. Zeppelin blickte vorwurfsvoll nach rückwärts, wo mein Vater, die Zigarre wieder im Mund, zufrieden brummte.
Hinter meinem Vater ging Tante Deli, mit kurzen Schritten, die Hände in den Taschen ihres weitgeschnittenen Kleides oder eines entsprechenden Mantels. Alle Kleidungsstücke hingen an ihr. Den Kopf streckte sie vor.
Joachim und ich bildeten den Schluß. Wir gingen nebeneinander, ich hörte Joachim zu, der seine Ideen entwickelte, wie jene vom Baumhaus: Im Park gegenüber wollte er, im Wipfel einer Linde, ein Baumhaus bauen, jedoch nur aus »natürlichen« Ästen, wie er sagte. Er haßte es, wenn man nicht harmonierende Baustoffe verwendete. »Bretter, wie sieht das aus«, sagte er. »Bretter sind Fremdkörper. Außerdem fällt so ein Baumhaus aus Brettern unseren Feinden auf. Hingegen – wieder so ein geschraubtes Wort –, hingegen, wir sammeln Äste, dickere und dünnere. Die dickeren sind Unterlage und Stütze. Die dünneren verflechten wir. Das ist Statik, verstehst du?« Er blickte mich an, jedenfalls wendete er mir sein Gesicht zu. Ich nickte beflissen, obwohl ich nichts verstand. Vielleicht konstruierten wir dieses Statikhaus hoch oben in der Linde. Meistens blieb es beim Pläneschmieden.
Ich sehe uns den Kamm eines flachen Hügels entlanggehen, gegen das Sonnenlicht gleichen wir Schattenrissen. Es ist, als beobachtete ich uns von einem tiefer gelegenen Ort, und zugleich bin ich dabei, dort oben, eine winzige Gestalt gemessen an dem kolossal wirkenden Vater, der dürren, hoch aufgeschossenen Tante, sie befand sich im letzten Stadium einer Art Magersucht, ein Jahr später begann sie Fett anzusetzen. Nur Anneli war kleiner als alle, ihre Glieder, die sie hüpfend warf, sahen aus wie Stecken. Wir gingen vorbei an dem Gutshof, auf dem sich eine alte Reitbahn befand. Zeppelin verschwand, wir hörten ihn zwischen den Ställen kläffen. Anneli rief »Zellepin«, mein Vater brummte »Scheißtöle, verdammte« und blieb stehen. »Ich sag’ immer, der Hund muß an die Leine«, schimpfte meine Tante, »eines Tages wird er jemand beißen. Einen Menschen. Vielleicht ein Kind. Oder ein Pferd. Dann ist der Schaden groß. Wer soll das zahlen? Hab’ ich dir erzählt, wie mich unser Hund in den Bauch gebissen hat? Ich war noch ein Kind, wir hatten einen Schäferhund, Wotan, der hatte Angst vor Gewitter. Ich auch. Es donnerte, ich unters Sofa, Wotan ebenfalls. Wir prallten zusammen, unter dem Sofa. Vor Schreck biß er mich in … da kommt ja Zeppelin. Zeppelin! Komm her! Guter Hund.«
»Scheißtöle«, brummte mein Vater. Wir gingen weiter. Joachim sagte: »Wir könnten eine elektrische Leitung ins Baumhaus legen, von der Wohnung aus. Schwachstrom. Wir könnten Morseapparate bauen und Nachrichten senden. Kannst du morsen?«
»Nein«, sagte ich erstaunt. Joachim schüttelte den Kopf. »Ich auch nicht«, sagte er.
Links entlang verlief der Sandweg, gelber märkischer Sand mit tiefen Wagenspuren. Akazien wuchsen auf beiden Seiten, ihre Kronen berührten einander, der Weg wirkte wie ein grüner Tunnel. Selten ging hier jemand entlang. Wir stolperten über Wurzeln, jetzt im Gänsemarsch, Joachim ging vor mir. Er machte kleine Schritte, den Oberkörper aufgerichtet. Seine langen Arme schlenkerten wie die Arme unseres Vaters, der allerdings von Zeit zu Zeit die Jacke aufknöpfte und die Daumen in die Armlöcher seiner Weste steckte. Er trug Anzüge aus festem Tuch, ein Anzug hielt viele Jahre.
Der Weg streifte eine Ecke der Laubenkolonie Tausendschön. Dann führte eine schmale Brücke über den Graben, einen tief zwischen Böschungen versenkten Wasserlauf, der in einem verschilften Teich endete. Schließlich überquerten wir eine Chaussee. Auf der anderen Seite, unter Ulmen und Kastanien, lag das Schützenhaus.
Das Anwesen wirkte verlassen. Mannshohes Gebüsch wucherte und verdeckte zum Teil die einst weißen, von Fachwerkbalken gegliederten Mauern. Faulende Stufen führten zu einer Holzveranda, die sich an der gesamten Vorderseite des Haupthauses hinzog. Die Fenster waren mit rohen, ungehobelten Brettern verschalt. Eine Reklame für Berliner Kindl-Bier hing an einem Nagel schräg herab. Ein Teil der Dachrinne hatte sich gelöst.
Zeppelin verschwand in den Büschen. Wir gingen ums Haus. Der saalartige Bau an der Rückseite machte einen stabilen Eindruck. Die Kegelbahn daneben sah sogar aus, als sei sie kürzlich benutzt worden. Die Kugeln lagen blank der Reihe nach in einer hölzernen Rinne, alle neun Kegel waren am anderen Ende aufgestellt. Doch konnten wir die Kegelbahn nicht betreten, weil davor ein breiter Streifen Brennesseln wucherte. »Entenfutter«, sagte mein Vater. »Wir sollten einen Teich anlegen und Enten züchten.«
Wir gingen weiter. Joachim meinte, wir könnten unser Baumhaus hier bauen, dies sei »die wahre Wildnis«. Tante Deli nahm die Hände aus den Taschen und fuchtelte vor Vaters Nase. »Du denkst doch nicht ernsthaft daran, diese Klitsche zu übernehmen?« fragte sie. Und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Dies ist ein Schuppen. Die Kosten, bis das alles repariert ist. Wie wird es erst innen aussehen. Verfault wird alles sein, die Wasserrohre zerbrochen. Und die Elektrizität? Bestimmt sind die Wände feucht, der Pilz nistet in den Mauern. Wer soll das bewirtschaften? Das Haus ist nicht zu retten. Ein Haus muß bewohnt werden. Wie lange steht das schon leer? Wenn die von der Brauerei das sehen, geben sie auf, das wette ich. Und der Schützenverein wird sich daran gewöhnt haben, seine Feste woanders zu feiern. Warum sollen die Schützen zurückkommen? Hier sagen sich Hund und Katze gute Nacht. Niemand kommt hier heraus. Das Bier wird schal. Wir leben doch nett. Warum also.«
Wir waren auf den Wall vom Schießstand geklettert. Disteln blühten blau. Mein Vater zündete sich den Zigarrenstummel neu an. »Schön ist es hier, findet ihr nicht?« fragte er. Joachim plinkerte mit den Augen. Tante Deli stand hoch aufgerichtet und sagte, entgegen ihrer Gewohnheit, kein Wort mehr.
Auf der Straße schoß ein Bursche auf einem Fahrrad heran, dessen Speichen in der Sonne blitzten. Mein Vater sagte: »Seht, Sternchen Siegel mit dem Schlüssel.«
Ich erinnere mich, daß mein Blick jedoch auf Anneli fiel, die uns hüpfend umkreiste. Ich erinnere mich genau, nach so vielen Jahren, genauer als an Tante Delis Monologe, die ich nur ungefähr wiedergeben kann, daß ich in diesem Augenblick Anneli nicht als das kleine, magere Mädchen sah, das sie war, sondern als – wie soll ich sagen – als Frau. So, wie man sich angesichts der Puppe den Schmetterling vorstellt, der aus dieser Hülle ausschlüpfen wird, sah ich in Anneli das herangereifte weibliche Wesen. Heute frage ich mich, wie so etwas geschehen konnte, da ich selbst, unerweckt und noch verschont von gewissen Gefühlen, keine Möglichkeit für Erkenntnisse und Vergleiche in dieser Richtung hatte – so meine ich wenigstens. Dennoch, ich sah diese Anneli, für den Bruchteil von Sekunden. Ich vergaß es nie, die ganze Zeit nicht, bis Anneli, Jahre später, dieses Bild erfüllte, und ich habe es bis heute nicht vergessen.
Wie mir denn überhaupt jene Szene noch eindringlich vor Augen steht, der Vater auf dem Wall der Schießstände, überlebensgroß, wie er mir stets erschien, eine Autorität, die nicht angezweifelt wurde, nicht von mir, nicht von Joachim, auch von der Tante nicht.
Dieser Mann, der nichts tat, wortkarg seine Tage im Bett dahinlebte: Was zeichnete ihn aus? Wieso erschien er uns so übermächtig? Vater. Für uns, für Joachim und mich der Vater. Aber für Tante Deli?
Anneli vielleicht, denke ich heute, unterlag nicht seinem Einfluß. Sie schwirrte um diesen Mächtigen wie ein Insekt, manchmal in der Gefahr, von ihm mit einer imaginären Fliegenklatsche erwischt zu werden, generell aber auf die Gutmütigkeit dieses Elefanten bauend, solange sie klein und unansehnlich war. Später, weiß ich, setzte sie eben jene Mittel ein, die meinem Phantasiebild von ihr entsprachen.
Sternchen Siegel legte sich in die Kurve und bremste sein Rennrad vor uns ab. Es war ein schönes Rad, um das ich ihn sofort beneidete, mit vernickeltem Rahmen, die Räder Holzfelgen. Das Rad mußte ein Vermögen gekostet haben. »Herr Pommrehnke«, rief Sternchen Siegel, ein wenig außer Atem, »ich bringe die Schlüssel.«
Wir kannten Sternchen, er führte gelegentlich Aufträge für uns aus. Das Fahrrad war neu, ebenso die Schiebermütze, die Sternchen verkehrt herum auf dem Kopf trug, den Schirm nach hinten. »Toller Bock«, flüsterte Joachim und meinte das Fahrrad.
Die Tür zum Schankraum ließ sich nur mit Mühe öffnen, feuchte, nach schalem Bier riechende Luft schlug uns entgegen. Es war dunkel, das Licht funktionierte nicht. Sternchen und mein Vater gingen vors Haus und rissen Bretter von der Fensterverschalung ab. Als unsere Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannten wir die Theke mit Zapfhähnen, ein Regal, auf dem Gläser und Flaschen blitzten, ein anderes mit Pokalen. Offenbar hatten die Schützen ihre Trophäen hiergelassen. An die negativen Worte meiner Tante denkend, berechtigte mich das zu der Hoffnung, daß wir hier einziehen würden. Ein ganzes Schützenhaus für uns! Und der verwilderte Park, die Festwiese, der Schießstand. Wenn kein Gast käme, um so besser. Ich stieß Joachim in die Seite. »Kolossal«, sagte mein Bruder.
An den Schankraum schloß sich der kleine Saal an und eine Art Anrichte. An der Decke waren Metzgerhaken angebracht. Wahrscheinlich hatten hier früher Würste und Schinken gehangen. Zeppelin war hereingekommen und schnüffelte die Ecken des Raumes ab. Hinten führte eine Treppe in die oberen Wohnräume. Sie lag fast vollkommen im Dunkeln, mein Vater mußte mehrere Streichhölzer anreißen, damit wir den Weg fanden. Im ersten Stock waren jedoch die Fenster unverschalt geblieben. Licht flutete herein, als wir die Zimmertüren öffneten. Die Zimmer gingen von einem langen Gang ab, ganz am Ende befanden sich Klosett und Badezimmer. »Komfortabel«, sagte mein Vater, »sogar Dampfheizung«.
»Wo ist die Küche?« fragte Tante Deli. Sternchen Siegel, der sich hier anscheinend auskannte, sagte, die Küche liege im Keller. Wir tasteten uns die dunkle Treppe wieder runter und weiter über eine noch dunklere und engere Treppe in den Keller. Sternchen hatte eine Stallaterne gefunden, die einen Rest Petroleum enthielt. Wir entzündeten den Docht und drangen in die unteren Regionen des Hauses ein. Auf einer Seite lagen Kohlenkeller und Heizung, auf der anderen befand sich die Küche mit gewölbter Decke und einem gewaltigen Herd in der Mitte. Eine Tür öffnete sich zum Bier- und Weinkeller.
»Sehr schön«, sagte Tante Deli, »aber unpraktisch. Wer will immerzu in den Keller? Und wer trägt die Speisen rauf?«
Sternchen demonstrierte, daß es einen Speiseaufzug gab, bis in den ersten Stock sogar, in die Wohnung. »Sehr schön«, wiederholte Tante Deli. »Doch man braucht Personal.«
Was die beiden weiter besprachen, hörten wir nicht, längst waren mein Bruder und ich wieder nach oben gelaufen und durchstöberten die Zimmer. Hier und da war ein Möbelstück stehengeblieben, eine Seemannskiste, ein Vertiko, das unserem daheim glich, ein Regal aus Bambusrohr mit Glastüren und Vorhängen hinter den Scheiben. Die Seemannskiste war zu unserer Enttäuschung leer. Im Vertiko fanden wir rund ein Dutzend angestaubte weiße Kragen, wie sie damals jeder Mann trug, Kragen, die mit Durchsteckknöpfen am Hemd befestigt wurden. Man wechselte die Kragen häufiger als das Hemd.
Die Tür zum Bambusschränkchen klemmte, sprang aber auf, als wir an dem Möbel rüttelten. Eine Schachtel befand sich darin, die Schachtel war mit Filmrollen gefüllt. Kleine Rollen für ein Heimkino, damals etwas Seltenes, aber wir hatten so eine Apparatur einmal bei unserem Schulkameraden Benjamin gesehen, der wohlhabende Eltern hatte. Doch hatten wir uns keine Filmvorführung ansehen dürfen, draußen schien die Sonne, und Benjamin schickte uns in den Garten zum Spielen.
Wir starrten auf die Filmrollen. »Die nehmen wir mit«, sagte Joachim, »nicht alle, aber ein paar. Jeder steckt sich zwei oder drei unter das Hemd.«
»Und was machen wir damit?«
»Wir gehen zu Benjamin. Vielleicht passen sie auf seinen Apparat.«
»Dann will er sie haben. Was meinst du, was drauf ist?«
»Was weiß ich? Sauereien vielleicht. Haremsdamen oder Bauchtanz. Ich hab’ so was mal auf einem Kinoplakat gesehen. Für Jugendliche verboten.«
»Die Filme gehören uns nicht.«
»Wem können die schon gehören? Wenn wir hier einziehen, wirft Tante Deli sie in den Müll.«
»Dann können wir doch den ganzen Karton mitnehmen.«
»Damit wir alle Filme wieder loswerden? Stell dir vor, es sind wirklich Haremsdamen drauf. Vater guckt sich das an, gegens Licht, und schwupp!, sind die Dinger beschlagnahmt. Nee, nee, wir schmuggeln ein paar davon raus und sehen erst mal in meiner Dunkelkammer nach, was drauf ist.«
»Und dann?«
»Dann müssen wir an so eine Maschine kommen. An ein Vorführgerät. Ich will längst so was haben. Hast ja gesehen, der kleine Saal. Wenn wir hierherziehen, mache ich Kintopp.«
»Du? Dafür muß man erwachsen sein.«
»Knallkopp. Wer sagt das?«
Darauf wußte ich keine Antwort. Wir ließen ein paar Spulen in unsere Hemdausschnitte gleiten und schoben sie unter den Gürtel. Die Erwachsenen blieben vor der Tür stehen, unterhielten sich. »Wo seid ihr?« rief Tante Deli. Wir liefen die düstere Treppe hinunter, an ihnen vorbei. Wahrscheinlich sollten wir alle gemeinsam zum großen Saal rübergehen, diesen Anbau besichtigen, die Remisen. Wenn mich nicht alles täuscht, schlug Sternchen Siegel sogar mit einem Knüppel, den er aufgelesen hatte, einen Pfad durch die Brennesseln zur Kegelbahn. Ich könnte meine Gedanken weiterspinnen und behaupten, mein Vater habe eine Kugel aufgenommen, sie geschoben und – »alle Neune«.
Möglich. Ich weiß es nicht mehr. Auch die Pferdeställe an der anderen Seite des Saalbaus entdeckte ich erst später, bei einem weiteren Besuch. Ich will nicht ausschließen, daß wir auch sie besichtigten, damals, am ersten Tag. Aber die Faszination meines Bruders hatte mich angesteckt, die Filmrollen brannten mir unter dem Hemdstoff. Nur daran erinnere ich mich noch, daß Sternchen sich wieder auf sein Rad schwang und mit einem »Ist jeritzt« in die Pedale trat. Mein Vater gab einen merkwürdigen Spruch von sich, er sagte: »Goldschnitt vergeht – Schweinsleder besteht.«
Wir rannten den Weg zurück, waren längst vor den anderen zu Hause. In Joachims Dunkelkammer wickelten wir die Spulen auf, hielten Film um Film gegen das Licht. Tieraufnahmen waren auf dem ersten, »enttäuschend«, flüsterte Joachim. Es schien sich um Filmaufnahmen aus dem Zoo zu handeln. Eine Schar Pinguine, meterweise Film nichts als Pinguine. Dann Seerobben. Ein Eisbär.
Auch die nächsten Spulen enthielten Tieraufnahmen, eine fing mit Giraffen an, die andere zeigte das Elefantenhaus von außen, es war tatsächlich unser Zoo in der Budapester Straße, den wir von einigen Besuchen kannten. Jedes Berliner Kind wurde sonntags in den Zoo geschleppt, ich dachte lange, daß es andere Tiere als eingesperrte gar nicht gäbe. Schilderungen von Tieren in freier Wildbahn, die ich irgendwo las, nahm ich nicht zur Kenntnis, oder jedenfalls drangen sie nicht in die Tiefe meines Bewußtseins, so, als ob sie sich auf einem anderen Stern befänden. Nur die Zootiere hielt ich für »die Wirklichkeit«.
Die Filme waren stark beschädigt. Feuchtigkeit hatte Teile der Emulsion abgelöst, andere Partien, die wir entrollten, waren zerkratzt, und manchmal war der Film an der Perforierung zerrissen. Erst zum Schluß wurden wir belohnt. Die letzte Spule, am besten von allen erhalten, zeigte Charlie Chaplin. In Charlies Begleitung befand sich ein kleiner weißer Hund. »Den Film kenne ich«, sagte Joachim. »Ich habe ihn gesehen. Der heißt ›Hundeleben‹. Charlie ist ein Arbeitsloser, er und der Hund verhungern beinahe.«
Joachim ging oft in die Kindervorstellungen im Heli-Kino, ich nur manchmal. Ich machte mir nicht viel aus Kintopp, Joachim war von den Filmen fasziniert. Es gelang ihm fast immer, sich das Eintrittsgeld zusammenzuschnorren.
Wir wickelten die Spulen wieder auf.
»Was machen wir?« fragte ich.
»Wir bauen so einen Apparat. Zum Vorführen«, sagte Joachim.
Nichts schien sich in unserer Familie nach der Besichtigung des Schützenhauses geändert zu haben. Nur aus Gesprächen, die wir hin und wieder belauschten, ging hervor, daß der Plan, das Schützenhaus zu übernehmen, Gestalt annahm. Einmal sagte mein Vater zu Tante Deli: »Das Geld wird nicht bleiben. Besser, wir stecken es …« Er vollendete den Satz nicht, aber mir war klar, daß er sagen wollte, »ins Schützenhaus«.
»Es geht uns doch gut«, sagte Tante Deli. »Warum willst du was riskièren? Sieh dich um, fast keiner hat mehr einen Pfennig nach dem Krieg. Und wenn die Versailler Verträge kommen …«
Ich wußte nicht, was die Versailler Verträge waren, in der Schule vermied man, uns über die Probleme der Gegenwart zu informieren. Wir nahmen gerade Sedan durch, ein Anlaß, der den Lehrer zu der Behauptung hinriß, 1918 seien unsere Truppen im Felde unbesiegt zurückgekehrt. »Im Felde unbesiegt«, schrie unser Geschichtslehrer, das Kyffhäuser-Abzeichen auf dem Revers seines Anzuges blitzte. Er trug immer denselben Anzug, damals war das üblich. Ich habe seinen Namen vergessen, nur der Spitzname ist mir in Erinnerung geblieben, Bullus, wir nannten ihn Bullus wegen seiner gedrungenen Gestalt.
Bullus verriet uns nicht, wie das Leben weitergehen würde in diesem Land, das mein Vater als besiegt bezeichnete trotz der unbesiegt heimgekehrten Armee. Wir lebten auf einer Insel, Millionenbauer-Erben, mit armen Verwandten gesegnet, die von Zeit zu Zeit aus der Stadt hierher in den Vorort kamen und sich über meinen Vater mokierten, der im Bett liegenblieb, während sie an unserem Eßtisch Schmorbraten in sich hineinstopften.
2
Mein Vater legte sich wieder ins Bett. Er raschelte mit den Zeitungen, sein Kopf mit den militärisch kurzgeschnittenen Haaren ragte aus den Kissen. Wer etwas von ihm wollte, blieb im Türrahmen stehen, bis der Blick aus blauen Augen ihn traf.
Sternchen Siegel fuhr fast jeden Tag auf seinem Rennrad vor. Damit begann eine Epoche, in der mein Vater sich überraschend oft von seiner Lagerstatt erhob. Am Eßtisch sitzend, blätterte er in Papieren und erteilte Sternchen Aufträge. Bei solchen Anlässen rückte Sternchen den Schirm seiner Mütze nach vorne, er nahm sie aber nicht ab, obwohl Tante Deli ihn des öfteren dazu aufforderte: »Nehmen Sie doch Ihren Deckel ab, wenn Sie bei uns im Zimmer sitzen.«
Sternchen grinste, behielt aber die Mütze auf. Wenn er davonfuhr, drehte er den Schirm wieder nach hinten.
Manchmal verließ mein Vater das Haus, es hieß dann, er sei zum Schützenhaus hinübergegangen. Er forderte uns jedoch nie auf, ihn zu begleiten, nur Zeppelin nahm er mit. Kam er von einem dieser geheimnisvollen Gänge zurück, saßen wir Kinder um den Eßzimmertisch, auf dem er seine Papiere ausbreitete. Dieser Tisch war der zentrale Versammlungspunkt, hier wälzte Tante Deli ihre Wirtschaftsbücher, gewichtige Kladden in schwarzen Kaliko-Einbänden. Auf der grünen Tischdecke lagen auch unsere Schulbücher.
Wir machten Schularbeiten. Oder jedenfalls gaben wir vor, sie zu machen. Joachim und mich langweilten Hausaufgaben, das Wichtigste erledigten wir während der Pausen in der Schule, genierten uns nicht, abzuschreiben in Fächern, in denen wir schwach waren. Anneli hingegen, mit der Ordentlichkeit einer Katze, die ihr Fell durch Lecken reinhält, malte ihre Buchstaben und Zahlen. Wir halfen ihr, weil wir unseres eigenen Pensums überdrüssig waren. Bereits zu Beginn eines jeden Schuljahrs, wenn wir die neuen Bücher vom Buchhändler Holzapfel erworben hatten, lasen wir sie durch, von vorne bis hinten, mit rasanter Geschwindigkeit. Der Unterricht konnte uns dann, meinten wir, nichts Neues mehr bieten, von ein paar Überraschungen abgesehen. Die passierten eigentlich nur, wenn ein Lehrer unversehens vom Lehrplan abwich. Dann hielt er sich aber meistens nicht mehr lange in der Schule und verschwand.
Wir saßen am Tisch in diesem zentralen Raum unserer Wohnung, weil wir hier alles erfuhren. Hier war der Mittelpunkt unseres häuslichen Lebens. Mein Vater, von seinen Gängen zurück, umrundete uns, wir sahen zu ihm auf. »Ach, ihr!« sagte er. – Er sagte es mit einer Zärtlichkeit, die bei diesem verschlossenen Mann erstaunte. Wir bedurften dieser Worte, und wir liebten ihn dafür. Manchmal fuhr er uns mit der Hand hinten in den Kragen und zwickte uns in den Nacken, als wolle er seine Kinder wie eine Katzenmutter davontragen, an ein sicheres Plätzchen. Heute bin ich überzeugt, daß dies nicht unbewußt geschah. Da wir mutterlos aufwuchsen, wollte er uns wohl fühlen lassen, daß er in unserer Nähe war, daß es ihn gab, auch körperlich. Dazu gehörten: zwei Holunder-Pistolen, die er uns bastelte, ein Drachen und ein paarmal Prügel mit seinem Leibriemen, den er umständlich abschnallte, bevor er ihn auf unsere Hintern niedersausen ließ.
Heute frage ich mich: Hat das ausgereicht? Aber wir liebten ihn. Väter waren so, damals, in der guten alten Zeit, die keine gute mehr war, wie sich bald herausstellte.
»Das Geld wird gleich nichts mehr wert sein«, prophezeite er, wenn er seine Pläne mit Tante Deli besprach. Wir hatten dann an dem grünen Tisch, wie wir das Möbel der Decke wegen nannten, nichts zu suchen. Joachim ging in seinen Laborkeller, Anneli spielte in ihrem Zimmer mit Puppen, ich jedoch, wißbegierig, drückte mich in der Nähe herum, schnappte auf.
»Wichtig ist die Flucht in die Münze«, sagte mein Vater. »Das können sie so schnell nicht umstellen.« Er hortete in einer Schublade der Schlafzimmerkommode Rollen mit Zweimarkstücken, »für den Notfall«.
Für welchen Notfall? Das Wort Inflation fiel noch nicht. Oder fiel es und bedeutete mir nichts?
Joachim nahm im Labor seine Apparate auseinander. Er wollte einen Projektor bauen, dazu brauchte er die Objektive seines Vergrößerungsapparates. »Das Schwierige ist dieses Malteserkreuz«, erklärte er mir. »Das Malteserkreuz dient der Zerlegung in Einzelbilder.«
In der Großgörschenstraße, in der Nähe unseres Mietshauses, existierte ein Laden mit technischem Krimskrams, eine mit Trümmern angefüllte Höhle, die von einem öligen Mann in grauem Kittel verwaltet wurde, der Herr Meier hieß. Herr Meier trug stets einen Hut, der, nicht weniger speckig als der Kittel, auf seinem Kopf glänzte. Wie unser Vater kaute er auf einem Zigarrenstummel.
Joachim hatte sich mit Herrn Meier angefreundet. Einige Male fuhren wir in die Stadt. Zwar wußte Herr Meier nichts von Projektoren und ihrer Konstruktion, aber er half Joachim bereitwillig beim Suchen und machte ihm Preise, die unseren bescheidenen Taschengeldverhältnissen angemessen waren. Für ein paar Mark schleppten wir Kisten von möglicherweise brauchbaren Teilen in unsere Vorortwohnung und dann in Joachims Labor. Joachim schob sich, wenn er die Schätze auspackte, die Brille auf die Stirn, er sah besser ohne diesen Korrekturapparat, der ihn überdies verunstaltete.
Manchmal spionierten wir auch bei Benjamin. Wir sagten ihm nichts von unseren Filmfunden, obwohl wir den Chaplin-Film gern gesehen hätten, anderer Filmstreifen wie »Fips, der Affe« und ähnlicher fürs frühe Heimkino produzierter Banalitäten waren wir überdrüssig. Joachim ging es darum, die Geheimnisse des Projektors zu ergründen, der mit einer Handkurbel betrieben wurde. Benjamin behielt sich die Vorführung selbst vor, er ließ weder Joachim noch mich an seine Maschine, die, grau und gußeisern, auf einem Gestell montiert war.
Ein neues Problem ergab sich mit der Lampe. Eine hohe Lichtstärke war nötig, damit die Bilder klar auf der Leinwand erschienen. Die Lampen strahlten jedoch dermaßen viel Wärme ab, daß sie die Filmoberfläche beschädigten. Wir experimentierten mit unterschiedlichen Lichtstärken, benutzten die erbeuteten Tierfilme.
»Es gibt keine Lösung«, sagte Joachim. »Benjamins Apparat besitzt ein Kühlgebläse. Ich sehe mich außerstande, so ein Gebläse zu bauen.«
Wieder so eine geschraubte Redewendung: »Ich sehe mich außerstande.« Diesmal wußte ich, wo er sie herhatte. Professor Rübelmann, der in seiner und meiner Klasse Latein gab, sagte gern: »Ich sehe mich außerstande, euch Primitivlingen diese schönste aller Sprachen zu vermitteln.«
»Was bastelt ihr eigentlich?« fragte einmal mein Vater. Wie üblich, legte er jedoch auf eine präzise Antwort keinen Wert. Ja, er verzichtete meistens überhaupt auf Antworten unsererseits. Er kümmerte sich nicht um unsere Schularbeiten, allenfalls fragte er, wenn er, des Bettdaseins überdrüssig, um den Tisch strich: »Kommt ihr gut voran?« Unsere Zeugnisse enthielten wenig Hinweise auf unsere Faulheit, wir reparierten die ärgsten Katastrophen durch unser ausgefeiltes Abschreibesystem. Anneli durchschaute uns. »Ihr seid von der Firma Klemm und Lange«, spottete sie, zaghaft, sie wollte das Hilfssystem nicht gefährden, von dem wiederum sie profitierte. In wenigen Minuten rechnete Joachim Annelis Divisionsaufgaben aus, sie selbst hätte den ganzen Tag dafür gebraucht.
»Wir könnten«, schlug Joachim vor, »die übrigen Filme aus dem Schützenhaus holen.«
»Es ist verschlossen«, gab ich zu bedenken. »Die Fenster sind vernagelt.«
»Hat uns so was je gestört?«
Wir pfiffen Zeppelin. Anneli war spielen bei einer Freundin, wir hätten sie nicht dabeihaben wollen. Alarmiert rief Tante Deli aus der Küche: »Wo wollt ihr hin? Ihr richtet doch nichts an?«
»Ein bißchen raus«, sagte Joachim. »Den Hund ausführen. Zeppelin liegt den ganzen Tag nur unter dem Bett.«
Tante Deli stellte sich in den Türrahmen, diesmal in der Küchentür, die ebenfalls auf unseren Dorfplatz, das Eßzimmer, mündete. Hier herrschte ein angenehmes Halbdunkel, es machte das Lügen oder, wie wir es nannten, das Verharmlosen leichter. Tante Deli wußte das und betätigte den Lichtschalter. Der Kronleuchter flammte auf, ein aus Geweihen bestehendes, mit elektrischen Kerzenimitationen bestücktes Monstrum, mein Vater behauptete, es stamme aus einem ehemaligen Jagdschloß des Prinzen Adalbert von Preußen. Ich bezweifle heute, daß Prinz Adalbert – gab es ihn? – ein Jagdschloß besaß, und wenn, daß er sich zugunsten des Millionenbauernsprosses Walter Pommrehnke von einem Kronleuchter getrennt hatte.
Gleichviel, der Kronleuchter übergoß uns mit Licht. Mit entlarvendem Licht. »Ich kenne meine Pappenheimer«, drohte Tante Deli. »Macht bloß keine Dummheiten.«
Wir verzogen uns in Richtung Ausgang, jagten mit Zeppelin die Treppe hinunter.
Gegenüber lag ein Park, uns als Spielplatz vertraut. Als wir klein waren, wurden wir in diesen Park zur Buddelkiste geführt. Joachim war bald dem Sandspiele-Alter entwachsen, mußte aber mitgehen. Er haßte seitdem diesen Park. Zeppelin hielt auch nichts von solchen miserablen Jagdgründen, es gab dort nur Eichhörnchen.
Ausgerechnet heute verschwand er pfeilschnell über die Straße ins Unterholz. Wir pfiffen und riefen, ohne Erfolg. »Scheißtöle«, sagte Joachim, indem er Papas Bezeichnung für Zeppelin im Stadium des Ungehorsams benutzte.
Bei der ersten Parkbank trafen wir ihn. Er hockte vor einem Mann, der auf der Bank seine Mahlzeit ausgebreitet hatte, Wurststullen, das Butterbrotpapier glänzte vor Fett. Gerade nahm der Mann eine Bierflasche auf und setzte sie an. Zeppelin beobachtete ihn mit treuestem Hundeblick. Der Mann trank und setzte die Flasche ab. »Eurer?« fragte er. »Scheint ’n richtijer Jachthund zu sein, wat? Ick sage euch, so wat verkümmert in de Stadt. Kiekt mal, wie der hinter meine Stullen her is. Jesetzt der Fall, ick jeb ihm ’ne Käsestulle, wa? Ick hab zufällich keene Käsestulle, aber wenn ick nu eene hätte? Der Hund frißt Käse, denn riecht er nüscht mehr. Für die Jacht unjeeignet. So ’n Hund verliert den Jeruchssinn. Na ja. Vielleicht nich von eene einzije Käsestulle. Aber auf die Dauer. In de Stadt verderben se die Hunde. Wie heeßt er denn?«
»Zeppelin.«
»Zeppelin? Det is mir vielleicht ’n Name for ’n Hund. Wem is det einjefall’n? Kann er fliejen?«
»Er heißt eben so. Natürlich kann er nicht fliegen«, sagte Joachim und nahm Zeppelin beim Halsband. »Er hieß so, als wir ihn bekamen.«
»Vielleicht kann er wirklich fliejen«, brummelte der Mann. »So jenau kann ick det nich sehen, ick hab mir jestern uff meene Brille jesetzt, und nu isse hin. Hier, een Happen von meene Wurststulle, is beste Mettwurst von Jebrüder Jroh. Und nu haut ab.«
Zeppelin schnappte sich den Bissen. Wir nahmen ihn an die Leine. Erst jenseits der Unterführung ließen wir ihn frei.
»Heute ist was fällig«, sagte Joachim. Er wußte nicht, wie recht er hatte. In der Laubenkolonie Tausendschön lebten unsere Feinde. Ein gewisser Wilfried hatte eine Bande gebildet. Wilfried Wumme nannten sie ihn, er spielte bei der Jugendmannschaft der »Wespen« Fußball, seine Elfmeter, als Wummen bezeichnet, galten für unhaltbar.
Eine Weile hatte Waffenstillstand geherrscht. Doch seit wir Sirene, den Kleinsten von Wummes Bande, geschnappt hatten, war Wumme wieder hinter uns her. Wir hatten Sirene den nackten Hintern mit Akazienruten versohlt. Er schrie mörderisch, machte seinem Namen Ehre, das Geschrei stand in keinem Verhältnis zu dem Schmerz, den wir ihm zugefügt hatten. Sirenes Abgang war filmreif, er ließ die Hosen baumeln, hielt sich mit beiden Händen die Hinterbacken und schrie, während er mit winzigen, von der baumelnden Hose gehemmten Schritten der Laubenkolonie entgegentaumelte. Wir hatten uns nicht allzulange an dem Anblick weiden können, Sirenes Geschrei hatte Wummes Bande alarmiert. Damals waren wir ihr entkommen, aber wir wußten: Kriegszustand herrschte.
Nun hätten wir einen Umweg machen können. Doch in unseren Köpfen ging nichts anderes rum als der Gedanke, an die Filme im Schützenhaus heranzukommen. Wir trabten den Sandweg entlang, zwischen den Akazien. Weit voraus hörten wir Zeppelin kläffen. Ich fürchtete mich vor der Brücke über den Graben.
In der Schule hatten wir ein Gedicht gelernt, in dem eine Brücke vorkam, die einstürzte, wenn Kinder gelogen hatten. Ich hatte das Gedicht ernst genommen. Aber die Brücke über den Graben würde nicht einstürzen, wenn ich sie nur mit einer Lüge im Herzen betrat, das glaubte ich fest. Doch sie hieß unter den Vorstadtkindern auch »Wilfried-Wumme-Brücke«. Der Name deutete auf Eigentumsrechte hin, das war Wilfrieds Brücke, er beherrschte sie, ihm oblag es, den Steg nach Belieben zu sperren oder freizugeben.
»Joachim«, rief ich. Doch mein Bruder zockelte durch den grünen Tunnel, in einer Art Hundetrab, den er Zeppelin abgeschaut hatte, Sand stob auf unter seinen Sohlen.
»Joachim!«
Seine Filme. Warum ließen wir sie nicht in dem Karton? Ohnehin würden wir nie einen Apparat besitzen, mit dem wir sie sehen könnten. Noch mehr Pinguine und Eisbären auf beschädigtem Zelluloid. Andere Jungen stellten Rauchbomben damit her, man wickelte die Filmstreifen fest in Papier, zündete ein Ende an, und die Rauchfahnen, die sich durch das langsame Glimmen entwickelten, erschreckten Lehrer und Nachbarmädchen.
Die Brücke. Wenn Wilfried und seine Komplizen uns schnappten, würden sie jene Mißhandlungen an Joachim und mir rächen, die wir Sirene hatten angedeihen lassen.
Der Weg öffnete sich. Ans Brückengeländer gelehnt, stand Wumme. Er paffte eine Zigarette, die er, zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt, ruckartig zum Mund führte. Hinter ihm lehnten zwei andere Jungen aus der Kolonie in ähnlicher Haltung am Geländer, sie ahmten Wumme nach, doch die ungeheure Lässigkeit ihres Anführers blieb für sie unerreichbar. Zeppelin raste davon, die Böschung hinunter. Neben der Brücke setzte er über den Graben, sauste die gegenüberliegende Böschung hinauf und verschwand.
Joachim ging, das Traben hatte er eingestellt, langsam auf die Brücke und ihre Bewacher zu. Ich holte auf, marschierte hinter meinem Bruder im Gleichschritt. Wie würde er sich entscheiden? Würden wir Zeppelins Beispiel folgen und über den Bach springen? Würden wir umdrehen und weglaufen? Fast wünschte ich das. Wenn die Ehre nicht gewesen wäre. Ehrenvoll das Kommende durchstehen, eine andere Möglichkeit, ahnte ich, gab es nicht.
Der Abstand schmolz. Schon konnte ich, wie es in den Groschenheften hieß, die wir damals verschlangen, »das Weiß im Auge des Feindes« sehen. Wir gingen weiter.
Jetzt betrat Joachim die Brückenbohlen. Wilfried Wumme und seine Mannen blickten uns an, reglose Gesichter. Wilfried warf seinen Zigarettenstummel hinter sich in den Bach. Wir gingen so nahe an den Feinden vorbei, daß wir sie fast streiften. Der Steg war schmal. Ich wartete auf den Faustschlag.
Doch nichts geschah. Reglos verharrten unsere Feinde. Erst als Joachim den letzten Brückenwärter passierte, griff dieser blitzschnell in Joachims Gesicht und riß ihm die Brille von der Nase. Joachim blieb stehen, plötzlich, so daß ich gegen ihn rannte. Der Feind schwenkte Joachims Brille an einem Bügel, wie man einen Knochen vor einer Hundenase schwenkt. Ich rechnete damit, daß Joachim nach seiner Brille griff. Gleichzeitig hoffte ich, er würde es nicht tun, sich keine Blöße geben, die unsere Ehre beeinträchtigen könnte.
Half mein Wünschen? Joachim stand regungslos, ich hautnah hinter ihm. Er mußte meinen Atem im Nacken spüren. Der Junge hielt die Brille, sie tanzte vor Joachims Gesicht. In diesem Augenblick sagte Wilfried mit gefährlich ruhiger Stimme:
»Gib sie ihm wieder.«
Der Junge lachte, in schrillem Ton. Dann warf er die Brille in den Graben.
Wir drehten uns um. Wilfried kam auf uns zu. Er ging mit wiegendem Schritt, so, wie es später Gary Cooper in »Zwölf Uhr mittags« demonstrierte. Der Junge lachte wieder, aber nun leise, verlegen.
Einen Schritt vor uns blieb Wumme stehen. »Hol die Brille«, sagte er zu seinem Kumpel. Der zuckte mit den Achseln. Die Hände in seine Taschen gebohrt, ging er zum Ende des Stegs. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er die Böschung hinabkletterte.
Wumme sah uns nicht an. Sein Blick blieb auf die Brückenbohlen geheftet.
Sein Kumpel kam zurück. Reichte Joachim die Brille. Sie war mit Schlamm beschmiert, ein Glas war zerbrochen. Joachim nahm sie mit einer Handbewegung, in der größtmögliche Zurückhaltung lag, als traue er dem Frieden nicht.
Jedoch verlief die Übergabe reibungslos. Ich stubste Joachim in den Rücken. Wir setzten unseren Weg fort. Wir drehten uns nicht um, hörten, wie Wumme und seine Kumpane abzogen, sie trampelten über die Bohlen der Brücke nach der anderen Seite, dort führte ein Weg in die Kolonie. Einer von Wummes Begleitern sang: »Wie oft sind wir geschritten – auf schmalem Negerpfad…«
Nach einer Weile blieb Joachim stehen, ich ebenfalls. Mein Bruder zog sich einen Hemdzipfel aus der Hose und rieb an dem heilen Glas der Brille. »Verdammte Obermückenscheiße«, sagte er. »Das Nasenfahrrad ist im Eimer.« Wieder einmal griff er hoch bei der Wahl seiner Worte.
Ich überlegte: Warum hatten die Tausendschönchen, wie wir die Kinder aus der Laubenkolonie nannten, uns nicht verprügelt? Warum hatten sie uns nicht in den Graben geworfen? Warum uns nicht – für diese Spezialität waren sie bekannt – an die nächste Akazie gefesselt? Kaum jemand benutzte den Weg, es hätte Stunden gedauert, bis wir gefunden worden wären.
»Warum haben sie uns nicht verkloppt?« fragte ich Joachim.
»Weiß nicht«, brummte mein Bruder. Er hatte die kaputte Brille aufgesetzt, sah mich durch das immer noch verschmierte eine Glas an. »Vielleicht heben sie sich das auf. Für den Winter.«
Es wunderte mich nicht, als er sagte: »Dies ist kein Tag fürs Schützenhaus. Gehen wir nach Hause.«
Ich nickte. »Aber den Umweg. Wo ist Zeppelin?«
Wir pfiffen. Zeppelin brach aus einem Gebüsch, mit Gras und Kletten behängt. Sein Schwanzwedeln drückte höchste Unschuld aus, als erwarte er, daß wir ihn lobten, ihm ein »Brav, lieber Hund« entgegenschmetterten. Statt dessen rief Joachim: »Ratte!«
Zeppelin zog die Lefzen hoch. Ich glaube, er lachte uns aus.
3
»Ratten«, brüllte mein Vater. Er warf den erkalteten, zerkauten Zigarrenstummel in den Aschenbecher. »Womit habe ich das verdient!«
Wir standen vor ihm, Joachim mit verschmierter Brille. Die Sonne schien schräg ins Schlafzimmerfenster. Mein Vater saß im Bett und betrachtete uns. Ach, wäre es doch ein trüber, dunkler Tag gewesen, ein Novembertag mit Regenwolken. Statt dessen diese strahlende Abendsonne, die uns wie ein Scheinwerfer beleuchtete.
Hinter uns, natürlich an den Türrahmen gelehnt, stand Tante Deli. »Ich hab’ gleich gesagt, sie taugen nichts«, sagte sie. »Seit ihre Mutter tot ist, tun sie, was sie wollen. Du kümmerst dich nicht genügend um deine Jungen, Walter. Sie verkommen.«
»Du?« rief mein Vater. »Du fällst mir in den Rücken?«
Hinter Tante Deli sah ich, im Halbdunkel des Eßzimmers, Anneli. Sie stand auf einem Bein und popelte in der Nase. »Stubenarrest«, sagte mein Vater. »Eine Woche Stubenarrest.«
»Wie sieht der Köter aus«, schimpfte Tante Deli. »Ich muß die ganze Schweinerei wieder in Ordnung bringen. Und Hansi! Ihr seid richtige Ferkel.«
»Der kleene Hansi ist ein Ferkel«, schrie Anneli. Ich warf das Rechenbuch nach ihr, das auf dem Tisch unter dem vermaledeiten Kronleuchter lag. »Wasch lieber die Töle«, schrie ich zurück.
»Ruhe im Beritt«, brüllte mein Vater. Manchmal unterliefen ihm, Gewohnheit aus seiner Kavalleristenzeit, militärische Ausdrücke. Ich hörte, wie Anneli in ihrem Zimmer, hinter geschlossener Tür, zwitscherte: »Hansi mit dem kleinen Schwansi…«
Konspirative Überlegungen hielten uns die nächsten Tage in Atem. An der Tür war mit Reißnägeln der Stundenplan befestigt, von Tante Deli einsehbar. Sie wußte, wann wir Schulschluß hatten und zu Hause eintreffen würden. Von diesem Augenblick an begann übergangslos unser Hausarrest. Wir wollten uns aber unbedingt die übrigen Filmrollen aus dem Schützenhaus beschaffen.
Hoffnung schöpften wir durch die Tatsache, daß die Erwachsenen immer öfter ihre Köpfe zusammensteckten und, wie Joachim es nannte, »die Zukunft besprachen«. Wenn ich mir das heute, in der Erinnerung, zusammenreime, beschäftigte sie die bevorstehende Inflation. Mein Vater meinte, man müsse alles verfügbare Geld anlegen, sogar Bankschulden machen. Das löste bei Tante Deli Monologe etwa folgender Art aus.
»Woher willst du Geld nehmen? Hättest du nur nicht Kriegsanleihe gezeichnet. Das Geld ist futsch. Ich frage dich nicht, wieviel du verloren hast, geht mich nichts an. Mir ist jedoch nicht entgangen, daß auf den Häusern Hypotheken liegen. Wir sparen, wo wir können. Die Mieteinnahmen, da will ich lieber nicht von reden. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Weiß ja auch, was du mir für den Haushalt gibst. Wenn du von den Einnahmen die Hypothekenzinsen bezahlen kannst, kannst du froh sein, oder? Und wovon willst du das Schützenhaus bezahlen? Die Brauerei gibt Kredit? Wofür gibt sie Kredit? Fürs Bier. Vielleicht stiftet sie dir ein Dutzend Gläser. Und ein Wirtshausschild. Hast du bereits bestellt? Wer zahlt das? Geht mich nichts an. Ich weiß, ich weiß, du kaufst das Schützenhaus nicht, du pachtest es. Und wenn keiner kommt? So weit draußen. Wer will da sein Bier trinken? Die Leute gehen in die Kneipe an der Ecke. ’ne Molle mit Korn. Boulette. Solei. Bis Schützenfest ist, wird das Bier mulsch. Mensch, Walter! Siehste denn das alles nicht?«
»Doch, doch …« Mein Vater saß aufrecht in seinen Kissen.
»Und dann der Umbau«, fuhr meine Tante fort, wobei sie Stand- und Spielbein wechselte. »Wer soll das bezahlen? Wenn wir in den Räumen oben wohnen sollen, müssen die Maler kommen. Gleich ist Winter. Wer bezahlt den Koks? Und glaub ja nicht, daß ich dir den Dreck wegmache. Du brauchst Personal, für die Schank, einen Kellner. Wenn nichts läuft, hauen die ab. Also mußt du dir was einfallen lassen. Meinste, du kannst weiter im Bett liegen wir dieser Oppusoff ?«
»Oblomow«, korrigierte mein Vater.
In der Tat saß er bald mehr am Tisch unter dem Kronleuchter, als daß er im Bett lag. Von der Brauerei kam manchmal ein Vertreter, und sie rechneten. Es war nicht mehr Berliner Kindl, wie man hätte meinen können, wenn man an das schief hängende Reklameschild am Schützenhaus dachte. Mein Vater hatte sich mit Schultheiß Patzenhofer verbündet.
Warum?
»Das Bier schmeckt mir besser«, sagte er. »Persönlicher Geschmack. Nischt gegen Berliner Kindl.«
»Ich will Faßbrause haben«, sagte Anneli. Mein Vater beruhigte sie: »Faßbrause wird auch ausjeschenkt.«
Tante Deli faßte sich an ihren Dutt. »Wenn das man gutgeht.«
Sternchen Siegel kam mehrmals täglich, nahm Aufträge entgegen. Worum es sich im einzelnen handelte, erfuhren wir nicht, eine Menge Wörter fielen, mit denen sich für uns keine Vorstellung verband. Wir wußten lediglich, daß Sternchen die Schlüssel zum Schützenhaus besaß.
Wie aber an die Schlüssel rankommen? Und wie den Stubenarrest umgehen? Sollten wir Sternchen zu unserem Komplizen machen? Diese Filmangelegenheit war für Joachim und wider Erwarten auch für mich in einen Bereich hoher Wichtigkeit gerückt. Vielleicht hätten wir einfach fragen sollen: »Da ist ein oller Karton mit Filmen. Können wir die haben?« Aber das fiel uns nicht ein. Tiefer und tiefer verstrickten wir uns in unsere Geheimnistuerei.
Joachims Dunkelkammer diente uns als Zentrale für unsere konspirativen Sitzungen. Ungestört blieben wir dort jedoch nicht. Tante Deli legte in berechtigtem Mißtrauen Kontrollgänge ein, sie schlich die Treppe hinunter, stand überraschend in der Tür. »Da seid ihr«, sagte sie, als habe sie uns überall sonst vermutet, nur nicht hier. »Und die Schularbeiten?«
Sie erwartete keine Antwort. Nach wie vor pfiffen wir auf die Schularbeiten, und sie wußte es. Ein stillschweigendes Abkommen: ihre Frage, keine Antwort.
Auf der Leine über dem Spülbecken hing an Klammern das Foto von der Libelle, irgendwann hatte Joachim es aus dem Wasser genommen und aufgehängt, seine letzte Vergrößerungsarbeit. Der Apparat war auseinandergenommen, die Optik in ein Gestell eingefügt, das einem verkleinerten Schiffshebewerk glich. Wir schraubten an diesem Apparat, bastelten eine Transmission, zweckentfremdeten die Kurbel vom Grammophon im Wohnzimmer, das fiel niemandem auf, keiner spielte Schallplatten. Doch der Projektor funktionierte nicht. Entweder haperte es mit dem Filmtransport, oder die Lampe war zu schwach, oder die stärkere Lampe setzte den Film in Brand.
Und die Filme im Schützenhaus? Die Erwachsenen, meinten wir, hätten genügend Gründe, die Wohnung zu verlassen. Der Hund mußte ausgeführt, das Schützenhaus besichtigt, die Brauerei besucht weren. Außerdem waren wir jetzt Groß-Berlin. Fast vier Millionen Einwohner. Das Leben tobte, auf dem Kurfürstendamm, Unter den Linden, Friedrichstraße, wir lasen es täglich in den Zeitungen, die sich in Stapeln häuften, neben dem Bett meines Vaters und auf der Anrichte.
Er liebte Zeitungen, glaubte wohl auch ein bißchen, was darin stand. Aus dem Felde hatte er damals Tante Deli angewiesen, Kriegsanleihen zu zeichnen, Walter Rathenau, zu der Zeit Präsident der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, hatte in der Zeitung geschrieben: »Schmiedet die goldene Rüstung dem Arm, der das stählerne Schwert führt!«
Sie saßen um den Tisch unter dem Kronleuchter, statt auszugehen. Unser Vater kaufte Schnaps. »Ich lagere den ein«, sagte er. »Saufen tun sie immer.«
Aktivitäten, die unsere Zukunft im Schützenhaus betrafen. Eine Zukunft, die wir uns nicht vorstellen konnten. Wir dachten an die Filme. Tante Deli ging einkaufen, während wir in der Schule die Stunden absaßen. Den Stundenplan hatte sie besser im Kopf als wir. Rechtzeitig war sie vom Markt in der Spandauer Straße zurück, um unsere Ankunft zu kontrollieren. Den Hund führte Anneli aus. Sie bekam sogar ein Extrataschengeld dafür. Wir hatten das, wie Joachim es wütend formulierte, »gratis und franko« getan.
Anneli spielte Hundefamilie. Ein Stoffhund, weiß mit schwarzen Ohren und hartem Holzwollebauch, war das Kind, wurde in Puppenkleider gehüllt, im Puppenwagen umhergeschoben. Zeppelin war der Vater, Anneli die Mutter. »Dir wird ‘ne Hundeschnauze wachsen«, spottete ich.
»Leck mich«, sagte Anneli, sie lernte solche Ausdrücke von Lieschen, der Portierstochter in unserem Haus.
Zeppelin wußte wenig mit seiner Vaterrolle anzufangen, er beschnüffelte den Puppenwagen, in dem der Stoffhund lag, stellte jedoch per Duftsynthese fest, daß er sich zur Vaterschaft nicht bekennen mußte. »Du blöder Zellepin«, rief Anneli, »siehst du nicht, daß hier dein Kind liegt?« Zeppelin sah es nicht. Er kroch unters Bett, sobald unser Vater sich hineinlegte, und steckte die Schokonase hervor.
Joachim meinte, wir müßten die Schule schwänzen. »Was hast du Mittwoch in der letzten Stunde?«
Ich sah auf den Stundenplan: »Geschichte. Die Reichsgründung durch Bismarck. Habe ich schon gelesen.«
»Knorke. Ich habe Musik. Fällt auch nicht auf, kombiniere ich. Wir hauen nach der vierten Stunde ab und holen die Filme.«
»Wir haben keinen Schlüssel fürs Schützenhaus«, sagte ich.
»Schnurz und piepe. Wir lösen ein Brett vorm Fenster. Zur Not schlagen wir eine Scheibe ein.«
Ich steckte die Hände in die Taschen. »Nicht unser Stil, eigentlich.«
»Was heißt hier eigentlich?« sagte Joachim. »Not kennt kein Gebot.«
Doch als wir am Mittwoch beim Schützenhaus ankamen, war alles verändert. Die Bretter vor den Fenstern waren entfernt worden, vor dem Haus lag ein Haufen Kies. Ein Lastwagen fuhr Mörtel an. Die Tür stand offen, auf die Terrasse trat ein Mann in Maurerkleidung, einen grünen Hut auf dem Kopf. »Wat wollt ihr hier?« fragte er.
»Wir sind die Söhne von Herrn Pommrehnke«, sagten wir. »Wir wollen mal gucken.«
»Ach so«, sagte der Mann. Er ging zum Lastwagen. Wir liefen ins Haus, die Treppe hoch, die nun keine düstere Stiege ins Nichts mehr war. Auch durch die Treppenhausfenster drang das Tageslicht. Allerdings waren alle Möbel und Gegenstände aus den Räumen verschwunden und mit ihnen der Karton, in dem die Filmrollen lagen. »Zu spät«, sagte ich. »Jemand ist uns zuvorgekommen.«
»Wer braucht so was? Und wer hat das erlaubt?« Joachim wunderte sich. Er war nicht eigentlich enttäuscht, er wunderte sich. Hatte es nicht für möglich gehalten, daß eine Veränderung derart schnell eintreten könnte.
Wir fragten den Maurer, wo die Möbel hingekommen seien. »Abjeholt«, sagte er. »Von de Müllabfuhr. Heute früh. Jleich kommen die Maler für oben. Und wir, wir fangen mit det Mauern an. Die Küche wird nach oben verlegt.«
Wir standen ratlos herum, bis der Mann sagte: »Jeht uff die Seite, der Kalk spritzt.« Joachim verstand die Welt nicht mehr. Die Filme waren für ihn ein Schatz gewesen, so was wie ein Topf voll Goldstücke, und nun einfach weggeworfen. Auf den Müll.
»Das Vertiko ist auch auf dem Müll«, sagte ich. »Man hätte es zerhacken und Feuer damit anmachen können. Schließlich war es gutes, trockenes Holz. Was meinst du, wie das gebrannt hätte.«
»Du Klammtüte! Ich will versuchen, dir zu erklären, was relativ ist«, sagte Joachim. So sprach er selten mit mir, an sich hielten wir zusammen.
»Relativ?« fragte ich.
»Relativ ist, daß die Filme für uns, für mich wenigstens, einen großen Wert hatten, und für andere Leute hatten sie gar keinen. Schwupp und weg. Was hätte ich alles mit den Filmen anfangen können.«
»Vorausgesetzt, es war was Vernünftiges drauf«, sagte ich. »Vielleicht wieder nur Seelöwen und Pinguine.«
Wir bummelten, weil wir früh dran waren. Schließlich mußten wir zu Hause eintreffen, als wenn wir von der Schule kämen. Der Akazienweg war sicher, Wumme arbeitete um die Zeit, er war Lehrling bei einem Schlosser. Mit den anderen Laubenkindern nahmen wir es jederzeit auf. Wir liefen über die Brücke. Tief saß die Schmach in uns.
Wir stahlen uns in die Wohnung, die Tante guckte auf den Stundenplan und auf die Uhr, in der Ecke vom Eßzimmer stand eine Standuhr. So eine, die alle Viertelstunde gongte. Wir waren davongekommen.
Unser Ausflug ins Schützenhaus hatte jedoch ein Nachspiel. Am nächsten Tag, als wir aus der Schule kamen, saß am Tisch dieser Maurer. Er saß mit meinem Vater da und hatte seinen grünen Hut auf das grüne Tischtuch gelegt. Es waren zwei verschiedene Grüns. Der Maurer schwitzte und wischte sich mit einem karierten Taschentuch die Stirn.
»Wollen Sie Kaffee?« fragte ihn Tante Deli.
»Lieber einen Schnaps«, sagte der Maurer.
Wir wollten vorbeiwischen, aber unser Vater sagte: »Halt!«