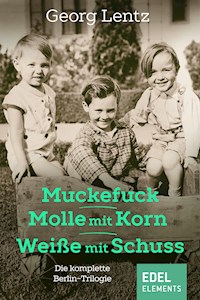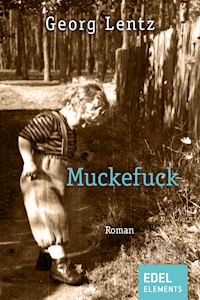3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berlin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Auch dieser dritte Roman der grandiosen Berlin-Trilogie ist herrlich witzig und ein ganz klein wenig melancholisch! Die wilden Fünfziger haben endlich auch Berlin erreicht. Karl Kaiser und seine Kumpels aus der Laubenkolonie "Tausendschön" genießen nun die "Segnungen" des Wirtschaftswunders. Doch der Mauerbau, die Teilung Berlins gehört ebenso zu dieser Zeit ....
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Georg Lentz
Weiße mit Schuss
Roman
Edel Elements
Copyright dieser Ausgabe © 2012 by Edel Elements einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. www.edel.com Copyright der Originalausgabe © 1981 by Georg Lentz
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-029-6
Inhalt
Vorwort
I. Ach, Paula, mach die Bluse zu
II. Die Regenwürmer
III. Heringssalat
IV. Es liegt was in der Luft
Nachwort
»Ich war nie in Berlin, aber die vielen deutschen Soldaten, die zu uns kommen, haben mir von Berlin vorgeschwärmt. Wie ich höre, gibt es dort eine Mauer, ähnlich wie die in China. Wir hier in El Paso haben auch eine Attraktion, den Mount Franklin (1147 Meter). Um unsere Verbundenheit mit Deutschland und Berlin unter Beweis zu stellen, habe ich einen Auto-Aufkleber drucken lassen: BERLIN HAS ITS WALL – EL PASO HAS ITS MOUNTAIN (Berlin hat seine Mauer – El Paso hat seinen Berg). Dieser Sticker zu 1,50 Dollar ist hier sehr beliebt und wird viel gekauft.«
Edgar S. Frazer.Andenkenverkäufer.El Paso, Texas
I Ach, Paula, mach die Bluse zu
Am liebsten spiele ick uff unsern Hof mit Helga, Hannelore und mit Frieda. Und an die Hauswand schreib ich »du bist doof«. Krieg ich ooch Keile, ich tu’s immer wieda.
Erika Brüning
»Versuch es noch einmal«, ermahnte mich Großmutter.
»Junge, du musst das doch begreifen! Frühling will nun ein-maar-schiern – kommt mit Sang und Schalle… «
Ich stand da in meinen zu langen Kniehosen, ein Säbelbein nach hinten gestellt, der Wadenstrumpf heruntergerutscht, begriff nichts. Wer waren Sang und Schalle? Zwei Kintoppkomiker wie Dick und Doof, über die ich bei der Kindervorstellung lachte im Zeli-Kino? Zu hoch für einen Siebenjährigen aus der Laubenkolonie. Amsel, Drossel, Fink und Star –, das ging, da stellte ich mir was vor, die Vögel lebten in den Gärten, Amsel und Drossel blieben manchmal im Winter, traten den Zug nach Süden nicht an, ich streute ihnen Futter ins Häuschen, das ich mithilfe meines Vaters gebastelt hatte, nach der Anleitung in Hilf mit, der Jugendzeitschrift, auf Befehl der Schule abonniert, zwölf Hefte im Jahr, Pimpfe auf dem Titelbild, die Erbsensuppe abkochten im Hordentopf, lachende BDM-Mädchen mit blonden Zöpfen, gesunden Zähnen. »Oma«, bat ich, »erkläre mir: Wieso Amsel, Drossel? Die bleiben doch bei uns im Winter. Stare, weiß ich, kommen im Frühling zurück aus dem Süden.«
Großmutter strich mir über das kurz geschorene Haar. Von ihr, nur von ihr duldete ich es. »Auch Amseln und Drosseln fliegen fort, wenn es kalt wird. Nur einige bleiben hier, überwintern bei uns. Holen sich Futter aus deinem Vogelhaus. Wenn es warm wird, kommen die anderen zurück. Aus Afrika, Griechenland, Italien. Aus fernen Ländern, in denen immer die Sonne scheint. Die Drossel singt wunderbar, wenn der Frühling naht.«
Meine Großmutter sagte »naht«. Was fand sie an einem Lied, das behauptete, der Frühling marschiere ein?
Nie wieder habe ich den Frühling so erlebt wie in jenen Kindertagen in der Geborgenheit der Laubenkolonie, die Sinne geschärft für alles, was um mich herum geschah. Schön war die Kolonie, mit ihren leuchtenden Gärten, ihren Menschen und Tieren. Dass es drei-drei-drei bei Issus Keilerei gab, stopfte ich mir später in den Schädel. Und die Konstantinische Schenkung. Und den Gang nach Canossa. Und Lützows wilde, verwegene Jagd.
Für jede neue Schulerkenntnis opferte ich ein bisschen von dem, was ich damals, als kleiner Junge, von der Großmutter wusste: Wann die Schafgarbe blüht, wie man Tee aus ihr bereitet und wogegen er gut ist; wann die Drossel zu singen, der Fink zu schlagen beginnt; wohin die Störche flogen, die bei Hinrichsen auf dem Scheunendach ihr Nest hatten.
Ich wusste es so lange, bis auch ich aus dem Nest fiel. Mein Nest war die Laubenkolonie Tausendschön, draußen am Rand der großen Stadt gelegen, wo Kiefern- und Eichenwälder begannen. Wo die Füchse im Krummen Fenn zweimal im Jahr Junge bekamen. Wo meine Großmutter mir Geschichten erzählte, während der Kaffee in der braunen Bunzlauer Kanne auf dem Herd summte, und sie versuchte, mir das Lied beizubringen vom Einmarsch des Frühlings.
Die Schule versuchte dann, mich zu bilden, ich sah die Laubenkolonie von außen. Stimmte meinem Freund Othmar bei, der mit Blick auf unsere Behausungen meinte:
»Doll wirkt das nicht.«
Seitdem sind Jahre, Jahrzehnte vergangen, Krieg, Blockade, Nachkriegszeit. Ich sehe sie gleichzeitig von innen und von außen, die Kolonie, sehe sie in jener Zeit, als ich wieder in Laube vierzehn lebte, unter dem Pappdach, das Winterkälte und Sommerhitze durchließ.
Sah sie so:
Wenn man von der Bertholdzeile, einem lindengesäumten Sandweg, auf die Lauben blickte, fiel eine Baracke im Vordergrund auf, in der Ernie Puvogel seinen Kramladen betrieb, als Nachbar der Kneipe Zur beknackten Maus, die uns Laubenpiepern als Sauf-, Motz- und Klöhnstube diente – jenen, die der Krieg übrig gelassen hatte, und den neuen, von Osten überschwappenden Menschenwogen, die immer noch heranstrudelten: Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Displaced Persons (echte und unechte), Kriegerwitwen, Ukrainer, Amiliebchen, KZ-ler, die bei antifaschistischen Kundgebungen ihre gestreifte Lagerkleidung trugen. Von Schönow her, über den Teltowkanal, der seit fünfzig Jahren das Urstromtal der Bäke füllte, waren sie gekommen, aus den Wäldern überm Havelstrand tröpfelten Überlebende des letzten Gefechts um Berlin, sie wogten heran aus Gumbinnen und Landsberg (Warthe), aus Deutsch-Krone und Schneidemühl, aus Kattowitz, Danzig, Posen, Liegnitz, Schwiebus und Marienburg und Stolp und Cammin.
Aminutten, Lippenstift auf die Zahnhälse verschmiert wie Draculas Bräute, schleppten ihre Boyfriends in die Beknackte Maus, Texasreiter vom nahen Horse Platoon mit prall sitzenden Breeches, Nachzügler der Boys von Hell an wheels, einer Eliteeinheit General Eisenhowers, die im Sommer fünfundvierzig als Erste in den amerikanischen Sektor einmarschiert war, Wrigley’s chewing gum kauend, auf leisen Kautschuksohlen, orthopädisch durchdacht die Stiefel, falls ihre Jeeps mal stehen blieben: Ein Knubbelchen stützte den Mittelfußknochen jedes GIs.
Schlingel aus der nahen Einfamiliensiedlung fanden den Mut, sich durch die Glastür in unsere Budicke zu schlängeln, blasse Halbstarke mit angeklebten Tollen, weiße Kaschnees um Pickelhälse, Hose auf Schlag, erzielt, indem sie die Beinkleider nächtelang angefeuchtet auf Sperrholzkeile rammten.
Die Halbstarken kamen wegen der Wurlitzer-Orgel, die in einer Ecke der Kneipe pfiff und donnerte. Außerdem wollten sie Agathe Fanselow in den Ausschnitt plieren. Agathe führte die Bar, ihre schwarz drapierte obere Hälfte – die untere schien durch die Waagerechte des Tresens abgeschnitten – agierte wie eine Schattenspielfigur vor dem warmen Gelb der fichtenbretterverkleideten Wände mit ihren dunklen Asteinsprengseln.
Eine Prise Fantasie vorausgesetzt (oder sechs, sieben Bommerlunder), erkannte der Besucher in den Konstellationen der Äste Gesichter. Lächelnde, weinende, schiefe, verzerrte, alle mit braunen Augen und rundem braunen Mund. Fliegen krabbelten im Sommer auf diesen Fratzen umher, überquerten die Flächen von Reklameschildern wie Hundeschlitten Schneewüsten der Arktis. Auf den Wangen des Mannes im Schultheiß-Habit luden sie einen Schiss ab. Das Plakat kündigte an: Hier gibt es Berliner Weiße – mit Schuss oder ohne, also mit oder ohne Himbeersaft.
Auf dem vergilbten Farbdruck der Reklametafel war nicht mehr zu erkennen, wie der Schultheiß seine Weiße bevorzugte; das Glas, eine Art Pokal, den er in der Hand hielt, war mit einer Flüssigkeit gefüllt, die alles sein konnte; sie schillerte zwischen orange und olivgrün wie die Tarnhose eines Panzergrenadiers, mit einem Schuss rot – womit vielleicht einst der Himbeersaft gemeint war.
Die Amtskette um den Nacken, des Reklamebonzen Würde als Dorfschulze unterstreichend, hatte ihren goldenen Glanz eingebüßt. Oder schien das nur so, weil daneben die Wurlitzer-Orgel ihre Neonorgien abfackelte? Blaue, rosa, gelbe Lichtschlangen zischten durch Glasröhren, flackerten, erloschen, sprühten wie Weihnachtskerzen, bissen sich in den Schwanz, zerhackstückten einander, bis es aussah, als tropfe das Licht herab, kalt, eine Handvoll Milchstraße, während der Roboterarm eine neue single, eine fünfundvierziger Schallplatte aus dem Arsenal griff, elektronischen Befehlen folgend, die einer der Pickeljünglinge (sie waren die treuesten Musikkunden) der Musikmaschine durch Drücken zweier Tasten erteilt hatte.
Heulte der Kasten, schmetterte er Das machen nur – die Beine von Dolores in die Saufanstalt, in die Tausendschön-Destille, fuhr gewöhnlich der Drücker seinen Hals mit dem vortretenden Adamsapfel auf Sehrohrtiefe aus, um die Augen in Richtung jener Rundungen zu rollen, die Agathe entblößte, wenn sie Gläser spülte oder einen Mampe halb und halb eingoss.
Viel war’s nicht, was sie unter der Bluse führte, Hügelchen. Aber nach etlichen Jahren Hängolin und Unterernährung machten Agathes Anhöhen die Siedlungshausjugend ganz schön an.
Sie merkte nichts?
Manchmal sah sie hinüber zu ihnen. Ein Blick unter dunklen Wimperlaschen.
Die Jungs schämten sich und warfen weitere Fünfziger in den Schlitz der Musikmaschine.
Eine Tür in der Wand rechts vom Tresen führte in die andere Hälfte der Baracke, die Ernie Puvogel, auf bessere Zeiten bauend, nachdem die Blockade überstanden war, zu einem Tempel deftiger Versuchungen hochmotzte, mit schwarzen Resopalplatten hinter den Regalen, einem verchromten Schinkenfestklemmer auf Marmorplatte, einer Aufschnitttheke, mit Sauerkrautpyramiden und Wurstkaskaden, Gebirgen aus Löcherkäse, Stolper Jungchen in Spanschachteln, portugiesischen Ölsardinen, Bücklingskisten, Bastionen von Spargelkonserven und feinstem Leipziger Allerlei. Draußen prunkte Puvogel mit einem Schild, das durch die Aufschrift Kolonialwarenhandlung überraschte. Lieber Herr Puvogel, wo leben Sie denn? Die Epoche, als Deutschland zu den koloniengesegneten Staaten gehörte, war doch schon neunzehn vorbei! Togo. Deutsch-Südwest. Deutsch-Ost. Fünf Jahre nach dem Ende von Weltkrieg zwei wirkte Puvogels Schild so unangebracht wie ein Hindenburgbild im Sektionsbüro der Kommunistischen Partei.
Puvogel machte sein Ladenschild Freude. »Klasse, wat?«, fragte er jeden, der seine Blicke nach oben wendete. Puvogel baute sich, wie ein Gewerbetreibender, der auf den Fotografen wartet, unter der Inschrift auf. Von diesem Standpunkt aus konnte er beobachten, wer alles die Beknackte Maus betrat.
Seine Tochter Wanda werkte im Laden, schnitt Schinken auf mithilfe des verchromten Apparates oder wog ein Achtel von Freiherr von Palleskes feinster Leberwurst ab, nach Gutsherrenart.
Wanda glich, seit sie meinen Schulkameraden Siegfried zwecks Eheschließung übertölpelt hatte, immer mehr einer gigantischen Topfpflanze fleischfressender Art, Venusfalle, die mittels lebhaft auf- und zuklappender, bewimperter und borstiger Blätter Lebendiges fängt und aussaugt. Eine üppige, rot klaffende Muschel, in deren Blätterarmen Siegfried sich wand, einem dicken Harold Lloyd ähnlich, ohne Hornbrille, aber auch mit Poposcheitel, der Siegfrieds düstere Haartour in zwei gleich große Felder teilte.
Wanda lag es fern, sich über Vater Ernies Ladenschild Gedanken zu machen, den Verdacht erregte sie nicht, dass sie über den Verlust Kameruns nachsann, in Epochen nachdachte wie:
Vor Weltkrieg I.
Nach Weltkrieg II.
Die deutschen Kolonien waren Wanda schnurz, samt Hottentotten und Hereros und Dr. Peters und Lettow-Vorbeck, selbst wenn sie einst, wie ich, die bunten Bildchen aus Zigarettenpackungen geklaubt hatte, die zur Serie Unsere Kolonien gehörten (»der deutsche Schraubendampfer ›Emil Schulte‹ auf der Reede von Daressalam«). Puvogels Lendenfrucht schleuderte ihre Fangarme, presste, säbelte, riss und wickelte. Die Kunden sahen ihr zu mit einer Andacht und einem Gruseln, wie es Riesenwüchsiges hervorruft.
Betrat ein Kunde das Geschäft, düste Puvogel herbei, schlug seine Augen von unten her auf, demütig aber doch wach wie ein Frettchen vorm Zubiss, sonderte Wortkaskaden ab, um- und unterspülte den Willen der Kundschaft, benebelte sie mit zutraulicher Werbung:
»Habe die Ehre, frisch hereingekommen ist dieser zarte gekochte Schinken, so was haben wir lange nicht … Und der Emmentaler, wie Butter, wenn Sie probieren wollen?« Schon hatte er Wanda das Messer entwunden, sich auf Schinken oder Käse (oder, hintereinander, auf beides) gestürzt, die Klinge angesetzt, Pröbchen herabgesäbelt vom verheißend sich darbietenden Stück, es auf der Messerspitze gereicht, »bloß nicht mit den Händen berühren!«, bleute er Wanda ein, und wieder traf sein demütiger Blick den Kunden: Ja? Nein? »Die Cervelatwurst vielleicht? Oder hier: Die Blutwurst, wie ein Bild!«
Der Kunde vergaß, dass er ein windiges Bauwerk betreten hatte, aus einer Epoche stammend, die den Menschen durch Unterbringung in schnell auf- und abmontierbaren Gehäusen belehrte, dass er höchstwahrscheinlich fortan zu den Unbehausten gehören würde, einer neuen Klasse Erdbewohner.
Laubenpieper wie die Tausendschönchen verbrachten ihr Leben in aller Statik hohnsprechenden Improvisationen.
Meinen Onkel Siegfried, der beim Bauamt einen Plan für den Massivbau einer Laube einreichen wollte, beschied die Behörde: Dies Vorhaben leiste festem Wohnen Vorschub, und das sei nicht der Sinn einer Laubenkolonie. Dass dieser Onkel, dass wir alle seit zwanzig oder dreißig Jahren in Hütten aus Fichtenbrettern, Gipsplatten und Dachpappe hausten, nahm die Behörde nicht zur Kenntnis.
Folglich baute Onkel Siegfried schwarz.
Wir halfen ihm, zuerst die Hinterwand einzureißen und mit Hohlsteinen neu aufzuführen, dann eine Seitenwand, und so fort, bis die neue Laube stand. Sogar Richtfest feierten wir, ohne dass die Behörde eingeschritten wäre.
Ich besitze das Foto noch heute: Onkel Siegfried und seine Helfer, vor der Baracke mit neuem Dachstuhl, die Richtkrone auf dem Firstbalken. Die Älteren tragen Holzpantinen und Fußlappen, wie vor dem Krieg Maurer und Bauarbeiter. Buseberg, ganz rechts, hat seinen Patentarbeitshaken angeschnallt. Puvogel, scheint mir, ist noch in seine Organisation-Todt-Hose gekleidet, in der er Kriegsund Blockadejahre abritt, was auf gute Stoffqualität schließen lässt.
Der Spaßvogel liebte es, seine Kundschaft darauf hinzuweisen, dass die Kramladenbaracke nicht Barock-, nicht Renaissance-Zeit verkörpere, sondern »Barack- und reene Angst-Zeit«. Er deutete dabei auf die schmucken Hartfaserplatten hinter seinen Regalen, und sein Meckigesicht verzog sich zu einem Grinsen, das zugleich demütig und verschlagen war: Jeder Quadratzentimeter von Puvogels Gesicht lachte, grinste, schmierte sich an.
In einer Baracke einzukaufen machte den Bewohnern der Kolonie Tausendschön nichts aus. Schon gar nicht, seit sie sich im neuen Stil präsentierte: »Unser kleiner Wertheim«, sagte Frau Buseberg, auf den weltberühmten Konsumpalast am Leipziger Platz anspielend (der allerdings in Trümmern lag).
Genausowenig störte es die Laubenpieper, dass ihre Kneipe in Wänden Unterschlupf gefunden hatte, die samt Bretterverkleidung und Glasfaserisolierung höchstens zehn Zentimeter dick waren. Innen in der Beknackten Maus, in ihrer Beknackten Maus, schlugen sie einander auf die Schultern und beteuerten immer wieder:
»Jemütlich!«
Es war wirklich gemütlich. Wenn ich abends von meiner Arbeit in Benno Blütes Buchhandlung zurückkam, machte ich für ein Bier in der Beknackten Maus fest. Da saßen sie alle, die Helden aus den Gründertagen, zwischen neuem Strandgut. Traf ich sie nicht heute, dann morgen oder übermorgen.
Nach wie vor hielt Agathe Fanselow die Stellung hinter der Theke, über ihrem Blumendrahthaargewirr schwebten, Hals nach unten, Flaschen mit Korn und Kognak, aber auch mit dem beliebten Cherry Brandy, mit Eierlikör und Gilka-Rum-Verschnitt.
Agathe, aufgestiegen zur Lebensgefährtin Sternchen Siegels, unseres Freundes und Nothelfers, ließ unter langen Augenlaschen Blicke schweifen, zu den Flaschen hinter ihr, wenn entsprechende Bestellung sie erheischte, oder zur Tür, durch die dann auch regelmäßig der kleine Mann eintrat, von dem wir während der Blockade gesagt hatten:
»Wunderkraft bewies er,
Mücken fliegen ließ er«:
Sternchen Siegel.
Gerettet hatte Sternchen uns aus mancher Not, jüdelnd auf Deutsch oder Englisch, Letzteres wenn es galt, Besatzern Zugeständnisse abzuringen.
Das »Merkantilzentrum«, wie Siegel lächelnd (und hochtrabend) die Doppelbaracke bezeichnete, war sein Werk – oder jedenfalls von ihm in Gang gesetzt nach dem Brand von Puvogels altem Kramladen. Kein Wunder, dass Sternchen Siegel Teilhaber dieser Betriebe war. Durch solche Verflechtung schien Agathe Fanselows Auskommen gesichert. Aber auch Friedrich, der kriegsversehrte Bruder meiner Freundin Gigi, erhielt ein Zubrot: Auf seinen Namen liefen Lizenz und Schankerlaubnis für die BeknackteMaus, Arrangement aus einer Zeit, als Behörden es peinlich genau nahmen und es nützlich war, ein Kriegsopfer vorzuschicken.
Friedrich kam selten, um nach »seinem« Betrieb zu sehen. Die Kunden waren froh, wenn er nicht auftauchte, feldgrau durchtränkt, wie der Inhaber des Deutschen Kreuzes in Gold und der Nahkampfspange wirkte. Er trug zwar diese Orden nicht mehr, und seine auf Zivil umgeschneiderte Uniform, Einheitskleidung der Nachkriegstage, hatte er mit einem praktischen, sogar flott zu nennenden Kunstfaseranzug vertauscht. Dennoch blieb etwas Feldgraues um Friedrich, wenn er an seinen Stock gelehnt dastand, mit blassem Gesicht, dieser allzu hohen Stirn. Einzelkämpfer.
Die anderen Stammgäste machten einen zivilen Eindruck, obwohl manche deutliche Spuren durchgestandener heroischer Zeiten trugen, wie Marineveteran Buseberg, der im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren hatte, oder Willy Reh, der seine Hustenanfälle auf einen Lungensteckschuss und feuchte Westwallkasematten zurückführte.
Einige tranken in der Beknackten Maus ihr Bier, denen ich bei aller Fantasie, die Buchhändler Blüte durch bewusste Hinlenkung auf hochwertige Lektüre in mir gefördert hatte, keine heroische Vergangenheit unterstellen konnte: Ernie Puvogels Bruder Xylander (so jedenfalls nannte er sich, in Wirklichkeit war sein Vorname, wie jeder wusste, Gustav), von Beruf Zauberer, der meistens in Begleitung seiner zersägten Jungfrau Amaryllis erschien, oder der Sickergrubenentleerer Eichelkraut, dessen berufsbedingter Duft jeden anderen Gedanken als ausschließlich den an seine Profession verbot.
Agathes Bruder Gustavchen, der sich der Küche annahm, trotz des humorigen Hinweisschildes an der Wand: »Hier kocht der Wirt; essen tut er woanders«, schien uns die Verkörperung einer Originalnachkriegskarriere zu sein. Gustavchen handelte zuerst mit allem, was Schwarzmarkt und US-Army hergaben. Jetzt war er in diverse Unternehmungen eingestiegen, die Sternchen Siegel betreute, zusammen mit dem gemeinsamen Freund Omme Heringsbändiger, einem Windhund. Besitzer der FischhandlungDogger Bank, Libero der von Siegel geförderten Fußballmannschaft, Lebensgefährte meiner Cousine Ingeborg.
Ich verweilte länger in der Kneipe, als nötig gewesen wäre, um ein Bier zu trinken oder zwei. »Traust dich wohl wieder nicht in deine Klapsmühle?«, fragte Agathe, wenn sie sah, dass ich auf dem Stuhl am Tisch neben der Wurlitzer-Orgel kleben blieb. Agathe spielte auf die Tatsache an, dass meine Mutter Minnamartha einige Monate in einem Sanatorium verbracht hatte.
Es stimmte. Zwar zog es mich zu meiner Freundin Gigi, doch ich wusste, wenn ich lange ausblieb, kam sie mich holen. Oder schickte den feldgrauen Friedrich. Was mich zögern ließ heimzugehen war die Tatsache, dass meine Mutter, Minnamartha, jetzt die Laube nebenan bewohnte, die als Folge der Dezimierung der Laubenbevölkerung durch Kesselschlachten und Luftminen frei geworden war. Hier nistete sie nun, die Witwe Kaiser, dramatisierte den Heldentod ihres Mannes, meines Vaters, Ede Kaiser, Kämpfer der letzten Stunde, als Volkssturmveteranen und Hitlerjungen sich jener sagenhaften Armee Wenck entgegenwarfen, die Berlin entsetzen sollte, Deutschlands von den Russen fast umzingelte Reichshauptstadt. Ein paar Reihen Kohlstrünke, Geißblatt, das seine Blätter im Sommerwind bewegte, sie beim ersten Herbststurm auf die kahle Zementumrandung der Laube warf, trennten mich von Minnamartha, von ihren scharfen Augen, den Ohren, die sie saugnapfgleich an die Wände meiner Behausung zu heften schien.
»Menschlein«, nannte sie mich, so lange ich denken konnte. Immer noch begann sie ihre Kritik an meiner Art zu leben mit diesem Wort: »Menschlein, du hättest doch…« Hinterher ein Gemeinplatz: »Unrecht Gut gedeihet nicht…« – »Hoffen und Harren hält manchen zum Narren…«
Die anderen Laubenpieper, Zeugen über den Zaun, grinsten. Der alte Buseberg blieb sogar stehen, kaute seinen Priem, spuckte braunen Saft auf die Radieschen. »Ja, Sie können es ruhig sehen, Herr Buseberg«, rief Minnamartha. »Wo kommt er jetzt her? Menschlein, sage es mir, wo kommst du so spät her?« (Es war immer zu spät.) »Ich warte und warte. Das geht auf keine Kuhhaut.« Einmal sagte sie: »Es ist höchste Eisenbahn.« Ich schlug in einem Sprichwörterbuch nach, bei Benno Blüte in der Buchhandlung, und fand: Der Berliner Dichter Adolf Glasbrenner, Erfinder des Eckenstehers Nante, ließ in einer seiner Komödien einen durchgedrehten Briefträger sagen: »Es ist höchste Eisenbahn; die Zeit ist schon vor drei Stunden angekommen.«
Minnamartha überwachte Zeitintervalle mittels jener amerikanischen Eieruhr, die meine Tante Friedl ihr einst aus der Neuen Welt, »direkt aus Neuyork« mitgebracht hatte, ein Geschenk, das seitdem unsere Tage und Nächte in durch Klingeln abgegrenzte Segmente zerlegte. Die Uhr klingelte plötzlich, in Minnamarthas Schürzentasche, erschreckte mich. Minnamartha stellte anhand dieses Klingeins fest, dass sie wiederum dreißig, vierzig, sechzig Minuten auf mich gewartet hatte. Das ging auf keine Kuhhaut.
Erst nach Einbruch der Dunkelheit wagte Gigi es, auf Zehenspitzen hinter Stangenbohnen und Himbeerhecke entlangzuschleichen, Schatten ausnutzend, die der Mondschein schwarz malte, aber ihr elfengleiches Vorrücken half wenig, Uhus ließ Minnamartha ausfliegen, Raben und Mückenschwärme berichteten ihr, die Katze auf dem kalten Pappdach petzte. Am nächsten Tag, wenn sie Gigi sah, eilte Minnamartha vor die Laube in ihren Holzpantinen, klapperte zum Gartentor, um zu fragen:
»Ach, du warst gestern bei Menschlein?«
Meinen Vornamen gebrauchte sie auch Gigi gegenüber nie.
»Es ist der ewige Mist«, sagte Gigi. »Deine Mutter steht zwischen uns; und immer noch traue ich mich nicht, Friedrich allein zu lassen. Er ist so unbeholfen seit seiner Verwundung.«
An solche Vorstellungen schlossen sich nächtliche Diskussionen an, wir saßen nebeneinander auf der Chaiselongue, die mir als Lager diente, tranken Apfelsaft mit Korn, rauchten. Man sollte, man müsste – darin waren wir einander längst einig – für Friedrich eine Frau besorgen, »aber wer will ihn schon haben mit der feldgrauen Flappe?«
Wir besprachen, dass es nötig war, Minnamartha in ihre Schranken zu weisen, verdammt noch mal. Aber wie?
Wir redeten wie die Mäuse, die der Katze die Schelle umhängen wollen.
Niemals machten wir Licht in diesen Laubennächten, doch wenn es auch ganz dunkel war, sah ich Gigis Gesicht leuchten, weiß, oder von rötlichem Schein überhaucht, wenn sie an der Chesterfield zog. Sie rauchte Kette. Füllte in einer Nacht den Aschenbecher, der sich marmorn gegeben hatte, bis er mit einem glühenden Feuerhaken in Berührung kam, wodurch sich herausstellte, dass er aus Zinn war, mit einer Schicht überzogen, die das marmorne Muster vortäuschte. Ein schwerer Aschenbecher, zu Lebzeiten meines Vaters, Ede Kaiser, hatte er auf dessen Schreibtisch gestanden, mit kurzen Stummeln seiner Boenicke-Zigarren gefüllt. Minnamartha sammelte damals diese Reste von Edes Zigarren, um Aufgüsse zu bereiten, die sie für Düngung und Schädlingsbekämpfung ihrer Zimmerpflanzen verwendete, Plantagen von Hakenlilien, Amaryllis, Zyklamen, Myrthen und Stechpalmen, in Töpfen, die gelegentlich von unseren Hauskatzen heruntergeworfen wurden, was Minnamartha veranlasste, durch geschickt konstruierte Kausalketten nachzuweisen: Ich, Menschlein, hatte den Sturz der Blattpflanze verursacht.
Was von diesen Pflanzen überlebt hatte, war mit Minnamartha in die neue Laube gezogen. Mir war Ede Kaisers Aschenbecher geblieben, in den nun Gigi ihre Chesterfield-Stummel schichtete. »Das Mädchen raucht ja wie ein Schlot. So was würde mich in Harnisch bringen«, sagte Minnamartha.
Manchmal, wenn die Luft den Schall gut leitete, etwa kurz bevor Regen kam, hörten wir Minnamarthas Eieruhr klingeln. In der Nacht! Was mochte sie veranlassen, zu solcher Stunde eine Kerbe in die Zeit zu hacken? Wollte sie erwachen, um ihr Lauschohr auszufahren? Es reichte, um unsere zärtlichen Spiele zu unterbrechen. Gigi stand auf, und während eine frisch entzündete Zigarette im Winkel ihrer roten, vollen Lippen glomm, hakte sie den Büstenhalter vorn zu, um ihn dann mit einem Ruck herumzudrehen und die Schalen über ihre kleinen Brüste zu stülpen. Sie rauchte weiter, während sie in den Pullover schlüpfte, in den Rock. Dann ging sie. Der Stummel ihrer letzten Zigarette verglomm auf dem Kippenhügel im Aschenbecher.
Ich wusste, dass ich Gigi mindestens drei Tage, drei Nächte nicht wiedersah.
Einmal fragte ich Gigi, was denn Friedrich über uns sage.
Gigi zog die dünnen Augenbrauen hoch. »Er meint, wir seien zwei Brummer, die auf den Fliegenfänger geraten sind. Wir summen und bewegen die Flügel, aber nichts kommt heraus dabei. Am Ende nimmt jemand den Fliegenfänger und wirft ihn ins Herdfeuer.«
Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem Gigi mich, mittels Zitat dieser Friedrich’schen Sentenz, in betroffenes Schweigen versetzte. Wir gingen spazieren, den Königsweg hinunter, der sich als schnurgerades helles Sandband unter alten Bäumen durch den Düppeler Forst zog. Ein reiner Spaziergang war es nicht, die Gewohnheiten von Notzeiten steckten in uns, Gigi trug einen Korb, wir wollten sehen, ob Pilze in den Schonungen wuchsen. Die ersten Pfifferlinge müssten da sein, meinte Gigi, es hatte geregnet, jetzt dampfte die Erde in der warmen Septembersonne, das ideale Pilzwetter.
Am Kamickelberg wollten wir abbiegen zur Potsdamer Chaussee, vielleicht bei Mutter Mochow ein Bier trinken, der Fernfahrerkneipe kurz vor dem Sanatorium, das im letzten Jahr für ein paar Monate meine Mutter beherbergt hatte, als sie es, wie sie sagte, mit den Nerven hatte.
Gigi zitierte Friedrichs Satz von den Fliegen, sie blieb stehen auf dem Sandweg, das Körbchen hielt sie am Arm wie einen Schild, als sei sie genötigt, sich zu verteidigen. Friedrich hatte wieder einmal, wie Minnamartha gesagt hätte, mit der Faust aufs Auge getroffen.
Übrig blieb, darüber nachzudenken, wer wohl das Fliegenpapier ins Feuer schleudern würde.
»Ich hätte es nicht sagen sollen«, meinte Gigi. »Aber es ist so.«
»Gewonnen«, sagte ich. »Friedrich hat recht. Ich frage mich nur, weshalb ihm solche Weisheiten sein eigenes Leben betreffend nicht einfallen.«
Wir kamen nicht dazu, dies zu erörtern, auch die Verfolgung der Pilzspur verzögerte sich. In der Nähe des Autobahnzubringers, der schluchtartig in den Wald schneidet und den Anschluss an die Avus herstellt, verläuft die Grenze zwischen Westberlin und der DDR, früher der sowjetischen Besatzungszone, in einem Winkel. Noch riegelte Stacheldraht diesen Teil nicht ab. Eine russische Radfahrpatrouille kam uns entgegen. Uns blieb keine Zeit mehr auszuweichen.
Während die Russen näher kamen, fiel mir ein, was Buseberg uns jüngst aus der Zeitung vorgelesen hatte:
»Um das gesamtdeutsche Bewusstsein zu stärken und dem gemeinsamen Willen Ausdruck zu geben, sich niemals mit der Dreiteilung Deutschlands und dem Verlust seiner Ostgebiete abzufinden, wird dringend empfohlen, den mitteldeutschen Raum im Allgemeinen Sprachgebrauch nicht als ›Ostzone‹ zu bezeichnen. Als ›Ostdeutschland‹ haben allein die Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie zu gelten, die deshalb als ›deutsche Ostgebiete unter polnischer bzw. sowjetischer Verwaltung‹ nicht aus dem politischen Bewusstsein ausgeklammert werden dürfen. Wer ›Mitteldeutschland‹ als ›Ostdeutschland‹ anspricht, gibt damit zu erkennen, dass er die völkerrechtswidrige Abtrennung der deutschen Ostgebiete als endgültige Tatsache hinzunehmen bereit ist. Ebenso kommt auch die Benennung der Sowjetzone als ›Deutsche Demokratische Republik‹ einer formellen Anerkennung des Pankower Systems und der Zerreißung Deutschlands gleich, der schon im allgemeinen Sprachgebrauch entgegengewirkt werden soll.«
An diesem Septembermorgen hielt das Pankower System sich zurück und ließ seine hoheitlichen Aufgaben von der befreundeten Sowjetmacht erfüllen. Der Patrouillenführer rief: »Stoj!«. Er fuchtelte mit der Kalashnikowmaschinenpistole, während er Mühe hatte, mit einer Hand am Lenker das Fahrrad durch den tiefen märkischen Sand zu steuern. Er fuhr ein Damenrad. Sie bremsten vor uns, drei olivgrüne Gestalten mit Schiffchen auf den geschorenen Köpfen. »Wohin«, fragte der Anführer. Ich wies auf Gigis Korb und erklärte ihnen, dass wir Pilze suchten. Sie verlangten »Propusk«. Wir hatten aber keinen Propusk. Keinen Passierschein, keinen Ausweis. Sie bedeuteten uns, dass wir zurückgehen sollten, bis zu jener Linie, die hier, mitten im Wald, Ost und West trennte. Das Hinweisschild »You are leaving the American Sector« hatten wir gesehen, aber nicht beachtet. Es gab unseres Wissens auch keine Vorschrift, die uns untersagte, das DDR-Gebiet zu betreten.
Wir gingen zurück. Die Pilze gehörten zum östlichen Teil dieser Welt.
»Schade«, sagte Gigi.
Ich hütete mich zu fragen, ob sie den Reinfall mit der Russenpatrouille meinte oder unsere Situation, geschildert von ihrem Bruder Friedrich, dem »feldgrauen« Friedrich, anhand des Gleichnisses mit dem Fliegenpapier.
Die Berliner Tageszeitung »Telegraf« veröffentlichte eine Serie: »Buchhändler in Berlin.« Darin hieß es: »Die Buchhandlung Blüte hat einen ungeahnten Aufschwung genommen.« Benno Blüte zeigte mir den Artikel. »Ganz Berlin hat einen ungeahnten Aufschwung genommen«, sagte er. »Oder vielleicht auch nicht ungeahnt. Westdeutschland hat es uns ja vorgemacht, während wir die Blockade hatten. Trotzdem. Ein bisschen bin ich überrascht, dass wir von den dicken Schinken so viel verkaufen.« Er meinte jene aus dem Amerikanischen übersetzten Bestsellerromane, die seine Kundinnen bestellten. Auf Lager hielt Benno Blüte so was möglichst nicht. »Sie kaufen es auch so«, sagte er. »Leider. Doch die Arbeit wird nicht weniger. Was machen wir mit Ihnen?«
»Mit mir? Oh, ich bin glücklich hier. Und ich hoffe, ich bin Ihnen eine Hilfe.«
»In der Tat. Zwar wäre eine Berufsausbildung gut…« Er sah mich an. »Allerdings glaube ich, der Augenblick ist verpasst. Schreiben wir es einmal den Nachkriegswirren zu, dass ich Sie ohne Ausbildung als Buchhandelsgehilfe führe. Mit entsprechender Bezahlung.«
»Ich danke Ihnen.«
»Nichts zu danken. Weil wir es aber allein nicht schaffen, habe ich mich entschlossen, einen Lehrling einzustellen. Er fängt morgen an. Beziehungsweise: Sie fängt morgen an.«
»Sie?«
Blüte winkte ab. »Herr Kaiser, Sie werden sehen.«
Er nannte mich immer Herr Kaiser. Auch daran musste ich mich gewöhnen.
Ich erzählte Gigi am Abend, dass ein Lehrling in der Buchhandlung anfangen würde, vermied aber zu berichten, dass es sich um ein Mädchen handelte. Gigi war auf fünfzig Prozent der Bevölkerung eifersüchtig, genau genommen im Augenblick 52,4 Prozent, das war der Anteil der weiblichen Bewohner Westdeutschlands (das sich nun Bundesrepublik nannte und statt von einer Militärregierung von einem alliierten Kontrollrat überwacht wurde) und Westberlins.
Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem neuen Lehrling um eine junge Frau handelte. Fünf Minuten nach acht betrat sie den Laden, zotteliger Bärenpelzmantel, ziemlich elegant, hübsches Gesicht.
»Womit kann ich dienen?«, fragte ich, im Stil des Hauses, auf den Benno Blüte Wert legte. Die Frau lachte. »Geht es hier immer so zu? Ich bin Sylvia Flötotto. Der neue Lehrling. Sind Sie der Buchhändler?«
»Augenblick«, stammelte ich. »Sofort rufe ich Herrn Blüte. Ich bin nur der Gehilfe.«
Sie streckte mir die Hand hin. »Angenehm. Wie heißen Sie?«
» Karl. Eh … Karl Kaiser. «
Sylvia Flötotto bezeichnete sich als Leutnantswitwe. Sie war nur zwei Wochen lang verheiratet gewesen. Solange der Heiratsurlaub dauerte. Dann war Leutnant Flötotto wieder an die Front gefahren. Und gefallen: »Jetzt muss ich mich allein durchschlagen.«
Sie wohnte bei ihren Schwiegereltern, den alten Flötottos, in einem schmalbrüstigen Reihenhaus nahe beim U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte.
Am zweiten Tag duzte Sylvia Flötotto mich, am dritten lud sie mich zu sich nach Hause ein: »Besuch mich doch mal.« Sie zog einen eleganten goldenen Drehbleistift aus ihrer Handtasche und schrieb mir ihre Adresse auf.
Ein paar Tage wartete ich ab.
»Kommste denn nicht?«, fragte die Witwe.
Ich versprach es ihr.
Die Gegend war mir geläufig, Fischtalgrund, Riemeisterfenn, die Straße, in der die beiden WACs gewohnt hatten, weibliche Mitglieder der US-Streitkräfte, die sich einst in den Kopf gesetzt hatten, dem Jüngling Karl Kaiser ihre Gunst zu schenken. Nur hatte Jüngling Karl Kaiser es nicht bemerkt.
Lange war das her. Eine Geschichte aus der Epoche vor der Blockade.
An diesem Tag war Frau Flötotto nicht im Laden erschienen. Berufsschule. In ihre Klasse gingen ein paar Macker, die Witwe Sylvia flott fanden. Sie verloren nicht viel Zeit. Ein halbes Dutzend Jungbuchhändler flezten bei ihr auf dem Teppich, als ich eintrat, vom alten Flötotto in den ersten Stock gewiesen.
Sylvia Flötotto ruhte auf einem breiten Bett, dessen hinteres Drittel in einem Alkoven verdämmerte oder verbläute, eine himmelblaue Steppdecke war über das Ruhelager gebreitet, von dessen Höhe die Witwe auf ihre Teppichhocker herabsah.
»Karl Kaiser ist nämlich etwas Besonderes«, sagte sie.»Er lebt in einer Wohnlaube.«
Ein junger Macker, mit angeklebten Haaren und langen gelblichen Zähnen, lachte.
»Klausimausi, lass das«, sagte die Witwe.
Klausimausi zog die Lefzen über seine Zahnstängel. »Ick finde det komisch«, sagte er. »Heutzutage wohnt doch niemand mehr in ’ner Laube.«
»Anscheinend doch«, sagte ich. »Manche leben auch in Behelfsheimen und manche in Ruinenkellern … immer noch.«
»War ja nich so jemeint«, sagte Klausimausi. »Wo waren wir stehen geblieben?«
Sie unterhielten sich über Bücher, sprachen von Literatur wie Verhungernde über Beefsteaks und Kapaune. Sylvias Beine ragten aus Wolken von Schlagsahne, so sah es jedenfalls aus, sie trug einen dieser modernen Nylonpetticoats.
»Walt Whitman ist eine Offenbarung«, sagte Klausimausi.
Die Witwe steckte mir ihre Hand in den Hemdkragen.
Herr Flötotto sah zur Tür herein wie ein Truthahn, der mit faltigem Hals um die Stallecke linst. »Hier ist noch jemand«, sagte er und ließ ein Mädchen mit Tituslocken ein.
»Ach, Gerda…«, sagte Sylvia, während ihr Schwiegervater seinen faltigen Schädel zurückzog und die Tür leise schloss.
»Habt ihr gewartet?«, fragte Gerda. Sie ließ sich neben Klausimausi auf dem Teppich nieder. »Kinder, ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich lese euch mal vor. Auburtin. Einer bläst die Hirtenflöte. « Klausimausi raffte die Oberlippe und zeigte seine Hasenzähne, als wolle er in eine Mohrrübe beißen.
Sylvia wechselte die Beinstellung, ihr Petticoat raschelte. Gerda begann zu lesen.
Ich lag krank im Bett. Fieber. Das offene Fenster war fast ganz von einem milchig-blauen Himmel ausgefüllt, nur unten ragte dunkel die Krone des Apfelbaums ins Bild. Ein Flieger zeichnete einen Kondensstreifen in das Viereck. Er begann oben links. Der Streifen entwickelte sich zur Mitte hin, brach ab. Von oben her begann er sich aufzulösen, aber die schäfchenwolkengleichen Bestandteile hielten sich lange. Das Fieber hatte ein Gefühl der Verantwortungslosigkeit in mir ausgelöst, die Umwelt – und auch ihre Probleme – schienen durch eine Glaswand von mir getrennt. Wirklich war nur der Apfelbaum in dem blauen Fenstergeviert und der Wolkenstreifen, den der Flieger gemalt hatte. Ein Flugzeug der westlichen Alliierten? Über dem Gebiet der DDR nahmen die Sowjets die Lufthoheit wahr. Durch die Luftkorridore flogen Maschinen der westlichen Alliierten in so geringer Höhe, dass sie keine Kondensstreifen produzierten.
Das Problem konnte ich genausowenig lösen, wie es mir gelingen würde, in die tieferen Geheimnisse der Literatur einzudringen. Wer war Auburtin? (Falls ich den Namen richtig verstanden hatte.) Weshalb blies einer die Hirtenflöte? Wenn ich wieder gesund war, musste ich Herrn Blüte fragen. Und ihm auch sagen, dass es so nicht weiterging. In Gedanken übernahm ich eine Lieblingswendung Minnamarthas: Menschlein, so geht es nicht weiter! Es ging so schon nicht weiter, als ich vier oder fünf Jahre alt war, egal, was ich tat, Minnamartha war es nie recht. Wir umkreisten den Wohnzimmertisch, Minnamartha schwang einen Teppichklopfer, aus Rohr geflochten, ich bezweifle, dass sie mich wirklich züchtigen wollte, das Instrument diente zur Bedrohung.
Einiges ging immer noch so nicht weiter. Ein Buchhändler war ich, der noch nichts von Auburtin gehört hatte! In dieser Laube lebte ich immer noch, oder schon wieder, nachdem unser Haus in Schutt und Asche gefallen war. (Schon wieder eine Minnamartha’sche Redewendung: In Schutt und Asche. »Alles ist in Schutt und Asche«, hatte sie damals gesagt. Asche fand sich nicht; ein Brand war nicht ausgebrochen.)
Gigi trat an mein Bett, ihre Silhouette durchstreifte einen Augenblick lang das Fensterviereck, ein Scherenschnitt, dessen Kanten golden leuchteten. Ich sah Gigi und dachte im gleichen Augenblick an Sylvia, die Witwe, wie sie Hof hielt auf ihrer Steppdecke, ihr zu Füßen Klausimausi, der einen Prüfungsaufsatz über Walt Whitman schrieb, diesen »wunderbarsten Dichter Amerikas«, wie er sagte. Immerhin: Den Namen hatte ich schon gehört, kannte aber nichts von diesem Genie (denn dass Whitman eins war, nahm ich gewiss an), nur eine Parodie auf seine Verse: »Ich besinge den Bleistift Koh-i-noor … «
Damit war nichts anzufangen.
Wohin lief es, mein Herz? Mein dummes Herz, das sich doch mit dem Fieber beschäftigen sollte, ein Muskel, eine Pumpe, ziemlich unansehnlich auf anatomischen Tafeln, oder wenn ich ein frisch geschlachtetes Kaninchen ausnahm; dieses graue Ding, einem Zwergenkopf mit Zipfelmütze ähnlich, in das kräftige Röhren führten: Aorta, Arterie?
Was würde werden aus mir und Gigi, aus unserer Liebe, die eher einer Verwicklung glich, langfristig verschleppt, aus Kindertagen stammend? Was würde werden, wenn nun Sylvia, die Witwe, hier eindrang? Schon hatte sie per Fahrrad einen Besuch bei Kaisers gemacht. Minnamartha behauptete: »Ich bin begeistert von ihr. Sie stammt vom Land. Hat eine Ahnung. Ja, ich habe mit ihr übers Einwecken gesprochen. Sie weiß Bescheid. Dass ihr Mann gleich fallen musste. Der Krieg. Nimmt uns die liebsten Menschen. Mein Ede … Mein Gott, wenn er noch hier wäre. Würde nicht alles verkommen.«
Sie sah mich an. Kein Zweifel, ich war es, der alles verkommen ließ.
»Ede war immer auf dem Posten. Hat sich um alles gekümmert. Hühnerfutter herangeschafft, als es nichts gab. Nun sieh mal, dass du wieder gesund wirst. Was sagt denn Herr Blüte dazu?«
»Wozu?«
»Dass du fehlst. Im Geschäft. Du hast keinen Ehrgeiz, Menschlein. Da liegt der Hase im Pfeffer.«
Ich war entschlossen, ihn da liegen zu lassen. Sollte sie doch gehen, endlich, in ihre Laube. Ich sah Gigi an, aber das Signal funktionierte nicht. Gigi saß da und zerrte mit der rechten Hand an den Fingern ihrer linken Hand. Bleiche, lange Finger. Ihre Augen waren fast geschlossen, sodass unter den sehr hoch geschwungenen Augenbrauen die Lider wirkten, als seien sie aus dünner Haut gemacht, wie Fledermausflügel. Wieder schob sich Sylvias Bild davor, während nun meine hin- und hergehende Mutter abwechselnd das Fenstergeviert verdunkelte und wieder freigab. So lange, bis auch die letzte Schäfchenwolke des Kondensstreifens verwischt, verweht war.
Sylvia. Mit ihren dunklen Haaren, ihrer braunen Gesichtsfarbe war sie so ganz anders als Gigi. Minnamartha hatte es einmal ausgesprochen: »Die Witwe ist das Gegenteil.« Und hatte hinzugefügt: »Aber ich weiß nicht. So etepetete. Obwohl sie vom Land stammt. Doch ich will mich nicht in die Nesseln setzen. Bist ja noch jung. Wer weiß, wie das Leben spielt.«
Gigi fragte: »Soll ich?« Sie deutete auf das Grammofon in der Ecke.
»Mach nur Musik. Das wird dem Schlawiner guttun. Kinder ich muss rüber.«
Gigi spielte eine Platte, die sie von ihrem Bruder geerbt hatte:
Ach Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett. Man sieht ja deinen zarten Teint, sogar was vom Korsett.
Ach Paula, mach die Bluse zu. Ich schwör’s bei meiner Treu: Es dauert gar nicht lange mehr, dann sind die Pferde scheu!
Ich, Menschlein, flog von den Wolken des Fiebers getragen hinaus, oder ein Teil, ein flüchtiger Bestandteil von mir flog, während Ohren mit Umgebung im Bett liegen blieben und zuhörten, wie es Paula erging, dieser Mulle mit der offenen Bluse (an der wahrscheinlich alle Knöpfe fehlten), ich flog und flog, von unten sah man wohl, wie ich einen Kondensstreifen entfachte, ins Fensterviereck hinein. Wohin flog ich? Zu Sylvia? Oder nur zu einem, der die Hirtenflöte blies?
Welch ein Quatsch!
Ich hörte nicht mehr hin, wie Paula krächzend verschied.
Es war Zeit, Fieber zu messen.
Ich sagte zu Gigi: »Gibst du mir mal das Thermometer?«
Neununddreißig fünf.
»Schlimm?«, fragte Herr Blüte, als ich wieder zur Arbeit erschien. Ich schilderte ihm meine Fieberanfälle, in der Hoffnung, sein Mitgefühl zu erwecken. »Schlimm«, sagte er wieder, diesmal auf die Fragebetonung verzichtend. »Hoffentlich bleibt nichts nach.«
Sylvia Flötotto stand oben auf der Leiter, räumte soeben angelieferte Neuerscheinungen ins Regal. Benno Blüte schichtete die Rowohlt-Rotationsromane neben die Kasse, im Zeitungsformat waren die ersten gerade herausgekommen, fünfzig Pfennige das Exemplar. Sein Blick traf, über den Rand der Eulenbrille, die Witwe. Er legte die Romane, die er in der Hand hielt, auf den Stapel. »Gütiger Himmel, Frau Flötotto«, sagte er, »so geht es nicht.« Sylvia fuhr herum, hielt das Gleichgewicht, indem sie den Bücherstapel in ihren Händen erst hin- und herschwenkte, dann an ihre Brust und unters Kinn presste. Sie fragte:
»Wie?«
»Ihr Rock. Um genau zu sein… Ihr ehm… Unterrock. Das geht nicht für den Laden. Was sollen die Kunden denken? Außerdem – ja! Es ist unpraktisch.«
Die Witwe trug auch im Geschäft Petticoats. Ihre wegen später Trauer oder modischen Gründen in schwarze Nylons gehüllten Beine ragten aus der rasierschaumartigen Masse hervor wie die Porzellanbeine einer Puppe. Vollends in ihrer Erstarrung da oben glich sie mehr einem Spielgerät als einem lebenden Menschen.
Sie fasste sich und sagte: »Man trägt das jetzt, Herr Blüte.«
Der Buchhändler warf ihr wieder einen Blick zu und sagte:
»Hier nicht!«
Das war endgültig. Sylvia Flötotto zuckte mit den Schultern, setzte die unterbrochene Bewegung fort, indem sie die Bücher ins Regal hob. Dann stieg sie von der Leiter.
Blüte sah nicht mehr hin. »Im Keller ist das Antiquariat zu ordnen«, schlug er mehr vor, als er befahl.
Wir stiegen hinab ins Gewölbe, das Neonröhren erleuchteten. Hier zogen sich Regale mit all jenem, das, jahrelang verboten, nun aus verschiedenen Quellen den Laden überflutete, um neue Kundschaft zu finden: Thomas Mann. Frank Thieß. Hoffmannsthal. Jakob Wassermann. Kästner. Tucholsky. Die Verleger kamen längst nicht hinterher, mit Neuausgaben den Lesehunger zu befriedigen.
»Was er nur hat?«, sagte Sylvia. »Guck mal. Ist doch schön.« Sie hob ihren Rock, um die Rüschen des Unterkleides freizulegen. Sie breiteten sich aus um die schwarzen Beinstelzen. »Hübsch. Oder?«
»Eben.«
Sie ließ die Hände sinken, ich sah, dass ihre Fingerspitzen dunkel waren von der frischen Druckerschwärze der Bücher, die sie ausgepackt hatte. »Fangen wir an«, sagte sie. »Bei A wie Auburtin. Einer bläst die Hirtenflöte.«
»Du warst bei meiner Mutter?«
»Ich wollte dich besuchen. Aber du warst nicht da. Patente Frau.«
»Meine Mutter?«
»Schrecklich, den Mann am letzten Tag des Krieges zu verlieren. Ich bin zwar auch Kriegerwitwe, aber er war … mein Mann war … ich kannte ihn ja nicht lange. Aber dein Vater und deine Mutter waren doch lange verheiratet.
Stimmt es, dass sie nur einen Fuß von ihm gefunden hat?«
»– – –«
»Einen Fuß. Sie sagte, nur einen Fuß. Den rechten, glaube ich.«
»In den Bäumen hingen nur noch Fetzen. Kleidungsstücke. Splitterbomben. Russische Ratas.«
»Fliegende Nähmaschinen.«
»Sie hat einen Fuß gefunden. Aber sie war sich, glaube ich, nie sicher, dass es der Fuß meines Vaters war. Ein Fuß.«
»Sie hat ihn mitgenommen?«
»Nach Hause. Sie hat ihn in Packpapier gewickelt. In braunes Packpapier. Und unter dem Apfelbaum vergraben.
Aber weil sie nicht sicher war, ob der Fuß wirklich …
Sie hat ihn wieder ausgegraben. Ein paarmal. Ich habe sie nicht gefragt. Aber ich denke, am Schluss müssen es nur noch Knochen gewesen sein.
Sie war sich eben nicht sicher.«
»Wo ist der Fuß jetzt?«
»Ich denke, immer noch unter dem Apfelbaum. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Niemand hat sich drum gekümmert. Es war ja auch nicht gewiss, dass es sich bei dem Fuß um den Fuß meines Vaters handelte. Sie ist dann ein bisschen wunderlich geworden. Nicht direkt verrückt.«
»Wer?«
»Meine Mutter. Sie kam in ein Sanatorium. Hat immer alles verwechselt.«
»Aber jetzt ist es wieder gut?
»Alles?«
»Alles.«
»Eine patente Frau, deine Mutter.«
Ich überließ es Sylvia, in der einst verbotenen Literatur zu wühlen.
In einer Ecke hatte ich Merkwürdiges entdeckt. Ein Buch von 1840 mit der Anleitung zum Selbstherstellen von Schuhwichse. Einen Sammelband Berliner Illustrierte von 1912. Einen dicken Schinken Von der Bedeutung des Regenwurms.
Für Laubenmenschen sind Regenwürmer fast so etwas wie Haustiere. Sie lockern den Boden, erzeugen Kompost. Angler benutzen sie als Köder. Das Buch, eine Broschüre, war mit einem unansehnlichen grauen Umschlag versehen. Ich blätterte das Impressum auf. 1949 erschienen! Verfasser: Erik von Soldau auf Soddelau. Hatte sich also ein Landklitschenedelmann gleich nach dem großen Völkerringen mit Regenwürmern befasst!
Etwas zündete in meinem Hirn, wurde aber nicht greifbar. Ich stopfte die Schwarte ganz oben links ins Sachbuchregal, in die zweite Reihe, hinter Bücher über Ameisen, Aprikosen, Afrika, Antillen, Antwerpen, Anden.
Eines Tages, das wusste ich, würde ich es heraustragen, gestohlen oder bezahlt, und es würde Bedeutung für mich erlangen.
Ich hütete mich, Sylvia meine Vermutungen mitzuteilen. Die Bedeutung des Regenwurms? Sie hätte gelacht. Oder, wie in den hübschen Romanen aus der Deutschen Buchgemeinschaft stand: Sie hätte hellauf gelacht. Sie sah zu mir herüber. »Kommst du heute Abend mit zu mir?«
»Liest wieder jemand vor?«
»Nein, nein.«
»Vielleicht kommt der mit den langen gelben Zähnen?«
»Der auch nicht. Klausimausi nicht.«
»Flötottos?«
»Sind im Kino. Es gibt Tanzende Sterne. Weißt du: Mäckie Boogie. Mäckie war ein Seemann – und kein Hafen war ihm fremd…«
Sie sang das. Statt Hafen sang sie »Hoofen«. »Wäre eher etwas für uns«, sagte ich. »Was sollen die alten Flötottos mit Mäckie Boogie anfangen?«
»Ich habe sie hingeschickt.«
Ach so.
Flötottos waren altdeutsch eingerichtet. An der Wand über dem Sofa hing Kaiser Wilhelm mit einem Blechadler auf dem Helm. Die Rückenkissen waren mit Kordeln am Holzrahmen des Sofas befestigt. Der Bezugsstoff, heraldisches Muster, roch nach altem Staub. Aus einer weißen Blumenkrippe mit schwarzen Füßen wucherten Blattpflanzen. Sylvia brachte wieder ihre Sahnequirle zur Geltung. Kaiser Wilhelm schaute streng, aber über uns hinweg.
Die Witwe häutete sich. Verlor erst den Rock. Dann einen Petticoat. Dann noch einen. Wickelte sich aus einem dritten. Die übrigen Kleidungsstücke folgten. Immer in Wickelmanier. Übrig blieb ein mageres, dunkles Mädchen. Eine kleine, hungrige Zigeunerin.
Wir sammelten ihre Kleidungsstücke ein und gingen nach oben. In ihr Zimmer. Sie kroch auf die blaue Steppdecke. Legte sich hin. Mit dem Bauch nach unten.
»Dreh dich um«, sagte ich.
Wie viel Zeit war vergangen? Irgendwann hatte Mäckie ausgeboogiet. Schon schuffeiten wohl die alten Flötottos vom Kino heimwärts, unsicheren Schrittes der Alte, gestützt von Sylvias Schwiegermutter, vorbei an ebensolchen Reihenhäusern, wie sie eins bewohnten. Sylvia schwang ihr kleines Hinterteil in das Waschbecken in der Wandnische neben dem Fenster. Das Becken brach herunter. Sie winselte. Ich hob sie auf. Legte sie auf das Bett. Wieder auf den Bauch. Ich suchte eine Pinzette. Zog ihr ein paar Porzellansplitter aus der Haut. Es war nicht schlimm. Blutete kaum. Ich verklebte die Wunden mit Hansaplast.
Ihr Hintern sah kariert aus.
Ich lachte.
Sylvia heulte.
Wir hörten die Flötottos die Haustür aufschließen. Sylvia sprang auf und warf einen Morgenmantel über. Ich räumte Pflaster, Schere, Pinzette weg. Zog den Vorhang vor die Waschnische mit dem zertrümmerten Becken. »Du musst mir vorlesen«, flüsterte Sylvia.
Ein Band Heine lag auf dem Teppich. Ich las, ein bisschen zu laut:
Und Wunder thu ich alle Tag’, Die sollen dich entzücken, Und dir zum Spaße will ich heut’ Die Stadt Berlin beglücken.
Die Pflastersteine auf der Straß Die sollen sich jetzt spalten, Und eine Auster, frisch und klar, Soll jeder Stein enthalten.
Ein Regen von Zitronensaft Soll tauig sie begießen, Und in den Straßengössen soll Der beste Rheinwein fließen.
Wie freuen die Berliner sich…
Sylvia saß aufrecht auf ihrem blauen Reichssportfeld. Während ihr die Tränen noch herunterliefen, lachte sie, lachte…
Es klopfte.
Flötotto hängte seinen Truthahnschädel zur Tür herein.
»Alles in Ordnung?«
»Alles in Ordnung.«
»Der Film«, meinte er, »war nicht so gut.«