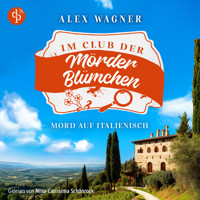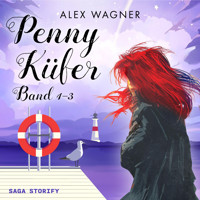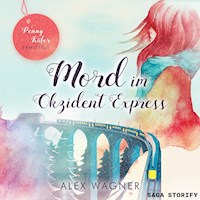9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Clara Annerson in Kitzbühel nur ein paar erholsame Tage verbringen. Doch selbst im noblen Grandhotel ist ihre Schnüfflernase gefragt: Ein angeblicher Berggeist stiftet Unruhe unter den Gästen. Bloß ein harmloser Scherz? Clara ahnt sofort, dass mehr dahinterstecken muss. Tatsächlich stößt sie bei ihren Ermittlungen auf einen überaus verdächtigen Todesfall. Und schon bald muss sie der Wahrheit ins Gesicht schauen: Der Mörder hat es ganz persönlich auf sie abgesehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eigentlich wollte Clara Annerson in Kitzbühel nur ein paar erholsame Tage verbringen. Doch selbst im noblen Grandhotel ist ihre Schnüfflernase gefragt: Ein angeblicher Berggeist stiftet Unruhe unter den Gästen. Bloß ein harmloser Scherz? Clara ahnt sofort, dass mehr dahinterstecken muss. Tatsächlich stößt sie bei ihren Ermittlungen auf einen überaus verdächtigen Todesfall. Und schon bald muss sie der Wahrheit ins Gesicht schauen: Der Mörder hat es ganz persönlich auf sie abgesehen …
Alex Wagner, geb. 1972, lebt in Wien. Ursprünglich Betriebswirtin, experimentierte sie sich durch die Jobwelt – von Private Banking und Versicherungsvertrieb über Coaching und Hypnose bis zu Weltretten bei Greenpeace. Derzeit schreibt sie an der Fortsetzung von Die edle Kunst des Mordens.
ALEX WAGNER
Das süße Lied des Todes
CLARA ANNERSONERMITTELT
Kriminalroman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefanie Kruschandl, Hamburg
Titelillustration: © getty-images: Jens Magnusson | Luciano Lozano | filo
Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-7237-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Ein verlagsneues Buch kostet in Deutschland und Österreich jeweils überall dasselbe.
Damit die kulturelle Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt, gibt es die gesetzliche Buchpreisbindung. Ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler, im Dorf oder in der Großstadt – überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
Als ich Marion Schiller versprach, ein paar Tage in ihrem Grand Hotel in Kitzbühel zu verbringen, hatte ich eines völlig vergessen: dass die Welt der Reichen und Schönen nicht gut für meine Gesundheit war. Den letzten derartigen Ausflug, die letzte Einladung eines mir wildfremden Menschen zu »unvergesslichen Tagen in einzigartigem Ambiente«, hätte ich nämlich beinahe mit dem Leben bezahlt. Und das war erst wenige Wochen her. Ich kann als Entschuldigung für diese Torheit nur anführen, dass mein Verstand nicht richtig arbeitete, weil mein Herz …
Aber ich sollte wohl am Anfang beginnen. Also: Ich lernte Marion Schiller am Freitag, den 2. September, in der Wiener Staatsoper kennen, einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt, wo an jenem Abend Beethovens einzige Oper aufgeführt wurde. Fidelio.
Leider schien der Abend unter keinem guten Stern zu stehen. Dieser Opernbesuch hätte romantisch werden sollen. Seeehr romantisch, mit Raffael an meiner Seite. Aber alles war ganz anders gekommen.
Warum hatte ich die Karten nicht einfach verfallen lassen? Das Einzige, was ich zu meiner Verteidigung vorbringen konnte, war, dass ich die Oper liebte. Die Oper im Allgemeinen und Fidelio im Besonderen. Diese Geschichte einer furchtlosen Frau, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt, um ihren Mann vor dem sicheren Tod im Kerker zu retten. Dazu die Musik von Beethoven. Die Klänge eines fast tauben Komponisten, die einem schon bei stabiler Gemütslage die Kehle zuschnürten. Heute waren sie schier unerträglich.
»Ist nicht mein Grab mir erhellet?«, sang Florestan, der gerade inmitten der Düsternis des Kerkers eine Lichtgestalt erblickte. Eine Vision seiner Frau. Leonore, die gekommen war, um ihn zu befreien. Die Stimme des Tenors war wie flüssiges Karamell. Eine Stimme, die mich unweigerlich an ihn denken ließ. Den Mann, den ich liebte. Raffael.
Nein, ich hätte nicht herkommen dürfen. Und ich hätte Marion Schiller, die ich in der Pause nach dem ersten Akt beim Buffet kennengelernt hatte, nicht in meine Loge einladen sollen. Vor einer Fremden in Selbstmitleid zu zerfließen war einfach nur pathetisch.
Ich hatte ihr den Platz in meiner Loge freilich nicht aus purer Nächstenliebe angeboten, sondern um mich davon abzuhalten, auch den zweiten Akt mit sinnlosem Gestarre auf mein Handydisplay zu verbringen. In Gesellschaft würde ich mich vielleicht nicht so verloren fühlen, hatte ich mir gesagt. Und die Gegenwart einer anderen Opernliebhaberin würde mich hoffentlich davon abhalten, mein Telefon mitten in der Aufführung aus der Tasche zu ziehen.
Der Plan war aufgegangen. Das Problem war nur, dass ich inzwischen kein Handydisplay mehr brauchte. Denn ich kannte Raffaels letzte SMS mittlerweile auswendig, genau wie die achtunddreißig anderen davor, die er mir seit seiner Abreise nach Hamburg geschickt hatte. Statt dem Geschehen auf der Bühne sah ich nur Buchstaben, immer wieder die gleichen.
Es tut mir leid, Clara. Ich glaube, es klappt doch nicht mit uns. Ich weiß, es ist feige von mir, dir das auf diesem Wege zu sagen, aber ich sehe einfach keine Zukunft für uns. Bitte verzeih mir. Leb wohl.
Raffael
Die Nachricht war vor vier Tagen gekommen. Am Montag, den 29.8., um 20.21 Uhr. Selbst die Zeit wusste ich mittlerweile auswendig.
»Ich muss für ein paar Tage nach Hamburg«, hatte Raffael mir eine Woche zuvor, am 22.8., verkündet. »Ein Freund braucht meine Hilfe.«
Ich hatte das nicht weiter hinterfragt. Raffael war oft unterwegs, in seinem Beruf als Kunsthändler, aber auch aus anderen Gründen. Gründe, die mir noch immer unklar waren.
Die Loge in der Oper hatte Raffael reserviert, bevor von der Reise nach Hamburg überhaupt die Rede gewesen war. Er hatte die Karten heimlich gekauft und mich damit überrascht. Die ganze Loge, alle sechs Plätze. Privatsphäre für zwei Jungverliebte. Eine unglaublich romantische Geste, fand ich, als er mir die Karten in einem schmalen Päckchen mit kitschiger Schleife überreichte.
Und hier saß ich nun alleine. Oder besser gesagt: neben einer fremden Frau. Ich starrte den in Ketten gelegten Tenor auf der Bühne an, der seine Leonore mit einem Engel verglich. Und zerbrach mir zum hundertsten Mal den Kopf, was ich falsch gemacht hatte.
Die achtunddreißig Nachrichten, die Raffael mir vor dem Ende geschickt hatte, waren voller Liebe gewesen. Eher angedeutet als offen ausgesprochen zwar, aber das war allein meine Schuld. Ich war es, die ihm bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit erklärt hatte, dass ich gar nicht beziehungsfähig war. Es gab jede Menge gebrochener Herzen in meiner Vergangenheit – mein eigenes inklusive. Und zwar mehr als einmal. Ja, es war sogar so weit gekommen, dass ich es als etablierte Autorin von Liebesromanen nicht einmal mehr fertigbrachte, meinen Leserinnen ein neues Buch zu liefern.
Was nur war schiefgegangen zwischen Raffael und mir?
Du fehlst mir!
Diese Nachricht hatte ich Raffael am Abend des 28. August geschickt. Das war zwar nicht das originellste Statement in drei Jahrtausenden Liebeslyrik, aber doch wohl kaum ein Grund, mit mir Schluss zu machen? Es war noch nicht spät gewesen, als ich die SMS abschickte, erst kurz nach neun. Raffael konnte unmöglich schon geschlafen haben. Und dennoch erhielt ich an diesem Abend keine Antwort. Auch den ganzen nächsten Tag nicht. Bis dann um 20.21 Uhr die Abschieds-SMS gekommen war. Und danach kein Wort mehr.
Es ergab einfach keinen Sinn.
Ich schrieb nichts zurück. Was hätte ich auch sagen sollen? Eine Erklärung verlangen? Ihn anflehen, es sich noch einmal zu überlegen? Stattdessen ging ich alleine in die Oper.
Als ich in der Pause nach dem ersten Akt – vom dem ich nur die Ouvertüre und den Gefangenenchor mitbekommen hatte – an einem wackligen Stehtisch im Mahlersaal einen Sekt hinunterkippte, sprach mich eine schlanke Frau mit platinblondem Pagenkopf an. Sie trug ein Kleid, das von einem der Laufstege in Paris oder Mailand hätte stammen können, und stellte sich mir als Marion Schiller vor. Vermutlich hatte ich ihr Mitleid erregt, wie ich so alleine, an mein Sektglas geklammert, vor mich hin brütete. »Ein herrlicher Gobelin, finden Sie nicht?«, sagte sie und deutete auf den Wandbehang unmittelbar hinter mir. Eine Szene aus Mozarts Zauberflöte.
»Sehr schön«, murmelte ich, ohne wirklich hinzusehen. Ich weiß nicht mehr, was Marion als Nächstes sagte, irgendwann redeten wir über die aktuelle Aufführung. Sie goss mir Sekt nach und erzählte von ihrer Tochter Leonore, die nach der Heldin aus Fidelio benannt war, aber dem Namen leider keine Ehre machte. Als sie schließlich erwähnte, dass sie sich erst im letzten Moment zum Besuch der Vorstellung entschlossen hatte und daher ganz oben auf der Galerie hinter einer Frau mit Hochsteckfrisur saß, lud ich sie spontan in meine Loge ein.
»Ich habe Platz«, sagte ich. »Jede Menge Platz. Viel zu viel Platz.«
Irgendwann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. »Zeit zu gehen«, hörte ich Marion Schiller neben mir sagen. Was natürlich nicht stimmen konnte, denn der zweite Akt hatte ja gerade erst begonnen. Doch als ich mir unauffällig die Augen wischte und mich umsah, strömten die Menschen bereits zu den Ausgängen.
»Kommen Sie, ich lade Sie auf einen Drink ein«, sagte meine neue Freundin.
Ich ließ mich von ihrer Hand in meinem Rücken wie eine Schlafwandlerin aus dem Opernhaus führen, gleich um die Ecke ins Hotel Sacher, wo sie offensichtlich logierte.
Bei einem klebrigen süßen Cocktail in der Hotelbar erzählte ich ihr alles. Dass Raffael mich verlassen hatte – per SMS. Wie lange er und ich zusammen gewesen waren – nur ein paar Wochen. Dass wir eigentlich gar nicht richtig zusammen gewesen waren – was an meiner verkorksten Einstellung zu Beziehungen lag. Wie wir uns kennengelernt hatten – bei einem Mordfall, der uns beinahe beide das Leben gekostet hatte. Ich erwähnte auch, dass ich Schriftstellerin war, was Marion – wie die meisten Menschen – sehr aufregend fand. Eine Schriftstellerin, die eigentlich Liebesromane schrieb, jetzt aber ins Krimifach wechseln wollte, wo ich allerdings über die Anfänge eines vagen Plots noch nicht hinausgekommen war. Nicht nur in meinem Liebesleben herrschte Chaos.
Nachdem Marion mir – keine Ahnung wie lange – geduldig zugehört hatte und ich beim dritten oder vierten Cocktail angelangt war, lud sie mich in ihr Hotel in Tirol ein. »Ein paar Tage Urlaub vom Kummer« nannte sie es. Ich weiß nicht, wann sie mir offenbart hatte, dass sie ein Hotel ihr Eigen nannte, aber es besaß offensichtlich fünf Sterne und lag an einem der schönsten Flecken in den Alpen: Kitzbühel.
»Ein Tapetenwechsel tut Ihnen sicherlich gut«, sagte sie. »Und so kann ich mich für die freundliche Einladung in Ihre Loge revanchieren. Das war wirklich nett von Ihnen, ich habe die Vorstellung sehr genossen.«
Tja, dann hatten Raffaels Opernkarten ja doch noch jemanden erfreut, dachte ich bitter. Ich nahm Marions Einladung an, ohne groß nachzudenken. Urlaub vom Kummer war genau das, was ich jetzt brauchte.
Verrückt? Ja, das war es ganz bestimmt.
Das Schiller Grand Hotel war vor über hundert Jahren von Marions Vorfahren erbaut worden, die zuvor ein Vermögen im Silberbergbau gemacht hatten. Das jedenfalls erzählte sie mir auf der Rückbank ihres Mercedes Jeeps. Gelenkt wurde der Wagen von Marions persönlichem Assistenten, einem gewissen Daniel Crane. Der gute Mann schien den Jeep mit einem Ferrari zu verwechseln und 190 km/h auf der Autobahn als entspannte Reisegeschwindigkeit zu empfinden. Ich klammerte mich an den Türgriff und vermied es, auf die Straße zu sehen, während Daniel Crane lässig mit einem Arm am Fenster lümmelte und mit lediglich drei Fingern der anderen Hand den Wagen steuerte.
Außerdem erfuhr ich, dass Marion auch privat im Hotel wohnte und zahlreiche weitere Hotels besaß. Die Schiller-Grand-Hotel-Kette zählte mittlerweile dreiundvierzig Niederlassungen, die über den gesamten Erdball verstreut waren, von Oslo bis Muskat, von Peking bis Rio de Janeiro.
»Ich fahre übermorgen nach Kitzbühel zurück. Da kann ich Sie doch gleich mitnehmen«, hatte Marion mir in Wien erklärt, nachdem ich ihre Einladung angenommen hatte. »Das ist bequemer als mit dem Zug.«
Während der Fahrt bestätigte sie den ersten Eindruck, den ich von ihr gewonnen hatte: Sie war eine erstaunlich geduldige Zuhörerin. Teilweise fühlte ich mich wie auf der Couch einer Psychiaterin, nur dass die Couch im Höllentempo zwischen LKWs und Touristenbussen über die Autobahn jagte. Marion ließ sich von mir geduldig alles über meine Beziehung zu Raffael erzählen, solange bis ich es selbst nicht mehr hören konnte. Ich an ihrer Stelle hätte mich weinerliches, in Selbstmitleid zerfließendes armes Opfer schon zwanzig Kilometer nach Wien auf dem Pannenstreifen ausgesetzt.
Kurz vor Salzburg gelang es mir endlich, mich zusammenzureißen und das Thema zu wechseln. Ab da sprachen wir über aktuelle Thriller und persönliche Lieblingsautoren – worüber ich zum Glück in jeder Gemütslage plaudern konnte.
Marion Schiller war eine belesene und sehr kluge Frau, das wurde mir rasch klar. Ich mochte sie. Vielleicht hatte mir der Verlust meines Geliebten zumindest eine neue Freundin eingebracht. Kein Tausch, den ich freiwillig gemacht hätte. Aber auf lange Sicht war eine gute Freundin wertvoller als jeder Mann – das behaupten zumindest die Frauenzeitschriften.
Das Schiller Grand Hotel lag südlich von Kitzbühel. Es thronte hoch oben auf einem bewaldeten Hang und bot einen spektakulären Blick über die Stadt tief unten im Tal und die schneebedeckten Berggipfel in der Ferne.
Ich hatte einen pompösen Kasten im Alpenschick erwartet, aber das Haus entpuppte sich als architektonische Kühnheit allererster Güte: ein gut hundertfünfzig Meter langes, dreistöckiges Ensemble mit viel dunklem Holz und tiefhängenden Dächern, wie sie bei Tiroler Bauernhäusern üblich waren – aber das war es dann auch schon mit den traditionellen Anklängen. Zwischen den Holzelementen funkelten Stahl und Glas, die wie aus einem Science-Fiction-Film anmuteten, und über Teile des Erdgeschosses rankte sich Efeu. Eine postmoderne Zurück-zur-Natur-Idylle. Vor dem Hotel erstreckte sich eine Panoramaterrasse mit Lounge-Möbeln und weißen Sonnensegeln, die Rückseite des Hauses bildete die Felswand, in die es hineingebaut war.
»Ich kümmere mich um Ihre Suite und lasse Ihren Koffer auspacken«, sagte Daniel Crane im vollendeten Kammerdiener-Tonfall und griff nach meinem Gepäckstück, einem gut fünfzehn Jahre alten Lederkoffer, der mir mit seinen abgewetzten Ecken und Kanten auf einmal sehr schäbig vorkam. Ich hatte nicht damit gerechnet, hier wie ein Staatsgast empfangen zu werden. In meinem ganzen Leben hatte noch niemand zu mir gesagt, er lasse meinen Koffer auspacken.
Für einen Sekretär besaß Daniel Crane bemerkenswert muskulöse Arme, aber sein gut sitzender Anzug und der perfekte Scheitel verliehen ihm eine gewisse Eleganz. »Sie möchten bestimmt erst einmal in Ruhe zu Mittag essen«, sagte er. Sein Deutsch war fehlerfrei, aber er sprach mit einem Akzent, der eine amerikanische Herkunft vermuten ließ.
Marion hakte sich bei mir unter und führte mich auf die Panoramaterrasse, die zu der frühen Nachmittagsstunde fast verlassen dalag. Eine russische Familie war mit ihren temperamentvollen Kindern beschäftigt, und am hinteren Ende der Terrasse blätterte eine ältere Dame in einer Illustrierten. Ihre blonde Löwenmähne war so augenscheinlich eine Perücke, dass ich den Blick rasch abwandte.
Ein auffallend attraktiver Mann mit teurer Sonnenbrille hob die Hand zum Gruß, als er Marion erblickte. Sie nickte etwas steif zurück und führte mich zu einem Tisch ganz am Rand der Terrasse, der im Schatten einiger gewaltiger Fichten lag. Die Baumwipfel schaukelten sanft in der warmen Luft.
»Ein beeindruckendes Anwesen«, sagte ich, nachdem eine Kellnerin in Tiroler Tracht meine Bestellung aufgenommen hatte. Marion ließ sich nur ein Mineralwasser bringen.
»Nicht mein Verdienst«, sagte sie mit einem bescheidenen Lächeln, aber doch unüberhörbarem Stolz in der Stimme. »Ich habe es nur geerbt … und ein wenig modernisiert. Erwin führt jetzt die Geschäfte. Mein Mann. Er ist gerade in der Hohen Tatra, wo wir nächstes Jahr ein Schiller Mountain Resort eröffnen werden. Er ist ein sehr fähiger Manager.« Ihr Lächeln wurde breiter. »Deswegen habe ich ihn geheiratet. Ich selbst widme mich ganz meiner Stiftung, die …«
Weiter kam sie nicht. »Mum!«, kreischte eine Sopranstimme hinter uns, die mich vor Schreck beinahe aufspringen ließ.
Ich fuhr herum. Eine junge Frau war es, die da angestürmt kam. Noch keine zwanzig und das gleiche platinblonde Haar wie Marion. Nur war es wesentlich länger und so perfekt geglättet, dass es ihre Schultern wie Quecksilber umfloss. Nicht einmal mein fürstlich entlohnter Friseur konnte eine solche Prachtmähne zaubern.
Das Mädchen hatte einen seidenen Morgenmantel an, auf dem sich tropische Blumen rankten. Er war so lose gebunden, dass man ihre Brüste mehr als nur erahnen konnte. Einen BH trug sie nicht. Dafür bühnenreifes Make-up. Dahinter aber war ihr Gesicht zart, und sie strahlte trotz ihrer Aufmachung eine Art von Unschuld aus. Beinahe wie eine Elfe, die sich aus dem dichten Wald, der das Hotel umgab, hierher ins Sonnenlicht verirrt hatte.
Eine verdammt wütende Elfe allerdings. »Er war in meinem Zimmer, Mum!«, rief sie und knallte einen Steinbrocken vor Marion auf den Tisch. »In meinem Zimmer!«
Direkt hinter mir zerbarst mit lautem Klirren ein Glas. Erneut wirbelte ich herum. Eine der Kellnerinnen stand da wie vom Blitz getroffen, das silberne Serviertablett, das eben noch das Glas getragen haben musste, wie einen Schild vor die Brust gepresst. »Der Bergmann!«, stieß sie hervor. »Er ist zurück!« Die Wangen der jungen Angestellten hatten sämtliche Farbe verloren.
Die Augen aller Anwesenden waren auf sie gerichtet. Sogar die tobenden russischen Kinder verstummten einen Augenblick und gafften zu uns herüber. Stille. Nichts außer dem sanften Rascheln der Baumwipfel in der warmen Brise des Nachmittags.
»Entschuldigung, Frau Chefin! Ich …« Die Kellnerin kniete sich hin und klaubte mit zitternden Fingern die Scherben zusammen. »Wie ungeschickt von mir. Ich werde das sofort …«
»Schon gut, Alice«, sagte Marion und lächelte bemüht.
Das Mädchen im Morgenmantel ließ sich indessen unaufgefordert in den freien Stuhl an unserem Tisch fallen und stöhnte. Anklagend deutete sie auf den Steinbrocken, den sie Marion vor die Nase geknallt hatte. Er war faustgroß und von unauffälligem Grau. »Ich hab ’nen Scheißschrecken gekriegt. Ich …«
»Leonore, du vergisst dich«, zischte Marion ihr zu. Sie blickte über ihre Schulter, doch die anderen Gäste hatten das Interesse bereits wieder verloren. Bis auf den attraktiven Mann mit der Sonnenbrille, der ungeniert zu uns herüberstarrte. Als er meinen Blick auffing, lächelte er, nickte mir zu und wandte sich dann wieder dem gewaltigen Eisbecher zu, an dem er schon seit unserer Ankunft löffelte.
Marion seufzte. »Darf ich vorstellen: meine Tochter Leonore. Leo, das ist Clara Annerson, mein Gast.« So wie sie die beiden letzten Worte betonte und Leonore dabei mit verengten Augen fixierte, war offensichtlich, dass ihr das Betragen ihrer Tochter in höchstem Maße peinlich war.
Leonore jedoch schien das entweder nicht zu bemerken oder – was ich für wahrscheinlicher hielt – nicht zu kümmern. Sie gab mir zwar artig die Hand, ein lascher und kaum spürbarer Händedruck, aber dann setzte sie ihren Zornesausbruch auch schon fort. Nicht ganz so lautstark immerhin, aber mit einer Vehemenz, die man einem so zarten Geschöpf kaum zugetraut hätte.
»Das ist alles deine Schuld, Mum! Es reden schon alle drüber, das ganze Personal und so! Du holst die Toten aus ihren Gräbern. Das sagen sie! Echt toll, wenn man so ’ne Mutter hat.«
»Leonore! Es reicht! Ruf Daniel an, er soll sich das ansehen. Stellt fest, ob etwas fehlt, und dann lass dein Zimmer aufräumen. Du …«
»Daniel, Daniel. Immer nur Daniel. Er wird’s schon richten, nicht wahr! Kannst du dir vorstellen …«
Was Marion sich vorstellen sollte, erfuhr ich nie, denn in diesem Augenblick trat besagter Daniel an unseren Tisch. Es handelte sich um Marions Sekretär, wie ich bereits vermutet hatte. Er warf Leonore einen Blick zu, den ich nicht deuten konnte, wandte sich dann aber sofort Marion zu. »Frau Schiller, ich muss Sie dringend sprechen.« In seiner Rechten hielt er ein Mobiltelefon, das er zusammenpresste, als wolle er es auswringen.
»Frau Annersons Essen wurde noch nicht serviert«, erwiderte Marion, die jetzt kerzengerade in ihrem Stuhl saß. »Treffen wir uns nachher im Büro.« Ihre Lippen bewegten sich kaum beim Sprechen.
Die höfliche Gelassenheit war aus Daniels Miene verschwunden. Stattdessen wirkte sein Gesicht jetzt hart und angespannt. »Ich fürchte, es kann nicht so lange warten, Frau Schiller.«
Marion sog hörbar die Luft ein. Kurz dachte ich, sie würde den Frust, den ihre Tochter ihr bereitet hatte, an Daniel auslassen. Doch schließlich stand sie auf und schob ruckartig ihren Stuhl zurück.
»Entschuldige bitte, Clara …«, begann sie. Seit der Autofahrt duzten wir uns.
»Gar kein Problem«, sagte ich rasch. »Ich schaffe das schon allein.« Mein Lächeln geriet vermutlich etwas schief, da ich befürchtete, dass mir jetzt womöglich Leonore statt Marion beim Essen Gesellschaft leisten würde. Neugierig wie ich nun einmal bin, interessierte mich zwar, was es mit dem Einbruch in Leonores Zimmer und dem Gesteinsbrocken auf sich hatte. Aber die zornige junge Dame im Seidenmantel verspürte bestimmt wenig Lust, für einen Gast ihrer Mutter die Gesellschafterin zu spielen.
Zum Glück erübrigte sich das. Kaum war Marion ihrem Sekretär mit hart klackernden Absätzen ins Hotel gefolgt, erschien eine junge Frau in Kniebundhosen und schweren Bergschuhen auf der Terrasse. Als Leonore sie sah, hellte sich ihr Elfengesicht auf. »Naomi! Hier drüben!«
Die junge Frau – sie wirkte ein paar Jahre älter als Leonore – winkte und fädelte sich zwischen den Tischen zu uns durch. Sie verpasste Leonore Luftküsschen auf beide Wangen und streckte mir ihre Hand entgegen. »Hallo, ich bin Naomi. Ich bin die Wanderführerin hier im Hotel.« Sie war braungebrannt, hatte schulterlange braune Locken, und ihr Mund wirkte ein wenig verkniffen. Doch ihr Lächeln war warm und ihre Stimme ruhig und unaufgeregt. Eine Wohltat nach Leonores Auftritt.
Wir tauschten ein paar Höflichkeiten aus: Woher ich kam, wie meine Anreise verlaufen war, wie mir das Hotel gefiel … Als ich erwähnte, dass ich zum ersten Mal in Kitzbühel urlaubte, und Leonore einwarf, ich sei ein »Spezialgast« ihrer Mutter, lud mich Naomi gleich für den nächsten Tag zu einer gemeinsamen Wanderung ein. »Ich zeige Ihnen ein bisschen die Gegend, wenn Sie möchten – die Streif, unsere berühmte Skirennstrecke!« Darauf schien sie besonders stolz, vermutlich zu Recht, denn selbst ich als hundertprozentiges Anti-Sportstalent hatte schon von der Streif gehört.
Als ich fertig gegessen hatte, sprang Leonore auf und zerrte ihre Freundin mit sich fort. Ich protestierte nicht. »Dann bis morgen«, sagte Naomi. Leonore legte den Arm um sie, und noch bevor die beiden im Hotel verschwunden waren, steckten sie die Köpfe zusammen. Ich sah, wie Leonore begann, aufgeregt auf Naomi einzureden. Was sie zu sagen hatte, konnte ich allerdings nicht mehr hören.
Ich lehnte mich zurück und genoss für einen Augenblick das Alleinsein. Bauschige weiße Wolken zogen über den Himmel, die Dächer der Stadt tief unten im Tal glänzten in der Nachmittagssonne, und ich sagte mir, dass dieser Urlaub eine hervorragende Idee war. Ich würde wieder schreiben, vielleicht endlich den Krimi aufs Papier bringen, den ich mir schon seit vielen Monaten vornahm. Und auf keinen Fall würde ich an Raffael denken! Doch noch während ich mir das einredete, sah ich ihn schon wieder vor mir. Ohne dass ich die Augen schließen musste. Seine große, schlanke Gestalt, die Katzenanmut seiner Bewegungen, die dunklen Haare, die ihm bis auf die Schultern fielen, die tiefblauen Augen … Sie hatten die gleiche Farbe wie der Himmel über Kitzbühel. Noch vor knapp zehn Tagen hatte ich in diesen Augen gelesen, dass Raffael mich bis ans Ende aller Tage lieben würde.
Wie man sich irren kann.
Die Kellnerin, die meinen Teller abservierte, war die gleiche, die vorhin das Glas hatte fallen lassen. Ich bestellte einen Kaffee bei ihr, und als sie ihn brachte, begann ich ein Gespräch. Mittlerweile saßen nur noch die alte Frau mit der Perücke und ein asiatisches Pärchen auf der Terrasse und wurden von einer anderen Kellnerin bedient. Zeit für ein paar Fragen also. Ich musste mich dringend ablenken.
»Alice, nicht wahr?«, sprach ich sie an. »Sie Ärmste sind ganz schön erschrocken vorhin.« Ich setzte ein mitfühlendes Lächeln auf.
Alice verzog gequält das Gesicht, sagte aber nichts.
Ich redete weiter. »Ich habe nicht ganz verstanden, worum es eigentlich ging. Was hatte es denn auf sich mit diesem Gesteinsbrocken, den Leonore in ihrem Zimmer fand?«
Alice wurde blass. Rasch sah sie sich um. Einen Augenblick schien sie unentschlossen. Ihre Stirn legte sich in Falten, dann glättete sie sich wieder. Vermutlich fochten Angst und Klatschsucht in ihrem Inneren gerade einen Kampf um die Vorherrschaft aus. Die Klatschsucht gewann. Alice beugte sich zu mir herab und flüsterte: »Im Hotel geht der Geist eines Bergmanns um! Und heute war er wohl im Zimmer von Fräulein Schiller. Er hinterlässt oft dieses Fahlerz. Wie eine Unterschrift, verstehen Sie?«
»Ein Bergmann?«
»Ja. Ein Minenarbeiter, Sie wissen schon.« Da war jetzt Ungeduld in ihrer Stimme. Sie sah mich an, als wäre ich eine besonders begriffsstutzige Touristin.
»Und er hinterlässt das hier?« Ich deutete auf den Steinbrocken.
»Fahlerz. Ja. Das ist silberhaltiges Gestein … wie es früher in den Minen hier abgebaut wurde.« Alice warf einen raschen Blick über ihre Schulter, als könne die bloße Erwähnung dieses Bergmanns ihn selbst im hellen Sonnenlicht der Terrasse heraufbeschwören.
»Er spukt im ganzen Haus herum«, fuhr sie leiser fort. »In den Lagerräumen, dem alten Keller, in den Gästesuiten, selbst im Personalquartier. Eine rastlose Seele, verstehen Sie!« Sie sah mich durchdringend an.
Ich nickte, als wüsste ich bestens Bescheid über rastlose Seelen.
»Und was hat Frau Schiller mit dieser Sache zu tun?«, fragte ich.
Alice wurde noch blasser. »Frau Schiller? Sie … Sie meinen mit ihrer Stiftung?«
Ich hatte keine Ahnung, was ich meinte, aber wieder nickte ich rasch.
»Bestimmt nichts! Das ist nur übles Gerede!«, rief Alice. »Nein, ganz bestimmt nichts!«
Das Personal mochte alles Mögliche hinter Marions Rücken über sie sagen. »Du holst die Toten aus ihren Gräbern«, wie ihre Tochter es ausgedrückt hatte. Aber vor Gästen redete man im Schiller Grand Hotel anscheinend nicht schlecht über die Chefin. Zumindest nicht Alice.
»Er ist gefährlich, dieser Berggeist!«, fuhr sie in aufgeregtem Flüsterton fort. »Böse und gefährlich! Bestimmt will er Rache für ein Unrecht, das ihm widerfuhr!« Erneut blickte sie sich um. »Die Vorfahren der Schillers haben ein Vermögen gemacht im Silberbergbau, wissen Sie. Während die Arbeiter … natürlich wurden sie ausgebeutet und so … aber sie starben auch, verstehen Sie? Ganz viele von ihnen! Als das Schwarzpulver aufkam und nicht mehr von Hand geschürft wurde, da gab’s jede Menge Tote! Davor natürlich auch schon. Eingestürzte Stollen und so. Bestimmt starb dieser Bergmann hier in unserer Mine!« Sie deutete auf die Felswand, in die das Hotel hineingebaut war. »Und jetzt rächt er sich an den Gästen!« Ihr Busen bebte im ausladenden Dekolleté des Trachtenkleids.
»Wurden denn schon Leute angegriffen?«, fragte ich. Die Krimischriftstellerin in mir war erwacht und witterte eine Story. Ein Mörder, der sich hinter einer Geistergeschichte versteckte und auf diese Art unliebsame Menschen ins Jenseits beförderte? Na ja, vielleicht nicht ganz der Geschmack des modernen Lesers.
»Dieser verunglückte Wanderer, wissen Sie …«, riss mich Alice aus meinen Gedanken. »Also Elena, eins der Zimmermädchen, sie sagt, das war auch der Bergmann. Dass er ihn … Sie wissen schon. Dass er ihn geschubst hat!«
»Welcher Wanderer?«
»Hat Ihnen Frau Schiller das nicht erzählt? Ein Hotelgast, der am Berg in den Tod gestürzt ist. Ist erst zwei Wochen her. Angeblich ist er abgestürzt! Aber Elena glaubt … Und ich denke, sie hat recht …« Alice kaute an ihrer Unterlippe, während ihre weit aufgerissenen Augen den Berggipfel fixierten, der hinter dem Hotel aufragte. »Wir sind alle in Gefahr!«, rief sie. Es klang eher genussvoll als ängstlich, aber bevor ich weitere Fragen stellen konnte, strich die junge Kellnerin ihre Dirndlschürze zurecht und huschte davon.
Kurz nach 18 Uhr klopfte es an meiner Zimmertür. Als ich öffnete, stand Daniel Crane vor mir. Er überragte mich um mehr als einen Kopf und hatte wieder sein schönstes Kammerdiener-Lächeln aufgesetzt. »Frau Schiller bat mich, Sie zum Dinner zu geleiten«, sagte er. Mit seinem amerikanischen Akzent klang das herrlich gestelzt.
Ich hatte den Eingang zum Hauptrestaurant bereits am Nachmittag entdeckt – es lag auf dem gleichen Stockwerk wie mein Zimmer –, aber dennoch ließ ich Daniel vorangehen und mich geleiten.
Ich hatte eigentlich angenommen, dass Marion mit mir gemeinsam essen würde, aber offensichtlich war sie noch beschäftigt.
»Oh, Frau Schiller …«, sagte Daniel, als ich ihn nach Marion fragte. »Sie folgt einer ganz speziellen Diät. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Foundation. Wir haben unseren eigenen Koch und essen oben in der Lounge.« Er lächelte.
Die Foundation, das musste die Stiftung sein. Die gleiche, die die Toten aus ihren Gräbern holte, wie Leonore es ausgedrückt hatte?
Mir blieb keine Gelegenheit, Marions Sekretär dazu weitere Fragen zu stellen, denn wir hatten schon den Restaurantempfang erreicht. Daniel nahm den jungen Mann, der dort mit einem Klemmbrett hinter einem Pult stand, kurz beiseite, flüsterte ihm etwas zu, das nach »persönlicher Gast der Chefin« klang, und dann war er auch schon verschwunden.
Der Empfangsmitarbeiter führte, nein geleitete, mich zu einem Tisch an einem der raumhohen Fenster und rückte mir ergeben den Stuhl zurecht.
Der Blick ins Tal war Romantik pur. Urige kleine Häuser, die sich aneinanderschmiegten, funkelnde Lichter, die reinste Postkartenidylle. Auf der schneeweißen Tischdecke flackerte ein Teelicht in einer kunstvoll geschliffenen Glasschale, und das Zirbenholz, mit dem die Wände vertäfelt waren, verströmte einen aromatischen Duft. Nur der Stuhl mir gegenüber trübte die Stimmung. Denn er blieb leer. Kein Raffael, der bei Kerzenlicht aussah wie der Engel, dessen Namen er trug. Kitschig, ich weiß. Tja, damit war es vorbei. Ab jetzt würden meine Abende in nüchterner Sachlichkeit verlaufen. Nur ein leerer Platz mir gegenüber und neben mir der Kellner, der mir die Weinkarte in die Hand drückte. Vielleicht sollte ich endlich mit dem Trinken anfangen …
Wie erbärmlich! Ich verscheuchte den Gedanken. Reiß dich zusammen, Clara. Ich bestellte Mineralwasser, sprang auf, kaum dass der Kellner sich entfernt hatte, und steuerte das Buffet an.
Es war wie ein Marktplatz gestaltet. Viele kleine Tresen und Stände, in einem Halbrund arrangiert. Düfte und Farben, die einen mal hierhin zogen, mal dahin. An den größeren Stationen wurde live gekocht.
Die ersten beiden Gänge verschlang ich wie Burger in einem Schnellrestaurant, ohne auch nur einmal von meinem Teller aufzusehen. Den leeren Stuhl mir gegenüber blendete ich aus.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war. Irgendwann sagte eine Stimme neben mir: »Sie sehen aus, als könnten Sie eine Mousse au Chocolat vertragen.« Als ich aufblickte, stand der Mann vor mir, den ich schon am Nachmittag auf der Terrasse bemerkt hatte. Der gutaussehende Hotelgast mit Sonnenbrille, der neben uns sein Eis gelöffelt hatte. Jetzt allerdings trug er keine Brille. Dafür hielt er in jeder Hand eine Schale Mousse au Chocolat mit üppigem Sahnehäubchen.
»Viktor Kössler aus Basel«, sagte er mit unverkennbar schweizerischem Akzent. Er stellte die beiden Schalen ab und streckte mir seine Hand entgegen. »Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten?«
Ich nickte mechanisch und bot ihm den verhassten leeren Stuhl an. Und kam mir im gleichen Augenblick so erbärmlich vor, dass ich zornig auf mich selbst wurde. Ich richtete mich auf und atmete tief ein. Dann machte ich mich über die Mousse au Chocolat her. Pure Medizin.
Erst danach wurde mir bewusst, dass ich mich nicht vorgestellt hatte. »Clara Annerson«, sagte ich rasch und streckte meinem neuen Gegenüber die Hand hin. »Sie … reisen auch allein?«
»Ja«, sagte er, und es klang kein bisschen wehmütig. Für einen Augenblick sahen wir uns an, zu lange vielleicht, zu neugierig …
Ich wandte rasch den Blick ab, ließ ihn durch den Raum schweifen. Und da bemerkte ich all die Paare im Saal. Abgesehen von der alten Frau mit der auffallenden Perücke, die ich schon am Nachmittag gesehen hatte und die jetzt ein Buch bei Tisch las, saßen überall um uns herum nur Menschen im Zweierpack. Junge Paare, alte Paare, Paare, die sich verliebt anlächelten, die Köpfe zusammensteckten, sich küssten …
Ein Mann strich seiner Begleiterin eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Was für eine zärtliche Geste. Und schon sah ich wieder Raffael vor mir. Wie ihm seine dunklen Haare ins Gesicht fielen, wann immer er sich über einen Teller beugte. Oder über eins der einzigartigen Kunstobjekte, die er für Sammler aus aller Welt beschaffte. Oder über mich. Am liebsten über mich.
»Sie essen nicht oft allein«, bemerkte Viktor Kössler und riss mich in die Gegenwart zurück. Ich fühlte mich ertappt.
»Nein«, sagte ich knapp und zuckte die Schultern, so gleichgültig es mir möglich war.
Nach dem Kaffee verabschiedete ich mich von meinem neuen Bekannten, ohne dass wir über etwas Small Talk hinausgekommen waren, und ging auf mein Zimmer.
Mein Bett war für die Nacht bereitet worden, auf dem Kopfkissen thronte eine Praline in glänzender Folie. Ich kletterte unter die Decke, knipste das Licht aus und ließ mich fallen. In die Dunkelheit, in die gnädige Auslöschung des Schlafs, ins Vergessen.
Und damit war der Teil meines Urlaubs, in dem ich die Muße hatte, in Selbstmitleid zu schwelgen, zu Ende.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte sich mein Kopf an, als hätte ich ihn nachts gegen die Wand geschlagen. Schwer und dumpf und viel zu groß. Vor den Fenstern zogen Nebelschwaden vorüber, und ein ganzer Chor aus Vogelstimmen pfiff, trillerte und krähte, als gäbe es etwas zu feiern.
Ich rollte mich auf die andere Seite, um noch einmal einzuschlafen – da sah ich den Stein. Er lag auf meinem Nachttisch, direkt neben dem Telefon. Unauffällig grau mit einem winzigen blauen Fleck. Als gehöre er dort hin. Einen schlaftrunkenen Augenblick lang hielt ich ihn für eine Art Briefbeschwerer.
Doch dann registrierte mein Gehirn endlich, was es da sah. Mit einem Schlag war ich munter. Fahlerz! Ich rappelte mich hoch. Das gleiche Gestein, das Leonore Schiller ihrer Mutter gestern Nachmittag vor die Nase geknallt hatte.
Der Berggeist! Natürlich war mir bewusst, dass Geister blanker Unfug sind. Nichtsdestotrotz hämmerte unvermittelt der Puls in meinen Schläfen. Jemand war hier gewesen! In meinem Zimmer, in der Nacht. Wie war das möglich?
Dann sah ich das Graffiti. Beinahe hätte ich laut aufgeschrien. Große schwarze Buchstaben, die sich über die halbe Wand zogen:
Es war kein Unfall.
Einen Augenblick lang saß ich wie vom Blitz getroffen da, japste nach Luft und krallte mich an meiner Decke fest. Dann tat ich das Gleiche wie Leonore am Tag zuvor, als sie das Opfer des Spuks geworden war: Ich rief nach Marion. Auch wenn sie nicht meine Mutter war. Mit klammen Fingern wählte ich ihre Mobilnummer, die ich in meinem Handy eingespeichert hatte.
Zehn Minuten später stand sie vor mir, Daniel Crane an ihrer Seite. Mit zornrotem Gesicht starrte sie auf den Schriftzug an der Wand. Daniel ging hin und strich mit den Fingern darüber, kniff die Augen zusammen und untersuchte jeden einzelnen Buchstaben. Schließlich roch er sogar daran. »Vermutlich Textmarker oder etwas Ähnliches«, sagte er, als er sich wieder umwandte.
»Ein moderner Berggeist«, murmelte ich. »Und eine schöne Handschrift hat er auch.« Den spöttischen Worten zum Trotz nahm mich die Sache doch ziemlich mit. Mein Magen fühlte sich an, als hätte ich einen Eisklumpen verschluckt.
»So ein Unsinn!«, fuhr Marion mich an. Sie explodierte förmlich, ihre Stimme war ein schrilles Kreischen. »Nicht du auch noch, Clara!«
Ich zuckte zusammen. Stammelte dann eine Entschuldigung, obwohl ich nicht genau wusste, wofür eigentlich.
»Wie ist er hier reingekommen?« Sie sah mich herausfordernd an.
»Das weiß ich doch nicht! Denkst du, ich habe ihn eingeladen?«
»Hast du?«
»Marion … was soll das? Von wem reden wir hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer das getan hat. Aber ein Geist war es ganz bestimmt nicht.«
»Schon gut, schon gut, tut mir leid.«
Marion verstummte, doch die Art, wie sie mich ansah, gefiel mir überhaupt nicht. Was dachte sie – dass ich das alles selbst inszeniert hatte? Meine eigene Wand beschmiert?
Es war kein Unfall. Das konnte sich wohl nur auf den zu Tode gekommenen Hotelgast beziehen. Den Mann, der in den Bergen abgestürzt war. Aber was hatte ich damit zu tun, die ich gerade einmal gestern hier angereist war? Warum brach jemand in mein Zimmer ein, um mir das mitzuteilen?
Daniel Crane begann, mir Fragen zu stellen, ganz knapp und sachlich. Wann hatte ich den Einbruch bemerkt? Vermisste ich Wertsachen? Hatte ich in der Nacht nichts gehört? Wann war ich zu Bett gegangen? Es fühlte sich an wie ein Verhör.
»Wir haben eine massive Sicherheitslücke«, sagte er schließlich, an niemand Bestimmten im Raum gerichtet.
»Was Sie nicht sagen«, zischte Marion.
»Habt ihr die Polizei schon verständigt?«, fragte ich. »Wenn ich das recht verstehe, spukt dieser vermeintliche Geist ja schon länger hier herum.« Meine Benommenheit ließ langsam nach, meine praktische Seite gewann die Oberhand. Die Seite, die sich nur allzu gerne in Dinge mischte, die mich eigentlich nichts angingen.
»Nein.« Marion zögerte. »Bitte keine Polizei. Dieser Unfall, auf den dein nächtlicher Besucher zweifelsohne anspielt«, Marion deutete auf das Graffiti, »der hat dem Hotel schon genug negative Publicity eingebracht. Ein Gast ist beim Wandern in den Tod gestürzt. Schreckliche Geschichte. Zum Glück blieb es auf die Lokalzeitung beschränkt. Die liest kaum jemand von den Touristen. Aber wenn jetzt noch bekannt wird, dass hier irgendein Verrückter nachts in den Zimmern herumspukt … das können wir uns nicht erlauben! Das wäre eine Katastrophe für unseren Ruf.«
»Ich kümmere mich darum«, brummte Daniel. Seine Kiefermuskeln traten deutlich hervor.
Marion schien sich zu fassen. Sie kam auf mich zu und legte ihre Hand auf meine Schulter. »Arme Clara, es tut mir so leid. Nach allem, was du durchgemacht hast … Du solltest dich doch hier erholen. Wir werden herausfinden, wer hinter diesem geschmacklosen Streich steckt, das verspreche ich dir!«
»Du hältst das für einen Streich?«
»Was denn sonst? Es war kein Unfall.« Wieder deutete sie auf das Geschmiere an der Wand. »Natürlich war es ein Unfall! Die Polizei hat das gründlich untersucht.«
»Hat es zuvor auch schon Botschaften gegeben?«, fragte ich.
»Nein. Bis jetzt hat er immer nur diese Steine hinterlassen.«
»Und dieser Gast … der abgestürzt ist? Wer war das?« Meine Neugier hatte mich jetzt fest im Griff.
Daniel Crane wollte antworten, aber Marion kam ihm zuvor.
»Ein gewisser Matthias Rothenach, aus Hamburg.«
Ich holte mein Notizbuch aus der Schublade, das ich eigentlich mitgenommen hatte, weil es die spärlichen Grundzüge meines geplanten Kriminalromans enthielt. Nachdem ich eine leere Seite aufgeschlagen hatte, notierte ich mir den Namen. Marion sah mir dabei über die Schulter. Wortlos, aber mit einem merkwürdigen Zucken ihrer Mundwinkel.
»Ein Stammgast?«, fragte ich.
»Nein. Er war zum ersten Mal bei uns.«
Als ich wieder aufsah, fing ich einen misstrauischen Blick von Daniel Crane auf. Seine grauen Augen waren so hart wie der Klumpen Fahlerz, den er an sich genommen hatte und auf seiner Handfläche balancierte.
Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sowohl er als auch seine Chefin mehr über den vorgeblichen Berggeist wussten, als sie zugaben. »Hast du wirklich keinen Verdacht, wer hinter diesem Spuk stecken könnte?«, fragte ich Marion.
»Nein«, sagte sie, aber es klang nicht überzeugend.
»Warum lässt du denn keine Überwachungskameras in den Gängen installieren? Das würde die Sicherheit hier im Hotel doch deutlich erhöhen.«
»Denkst du, auf die Idee sind wir nicht auch schon gekommen? Aber wir sind hier nicht in den USA. Meine Gäste würden so eine Überwachung niemals akzeptieren. Die legen Wert auf ihre Privatsphäre.«
»Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee«, sagte ich und klappte mein Notizbuch zu.
»Gute Idee.« Marion sog hörbar die Luft ein und rang sich ein Lächeln ab.
»Du bekommst erst mal ein anderes Zimmer. Und dann werden wir hier … aufräumen lassen.« Sie blickte zu Daniel hinüber.
»Ich kümmere mich darum«, sagte der mit einem knappen Nicken. Anscheinend war das sein Lieblingssatz.
Ich griff nach dem nächstbesten Kleid in meinem Schrank und machte mich – während sich in meinem Kopf die Fragen überschlugen – auf den Weg ins Restaurant.
Das Frühstücksbuffet war nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie schon das Dinner: Marktstände und Show-Cooking-Stationen – nur dass es nun freie Platzwahl im Raum gab. Ich lud zwei Croissants auf meinen Teller und bestellte eine große Kanne Kaffee. Jetzt war nicht der Zeitpunkt für gesunde Ernährung.
Was hatte es mit diesem angeblichen Geist auf sich? War er wirklich ein Bergmann, der auf Rache sann, Erzbrocken aus seiner Mine hinterließ und Wanderern den Tod brachte? Waren die Worte Es war kein Unfall sein Bekenntnis zu der Tat? Prahlte er damit, dass er für den Absturz dieses Matthias Rothenach verantwortlich war?
Das ergab einen gewissen Sinn, nur dass ich natürlich keine Sekunde an einen echten Geist glaubte. Eher an einen Wahnsinnigen aus Fleisch und Blut, was aber nicht weniger angsteinflößend war. Und was mich vielleicht noch mehr beunruhigte: Warum hatte er seine Botschaft an meine Wand gemalt?
Als ich gerade das erste Croissant verschlungen hatte, ohne auch nur auf den Geschmack zu achten, kam mir ein neuer Gedanke. Es war kein Unfall konnte noch etwas anderes sein als das Bekenntnis zu einem Mord: ein Hinweis darauf, dass – wer immer diese Worte geschrieben hatte –, er die Meinung der Polizei nicht teilte. Der vorgebliche Geist musste nicht selbst der Mörder sein. Er konnte etwas gesehen haben, etwas wissen. Und hatte vielleicht nicht den Mut, damit persönlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann sollte die Botschaft wohl lauten: Es war kein Unfall, es war Mord.
Mit Mord hatte ich gewisse Erfahrungen. In der Sache in Niederösterreich, in die ich erst kürzlich hineingestolpert war, hatte ich es genau damit zu tun bekommen. Und die offizielle Theorie der Polizei war in diesem Fall schlichtweg falsch gewesen. Davon war ich so überzeugt gewesen, dass ich mich schließlich als Amateurdetektivin betätigt und eigene Nachforschungen angestellt hatte.
Doch es war nicht davon auszugehen, dass sich das Graffiti aus diesem Grund an meiner Wand befand. Es war kein Unfall war bestimmt keine Einladung an mich, erneut die Schnüfflerin zu spielen. Meine detektivische Glanzleistung im Lohenstein-Mord hatte sich wohl kaum bis hierher nach Kitzbühel herumgesprochen. Abgesehen von dem Kommissar, der die Ermittlungen damals leitete, und einer Handvoll weiterer Menschen hatte niemand von meiner Einmischung in diesen Fall erfahren. Auch nicht davon, dass ich letztlich Erfolg hatte, wo die Polizei gescheitert war.
Nichtsdestotrotz: Noch bevor ich meine zweite Tasse Kaffee geleert hatte, beschloss ich, den Ereignissen hier im Hotel auf den Grund zu gehen. Dem angeblichen Geist und dem vermeintlichen Bergunfall. Denn in welcher Form auch immer – diese beiden Dinge hingen offensichtlich zusammen.
Meine Beweggründe hinter diesem Entschluss mögen nicht die edelsten gewesen sein. Vielleicht ging es mir bei dieser Entscheidung nicht so sehr um das wahre Schicksal des verunglückten Touristen als einfach darum, nicht mehr Tag und Nacht an Raffael denken zu müssen. Alles war besser als dieses sinnlose, selbstquälerische Schwelgen in verlorenen Erinnerungen. Jede Ablenkung war mir willkommen. Ich würde dem Unbekannten mit dem Textmarker und der Vorliebe für Fahlerz auf den Zahn fühlen, statt mir Zeit für die Trauerarbeit zu nehmen, wie das Psychologen so gerne formulierten. Ich war miserabel in Trauerarbeit, dafür verspürte ich eine Leidenschaft für ungelöste Kriminalfälle, die ich wohl nicht mehr leugnen konnte. Wenn Marion keine Polizei wollte, so bekam sie eben Clara Annerson – Amateurschnüfflerin.
Als ich aufstand, um mir noch ein drittes Croissant zu holen, betrat Naomi das Restaurant. Die Wanderführerin. Sie blickte sich um, als suche sie jemanden. Als sie mich schließlich entdeckte, winkte sie und kam an meinen Tisch.