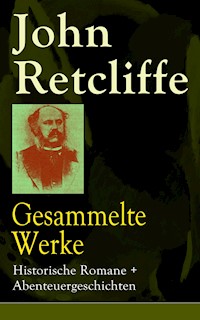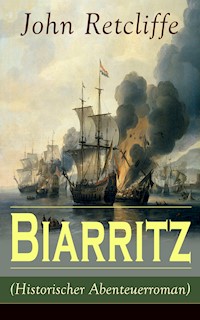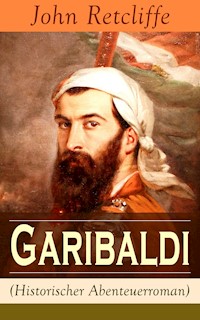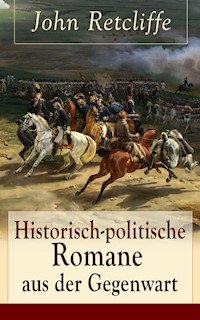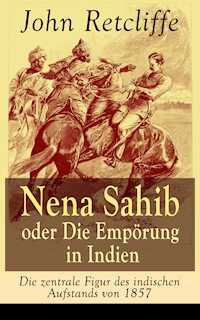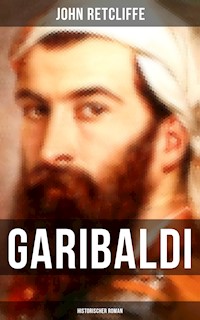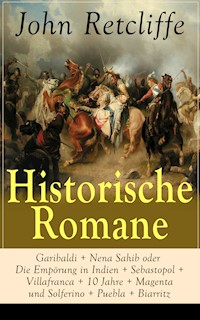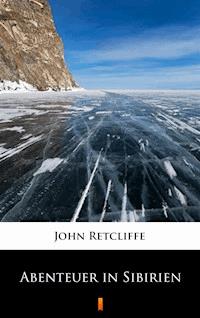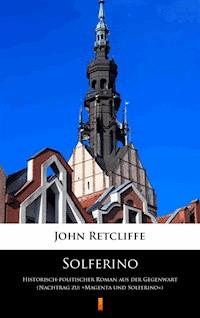1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Das Testament Peters des Großen: Historischer Roman' von John Retcliffe taucht der Leser in die faszinierende Welt des 18. Jahrhunderts ein, genauer gesagt in das Russland der Zarenzeit. Der Roman erzählt die Geschichte des Zaren Peter des Großen und seines zerrütteten Verhältnisses zu seinem Sohn Alexei. Mit einer meisterhaften Mischung aus historischen Fakten und fiktiven Elementen entführt der Autor den Leser in die Intrigen und Machtspiele am königlichen Hof. Retcliffe's Schreibstil ist detailreich und atmosphärisch, was es dem Leser ermöglicht, sich vollständig in die Handlung einzufühlen. Das Werk fügt sich nahtlos in die Tradition von historischen Romanen ein, die sowohl unterhalten als auch informieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Testament Peters des Großen: Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Das Vermächtnis des Zaren
Schneidend pfiff der kalte Oktoberwind durch die menschenleeren Straßen von Petersburg, fegte den Alexander-Newski-Prospekt hinunter und brach sich, manchmal in rüttelnden Stößen aufheulend, an den Mauern des Winterpalastes. Alles lag noch in tiefem Dunkel; die große Stadt schlief. Nur ab und zu hallte der einsame Schritt einer Wache zwischen den Mauern, oder ein Isworstschik trieb mit kurzem Zuruf seinen müden Gaul über das Pflaster, um einen verspäteten Fahrgast heimzubringen.
Hinter einem Fenster des Palastes stand in schweren Gedanken die wuchtige Gestalt des Zaren. Seine Augen blickten hinaus in die Nacht, zu den flackernden Gasflammen, die sich in der Newa spiegelten, in die kahlen Baumkronen, die sich vor den heftigen Böen beugten, und hinauf zu den rasenden Wolken, zwischen denen nur dann und wann das Leuchten der Sterne einen Weg zur nächtlichen Erde fand.
Aber Zar Nikolaus merkte nichts von alledem. Seine Gedanken trugen ihn wie Fausts Zaubermantel weit über sein Riesenreich hinunter in den Süden – an die Donau, an die Ufer des Schwarzen Meers, zu der halbmondgekrönten Hagia Sophia in Stambul. Die Kriegswürfel rollten – was würden sie für Rußland bringen? Tausende um Tausende würden sich opfern, heldenmütig, auf den Wink seines Fingers zum Tod bereit, und er allein trug die ewige Verantwortung für ihr Sterben.
Er schrak heftig auf aus seinem Träumen und wandte sich zurück in das spärlich erhellte Gemach. Scharf und kurz rasselte der Wecker; der Zeiger der kleinen Uhr wies auf fünf. Die quälenden Gedanken hatten ihn schon zwei Stunden vor der gewohnten Zeit aus dem Schlaf gestört, und er hatte vergessen, den Wecker abzustellen.
Schwer ließ er sich an seinem Arbeitstisch nieder und langte nach dem Stoß von Papieren und Akten, die seiner Durchsicht harrten. Aber müde zog er die Hand zurück; sein Auge wanderte wie gebannt hinüber an die Wand und blieb über einem Bücherschrank auf dem Brustbild Peters des Großen haften.
Ein Zug eiserner Entschlossenheit legte sich auf das Gesicht des Zaren.
»Gott mache Rußland groß!« sagte er laut vor sich hin.
Er stand auf, trat an das einfache Rollbett und holte unter dem Lederkissen einen Stahlring mit sechs verschiedenen Schlüsseln hervor; dann schritt er auf das Bild zu, stieg auf einen der starken Sessel, drückte einen Schlüssel in eine von unten fast unsichtbare Öffnung, die sich in der Mitte eines Ordenssterns auf dem Bilde befand – und die Kupferplatte, auf die das Porträt gemalt war, sprang auf.
Aus der Nische dahinter nahm er ein Kästchen von ziseliertem Eisen und mit goldenen Arabesken ausgelegt. Der Deckel trug den Doppeladler Rußlands mit der Krone darüber. Ein schneller Griff der kräftigen Hand – und der Behälter ließ sich leicht öffnen.
Vorsichtig stieg der Zar von dem Sessel herunter und setzte sich wieder an den Arbeitstisch. Behutsam, fast zärtlich entnahm er dem Kästchen eine alte Pergamentrolle und streifte sie auf.
Zar Nikolaus hielt das Testament seines Ahnen Peters des Großen zwischen den Händen ...
Es war in der Tat jenes Dokument, das die Diplomatie und die Presse der ganzen Welt in leidenschaftliche Auseinandersetzungen gestürzt und das auch heute noch von vielen für eine Erfindung der Gegner Rußlands gehalten wird.
Das Pergament trug die Jahreszahl 1725; Peter der Große hatte es nur wenige Wochen vor seinem Tode niedergeschrieben.
Langsam glitten die Augen des Zaren über die verblaßten Schriftzeichen. Seine Lippen bewegten sich beim Lesen; im Flüsterton sprach er die Sätze vor sich hin, als wolle er sich den Inhalt ganz besonders fest und unverlöschlich einprägen.
»Im Namen der hochheiligen und unteilbaren Dreieinigkeit, Wir Peter, Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen usw. allen Unseren Abkömmlingen und Nachfolgern auf dem Thron und in der Regierung der russischen Nation:
Der gütige Gott, von dem Wir Unser Dasein und Unsere Krone haben, hat Uns beständig mit seinem Licht erleuchtet und mit seiner göttlichen Hilfe gehalten. Nach dem Plane der Vorsehung ist das russische Volk berufen zur allgemeinen Herrschaft über Europa für die Zukunft.
Rußland fand Ich vor als einen Bach; Ich hinterlasse es als einen Fluß; unter Meinen Nachfolgern muß es ein großes Meer werden, bestimmt, das verarmte Europa zu befruchten. Dazu übergebe Ich ihnen das Vermächtnis der folgenden Unterweisungen, deren stete Beachtung und Befolgung Ich ihnen einschärfe, so wie einst Moses dem Volke Israel die Gesetztafeln gab.
1.
Das russische Volk stets auf dem Kriegsfuß erhalten, ein Volk von Soldaten, abgehärtet durch Gehorsam, stets zur Verwendung bereit. Dem Heere gerade so viel Rast geben wie nötig ist, um die Finanzen sich erholen zu lassen und die Truppen zu ergänzen. Die geeignetsten Gelegenheiten zum Angriff wählen. Krieg dem Frieden, Frieden dem Kriege. Dienstbar machen, immer zu dem Zwecke, das Gebiet Rußlands zu vergrößern, sein Gedeihen zu fördern.
2.
Durch alle möglichen Mittel aus den gebildeten Völkern Europas die geschicktesten Heerführer und Männer von Gelehrsamkeit und Bildung in den russischen Dienst ziehen, so daß Rußland die eigentümlichen Vorzüge aller Völker gewinnt, ohne seine eigenen zu verlieren.
3.
Bei allen Gelegenheiten sich in die innern Angelegenheiten und Streitigkeiten des übrigen Europas mischen, vorzüglich des Deutschen Reiches.
4.
Polen zerrütten durch Erregung fortwährender Unordnungen und Parteikämpfe. Die Regierungen kaufen. Durch den Reichstag Einfluß auf die Königswahlen gewinnen. Unsere Kandidaten wählen lassen, sie unter Protektion nehmen, kraft dieses Protektorats das Land besetzen, bis es Zeit ist, ganz darin zu bleiben. Wenn die benachbarten Mächte dieser Politik Schwierigkeiten machen sollten, sie für den Augenblick durch eine Teilung des polnischen Gebiets beruhigen, bis es Zeit ist, ihnen das Hingegebene wieder abzunehmen.
5.
Von Schweden so viel Gebiet nehmen, wie zu bekommen, und es zum Angriff reizen, damit Gelegenheiten gewonnen werden, es zu unterwerfen; zu dem Zweck Schweden von Dänemark trennen und umgekehrt und ihre Eifersüchte sorgfältig nähren.
6.
Die Gemahlinnen für die russischen Prinzen stets aus deutschen Häusern wählen, um dadurch unsern Einfluß in Deutschland zu mehren.
7.
Handelsbündnis vorzugsweise mit England suchen, das uns am meisten für seine Flotte braucht und uns am nützlichsten für die Entwicklung der unsrigen werden kann. Im übrigen vor England zu hüten.
8.
Uns unablässig im Norden an dem Baltischen, im Süden an dem Schwarzen Meer ausdehnen.
9.
Konstantinopel und Ostindien soviel wie möglich näher kommen. Wer dort herrscht, wird der wahre Herr der Welt sein. Zu dem Zweck unablässig Krieg erregen, abwechselnd gegen die Türkei und gegen Persien: Werften am Schwarzen Meer anlegen. Dieses, wie das Baltische Meer, Schritt vor Schritt in Besitz nehmen. Den Verfall Persiens beschleunigen. An den Persischen Meerbusen vordringen. Wenn möglich den alten Handelszug durch Syrien herstellen und gradenwegs auf Indien losgehen. Wenn einmal da, können wir das Gold Englands entbehren.
10.
Das Bündnis Österreichs mit Eifer suchen und pflegen. Offen den Gedanken Österreichs an eine künftige Herrschaft über Deutschland unterstützen, aber im geheimen die Eifersucht der deutschen Fürstenländer anfachen. Es dahin bringen, daß beide Teile Rußland um Hilfe angehen, und über Österreich ein Protektorat ausüben als Vorbereitung zu der künftigen Beherrschung.
11.
Das Haus Österreich für die Vertreibung der Türken aus Europa gewinnen und seine Eifersucht auf den Besitz Konstantinopels dadurch unschädlich machen, daß man es entweder in Krieg mit andern europäischen Staaten verwickelt oder ihm ein Stück von der Eroberung abgibt, das ihm zu gelegener Zeit wieder abzunehmen ist.
12.
Planmäßig dahin arbeiten, alle slawischen Stämme und die an der Donau und im südlichen Polen zerstreuten schismatischen Griechen um uns zu sammeln, uns zu ihrem Mittelpunkt, ihrem Rückhalt zu machen und vorläufig einen überwiegenden Einfluß zu gewinnen durch eine Art von politischer und priesterlicher Oberherrlichkeit. In dem Maße, wie dies ausgeführt wird, haben wir Freunde inmitten unserer Feinde erworben.
13.
Wenn Schweden geteilt, Persien unterworfen, Polen unterjocht, die Türkei erobert, unsere Armeen zusammengezogen und das Schwarze und das Baltische Meer von unseren Flotten bewacht sind, dann müssen wir einzeln und im tiefsten Geheimnis erst dem Wiener und dann dem Versailler Hof den Vorschlag machen, mit uns die Herrschaft der Welt zu teilen. Wenn der eine annimmt, was nicht fehlen kann, so ist er als Werkzeug zu brauchen, um den andern zu vernichten, dann der übrigbleibende zu vernichten in einem Kampfe, dessen Ausgang nicht zweifelhaft sein kann, wenn Rußland schon den Osten und einen Teil Europas besitzt.
14.
Wenn, was nicht wahrscheinlich ist, beide Mächte das Anerbieten Rußlands ablehnen, so wird es notwendig sein, sie in einen Streit zu verwickeln, in dem sie sich gegenseitig erschöpfen. Dann muß Rußland den entscheidenden Augenblick ergreifen, seine bereitgehaltenen Truppen über Deutschland ausgießen und gleichzeitig zwei Flotten von dem Schwarzen und dem Baltischen Meer mit asiatischen Horden gefüllt in das Mittelländische Meer und den Ozean schicken und Frankreich überschwemmen. Wenn Deutschland und Frankreich unterworfen sind, wird der Rest Europas uns leicht und ohne Schlag zufallen.
So kann und muß Europa unterworfen werden.«
Unter dem Dokument standen die Namenszüge aller, die nach Peter dem Großen auf dem Zarenthron gesessen hatten; als letzter in großen steilen Zeichen der des Zaren Nikolaus aus dem Jahre 1825, mit dem Datum der Stunde, ehe er die Krone erhielt.
Der einsame Mann atmete tief auf. Er verschloß Dokument und Kästchen wieder an dem verborgenen Ort und trat an das Fenster. Wie Feuer glühte das Blut in seiner Stirn; er riß das Fenster auf und gab den heißen Kopf dem kalten Winde preis.
»Beim Blute Ruriks«, sagte er halblaut vor sich hin und hob den Blick zum Himmel, an dem jetzt Millionen Sterne funkelten. »Beim Blute Ruriks – ich habe durch meine Unterschrift gelobt, einen Schritt vorwärts zu tun für Rußlands Ehre und Größe – ich werde mein Wort nicht brechen. – Wohl hab' ich gezögert, doch jetzt ist die Stunde gekommen!«
Er schloß das Fenster, ging in das Ankleidezimmer, warf den Mantel um die Schultern und stülpte den Helm auf. Leise trat er ins Vorgemach hinaus, schritt an den beiden schlafenden Pagen vorbei, dankte dem diensthabenden Kammerherrn für den Morgengruß durch ein Kopfnicken und stieg langsam die breite Treppe zum Vorhof hinab.
Der Tod des Jan Katarchi
Um vier Uhr morgens, am 13. Oktober 1853, einem Donnerstag, donnerte eine kräftige Faust an das Tor des Konaks Ismael Paschas, des neuen Statthalters von Smyrna.
Schlaftrunken und scheltend über den Lärm erhoben sich die Kawassen der Wache und öffneten die Pforte. Drei in Mäntel gehüllte Männer schritten in den Hofraum; der eine das Gesicht tief in die Falten verborgen, alle bis an die Zähne bewaffnet.
»Weckt den Statthalter«, sagte einer der Fremden; »Janos Katarchi will ihn sprechen.«
Die Kawassen und Tschokadars lachten.
»Du – Jan? – Maschallah, seht diesen Sohn eines Schweins! – Meinst du, du könntest einem Moslem in den Bart lachen? Du bist ein Esel und deine Väter waren Esel. Wir spucken auf ihr Grab und sprechen: Delhi der – es sind Tolle!«
»Jan«, höhnte ein anderer, »wird sich selber in die Höhle des Löwen wagen? Woher kommt Ihr, daß Ihr solchen Kot redet?«
Der Verhüllte warf den Mantel ab und rief mit donnernder Stimme:
»Ich bin Janos! – Geht!«
Zugleich legten alle drei ihre Waffen auf das Pflaster des Hofes und standen ernst und unbeweglich da. In die Diener des Paschas kam Leben, als sie diesen gefürchteten Mann sahen; Schlaf und Zweifel wichen aus ihren Augen und sie beeilten sich, die seltsame Kunde ihrem Herrn zu bringen. In kurzer Zeit erschien der Kiaja Bey, der Stellvertreter des Paschas, bald darauf der Gouverneur, der Statthalter selber.
Bis dahin hatte Jan auf keine Frage geantwortet. Erst als Ismael Pascha, ein Moslem von strenger, achtunggebietender Haltung erschien, faßte er die Hand eines seiner Begleiter und ging mit diesem auf den Pascha zu.
»Du hast diesem Mann versprochen, den jungen Griechen, der auf Verlangen des Inglis Konsul in deine Haft gebracht wurde, freizugeben und unbelästigt ziehen zu lassen, wenn Janos, der Kameltreiber, der Räuberhauptmann von Smyrna, in deine Hand gegeben würde. Wohl! Ich bin Janos und stelle mich selber. An dir ist es, dein Wort zu halten.«
Der Pascha strich sich den dunklen Bart; aufmerksam schaute er den so eifrig Verfolgten an. Dann sagte er ruhig: »Khosch dscheldin! Ihr seid willkommen! – Dschidelim! Laß uns gehen!« Damit wandte er sich nach der Tür des Selamlik und schritt voran, gefolgt von Janos und seinen beiden Gefährten.
In der großen Halle des Konaks, die zugleich zu Gerichtssitzungen diente, nahm der Pascha auf dem Diwan Platz und lud die Fremden ein, ein Gleiches zu tun, indem er sie höflich als seine Gäste behandelte. Auf seinen Befehl erschien alsbald der Diwan Effendi, der Schreiber des Paschas, und setzte ein Schriftstück auf. Es lautete:
»Nachdem Janos, genannt Katarchi, Räuber und Wegelagerer im Gebiet des Paschaliks von Smyrna, Seiner Hoheit dem Statthalter Ismael Pascha seinen Leib zur freien Verfügung angeboten, wenn der in Haft Seiner Hoheit wegen Teilnahme an räuberischem Überfall und Brandstiftung befindliche Griechenführer Gregor Caraiskakis jeder Strafe frei und ledig entlassen werde, hat Seine Hoheit der Pascha diesen Vorschlag angenommen und ist darüber dieser Vertrag geschrieben und unterzeichnet worden.«
Jan Katarchi nickte, als diese Schrift verlesen wurde, dann nahm er die vom Schreiber ihm angebotene Feder und malte in rohen Zügen zwei sich kreuzende Messer darunter, als sein Zeichen, wobei er eine Abschrift verlangte, die der Statthalter gleichfalls unterschrieb.
Von diesem Augenblick an war Jan nach türkischer Sitte für drei Tage Gast im Konak des Pascha. Man brachte ihm alsbald Tschibuk und Kaffee; der Statthalter unterhielt sich lange mit ihm über seine Taten und die Mittel und Wege, durch die er bisher allen Nachforschungen entgangen war. Jan Katarchi erzählte offenherzig und mit einem gewissen Stolz, hütete sich jedoch sorgfältig, Namen zu nennen und vermied geschickt, seine Anhänger in der Stadt bloßzustellen. Er bat den Pascha, den Gefangenen Caraiskakis bis zur Beendigung seines eigenen Prozesses in Ungewißheit über das Geschehene und in Haft zu lassen, und für den Fall, daß während des Tages ein Knabe sich zeigen und nach ihm verlangen sollte, auch auf diesen die Gastfreundschaft auszudehnen.
Wie ein Lauffeuer durcheilte am Morgen die Kunde von der Tat des berühmten Räuberhelden die Stadt. Das Volk sammelte sich vor dem Tor des Konaks, und eine Menge der vornehmsten und reichsten Griechen Smyrnas besuchte ihn ungescheut, beklagte seinen Entschluß und hielt lange Unterredungen mit ihm. Jan bewegte sich unterm Schutz der türkischen Sitte unbehindert im Umkreis des Konaks; jeder seiner Wünsche wurde gleich einem Befehl erfüllt. Mehrmals ließ ihn der Pascha zu sich kommen, um ihn den neugierig zum Besuch eingetroffenen fremden Konsuln zu zeigen, und alle unterhielten sich voll Teilnahme mit ihm. Im Laufe des Tages hatte sich auch der Knabe Mauro eingefunden und bediente fortan seinen Herrn und Oheim.
Es ist ein eigentümlicher Zug im orientalischen Leben, daß trotz wütendem Haß zwischen Türken und Griechen beide heilig auf ein unter gewissen Bedingungen gegebenes Wort bauen. Ismael Pascha mußte die freiwillige Auslieferung des Bandenführers sehr willkommen sein, da er sonst seiner nie habhaft geworden wäre. Denn obgleich er weit energischer als sein Vorgänger im Amte auftrat, so verhieß doch die politische Färbung, die jetzt die Banden anzunehmen begannen, eine weit drohendere Gefahr. In Smyrna, Sardes und Ephesus bereiteten sie offen den Aufstand vor, suchten die Unzufriedenen an sich zu ziehen und die griechische Bevölkerung zur Erhebung aufzureizen. Jan galt zugleich als der verwegenste und gefährlichste Führer, und es war den Türken sehr wohl bekannt, daß gerade zu ihm die griechische Bevölkerung als zu dem geeignetsten Leiter einer Empörung aufsah.
Da, zu Anfang Oktober, an dem Tage, da der Sultan an den Zaren Nikolaus den Krieg erklärte, wurde auf einem Dampfer der in Dardanelli an einer Wunde krank liegende CaraiskakisDer Griechenführer Gregor Caraiskakis war in einem Zweikampf mit dem Verführer seiner Schwester Diona, dem Baronet Edward Maubridge, verwundet worden, nachdem er das Mädchen gegen dessen Willen aus Maubridges Landhaus in kühnem Überfall geraubt hatte. Jan Katarchi hatte vor Jahren als Freund und Diener der Familie Caraiskakis die entsetzliche Leidenszeit der Griechenmartern auf Chios und Tschesme miterlebt und den alten Eltern Gregors versprochen, ihre Kinder, wo es auch immer sei, zu schützen. – Vergleiche den Band »Die Wölfin von Skadar«. in Fesseln an den Statthalter von Smyrna abgeliefert. Den eben Genesenen hatte mitten in seinen Nachforschungen nach der entflohenen Schwester und Maubridge der dortige englische Konsul durch die türkischen Behörden verhaften lassen. Der Vizekonsul von Smyrna hatte – offenbar auf Veranlassung des Baronets – eine Klage gegen ihn auf Teilnahme an dem Überfall und dem Niederbrennen seines Landhauses erhoben.
Der Banditenführer schien seine Spione selbst im Konak des Paschas zu haben; denn alsbald hatte er erfahren, daß der Sohn seines alten Herrn in dem türkischen Gefängnis lag und wahrscheinlich verurteilt und in die Verbannung nach Rhodus gebracht werden würde. Zwei Tage vor dem seltenen Ereignis, das jetzt alle Jungen von Smyrna in Bewegung setzte, war daher ein Fremder im Konak des Paschas erschienen und hatte diesem das Anerbieten der Selbstauslieferung des Räubers gemacht.
Am zweiten Tage wurde Jan nochmals zum Statthalter gerufen. Er machte ihm den Vorschlag, in seinen Dienst zu treten und das Amt eines Kawaß Baschi, eines Polizeihauptmanns, zu übernehmen, ein Posten, der in der Türkei sehr häufig das Ende einer Räuberlaufbahn ist. Aber Jan verweigerte trotz aller Vorstellungen, was sonst seiner harrte, standhaft die Annahme des Vorschlags.
So verging auch der dritte Tag unter den Vorbereitungen, die der Pascha zu dem Gericht über Katarchi treffen ließ.
Am Nachmittag hielt Jan noch eine längere Unterredung mit mehreren angesehenen Griechen aus Smyrna; er schien seine letzten Verfügungen getroffen zu haben. Als die Sonne im Westen in dem prachtvollen Golf von Vurla verschwand, und ihre letzten Strahlen den Pagus färbten, legten die Kawassen des Paschas Jan und seinen zwei Gefährten, die sein Schicksal teilen wollten, schwere Fesseln an. Die drei Sonnen der Gastfreundschaft waren vorüber, die nächste sollte über dem Gericht aufgehen. Gleichzeitig öffnete sich das Gefängnis des Konaks; der noch von schwerem Krankenlager erschlaffte Gregor wurde herausgeholt, und der Kiaja Bey verkündete ihm seine Freilassung mit dem Bemerken, daß er Smyrna spätestens am anderen Tage zu verlassen habe.
Das Wiedersehen des Griechen mit dem gefesselten Freunde seiner Kindheit war ergreifend. Er ahnte nichts von dem heldenmütigen Opfer Jan Katarchis und glaubte ihn auf einem seiner Streifzüge von den Leuten des Statthalters gefangen; mit keinem Laut verriet Jan sein Geheimnis. Gregor warf sich – unbekümmert um das blutige Handwerk des Mannes – in seine Arme und beklagte, das eigene vergessend, sein Schicksal. Auf den ausdrücklichen Wunsch Jans hatte Ismael Pascha gestattet, daß der Freigelassene bis zur herannahenden Katastrophe in seiner Gesellschaft bleiben durfte, und beide verbrachten die Nacht mit dem Knaben Mauro allein in der Zelle des Gefangenen.
Dort erst hörte Jan mit stummem Grimm von der neuen Flucht des betörten Mädchens, dem Zweikampf Gregors mit Sir Maubridge und die Ursache seiner Verhaftung. Dagegen erfuhr Caraiskakis, daß schon am andern Morgen, noch ehe er selber Smyrna verlassen hatte, das Schicksal des KlephtenSehr freiheitlich gesinnter südgriechischer Stamm, der den Türken zur Zeit ihrer Balkanherrschaft viel zu schaffen machte. Man nannte die tapferen Männer auch Palikaren. entschieden sein würde. Jan täuschte sich keinen Augenblick; alle seine Worte hatten das ernste Gepräge des letzten Vermächtnisses an einen Freund vor dem schweren Gang in die Ewigkeit.
Seine Rede, der der Mann und der Knabe aufmerksam während der schweren Nacht lauschten, atmete in jedem Laut den tiefen Haß des griechischen Volkes gegen seine Unterdrücker und Tyrannen. Sie mahnte Gregor an den Heldentod des Vaters, an die teuren Gelübde, die er der Befreiung seines Volkes und seines Glaubens beim Eintritt in den Bund von Elpis geschworen, und Mann und Knabe wiederholten in die Hand des Todgeweihten das Gelöbnis eines nur mit dem Leben endenden Hasses und Kampfes gegen den Halbmond.
Erst gegen Morgen legte sich der Palikare zum Schlaf – es sollte der letzte sein, von dem er auf dieser Erde wieder erwachte.
Der Kawaß Baschi, dessen Nachfolger zu werden er verschmäht, weckte ihn und führte ihn, begleitet von seinen beiden Genossen und Mauro, in die große Halle des Konaks. Dort waren der Statthalter mit seinen beiden Schreibern, der Kiaja Bey, der Kadi Askar, der Oberrichter Smyrnas, und eine Anzahl Mollahs und Muftis, Rechtsgelehrten, versammelt, desgleichen mehrere europäische Konsuln und zahlreiches Volk, meist Griechen.
Ismael Pascha leitete selber die Gerichtsverhandlung; es wurden viele Zeugen vernommen, die sich in der Gewalt der Wegelagerer befunden oder Freunde und Verwandte mit schweren Summen ausgelöst hatten. Auch mehrere Mordtaten wurden Jan Katarchi nachgewiesen, und der englische Vizekonsul beharrte gleichfalls auf seiner Klage wegen Einbruches in das Landhaus und Mordes gemeinsam mit Caraiskakis. Jan Katarchi blieb kalt bei all den Anklagen und Beweisen. Er versuchte mit keinem Wort, seine Taten zu beschönigen, sondern beschränkte seine Verteidigung einzig auf die Erklärung, daß er nur gegen die Feinde seines Glaubens und seines Volkes also gehandelt habe. Desgleichen weigerte er sich auch jetzt, die Namen seiner Zuträger und Freunde in Smyrna zu nennen und suchte möglichst alle Schuld seiner beiden Gefährten auf sich zu nehmen.
Unter diesen Umständen konnte der Ausgang des Verfahrens nicht zweifelhaft sein, und die Verhandlung wurde nach der Dauer von kaum zwei Stunden geschlossen. Der Rat der Mollahs fällte das Urteil, daß Janos – genannt Katarchi – als überwiesener Mörder und Wegelagerer die Strafe von fünf Yataganhieben zu erleiden habe. Seine beiden Gefährten wurden zu lebenslänglicher schwerer Galeerenstrafe verurteilt. Nachdem der Statthalter das Urteil bestätigt hatte, verkündigte es ein Ausrufer von der Schwelle des Gerichtssaales und in den Gassen der Stadt.
In der Türkei folgte die Vollstreckung des Urteils dem Ausspruch gewöhnlich auf dem Fuße. Von den Kawassen umgeben, wurde der Verurteilte nach seiner Zelle zurückgebracht, um sich in der kurzen Frist, die ihm noch gegönnt war, zum Tode vorzubereiten.
Eine rasche Vollstreckung des Urteils schien dem Pascha notwendig; bereits während der Verhandlungen hatte sich unter der griechischen Bevölkerung Smyrnas eine große Aufregung kundgetan, die einen gewaltsamen Versuch zur Befreiung ihres Helden und Palikaren befürchten ließ. Die Besetzung Smyrnas war zur Zeit wegen der allgemeinen Truppensendungen nach Rumelien und zum Heer unter Selim Pascha bei Tortum und Batum sehr schwach. Der Statthalter ließ daher das Tor des Konaks schließen und befahl, die Hinrichtung im Hofe vorzunehmen, anstatt wie sonst in den Straßen der Stadt zur öffentlichen Warnung. Es war Gebrauch, die Leichname der Gerichteten eine Zeitlang am Orte der Hinrichtung liegen zu lassen, bis sie den Freunden oder Verwandten übergeben wurden.
Als Jan in die Zelle zurückkam, verkündete sein Auge dem harrenden Freunde, den man wegen der Anwesenheit seines eigenen Anklägers, des englischen Vizekonsuls, nicht zum Gericht zugelassen hatte, das Urteil. Der Palikare hatte längst jene Gleichgültigkeit gegen das Leben angenommen, die den Orientalen im allgemeinen eigen ist, und er unterwarf sich dem Tode mit einer Ruhe und Würde, die das Erhabene seiner Aufopferung noch erhöhte. Er selber beruhigte den tieferschütterten Freund und sprach ihm Mut zu; er nahm ihm das Versprechen ab, für den Knaben Mauro zu sorgen und ihn zu seinem Rächer zu erziehen. Der Knabe, der, ohne eine Miene zu verziehen, dem Gericht des Paschas beigewohnt hatte, hielt stumm die Hand seines Oheims. Nur die keuchende Brust und das wild flammende Auge, wenn es sich durch die offene Tür auf die Kawassen richtete, zeigte den Sturm leidenschaftlicher Gefühle in seinem Innern.
So war die Mittagsstunde herangekommen; ein kurzer Trommelwirbel der aufgestellten Soldatenabteilung verkündete den Beginn der furchtbaren Handlung.
Beim ersten Schlag der Trommel richtete sich Jan Katarchi, der mit Gregor zum Gebet niedergekniet war, auf und schlug das Zeichen des Kreuzes. Dann trat er auf den Mann zu, den er einst als Kind auf Chios aus den Händen der Türken gerettet und jetzt wieder von Schmach und Kerker mit dem eigenen Leben löste.
»Gregor Caraiskakis,« sagte er, »der dreieinige Gott mit seinen Heiligen und den seligen Geistern derer, die für das Kreuz gestorben, schaut auf uns herab in dieser Stunde. Auch dein Vater ist unter ihnen und ich hebe meine Hand auf zu ihm und hoffe, daß er Fürbitte einlegen wird für meine Sünden – denn treu bis zum Tode habe ich meinen Schwur gehalten, sein Blut zu retten und zu schützen. – Ich bin alt, mein Weg geht abwärts, der deine hinauf – der morsche Eichbaum sinkt vor den Stürmen, der kräftige junge Stamm wird ihnen trotzen. Leb' wohl, Gregor Caraiskakis – vergiß nie den Haß gegen die Tyrannen, so wahr dir und mir der Gott unserer Väter barmherzig sein möge!«
Die Gewehre der Wache rasselten auf dem Pflaster; die Kawassen traten in den Eingang der Zelle. Gregor warf sich an die Brust Jan Katarchis. Auch über dessen braune Wangen rollten große Tropfen – dann riß er sich kräftig los.
»Sollen wir Weiber sein vor diesen Moslems in der Stunde des Todes nach einem Leben voll Kampf und Rache? Fluch und Haß ihnen bis zum letzten Hauch! – Und du, Knabe, der du die Geschichte meiner Jugend mit heißem Herzen angehört: wenn der Todesengel die Hand auf mich legt, gib mir den Ruf mit hinüber, dessen Erinnerung so oft mir die Brust gehoben: Gott und die Heiligen – Chios und Tschesme!«
Der Knabe drückte ihm krampfhaft die Hand – keine Träne stand in dem dunkel glühenden Antlitz. Als Gregors Blick darauf fiel, schämte auch er sich des Schmerzes; starr und finster nahm er die andere Hand des Freundes, der in ihrer Mitte ruhig und stolz hinausschritt in den Hof.
Am Fenster des Selamlik stand der Pascha inmitten seiner Offiziere und rauchte ruhig seinen Tschibuk. Wachen hatten das Tor und die Ausgänge besetzt. In der Mitte des Hofes bildeten die Kawassen einen weiten Kreis, in dessen Inneren die beiden zur lebenslänglichen Galeerenhaft verurteilten Gefährten des kühnen Palikaren standen; neben ihnen in kurzen braunen Mänteln die beiden Kawassen: die Henker.
Dorthin wurde Jan geführt – noch ein Händedruck, und der Mann und der Knabe mußten am Eingang des Kreises zurückbleiben.
Mit festen Schritten trat Jan Katarchi näher; die letzten Genossen seines wilden Lebens stürzten sich trotz der Fesseln auf ihn und bedeckten seine Hände und Kleider mit Küssen. Die Polizisten rissen sie fort, und auf einen Wink des Kawaß Baschis kniete Jan, das Zeichen des Kreuzes schlagend, auf dem Boden nieder, indes einer der Henker seine Hände schnell auf dem Rücken zusammenband.
Ein letzter Blick – ein letzter Gruß –
»Gott und die Heiligen!«
Die helle Stimme des Knaben rief es schneidend in den stillen Kreis – die beiden Kawassen neben dem Knienden warfen die Mäntel ab – in ihren Händen blinkten die schweren Yatagans mit dem bleigrauen Glanz der echten Klingen.
Ein Zeichen des Baschis – die Trommel wirbelte und der eine der Kawassen führte den ersten Streich.
Das Urteil der fünf Yataganhiebe ist nur eine Formel – die Henker der Türkei sind ihres fünften Hiebes sicher. Viermal hob sich der Yatagan und fiel auf den Nacken Jans, kaum die Haut blutig ritzend – dann sprang der Kawaß zurück und der zweite im selben Augenblick herbei.
»Rache für Chios! – Rache für Tschesme!«
Der schrille Ruf Mauros übergellte den Trommelwirbel und das Zischen des Hiebes – – weit vom Nacken rollte das Haupt auf den Boden hin. Krampfhaft öffneten und schlossen sich die Schlagadern und spritzten das Blut weithin – dann fiel der Leib Jan Katarchis schwer vornüber auf die Erde.
Durch den Kreis der Kawassen brach der Knabe und warf sich auf den blutenden Leichnam seines Schützers und Verwandten. Der kühne Trotz war gebrochen; die leidenschaftliche, griechische Natur machte sich geltend; Schrei auf Schrei durchgellte die Luft, vermischt mit wilden Klagen und Verwünschungen gegen die Türken.
Neben ihm und der Leiche kniete Gregor Caraiskakis im Gebet.
Ohne sich um die Tränen und Verwünschungen zu kümmern, nahmen die Henker das Haupt des Gerichteten und befestigten es an einer eisernen Spitze über dem Tore. Zugleich wurden die Pforten geöffnet, und das Volk strömte in den Hof zur Richtstätte.
Der Pascha hatte sehr richtig gerechnet: die Vollziehung des Urteils hob jede Gefahr auf und brach die Aufregung der Menge. Wohl erging sie sich in Drohungen, indes auf solche achtet der Türke nicht – wo Haß und Schmerz Worte finden, werden sie selten zur Tat.
Im Gebet an der Leiche des Getreuen störte Caraiskakis eine Hand, die sich auf seine Schulter legte; eine Stimme sagte leise zu ihm:
»Im Namen und Auftrag Jans des Palikaren soll ich Euch mit mir führen von dieser Stätte, die Euch Gefahr droht. Ich habe gelobt, für Eure Sicherheit zu sorgen.«
Gregor schaute auf; er sah einen alten Mann in dem schwarzen Gewande der Armenier. Fast willenlos gehorchte er der Aufforderung und erhob sich. Er sah, wie ein anderer Mann Mauro an die Hand nahm und folgte dem Unbekannten, nachdem ihm dieser versichert hatte, daß für die Beerdigung Jan Katarchis gesorgt sei.
Sein Führer geleitete ihn durch die Gassen der Türkenstadt nach dem fränkischen Viertel und dort in eines der Häuser, deren Hof ans Ufer des Meeres stößt. Dort wurde ihm eine kurze Erholung gegönnt; da er jede Erfrischung von sich wies, fuhren die vier in einem Boot zu dem im Hafen ankernden Lloyddampfer, der binnen zwei Stunden seine Fahrt nach Konstantinopel fortsetzen sollte.
Der Greis hatte für Paß und Fahrschein gesorgt. – Alles schien vorbereitet. Auf dem Verdeck führte der Alte Gregor an eine einsame Stelle, von der sie hinüberschauen konnten nach der ausgedehnten Stadt.
»Ich bin Ihr Landsmann und Glaubensgenosse, Herr,« sagte er, »und habe dies Gewand nur angelegt, um weniger beachtet zu werden. Mein Auftrag ist erfüllt und ich habe Ihnen jetzt nur noch wenige Worte zu sagen und einiges zu übergeben. Wenn auf Ihrer ferneren Laufbahn Ihr Gedanke oder Ihr Blick nach Smyrna zurückkehrt, dann erinnern Sie sich, daß dort ein Grab ist, das für Sie geöffnet worden. Janos Katarchi, der Kameltreiber, der Räuberhauptmann, der Palikare, der Held seines Volks, ist für Sie gestorben – diese Schrift, mit seinem Lebensblut bespritzt und nach seinem Befehl von der Brust seiner Leiche genommen, wird Ihnen Kunde davon geben. Jan war von uns zu hohen Dingen bestimmt; er hat uns auf Sie verwiesen, als jünger und geeigneter für den großen Kampf, der sich vorbereitet. Wir wissen, daß Sie mit Ihren Brüdern der Elpis, der Hetärie, dem Rächerbunde angehören und nie im Kriege gegen unsere Unterdrücker nachlassen werden. Was Jan besaß – kein Tropfen griechischen Blutes, kein Para griechischen Geldes klebt daran – hat er bei uns niedergelegt und zu einem Vermächtnis für Sie bestimmt, auf daß Sie es im Kampfe für unsere heilige Sache und zur Verfolgung Ihres Feindes verwenden mögen. Die Griechen der Hetärie von Smyrna haben das fehlende hinzugetan; ich überliefere Ihnen hier hunderttausend Piaster in drei Wechseln auf Konstantinopel, Varna und Odessa. Möge der Himmel Sie schützen und segnen, Sie und diesen Knaben.«
Gregor Caraiskakis war wie zu Boden geschmettert. Tausend Fragen drückten sein übervolles Herz; aber der Greis wehrte allen und bestieg die Barke, die ihn nach Smyrna zurücktrug.
Ein Opfer des Harems
Eine finstere, entschlossene Ruhe, ein noch strengerer Ernst, als er schon früher gezeigt, hatte sich über das ganze Wesen Gregor Caraiskakis' gelagert. Nur zuweilen funkelte sein dunkles Auge; ein unheimliches Leben sprühte darin.
Gleich ihm stumm und verschlossen zeigte sich auch der Knabe; er beobachtete alles mißtrauisch, was er hörte und sah; fast nie wich er von der Seite seines neuen Schützers. Er schien alle Neigungen des Knabenalters abgestreift zu haben.
Beide waren am Tage vorher mit dem Lloyddampfer von Smyrna gekommen und hatten in einer der hinteren Straßen von Pera Unterkunft gefunden. Gregor hatte gehofft, in den Kaffeehäusern am Campo Kunde zu finden von seinem alten Freunde und Gefährten Doktor Welland, der ihm bei der Befreiung Dionas, seiner Schwester, so aufopfernd geholfen. An einem Abend, der ihn spät heimführte, traf er wie durch Fügung auf ihn, als Welland mit dem verräterischen Paduani zusammen von dem berüchtigten Sta Lucia und seinen Mordgesellen überfallen wurde. Paduani ereilte sein SchicksalDer Tod Paduanis in Konstantinopel ist geschichtlich. Vergleiche den Band »Die Wölfin von Skadar«., aber den bedrohten Welland vermochte Gregor noch zu retten.
Mit Recht glaubte Caraiskakis in Konstantinopel zunächst am sichersten die Spur des Briten Maubridge und seiner Schwester Diona erforschen zu können, und wollte deshalb dort einige Zeit verweilen. Für Welland, der eine immer innigere Zuneigung zu Gregor empfand, war dies eine sehr willkommene Nachricht, und er versprach, ihn nach Kräften zu unterstützen.
In der Tat gelang es ihm auch, und zwar durch Baron von Montmarquet-Oelsner, einem bekannten Abenteurer, der zufällig den Griechen bei ihm getroffen, schon in den nächsten Tagen zu erfahren, daß Sir Maubridge sich längere Zeit in Konstantinopel aufgehalten hatte; dann war er nach Warna gegangen, das türkische Lager zu besuchen. Eine Gewißheit, ob er diesen Weg allein oder in Begleitung einer Dame gemacht, vermochten auch die reichen Hilfsquellen des Barons nicht zu ermitteln; jede Spur von Diona schien verloren.
Dagegen bemerkte Welland mit Erstaunen, daß sich bald ein vertrautes Verhältnis zwischen dem Baron und seinem Freunde entspann. Wiederholt traf er Oelsner in der Wohnung Gregors und beide in eifrigem Gespräch, das bei seinem Erscheinen abgebrochen wurde. Auch machten sie häufig gemeinsame Gänge, zu denen er nicht eingeladen wurde.
Eines Morgens wurde ein Brief in Wellands Wohnung abgegeben, der, mit dem geheimnisvollen Zeichen des FreiheitsbundesVergleiche im Band »Die Wölfin von Skadar« das Kapitel »Die Unterirdischen«.
versehen, dem er zu gehorchen sich verpflichtet hatte, ihn aufforderte, zu einer späten Stunde des Nachmittags am Springbrunnen Mahmuds I. sich einzufinden.
Dies Bauwerk hatte Welland seiner eigentümlichen Schönheit und Arabesken-Architektur wegen schon oft bewundert; ein viereckiges, hohes Gebäude mit plattem, von einem Geländer umgebenen Dach, die weißen Marmorwände von eingemeißelten Sprüchen aus dem Koran bedeckt. Der Bau erhebt sich mitten auf dem Markt von Tophana und spendet den umlagernden Menschen und Tieren erfrischende Labung.
Welland hatte erst kurze Zeit gewartet, als er die hohe, soldatische Gestalt eines Mannes auf sich zukommen sah.
Beide schienen schon Bekannte und begrüßten sich; Welland mit einiger Befangenheit.
»Das ist schön, daß Sie pünktlich sind, Doktor,« sagte der andere, »nachdem ich Sie so lange ohne Nachricht gelassen. Indessen, die Zeit ist da, wo Ihre Tätigkeit voll in Anspruch genommen werden soll. Sie werden wissen, daß ein Kurier schon die Nachricht von dem Beginn des Angriffs an der Donau gebracht hat.«
»Ich habe davon gehört, Herr GeneralGeneral Tommaso, ein Revolutionär und Freund des russenfeindlichen Fuad Effendi. Vergleiche den Band »Die Wölfin von Skadar«..«
»Ihr Gesuch um Anstellung beim Seraskiat ist unterstützt und ich hoffe, Sie werden eine Stelle unmittelbar im Gefolge des Muschirs erhalten. Vorerst aber sollen Sie uns hier einige Dienste leisten. – Haben Sie Ihr Besteck bei sich?«
Welland bejahte.
»So haben Sie die Güte, mich zu begleiten.«
Der General führte ihn nach dem Ufer und mietete dort einen vierruderigen Kaïk, der sie schnell über den Bosporus nach der asiatischen Seite trug, an die gleiche Wasserseite in Kandili, an der in der Nacht des 21. die Khanum des bekannten Truppenführers Omer Paschas zu der geheimnisvollen Unterredung mit Fuad Effendi gelandet warDas Kapitel »Das Geheimnis des Goldenen Horns« in dem Band »Die Wölfin von Skadar« gibt einen ausgezeichneten Einblick in die Ränke am Hofe des Sultans, die über Krieg und Frieden entschieden. .
Ein Diener führte beide in ein Zimmer des Erdgeschosses und brachte Kaffee und Pfeifen; bald darauf verließ der General das Gemach und Welland blieb allein. Nach kurzer Zeit brachte der Diener Welland in ein mit europäischem Prunk eingerichtetes Zimmer des oberen Stockwerks, wo er den General in Gesellschaft des Hausherrn wiederfand.
Auf einen Wink entfernte sich der Diener.
»Doktor,« begann der General, »ich habe Sie hierher gebracht, weil der Herr hier, einer unserer Freunde, mich ersucht hat, ihm einen zuverlässigen europäischen Arzt zu bringen, dem er bei einem traurigen Geschäft vertrauen kann. Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, daß Ihr Eid Ihnen unbedingten Gehorsam auferlegt, und Sie wissen, daß ich einer von denen bin, die ihn zu fordern haben. Aber ich teile Ihnen zugleich mit, daß von Ihrem Benehmen und Ihrer Willfährigkeit Ihre Zukunft in diesem Lande abhängen wird, die leicht Ihre kühnsten Hoffnungen und Wünsche übersteigen dürfte. Die Sache, um die es sich handelt, ist jedoch ernster Natur und – es gehören starke Nerven dazu.«
»Und was ist meine Aufgabe dabei?«
»Das werden Sie später erfahren. Vor allen Dingen handelt es sich um Ihr Schweigen und Ihre Bereitwilligkeit.«
»Das Schweigen«, entgegnete Welland ernst, »wäre die Aufgabe des Arztes, selbst wenn ich ohnehin nicht durch meinen Eid dem Bunde gegenüber verpflichtet wäre. Was meine Bereitwilligkeit betrifft, so werde ich meine Kunst nie verweigern, wo es mein Gewissen und meine Ehre gestatten.«
»Wir verlangen weder die Prüfung Ihrer Ehre noch Ihres Gewissens,« sagte barsch der General, »sondern einfach Ihren Gehorsam, und haben Mittel in Händen, ihn zu erzwingen.«
Welland richtete sich kampfbereit auf; der Hausherr aber kam zuvor und faßte beruhigend die Hand des Offiziers.
»Überlassen Sie mir die Sache«, sagte er vermittelnd; »ich glaube, ich kann die Angelegenheit dem Arzt von einem Gesichtspunkt darlegen, der sein Gewissen beruhigen wird.«
Welland verbeugte sich erwartend.
»Sie dürfen«, fuhr Fuad Effendi fort, »die Dinge und Vorgänge, denen Sie beizuwohnen berufen sind, natürlich nicht vom europäischen Standpunkt beurteilen. Sie befinden sich hier in der Türkei, in der Leben und Blut eines Menschen wertlosere Dinge sind. Die Sache, um die es sich hier dreht, ist, einen überwiesenen Verbrecher, der nach türkischen Gesetzen unbedingt den Tod verdient, in einer höchst wichtigen, für das Wohl und Wehe des ganzen Staates wesentlichen Angelegenheit zum Geständnis seiner Helfershelfer und der Mittel seines Verrats zu zwingen. Bis hierher, werden Sie zugeben, sind wir, auch nach europäischen Begriffen, vollkommen in unserem Recht.«
»Selbstverständlich.«
»Bei Ihnen«, fuhr der Moslem fort, »verliert man viel unnütze Zeit mit geistigen Daumschrauben – bei uns wendet man die wirklichen an. Es besteht bei uns noch die Folter, die früher bei allen christlichen Völkern Europas im Gebrauch war und selbst jetzt noch von der aufgeklärtesten Nation, den Engländern, in ihren Besitzungen in Indien ständig angewendet wird, sogar in Dingen, bei denen jeder Türke die Anwendung verabscheuen würdeVergleiche den Band »Volk in Folter«. . Ich wiederhole es, bei Völkern, die sich auf einer Stufe der Kultur befinden, wie das meine, sind grausame und blutige Strafen und Mittel nicht zu vermeiden.«
Welland schwieg – er konnte dem gewandten Unterhändler nach allem, was er schon in diesem Lande erfahren hatte, nicht ganz unrecht geben.
»Der Dienst, den wir von Ihnen verlangen, besteht nun darin, einer solchen notwendig gewordenen Maßnahme im Nebenzimmer beizuwohnen und sie wissenschaftlich in der Art zu überwachen, daß Sie nach dem Puls der verurteilten Person den Augenblick angeben, in dem wirkliche Lebensgefahr eintritt. Ich bemerke Ihnen, daß, wenn der Verurteilte bekennt, sofort innegehalten und ihm alle weitere Strafe geschenkt werden soll.«
Der Deutsche war bleich geworden. Dennoch fühlte er, daß er als Arzt und in der eigentümlichen Stellung, in der er sich dem ihm übergeordneten Mitglied des Bundes, dem General gegenüber befand, schwerlich sich der schaurigen Pflicht entziehen könne. Den grausamen Sitten des Landes mußte der Widerwille des menschlichen Gefühls sich beugen.
»Der Verbrecher ist wirklich zum Tode verurteilt?«
»Ich gebe Ihnen mein Wort; ich schwöre es Ihnen auf den Koran, die Person muß für das begangene Verbrechen sterben; das Geständnis ist ihre einzige Rettung. Ich wünsche sie zu retten – aber sie muß bekennen! Es muß sein, und wenn jedes Glied ihr stückweis vom Leibe geschnitten werden sollte!«
Der Starrsinn des Orientalen durchbrach bei dieser Drohung die dünne europäische Tünche; die Augen flammten wie die eines Tigers.
»Unsere eingeborenen Ärzte sind Esel und zu nichts zu brauchen; darum wenden wir uns an Sie. Außerdem sind Sie mit der türkischen Sprache unbekannt; dies ist, bei der Wichtigkeit des Staatsgeheimnisses, eine der Bedingungen. Selbst wenn die Person halsstarrig ist und von unseren Maßnahmen stark mitgenommen werden sollte, kann Ihre Kunst ihre Wiederherstellung sichern. Jetzt frage ich Sie, ob wir auf Ihre Begleitung rechnen dürfen? Bedenken Sie wohl, die Maßnahme geht in jedem Fall vor sich, auch ohne Sie! – Ihre Weigerung raubt einem Menschen lediglich die Aussicht auf Rettung.«
Nach kurzem Kampfe sagte Welland:
»Ich bin bereit!«
»Ihr ewiges Schweigen ist sicher – was Sie auch erblicken, welche Geheimnisse Sie zufällig auch erfahren mögen?«
»Sie haben mein Wort!«
»Wohl, so ist unsere Verhandlung geschlossen. Es beginnt zu dunkeln; in einer halben Stunde können wir fahren.« Er klatschte in die Hände. »Kaffee und Tabak!«
Die Diener traten ein und Welland schauderte, als er sah, mit welcher Ruhe seine beiden Gesellschafter trotz der bevorstehenden furchtbaren Szene den unvermeidlichen Kaffee und Tschibuk nahmen.
Während die Sterne am Himmel aufblinkten, bestiegen alle drei am Wassertor der Villa den harrenden Kaïk. Am Goldenen Horn bogen die Ruderer nach der Serailspitze, umfuhren sie und landeten auf der Seeseite an einer Pforte, die aus der rings das Serail umgebenden Mauer zum Wasser führt. Eine Wache an der Tür öffnete auf ein Losungswort Fuad Effendis, des ehemaligen Ministers.
Der General hielt seinen türkischen Freund zurück.
»Ich glaube, Hoheit,« sagte er mit einem gewissen Schauder, der Welland nicht entging, »es wird nicht nötig sein, daß ich das Serail mit betrete. Mein Geschäft ist beendet, Doktor Welland wird seine Pflicht tun und – gerade heraus, ich bin Soldat, aber weder Arzt noch – Moslem. Das Ergebnis erfahre ich morgen aus Ihrem Munde.«
Der türkische Staatsmann lächelte.
»Tun Sie ganz nach Ihrem Belieben, General,« sagte er, »ich habe den Arzt, und das ist vorläufig genug. Mein Kaïk steht Ihnen zur Verfügung. – Auf Wiedersehen morgen.«
Durch den mit hohen Zypressen und Platanen besetzten, sonst aber öden Garten führte der Minister den Arzt nach dem gegenüberliegenden Eingang. Links zur Seite blieben die großen Ställe des Sultans, die für tausend Pferde Raum hatten, rechts der Kiosk, das Lustschloß des Padischahs, nach dem Bosporus hin, auf Bogen gebaut mit vergoldeten Kuppeln; in einiger Entfernung nach der Stadt zu liegt ein zweiter, mit der Aussicht auf den Hafen. In dem ersten hielten sich früher während des Tages die Herrscher mit ihren Frauen und Stummen auf. Die Kais und das Serail waren mit Artillerie ohne Lafetten besetzt, die meisten Geschütze in der Höhe des Wassers. Bei den öffentlichen Festlichkeiten donnerte diese Artillerie, unter der sich die große Kanone befindet, durch die nach der Sage Babylon gezwungen ward, sich Sultan Murad zu ergeben. Ein anderer großer Mörser befindet sich in der Ecke des ersten Hofes – in ihm sollen die aufrührerischen Ulemas zu Tode gestampft worden sein.
Das Serail Burnu wurde von Mahomed II. erbaut und bildet auf der Landspitze zwischen dem Horn und dem Marmarameer eine Art Dreieck, dessen längste Seite sich nach der Stadt hin erstreckt; dort befinden sich auch die Tore und Höfe des Zugangs.
Die Eintretenden wurden erwartet; zwei Kapidschis, Torwächter, traten zu ihnen und gingen vor ihnen her bis zu einer zweiten, in die Gebäude sich öffnenden Tür, an der wieder zwei Schwarze die Wache hielten. Dort übernahm ein harrender Eunuch ihre Führung und geleitete sie durch einen kleinen Hof und verschiedene gewundene Gänge zu einem hellerleuchteten Divan-Hane, in dem an den Wänden mehrere schwarze Sklaven standen, der Sprache und der Mannheit beraubte Geschöpfe, willenlose Werkzeuge der Willkür ihrer Gebieter.
Dort mußte Welland auf einen Wink seines Begleiters sich niederlassen; Fuad Effendi verschwand durch einen Vorhang in ein anstoßendes Gemach.
Alles war Schweigen um ihn her – ein unheimliches Schweigen schon während des ganzen Ganges durch das weite Gebäude. Endlich eine leise, flehende Stimme, irgendwo in einiger Entfernung – er schauderte, denn er fühlte, seine Aufgabe begann.
Er lauschte – doch nur einzelne Laute drangen zu ihm herüber; dazwischen klang es zuweilen wie eine scharfe, kräftige Frauenstimme, zuweilen auch glaubte er die seines Begleiters zu vernehmen. Dann war wieder alles still – die stummen, verkrüppelten Menschen um ihn her rührten sich nicht.
Der Vorhang wurde gehoben; der Minister trat heraus; sein Gesicht war bleich, das Auge funkelte zornig, der Mund war wie in festem Entschluß zusammengekniffen.
Wortlos winkte er Welland.
Ein zweites großes Gemach – ohne Fenster, nur von einer Lampe schwach erhellt, aber leer. Im Hintergrunde öffneten sich, durch schwere Vorhänge geschlossen, zwei Türen.
Zu der rechts führte ihn der Staatsmann und hob den Vorhang; das Gemach war dunkel, nur durch die Spaltenöffnungen der einen Seitenwand schienen einzelne helle Lichtstrahlen hereinzubrechen. Sein Auge gewöhnte sich an das Dunkel, und er sah, daß sie durch die Öffnungen eines Vorhanges kamen, der in dicken, schweren Falten einen Eingang zum Nebengemach schloß.
Nach dieser Seite geleitete ihn der Moslem und bedeutete ihm, sich auf den Diwan niederzulassen. Dann hob er ein Tuch von einem Gegenstand, der unter den Falten des doppelten Vorhanges hervor auf den Diwan gestreckt war, und bat ihn, ihn zu fassen.
Welland legte die Finger darauf – es war eine warme Menschenhand – die Weiche der Haut, die zarte Fülle zeigte ihm eine Frauenhand; sie zuckte in der seinen, offenbar jenseits des Vorhangs durch eine Einzwängung des Armes in dieser Lage festgehalten.
»Lassen Sie mich fort, Herr – das ist ein Weib – um keinen Preis der Welt mag ich Teilnehmer der Handlung sein, die sich hier vorbereitet!«
Der Minister drückte ihn auf den Sitz zurück.
»Schweigen Sie und tun Sie Ihre Pflicht,« sagte er mit verhaltener dumpfer Stimme, »oder Sie sind selber das Opfer. Die Leute hinter jenem Vorhang sind nicht gewohnt, mit sich spielen zu lassen. Weib oder Mann, das Verbrechen ist das gleiche, ebenso die Strafe. – Und, Doktor, wollen Sie dem Verbrecher Ihre Hilfe versagen, nur weil er eine Frau ist? – Hier ist die Klingel, mit der Sie ein Zeichen geben, wenn die äußerste Gefahr eintritt – doch nur dann! – Sie wissen, was allein hier Rettung bringen kann.«
Ehe Welland noch antworten konnte, war Fuad Effendi verschwunden; er hörte das Gemach von außen durch einen Riegel verschließen.
Wieder trat tiefe Stille ein – dann erklang durch die Falten des Vorhangs ein tiefer, stöhnender Seufzer.
Er hielt die Hand der Unglücklichen – sie war weich und sanft und mußte einem noch jungen Wesen angehören. Er drückte sie leise, zum Zeichen, daß eine teilnehmende Seele in ihrer Nähe sei.
Der Seufzer schien einen Widerhall zu wecken; ihm war, als zittere er in dem dunklen Gemach wider, in dem er selber sich befand, dicht neben sich.
Aber er hatte keine Zeit, darauf zu achten.
Leichter Kohlenrauch drang durch die Spalten des Vorhanges, und gleich darauf zuckte die Hand heftig in der seinen.
Die Marter hatte begonnen –
Brandiger Geruch wie von verkohlendem Fleisch zog durch die Luft, rascher und krampfhafter wurde das Zucken der Hand.
Im Nebengemach flüsterten mehrere Stimmen – dann eine lautere Frage, ein Stöhnen als Antwort – er entnahm daraus, daß der Frau ein Knebel den Mund verschloß.
Sie mußte durch ein Zeichen verweigert haben, Antwort zu geben, denn der Brandgeruch dauerte fort und verstärkte sich.
Kalter Schweiß perlte auf seiner Stirn – zehnmal wohl griff die Hand nach der Klingel, um das Halt gebietende Zeichen erschallen zu lassen, aber die Vernunft sagte ihm, daß es der Dulderin nur einen kurzen, unnützen Verzug bringen werde.
Er ließ die Ärmste erschüttert los und begrub das Gesicht in die Hände.
Da störte ihn ein heiseres, tückisches Lachen; ein jammerndes Wimmern folgte – dem wiederum jenes seltsame Echo neben ihm zu antworten schien.
Rasch faßte er nach der Hand – sie war krampfhaft geschlossen – er fühlte, daß die Leidende in heldenhaftem Trotz gegen die Marter kämpfte. Sein Finger suchte den Puls – er schlug rasch und unregelmäßig, aber noch kräftig.
Ein Kreischen der Wut schien eine verneinende Gebärde der Leidenden zu erwidern – dann der herrische Befehl einer Weiberstimme. Er vernahm die seines Führers dazwischen, doch der Befehl wurde heftig wiederholt.
Hand und Arm erbebten krampfhaft, als wollten sie sich gewaltsam befreien – minutenlang dauerte die schreckliche Bewegung – etwas Grauenhaftes mußte auf Armeslänge von ihm vor sich gehen – er packte die Klingel.
Da streckten sich Arm und Hand – das wilde Ringen hörte auf; mehrere Menschen schienen um die Gemarterte beschäftigt; die Frauenstimme sprudelte Verwünschungen, wie er nach einzelnen ihm verständlichen Worten zu schließen vermochte. Darunter hörte er wiederholt den Namen Moskau. Eine zweite Frauenstimme mischte sich drein und zugleich die des Effendi; dann schwieg der Lärm und eine schwache, selbst in ihren gebrochenen Tönen noch süße Stimme sagte einige Worte.
Wiederum fragte der Effendi dazwischen.
Die Stimme antwortete noch einiges – dann stockte sie und verstummte endlich.
Die Frage wurde dringend wiederholt, auch die Weiberstimmen mengten sich hinein. –
Welland glaubte, dicht neben seinem lauschenden Ohr ein lateinisches Gebet, das Ave murmeln zu hören. Er spannte alle Nerven an, um zu hören, sich zu überzeugen – Totenstille.
Zwei Worte, schneidend, befehlend, unterbrachen sie.
Diesmal schien der Henker es verschmäht zu haben, der Leidenden den Knebel erst wieder einzuzwängen. Ein Ton wie von zermalmenden Knochen – zugleich ein herzzerreißender Schrei, ein zweiter – Welland ließ wie wahnsinnig die Klingel ertönen, aber die gelle Stimme eines Befehls fuhr dazwischen und Schrei auf Schrei erscholl fort in ersterbendem Jammer.
Mit beiden Händen riß Welland die Vorhänge gewaltsam auseinander: das schreckliche Schauspiel bot sich seinen Blicken.
Auf einem Ruhebett, dicht an seiner Seite, lang ausgestreckt, lag nackt, kaum über den Hüften mit einem Tuch bedeckt, eine junge, selbst in der Entstellung des Schmerzenskampfes noch schöne Frau. Aschblonde Haare umgaben wild das blasse Gesicht; schwarze, halb gebrochene Augen starrten zu ihm auf.
Es war MariamMariam, die Mingrelierin, fiel dem Ränkespiel ihrer Geschlechtsgenossinnen zum Opfer, weil man sie verdächtigte, für die Erhaltung des Friedens gewirkt zu haben. Vergleiche den Band »Die Wölfin von Skadar«., die Beneidete des Harems, die Gebieterin des Gebieters in drei Weltteilen.
Die Anklage hatte ihr Ziel erreicht, der Großherr hatte die Geliebte aus seiner Nähe verbannt.
Ein Blick genügte Welland, die furchtbare Marter zu ermessen, die das zarte Weib mit Heldenmut ertragen hatte. Von den halb verkohlten Fußsohlen stieg noch der widrige Geruch empor, die Mitte der Brust zeigte eine tiefe Brandwunde, in der noch die dunkle Asche der verglühten Kohlen lag. Die zwei schwarzen Henker an der Seite der Unglücklichen – Stumme mit teuflisch grinsenden Mienen, waren eben mit der höllischen Knebelvorrichtung beschäftigt, die zwischen Holzstücken die Gelenke der Glieder zermalmt. Auf dem Diwan gegenüber saßen, gleich Furien, der Dschehennah entstiegen, in ihren Yaschmaks zwei reichgekleidete türkische Frauen, in den Augen teuflischen Triumph; neben ihnen mit bleichem Gesicht Fuad Effendi, die Feder in der Hand, das Papier vor sich auf dem Schoß, um die Geständnisse der Gefolterten aufzuzeichnen.
Mit einem Sprung war Welland über das Schmerzenslager hinweg, und schleuderte die schwarzen Henker zur Seite.
»Mörder, blutdürstige Mörder, die ihr seid! – Seht ihr nicht, daß diese Frau stirbt?«
»Nieder mit dem Giaur! Schlagt ihn zu Boden!« schrie die eine der Frauen den Verschnittenen zu, doch der Effendi warf sich zwischen sie und vor den Arzt.
»Haltet ein, Sultana! – Dieser Ungläubige wird das Weib vom Tode retten, und du weißt, daß dies notwendig ist! Ihr Tod könnte uns doppeltes Verderben bereiten.«
Sein Befehl wies die Henker aus dem Gemach; nach einigen Widerreden folgten ihnen auch die Frauen. Welland kniete bei der Bewußtlosen, um sie ins Leben zurückzurufen. Ein flüchtiges Salz regte die Lebensgeister der Gemarterten wieder an, und er versuchte, einen Verband auf ihre Wunden zu legen.
Ihre Kraft ermattete jedoch mehr und mehr. Um ihr wenigstens Ruhe zu sichern, erklärte er dem Effendi, die Kranke müsse wenigstens einige Stunden ungestörte Ruhe haben; er selber werde bei ihr wachen. Nach einigem Zögern fügte sich Fuad Effendi mit der Erklärung, er wolle im Vorzimmer bleiben.
Der Vorhang der Tür fiel hinter ihm – Welland befand sich mit dem Opfer grausamer Verfolgung allein.
Er betrachtete mitleidig das schöne blasse Gesicht, auf das der Todesengel seine Schatten zu breiten begann. Die Wunden und Verletzungen, die das Mädchen empfangen, waren allerdings nicht durchaus tötlich, aber ihr ganzes Innere schien so verletzt, so zerrissen, daß es den äußeren Leiden schwerlich zu widerstehen vermochte.
Was konnte dies junge Wesen getan haben, das eine so grausame Strafe nötig machte? Was konnte die schwache Frau mit den Geheimnissen wichtiger Reiche zu tun haben?
Er saß in tiefem Nachdenken an ihrer Seite, ihren Puls unter seinem Finger.
Da erklang wieder der geheimnisvolle Seufzer, den er schon früher gehört und für das Echo des Schmerzensrufs der Gemarterten gehalten hatte. Nun überzeugte er sich, daß er sich geirrt, daß der Laut von einem anderen Wesen kommen mußte.
Die Sterbende schien ihn gleichfalls gehört zu haben; ihre Augen öffneten sich, irrten starr umher, dann fielen sie mit dem Ausdruck des Verständnisses und des Dankes auf den Arzt – kurz nachher schienen sie ihm zu winken und auf den zerrissenen Vorhang zur Seite nach dem Gemach zu deuten.
Er sah, wie die Leidende sich anstrengte, zu sprechen, und legte den Kopf an ihre blassen Lippen. Er hörte schließlich einige französische Laute.
»Rettung! Dort!«
War denn noch ein unglückliches Wesen in seiner Nähe, das seiner Hilfe bedurfte?
Er zog sein Taschenfeuerzeug hervor, zündete das Endchen Wachslicht an und stieg über das Lager hinweg in das Gemach, in dem er eben die furchtbare Szene miterlebt hatte.
Unfern von seinem Sitz, an den Polstern des Diwans, regte sich ein dichter Knäuel; er hob den bedeckenden Teppich auf – ein schwarzes Weib lag dort am Boden, zusammengeschnürt gleich einem leblosen Bündel, den Knebel im Munde.
Die großen Augen starrten ihn mit unbeschreiblichem Ausdruck an.
Mit einigen raschen Schnitten löste er die Bande; die Mohrin sprang mit der Schnellkraft der Jugend auf und stürzte sich dann auf die Gepeinigte.
Kaum vermochte Welland sie abzuwehren und zugleich das Jammergeschrei zu ersticken, das auf ihren Lippen schwebte und das unfehlbar die Würger wieder herbeigerufen hätte.
Mit Zeichen machte er ihr die drohende Gefahr begreiflich. Sie verstand – sie hatte die Leiden der Gebieterin ja wenigstens mit dem Sinn des Gehörs mitempfunden – einem Ballen gleich zur Seite geworfen, um, wenn das Schicksal der Herrin entschieden war, wahrscheinlich als unnütze und gefährliche Last mit ihr in den Fluten des Bosporus begraben zu werden.
Es war eine herzzerreißende Szene; die Schwarze warf sich mit all der Leidenschaft der heißen Zone bald am Schmerzenslager der Herrin, bald vor ihm nieder, die Hände zu ihm emporgestreckt, um Rettung flehend für die Sterbende.
Und das alles ohne Laut – aller Schmerz, alle Ungst allein stumme Gebärde –
Die Augen der Gequälten suchten wieder den Arzt und riefen ihn herbei.
»Beim Kreuz des Erlösers, Fremdling, rette das Mädchen! Der Mund einer Sterbenden muß eine Botschaft senden, die mit meinem Leben erkauft ist.«
Welland starrte sie an – wie sollte er helfen, befreien, hier in den Mauern des Serails, unter den Augen von hundert Wächtern? – Er blickte sie ratlos an.
»Dort – dort – das Fenster nach dem Meer!« – Ihr Auge deutete nach dem Schlafgemach; zum drittenmal betrat er es und schaute prüfend umher. An der entgegengesetzten Wand befand sich der Kiosk, Fenster ringsum, mit dichten Rolläden geschlossen. Es gelang ihm, einen zu öffnen; durch das vergoldete Holzgitter schaute er hinaus; dicht unter ihm lag das Meer, der Pavillon reichte bis nahe an die Mauer, die das Serail und seine Gärten auch von der Seeseite einschließt.
Er strengte alle seine Kräfte an und es gelang ihm, einen Teil des Gitters ohne merkliches Geräusch mit seinem Dolchmesser herauszubrechen; – als er den Kopf aus der Öffnung streckte, bemerkte er, daß eine Flucht wenigstens in die öden Gärten möglich war, denn wilde Weinreben schlangen sich um die Bogen und Pfeiler fast bis über die Fenster hinauf.
Als er zurückkehrte an das Schmerzenslager Mariams, sah er die Mohrin neben der Herrin knien, das Ohr auf ihren Lippen, die leise, dringende Worte zu sprechen schienen. Aber die Schwarze schüttelte heftig den Kopf, gleich als verweigere sie, um was die Herrin sie anflehte. Da rötete sich deren blasses Gesicht, das ersterbende Auge schien in Drohung zu funkeln, zwischen den Brauen zeichnete sich eine Falte – heftige Worte, Welland unverständlich, zuckten über die Lippen.
Die Sklavin beugte das Haupt; große Tränen rollten aus ihren Augen – sie faltete in stummem Gehorsam die Hände über der Brust. Welland drängte leise, daß der Weg zum Versuch der Flucht geöffnet sei. Die Schwarze stürzte nochmals am Lager ihrer Herrin nieder und bedeckte Leib und Antlitz mit Küssen. Dann streckte sie die Hände flehend gegen ihn, deutete auf die Kranke und verschwand in dem dunklen Gemach. Welland sah sie einer Schlange gleich durch die Öffnung des Fensters schlüpfen und verschwinden.
Atemlos horchte er auf jedes Geräusch – nur der Schlag seines eigenen Herzens ängstigte ihn – die Flucht schien gelungen.
Um den Verdacht so lange wie möglich aufzuhalten, schloß er den Teppich des Vorhangs wieder. Die Kranke zeigte eine tiefe, verklärende Freude in ihren Zügen.
Ihr Mund flehte leise zu ihm auf: »Beten!«
Der Mann sank an dem Lager des mißhandelten Mädchens – das er zum ersten Male im Leben sah – in die Knie, und leise strömten über seine Lippen die halb vergessenen Gebete der Kindheit.
Wie lange hatte er nicht gebetet, wie lange hatte der Dämon des Zweifels und der stolzen Freigeisterei seinen Sinn in Fesseln geschlagen! O, wie wohl tat es ihm jetzt, in dieser grauenhaften Umgebung rückhaltlos seine Zweifel abzuwerfen und einfach kindlich glauben und beten zu können, so recht aus vollem Herzen für ein vergehendes Leben, am Sterbelager einer fremden verachteten Frau ...
Er sah über ihr Antlitz die Schatten des Todes ziehen – er sah das ersterbende Auge sich umfloren mit den ewigen Geheimnissen des Jenseits. Mit einer letzten Anstrengung hob sie die unverletzte Hand gegen ihn, streifte einen Ring vom Finger und preßte ihn in die seinen – eine Gabe der Erinnerung. Er fühlte den Puls schwächer und schwächer werden, er faltete seine Hände über den ihren. Die Brust hob sich noch einmal, über die Lippen hauchte im Todesseufzer der Name des Großherrn: Abd ul Medschid – die Augen wurden glasig und kalt in der Erstarrung des Todes – sie hatte ausgelitten.