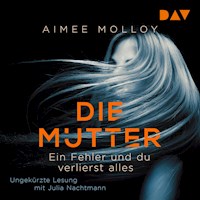9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Keiner sieht dich. Doch du hörst alles ... Der Psychotherapeut Sam und seine Frau Annie ziehen aus New York in die verschlafene Kleinstadt, in der Sam aufgewachsen ist. Dort arbeitet Sam fast rund um die Uhr in seiner Praxis im Souterrain mit seinen (hauptsächlich weiblichen) Klientinnen, während Annie zu viel Zeit allein verbringt. Sam ahnt nicht, dass durch einen Lüftungsschacht all seine Therapiesitzungen im Obergeschoss zu hören sind: die Frau des Apothekers, die sich scheiden lassen möchte. Die Malerin mit dem enttäuschenden Liebesleben. All diese Geschichten mit anzuhören, ist unwiderstehlich. Doch dann taucht die betörende junge Französin in dem grünen Mini Cooper auf. Und Sam geht eines Tages zur Arbeit, um nicht wieder zurückzukehren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Ähnliche
Aimee Molloy
Das Therapiezimmer
Thriller
Über dieses Buch
Keiner sieht dich. Doch du hörst alles …
Der Psychotherapeut Sam und seine Frau Annie ziehen aus New York in die verschlafene Kleinstadt, in der Sam aufgewachsen ist. Dort arbeitet Sam fast rund um die Uhr in seiner Praxis im Souterrain mit seinen (hauptsächlich weiblichen) Klientinnen, während Annie zu viel Zeit allein verbringt. Sam ahnt nicht, dass durch einen Lüftungsschacht all seine Therapiesitzungen im Obergeschoss zu hören sind: die Frau des Apothekers, die sich scheiden lassen möchte. Die Malerin mit dem enttäuschenden Liebesleben. All diese Geschichten mit anzuhören, ist unwiderstehlich. Doch dann taucht die betörende junge Französin in dem grünen Mini Cooper auf. Und Sam geht eines Tages zur Arbeit, um nicht wieder zurückzukehren …
«Wahrscheinlich der spannendste Roman, den Sie dieses Jahr lesen werden.» A.J.Finn
Vita
Aimee Molloy ist als Sachbuchautorin in den USA bereits sehr erfolgreich und genießt Bestsellerstatus. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Brooklyn. Mit ihrem ersten Thriller, «Die Mutter», stand sie monatelang auf der New-York-Times-Bestsellerliste.
Katharina Naumann ist Autorin, freie Lektorin und Übersetzerin und lebt in Hamburg. Sie hat unter anderem Werke von Jojo Moyes, Anna McPartlin und Jeanine Cummins übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Goodnight Beautiful» bei HarperCollins Publishers, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «Goodnight Beautiful» Copyright © 2020 by Aimee Molloy
Redaktion Rebecca Wangemann
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung SEAN GLADWELL/GettyImages
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-40634-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für meine Mom und meinen Dad
Prolog
20. Oktober
Ich schaue hoch und sehe, wie ein Mann mit roten Wangen und einem Bürstenhaarschnitt ins Restaurant tritt und den Regen von seiner Baseballmütze schüttelt. «Hey, Süße», ruft er dem Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren zu, das hinter dem Bartresen steht und Drinks mixt. «Könntest du das vielleicht ins Fenster hängen?»
«Klar», sagt sie und nickt in Richtung des Zettels, den er in der Hand hält. «Wieder ein Spendenaufruf für die Feuerwehr?»
«Nein, jemand wird vermisst», antwortet er.
«Vermisst? Was ist denn mit ihr passiert?»
«Nicht mit ihr. Mit ihm.»
«Ihm? Na, das hört man ja nicht jeden Tag.»
«Ist in der Unwetternacht verschwunden. Wir versuchen jetzt, die Vermisstenanzeige zu verbreiten.»
Die Tür fällt hinter ihm zu. Sie geht zum Ende des Tresens, nimmt den Zettel in die Hand und liest der Frau, die am Tisch in der Ecke ihr Mittagessen isst, den Text vor. «Dr. Sam Statler, Therapeut, circa 1,80 groß, schwarzes Haar und grüne Augen. Er war vermutlich mit einem Lexus RX 350 von 2019 unterwegs.» Sie pfeift leise durch die Zähne und hält den Zettel hoch. «Diejenige, mit der er verschwunden ist, hat wirklich Glück gehabt.» Ich werfe einen Blick auf Sams Foto – diese Augen, dieses Grübchen, das Wort VERMISST in Schriftgröße zweiundsiebzig über seinem Kopf.
«Ich habe heute Morgen in der Zeitung von der Geschichte gelesen», sagt die Frau am Ecktisch. «Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet.»
Das Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren tritt ans Fenster. «Frau, was? Hoffen wir mal, dass die ein gutes Alibi hat. Man kennt ja die alte Redensart: ‹Wenn ein Mann verschwindet, war es immer die Frau.›»
Die beiden lachen. Das Mädchen klebt das Foto von Sams Gesicht an die regenverschmierte Scheibe, und ich tauche mit einem flauen Gefühl im Bauch den Löffel in meine Suppe und schlürfe sie vorsichtig, den Blick auf meine Schüssel gesenkt.
Teil I
Kapitel 1
Drei Monate zuvor
Dieser Arsch.
Es ist unglaublich.
Der Arsch ist so perfekt, dass Sam den Blick einfach nicht abwenden kann. Er geht einen halben Block hinter ihr den Hügel hinauf, an dem Käseladen, dem Buchladen, der hochgelobten neuen Weinbar mit der leuchtend roten Tür vorbei. Er tut so, als betrachtete er bei Hoyt’s Hardware den Tisch mit den amerikanischen Flaggen zum halben Preis, während sie auf das Parlor zugeht, das schicke, feine Restaurant, das vor drei Monaten eröffnet hat. Ein Mann, der gerade hinausgeht, hält ihr die Tür auf und bleibt noch ein wenig stehen, um einen Blick auf ihre Rückseite zu erhaschen, zweifellos in der Hoffnung, dass seine Frau es nicht sieht.
Wie Sam schon sagte: dieser Arsch.
Die Restaurantbesitzer haben das Gebäude von den Finnerty-Zahnärzten übernommen, die dort über zwei Generationen praktiziert hatten. Die Ziegelfassade ist durch eine glatte Glaswand ersetzt worden. Sam bleibt davor stehen und schaut zu, wie sie durch den Raum geht und sich an die Bar setzt.
Den Leinenblazer auszieht.
Einen Drink bestellt.
Sie holt ein Buch aus ihrer Tasche. Ihre Schulterblätter treten unter dem dünnen Top wie die Flügel eines Vögelchens hervor. Er geht vorbei und bleibt vor den Angeboten im Fenster des Immobilienmaklers nebenan stehen. Genau neun Minuten wartet er, lange genug, dass sie schon fast mit ihrem Drink fertig ist. Er spürt den vertrauten Adrenalinschub und lockert seine Krawatte ein wenig. Dann dreht er sich um.
Los geht’s.
Die Tür zum Parlor öffnet sich, als Sam näher kommt, und ein Schwall klimatisierter Luft dringt hinaus in die feuchte Abendluft. «Dr. Statler.» Eine Patientin steht vor ihm, und er muss angestrengt überlegen, wie sie heißt. Fing vor zwei Wochen mit der Therapie an. Carolyn. Caroline.
«Catherine», sagt Sam. Mist. Was in New York nie passierte, geschieht hier ständig – er läuft andauernd Patienten über den Weg, auf der Straße, beim Einkaufen, gestern im Fitnessstudio, wo er fünf Kilometer auf dem Laufband lief, während Alicia Chao, die frisch geschiedene Geisteswissenschaftsprofessorin mit einer Angststörung, neben ihm auf dem Crosstrainer trainierte – und jedes Mal bringt es ihn aus dem Gleichgewicht. «Wie geht es Ihnen?»
«Mir geht es gut», antwortet Catherine. Catherine Walker. In New York ist sie eine bekannte Malerin und hat sich für eine Million Dollar ein Haus mit Blick auf den Fluss gekauft. «Das ist Brian.» Sam schüttelt ihm die Hand. Brian: der Restaurateur, der sie im Bett nicht befriedigt. «Wir sehen uns dann morgen», sagt Catherine. Sam betritt das Lokal.
«Möchten Sie heute hier zu Abend essen?», fragt das Mädchen an dem kleinen Stehtisch am Empfang. Sie ist jung und blond. Tattoos. Sehr hübsch. Eine Kunststudentin, nimmt er an, mit einem Piercing, das sich irgendwo unter ihrer Kleidung versteckt. Genau der Typ, den er früher bis zehn Uhr abends mit Sicherheit im Bett gehabt hätte.
«Nein», sagt Sam. «Nur einen Drink.»
Die Bar ist voll von Leuten, die neu aus der Stadt hierher gezogen sind. Sie teilen sich Teller mit geröstetem Rosenkohl und sauren Gürkchen für neun Dollar. Sam geht auf die Frau zu, wobei er wie zufällig ihren Arm mit seinem Ellenbogen streift, als er an ihr vorbeigeht.
Ihre Tasche liegt auf dem Hocker zwischen ihnen, und Sam stößt mit dem Bein dagegen, als er sich setzt, sodass sie zu Boden fällt. «Entschuldigung», sagt er und bückt sich nach ihr.
Sie lächelt, als sie die Tasche entgegennimmt, und hängt sie an einen Haken unter der Bar. Dann wendet sie sich wieder ihrem Buch zu.
«Was soll’s denn sein?», fragt der Barkeeper. Er hat sich das Haar nass zurückgekämmt und zeigt beim Lächeln erschreckend weiße Zähne.
«Johnnie Walker Blue», sagt Sam. «Pur.»
«Ein Mann mit einem teuren Geschmack», sagt der Barmann, und Sam zieht eine Kreditkarte aus seiner Brieftasche. «Meine Lieblingskunden.»
«Und ich würde dieser Dame gern einen Drink ausgeben. Weil ich ihrer Handtasche Unannehmlichkeiten bereitet habe.»
Sie lächelt kurz. «Das ist nett von Ihnen. Aber meiner Tasche geht es gut.»
«Nein, ich bestehe darauf. Was trinken Sie?»
Sie zögert und mustert ihn prüfend. «Na gut», sagt sie. «Gin Martini. Fünf Oliven.»
«Einen Martini? Ich hätte Sie als Rosé-Trinkerin eingeschätzt.»
«Wie vorurteilsfrei von Ihnen», sagt sie leicht sarkastisch. «Aber Sie wissen doch, was man über Martini sagt.»
Er ist geschickt darin, andere Menschen unauffällig zu beobachten. Es ist eine professionelle Notwendigkeit, die es ihm jetzt erlaubt zu sehen, dass sie unter dem weißen Top einen blassrosa BH mit Spitze trägt und dass die Haut auf ihren Schultern glänzt. «Nein, was sagt man denn über Martinis?», fragt Sam.
«‹Die richtige Verbindung aus Gin und Wermut ist von ebenso großer wie unerwarteter Herrlichkeit; sie ist eine der glücklichsten Ehen der Welt und gleichzeitig eine der kurzlebigsten.›»
Der Barkeeper stellt ihren Drink vor sie hin. «Bernard DeVoto.»
Sam nickt in Richtung ihres Buches. «Lesen Sie ihn gerade?»
Sie schlägt das Buch zu, sodass er das Cover sehen kann, das die Silhouette einer Frau zeigt. «Nein, das hier ist der Thriller, über den alle reden.»
«Taugt er was?»
«Es geht. Wieder eine unzuverlässige Erzählerin. Um ehrlich zu sein, geht es mir langsam ein bisschen auf die Nerven, wie Frauen derzeit in der Belletristik dargestellt werden.»
«Wie werden sie denn dargestellt?»
«Ach, wissen Sie», sagt sie. «Dass wir zu Neurosen und oder Hysterie neigen und dass man unserem Urteil nicht trauen kann. Das legitimiert die männlichen Herrschaftsstrukturen und die dominante Position des Mannes in der Gesellschaft sowie die untergeordnete Position der Frau.» Sie nimmt ihr Glas und wendet sich wieder ihrem Buch zu. «Aber danke für den Drink.»
Sam lässt sie eine Seite lesen und beugt sich dann zu ihr. «Hey, Fräulein Schlauberger. Sind Sie übers Wochenende hier?»
«Nein», erwidert sie und blättert um. «Ich wohne hier.»
«Ach was. Chestnut Hill ist eine kleine Stadt. Ich hätte Sie doch schon einmal sehen müssen.»
«Ich bin neu hier.» Sie schaut zu ihm hoch. «Bin letzten Monat aus New York hierher gezogen. Eine ‹Stadt-Idiotin›, ich glaube, so werden wir von den Leuten hier genannt?» Sie zieht mit den Zähnen eine Olive vom Plastikspießchen in ihrem Drink, und er stellt sich vor, wie salzig ihre Lippen schmecken müssen. In diesem Moment spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Es ist Reggie Mayer, der Apotheker. Seine Frau Natalie ist seine Patientin; sie findet, dass Reggie nach Salami riecht. «Natalie geht es nicht so gut», sagt Reggie und hält eine Plastiktüte mit Essen hoch. «Ich bringe ihr Suppe.»
«Sagen Sie ihr, dass ich ihr gute Besserung wünsche», sagt Sam und beugt sich ein paar Zentimeter vor. Er kann nichts riechen.
«Das tue ich, Dr. Statler. Danke schön.»
«Doktor?», sagt die Frau, als Reggie gegangen ist.
«Psychotherapeut.»
Sie lacht. «Sie sind also Psychotherapeut.»
«Was? Sie glauben mir nicht?» Sam greift erneut nach seiner Brieftasche und zieht eine Visitenkarte hervor, die er neben ihren Drink schiebt.
«Eigenartig», sagt sie und liest die Aufschrift. «Hätte schwören können, dass Sie Podologe sind. Also, wollen Sie mich analysieren?»
«Wieso glauben Sie, dass ich das nicht schon längst getan habe?»
Sie klappt ihr Buch zu und wendet sich ihm zu. «Und?»
«Sie sind schlau», sagt er. «Selbstbewusst. Ein Einzelkind, nehme ich an.»
«Sehr gut, Herr Doktor.»
«Zwei liebevolle Eltern. Privatschule. Mindestens ein Abschluss, vermutlich eher zwei.» Sam hält inne. Dann sagt er: «Und Sie mussten auch lernen, wie man die Last trägt, als außergewöhnlich schöne Frau durch die Welt zu gehen.»
Sie verdreht die Augen. «Wow, das war echt schlecht.»
«Vielleicht. Aber ich meine es ernst», sagt er. «Wenn man eine Umfrage unter den Männern hier machen würde, wen sie heute Abend am liebsten mit nach Hause nähmen, würden hundert Prozent von ihnen Sie nehmen, das wette ich.»
«Neunundneunzig Prozent», verbessert sie ihn. «Der Barkeeper würde Sie nehmen.»
«Ständig im Mittelpunkt männlicher Aufmerksamkeit zu stehen, kann Auswirkungen haben», fährt Sam fort. «Wir nennen es Objektifizierung.»
Ihr Gesicht wird weicher. «Also, wie bei Dingen.»
«Bei manchen Menschen ist das so, ja.»
«Glauben Sie, ich sollte mir einen Therapiehund anschaffen?»
«Machen Sie Witze? Ein heißes Mädchen mit einem Hund? Das macht es nur noch schlimmer.»
Sie lächelt. «Haben Sie sich das alles ausgedacht, während Sie hinter mir den Hügel hinaufgegangen sind und auf meinen Hintern gestarrt haben? Oder während Sie draußen standen und mich durch das Fenster beobachteten?»
«Ich musste telefonieren», erwidert Sam. «Eine existenzielle Krise, die meine sofortige Aufmerksamkeit erforderte.»
«Wie schade. Ich hatte gehofft, dass Sie da draußen standen, um erst einmal den Mut aufzubringen, mich anzusprechen.» Sie wendet den Blick nicht von ihm, nimmt eine weitere Olive zwischen die Lippen und saugt die Füllung heraus, und da ist es wieder, das Gefühl, das ihn antreibt wie eine Droge, seit er fünfzehn ist, dieses erregende Wissen, dass er kurz davor ist, seinen Pflock in eine wunderschöne Frau zu schlagen.
«Sie haben tatsächlich einen außergewöhnlichen Arsch», sagt Sam.
«Ja, ich weiß.» Sie wirft einen Blick auf seinen Johnnie Walker Blue. «Da wir gerade von außergewöhnlich sprechen, ich habe nur Gutes über Ihren Drink da gehört. Darf ich?» Sie hält das Glas ans Licht und betrachtet die Farbe, um es dann an ihre Lippen zu führen und auszutrinken. «Sie haben recht. Es ist wirklich ein guter Drink.» Sie beugt sich ganz nah zu ihm, ihr Atem verströmt die leichte Note seines Whiskys. «Wenn Sie kein verheirateter Therapeut von hier wären, würde ich Sie zum Probieren in meinen Mund einladen.»
«Woher wissen Sie, dass ich verheiratet bin?», fragt er. In seinem Nacken wird es ganz heiß.
«Sie tragen einen Ehering», sagt sie.
Er steckt die Hand in seine Hosentasche. «Sagt wer?»
«Weiß Ihre Frau, dass Sie heute Abend hier sind und das selbstbewusste Einzelkind aus Chestnut Hill, New York analysieren?»
«Meine Frau ist nicht in der Stadt», sagt Sam. «Was meinen Sie? Wollen Sie mit mir zu Abend essen?»
Sie lacht. «Sie kennen ja noch nicht einmal meinen Namen.»
«Es ist ja auch nicht Ihr Name, an dem ich interessiert bin.»
«So?» Sie stellt das Glas ab, wendet sich ihm zu und greift unter den Tresen. «Na, in dem Fall …»
«Alles in Ordnung bei Ihnen?» Der Barkeeper. Er ist zurück und kratzt sich über dem Auge. Unterdessen lässt sie ihre Hände Sams Schenkel hinaufgleiten.
«Ja», sagt sie. «In allerbester Ordnung.»
Der Barkeeper geht wieder. Ihre rechte Hand ist jetzt zwischen seinen Beinen angelangt, wo sie mindestens noch eine weitere Minute liegen bleibt. Sie sieht ihm dabei in die Augen. «Meine Güte, Doktor», sagt sie. «So wie ich das sehe, hat die arme Frau, mit der Sie verheiratet sind, großes Glück.» Sie legt die Hand wieder auf den Tresen. «Richten Sie ihr das unbedingt von mir aus.»
«Das werde ich.» Sam beugt sich vor und legt ihr sanft die Hand an die Wange. Sein Atem ist ganz heiß an ihrem Ohr. «Hey, Annie Potter, weißt du was? Du hast großes Glück.» Sie riecht nach Pantene-Shampoo und trägt die Ohrringe, die er ihr gestern Abend geschenkt hat. «Jetzt legen Sie Ihre Hand zurück auf meinen Schwanz.»
«Tut mir leid, Dr. Statler», sagt sie und löst sich von ihm. «Aber das war bloß ein Teil Ihres Geschenks zum Hochzeitstag. Sie bekommen den Rest, wenn wir zu Hause sind.»
«Na, in dem Fall.» Sam hebt die Hand und winkt dem Barkeeper. Annie nimmt das Spießchen und beißt in die letzte Olive.
«Wie war dein Tag, lieber Ehemann?», fragt sie und lächelt ihn an.
«Nicht so gut, wie meine Nacht wird.»
«Hast du deine Mom gesehen?»
«Ja», antwortet er.
Sie wischt ihm ein Haar von der Schulter. «Wie geht es ihr?»
«Ganz gut.»
Annie seufzt. «Alle dort waren gestern so schlecht drauf. Sie verabscheuen die neue Leitung.»
«Es ist in Ordnung, Annie», sagt Sam, der noch nicht bereit ist, das Gefühl von der Hand seiner Frau zwischen seinen Beinen durch die Gedanken an seine Mutter zu ersetzen, die allein und unglücklich im Fünftausend-Dollar-pro-Monat-Pflegeheim hockt, in das er sie vor sechs Monaten verfrachtet hat.
«Okay, gut, wir reden nicht darüber», sagt Annie. Sie hebt das Glas. «Auf eine weitere erfolgreiche Ehewoche. Diese letzten sechs Wochen waren so gut, dass ich uns mindestens sechs weitere gebe.»
Sam zupft ein wenig an Annies Top, ihm ihren BH-Träger unsichtbar zu machen. «Bist du dir sicher, dass du mich für das alles nicht hasst?»
«Für was alles?»
«Dafür, dass wir New York aufgegeben haben. In dieses Loch von einer Stadt gezogen sind. Dafür, dass du mich geheiratet hast.»
«Ich liebe dieses Loch von einer Stadt zufällig.» Sie schnappt sich die Rechnung vom Barkeeper und unterschreibt schnell mit seinem Namen. «Und nicht zuletzt bist du sehr reich. Und jetzt kommen Sie, Herr Doktor, bringen Sie mich nach Hause und verschaffen Sie mir Vergnügen.»
Sie steht auf und zieht sich langsam wieder ihre Jacke an. Sam folgt ihr zur Tür, so zufrieden von dem Anblick seiner Frau, die vor ihm durchs Restaurant geht, dass er das verführerische Lächeln der hübschen Blondine am Empfang kaum bemerkt. Er muss so etwas nicht mehr bemerken. Er ist ein neuer Mann.
Nein, wirklich.
Kapitel 2
Ich wache auf, und mir ist heiß. Die Sonne blendet mich durch das Fenster, ein warmes Lichtquadrat direkt in meinen Augen. Schritte kommen die Einfahrt herauf. Ich setze mich auf und sehe eine Frau in einem knappen blauen Kleidchen und fünf Zentimeter hohen Sandalen entschlossen an der Veranda vorbei und entlang dem von Zinnien gesäumten Steinpfad zur Tür von Sams Praxis im Souterrain gehen. Ich brauche eine Minute, um zu realisieren, dass ich nicht in meiner Einzimmerwohnung in der Stadt, sondern hier bin. Dass ich gerade aus einem Nickerchen aufgewacht bin, noch ganz verschlafene Augen habe und mich in Chestnut Hill, New York befinde. Und dass Sam unten bei der Arbeit ist.
Ich schaue auf meine Uhr – 16.16 Uhr – und lasse mich vom Sofa gleiten. Ich bleibe geduckt, bis ich das Fenster erreiche, und betrachte Sams letzte Patientin des Tages. Ende vierzig. Die Tasche ist aus echtem Leder. Die Föhnfrisur frisch.
Und jetzt ist es wieder an der Zeit für unser aller Lieblingsspiel: Erraten Sie die Probleme der Patientin!
Zwei Töchter im Teenageralter, denkt über eine Scheidung und eine Ausbildung zur Immobilienmaklerin nach.
Falsch! Eine Kinderärztin, kurz vor der Menopause, die immer noch ein Problem mit ihrer Mutter hat.
Ein Summen ertönt, und die Tür öffnet sich von innen. Sie tritt ein, und ich warte darauf, dass die Pforte wieder ins Schloss fällt, male mir aus, wie sie ins Wartezimmer tritt. Ich kann es mir genau vorstellen: Sam ist im Büro, die Tür ist verschlossen. Sie setzt sich auf einen der vier weißen Ledersessel, legt ihre Tasche auf den gläsernen Beistelltisch neben den beiden ordentlichen In Touch- und The New Yorker-Stapeln. («Ihre Wahl sagt mir schon alles», scherzte Sam, als die ersten Exemplare in der Post lagen.) Eine Nespresso-Maschine steht auf der Anrichte; in kleinen Glasbehältern liegen Teebeutel sowie brauner und weißer Zucker. Sie wird sich fragen, ob sie noch Zeit hat, sich eine Tasse Earl Grey aufzubrühen. In diesem Moment öffnet Sam seine Bürotür, Punkt halb fünf.
Ich habe ihn einmal gefragt, worüber er mit seinen Patientinnen da unten spricht – wenn sie auf dem weichen beigefarbenen Sofa sitzen, er auf dem teuren Ledersessel, den er extra bei einer skandinavischen Firma mit einem seltsamen Namen bestellt hatte. «Na komm schon, nur einmal», neckte ich ihn. Es war Happy Hour, und ich hatte uns ein paar Drinks gemixt. «Mit welchen Problemen schlagen sich die reichen Damen von Chestnut Hill herum?»
Er lachte. «Auch wenn das enttäuschend ist, aber das ist vertraulich.»
Ich bleibe am Fenster stehen, betrachte den Vorgarten und die ordentlich beschnittene Hecke, die das Haus von der Straße abschirmt. Mein Haus, das Lawrence House, das edle viktorianische Gebäude, fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Es hat einen spitzen Giebel und eine Veranda, die ganz um das Haus herum verläuft. Es ist eins von nur zwei Häusern hier in der Cherry Lane. Die Zufahrt verläuft über eine schmale Holzbrücke, die sich über den breiten Bach spannt, der neben dem Haus verläuft. Auf keiner offiziellen Karte habe ich seinen Namen gefunden.
Das Haus wurde von der Gründerfamilie der Stadt im Jahr 1854 gebaut – fünf Generationen von Millionären wurden genau hier in diesem Haus aufgezogen. Es hat ein riesiges Wohnzimmer, ein förmliches Esszimmer und eine Bibliothek hinter einer Schiebetür – vielleicht mein Lieblingsplatz im Haus. Darin gibt es passgenau eingebaute Mahagoni-Bücherregale, die bis zur Decke reichen. An das höchste Brett kommt man nur über eine Holzleiter an einer Schiene heran. So ein Unterschied zu der letzten Wohnung, in der ich gelebt habe: einer Einzimmerwohnung über einem Happy Chinese-Imbiss. Das pinkfarbene Neonlicht blinkte die ganze Nacht vor meinem Fenster.
Ich gehe zur Treppe, lasse meine Finger über das originale Eichengeländer streichen und zähle meine Schritte – zwölf nach oben, acht den Flur hinunter, an drei leeren Schlafzimmern vorbei zum Hauptschlafzimmer. In dem angrenzenden Badezimmer trete ich in die Dusche und stelle das Wasser an, woraufhin Leben in die alten Rohre kommt. Meine Laune hebt sich. Fünfundvierzig Minuten bis zur Happy Hour, dem Höhepunkt meines Tages. Ein starker Drink auf der Veranda, wenn Sam mit seiner Arbeit fertig ist – heute gibt es Wodka und Limonade, frisch aus den acht besten Zitronen gepresst, die ich aus dem klebrigen Kasten bei Farrells klauben konnte, Chestnut Hills jämmerlichstem Lebensmittelladen.
Sam wird mich fragen, was ich den ganzen Tag getan habe, wird mir Einzelheiten entlocken, mich dazu zwingen zu lügen (eine selbstgekochte Fischsuppe zum Mittagessen und eine Fahrt mit dem Fahrrad in die Stadt!), weil es mir zu peinlich ist, die Wahrheit zuzugeben (eine Stunde Shopping auf Amazon und weitere drei, in denen ich Produktrezensionen geschrieben habe!). Es ist ja nicht so, als hätte ich viel Auswahl. Ich bin ein Mensch, der gerne Listen führt, und ich habe auch dafür eine.
Wie ich meine Tage in Chestnut Hill verbringen kann: eine Liste
Meinen Amazon-Rang verbessern. Unter den Rezensenten bin ich jetzt auf Platz neunundzwanzig, vielendankauch. (Ich gebe nicht an, das ist mein User-Name.) Kopf an Kopf mit Lola aus Pensacola, einer Frau, von der ich überzeugt bin, dass sie eigentlich aus dem Mittleren Westen kommt.
Ein Ehrenamt übernehmen, damit Sam sich nicht mehr fragt, was ich den ganzen Tag hier mache.
Die Tür von Sams Büro reparieren. Er beschwert sich immer darüber. Sie knallt jedes Mal so laut, wenn jemand kommt oder geht, dass seine Sitzungen gestört werden. Er sagt, dass er selbst eine Firma beauftragen will, aber ich habe ihm versichert, dass ich mich darum kümmern werde, dass es als Nächstes auf meiner Liste steht.
Aber ich habe keinerlei Absicht, mich darum zu kümmern, und es nie auf irgendeine meiner Listen gesetzt. Die Wahrheit ist, dass ich gerne in dem Wissen bin, dass er unten ist, dass ich nicht ganz allein hier bin und in einem Haus mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit umherstreife. Denn das ist noch so eine Sache an diesem Haus. Die letzte Besitzerin, eine ledige, siebenundsechzig Jahre alte Frau namens Agatha Lawrence, starb hier. Sie lag fünf Tage lang mit blauen Lippen auf dem Boden ihres Arbeitszimmers, bis sie von der Haushälterin entdeckt wurde. Die Geschichte ist in die Folklore der Stadt eingegangen: die wohlhabende alte Jungfer, die allein sterben musste, der schlimmste Albtraum einer jeden Frau. Es fehlen nur die neun Katzen.
Es ist kein Wunder, dass ich mit der Vorstellung haderte, den ganzen Tag allein hier zu verbringen. Sam hatte eigentlich vor, sich irgendwo (hier mit den Fingern Gänsefüßchen andeuten) «in der Innenstadt» ein Büro zu suchen, aber ich überzeugte ihn davon, sich sein Büro hier einzurichten, im Souterrain, in dem großen, luftigen Raum, der früher als Lagerraum genutzt wurde.
«Wir könnten die hintere Wand einreißen und stattdessen ein Panoramafenster einsetzen lassen», schlug ich vor und zeigte ihm die grobe Skizze, die ich gezeichnet hatte. «Hier würde dann das Wartezimmer sein.»
«Gute Idee», sagte er, nachdem er sich die anderen Angebote in der Stadt angesehen hatte. «Ich glaube, das ist es.»
Und wie es sich herausstellte, hatte ich tatsächlich recht; alles ist spektakulär großartig geworden. Ich konnte einen Bauunternehmer auftun, der (zu einem happigen Preis) bereit war, die Sache schnell durchzuziehen und den einst steril wirkenden Raum in ein wunderschönes Büro mit Fußbodenheizung, schicken Lichtinstallationen und einem bodentiefen Fenster umzuwandeln, das den Blick auf den hügeligen Garten und den Wald dahinter freigab.
Ich ziehe mich rasch an und eile die Treppe hinunter, weil ich das Zuschlagen von Sams Bürotür gehört habe. In der Küche mixe ich die Drinks. Als ich gerade die Haustür öffnen und auf die Veranda treten will, sehe ich die Patientin durch die Fensterscheibe, Ms. Knappes Kleidchen, wie sie in der Einfahrt herumlungert und auf ihr Handy starrt. Ich trete von der Tür weg und versuche, sie gedanklich dazu zu bringen zu gehen – Hau ab, jetzt bin ich an der Reihe –, und dann knallt Sams Bürotür erneut zu.
«Sie sind noch hier», höre ich Sam sagen.
«Entschuldigen Sie, ich bin von einer Arbeitsangelegenheit abgelenkt worden.» Ich gehe ins Wohnzimmer, um aus dem Panoramafenster zu schauen, von dem aus man auf die Veranda und die Auffahrt schauen kann. Dort sehe ich Sam und Knappes Kleidchen und bemerke ihren verträumten Gesichtsausdruck. Ich bin schon daran gewöhnt, wie die Frauen auf Sam und sein kantiges gutes Aussehen reagieren. Sein Gesicht könnte direkt aus einem Abercrombie & Fitch-Katalog stammen. «Es ist wirklich so schön zu sehen, dass dieses Haus wieder ein Zuhause ist, nach der traurigen Geschichte mit der letzten Besitzerin», sagt sie. «Und noch einmal danke für heute, Sam. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Sie tun würde.»
Ich höre, wie ihr Auto leise piept, als sie es aufschließt, und warte, bis das Geräusch des Motors verklungen ist. Erst dann öffne ich die Haustür. Sam steht am Briefkasten und blättert durch den Stapel.
«Hallöchen, Herzensbrecher», sage ich. «Wie lief es heute?»
Er lächelt mich an, sodass das Grübchen sichtbar wird. «Langwierig», erwidert er. «Ich bin ganz schön erschöpft.»
Er steigt die Verandastufen empor und gibt mir die Briefe, die an mich adressiert sind. Ich reiche ihm sein Glas. «Worauf sollen wir heute Abend anstoßen?»
Er schaut zum Haus hoch. «Vielleicht auf neues Leben im Lawrence House?»
«Ja, das ist perfekt.» Ich stoße mit ihm an und lege dann den Kopf in den Nacken, um einen langen Schluck zu nehmen. Ich frage mich, ob er es auch spürt. Das Falsche an diesem Haus.
Kapitel 3
Sam macht das Radio lauter. In der anderen Hand hält er eine Dose Brooklyn Lager. «Zweite Hälfte achtes Inning, zwei Spieler aus», murmelt der Moderator namens Teddy aus Freddy mit seiner langsam rollenden Aussprache aus dem Lautsprecher, die ihn in ganz Maryland bekannt gemacht hat. «Bo Tucker schafft es bis zur Basis. Schneller Wurf. Fliegt hoch zum rechten Feld. Und … er ist aus.»
«Verdammt», schreit Sam und zerquetscht die Dose in seiner Hand, sodass lauwarmes Lager auf seinen Schoß spritzt. Das Spiel wird durch Werbung unterbrochen. Das Handy auf dem Beifahrersitz brummt. Eine Textnachricht von Annie.
Hallo, lieber Ehemann.
Er wechselt zur Stoppuhr auf seinem Handy – sechsundvierzig Minuten – und öffnet noch ein Bier. Plötzlich taucht eine Frau auf und geht auf Sams Auto zu. Er steckt die Bierdose, seine dritte in den letzten sechsundvierzig Minuten, zwischen seine Knie, und sie erschrickt, als er sie sieht, und packt ihre Tasche fester. Er kann es ihr nicht verübeln. Hier sitzt ein Typ, trinkt Bier und hört auf dem Parkplatz eines Altenpflegeheims einem Baseballspiel der unteren Liga zu. Er versteht, wie das aussehen muss.
Sie wirft ihm aus den Augenwinkeln im Vorbeigehen einen Blick zu, und Sam lächelt, ein schwacher Versuch, sie davon zu überzeugen, dass er nicht so unheimlich ist, wie es aussieht. Sie ist die Frau, die die Kantine leitet, Gloria irgendwas. Sie bereitet drei Mal am Tag weiches Essen und montags abends Fettuccine Alfredo für die Bewohner des Rushing Waters Altenpflegezentrums zu, also für sechsundsechzig Bewohner, je nachdem, wer über Nacht gestorben ist.
Die Werbung endet, und die Hörer sind jetzt in der zweiten Hälfte des neunten Innings. «Was meint ihr, Keys-Fans?», fragt Teddy aus Freddy. «Reißen wir das Ruder noch herum?»
«Natürlich nicht», sagt Sam. «Wir haben seit drei Jahren nicht mehr gewonnen. Das weißt du, Dad.» Teddy aus Freddy ist ein Name, der absolut unsinnig ist – niemand nennt die Stadt Frederick in Maryland Freddy –, aber er ist hängen geblieben. Zwölf Jahre sitzt sein Vater, Theodore Samuel Statler, nun schon in der Kabine im Harry Grove Stadium und moderiert die Spiele der Frederick Keys, des schlechtesten Farmteams in der Geschichte des Baseballs.
Bevor Theodore Statler als Teddy aus Freddy bekannt wurde, kannte man ihn als Mr. S., den charmanten und gut aussehenden Mathelehrer an der Brookside High School, der seine Frau für das heiße Model auf Seite vierundzwanzig des Talbots-Katalogs von Juni 1982 verließ. Sie hieß Phaedra, der einzige Name, der noch blöder war als Teddy aus Freddy. Jemand aus dem Baseball-Team beschaffte sich den Katalog, in dem die neue Freundin von Sams Vater im Bikini am Strand saß, die Schenkel mit Sand bedeckt. Er wurde wochenlang im Umkleideraum herumgereicht, und alle gaben zu, dass die Mädchen darin vielleicht nicht so heiß waren wie die in der Sports Illustrated, aber immer noch ihren Zweck erfüllten.
Ted lernte sie am 6. September 1995 in Camden Yards kennen, an dem Tag, an dem Cal Ripken Jr. Lou Gehrigs Rekord an direkt aufeinander folgenden Spielen brach. Sams Großvater war in Baltimore aufgewachsen, und wie jeder Statler-Mann seit 1954 war auch Sam ein eingefleischter Orioles-Fan. Er verehrte Cal Ripken, und die Eintrittskarten für das Spiel waren ein frühes Geburtstagsgeschenk von Sams Mutter Margaret – sein absolutes Traumgeschenk –, bezahlt mit dem Geld, das Margaret seit Monaten von ihrem armseligen Sekretärinnengehalt abgezwackt hatte.
Phaedra saß direkt vor Sam, und sie stieß ständig gegen seine Knie, wenn sie sich umdrehte, um über die Witze seines Vaters zu lachen, und dabei blockierte ihre hässliche Mütze mit den orange-schwarzen Puscheln Sams Sicht. Er fand es furchtbar, dass sein Dad dem Spiel kaum Aufmerksamkeit schenkte, und er fand es sogar noch furchtbarer, als er vorschlug, dass Sam und Phaedra die Plätze tauschen sollten.
Es stellte sich heraus, dass sie nicht nur weiße Zähne und lange Beine hatte, sondern auch noch Tupperware-Erbin war. Ted Statler hatte mit ihr eine geradezu unheimlich enge Verbindung, eine Erkenntnis, die er zwei Wochen später mit Sam und Margaret teilte, an Sams eigentlichem Geburtstag. Er stand auf, als Margaret gerade den Pepperidge Farm-Kokoskuchen anschnitt, als wollte er eine Hochzeitsrede halten. Sagte, er habe keine Wahl, er müsse einfach ehrlich zu sich selbst sein. Er habe seine Seelenverwandte getroffen und könne nicht länger ohne sie leben.
Das war im Jahr 1995, in dem das erste Klapphandy auf den Markt kam, im Jahr, bevor der Mindestlohn auf 4,25 Dollar angehoben wurde. Der Stundenlohn, den seine Mutter verdiente, nachdem Ted Statler seine Koffer gepackt und nach Baltimore gezogen war. In ein Penthouse am Hafen, das aus Tupperware errichtet worden war. Er hatte jetzt Zeit, herauszufinden, was er als Nächstes tun wollte, und zog sich dann den perfekten Job an Land: Er saß hoch oben in einer Glaskabine, um dem Spiel der Keys Farbe zu verleihen, und schaffte es dabei, heiter zu bleiben, obwohl sie drei Jahre lang jedes Spiel verloren, dieses Spiel eingeschlossen, das neun zu drei mit einem Aus im rechten Feld endet. Ted lädt seine Zuhörer ein, morgen Abend wieder einzuschalten, wenn die Mannschaft gegen die Salem Red Sox antritt. Sam schaltet das Radio aus und greift nach seinem Handy.
Hallo, liebe Ehefrau, schreibt er an Annie zurück.
Sofort erscheinen Pünktchen auf dem Display, ein Zeichen, dass sie etwas tippt, und Sam stellt sie sich zu Hause vor, mit Mehl im Gesicht, die geblümte Schürze so eng gebunden, dass sie ihre Taille betont, wie sie das Rachael-Ray-Rezept liest, das sie sich gestern Abend ausgedruckt hat. Bist du bei deiner Mom?, schreibt sie.
Er schaut zum Eingang des Pflegeheims. Eine Frau führt einen Mann mit einem Rollator durch die aufgleitenden Türen. Sam kann sich das Innere des Gebäudes gut vorstellen. Ein paar alte Leute, die auf den Sofas in der Lobby sitzen, ohne jeden Zweck, die Möbel, die in Uringestank mariniert sind. Er stellt sich seine Mom am selben Ort vor, wo sie beim letzten Mal saß: an einem kleinen Esstisch in der Ecke ihres Zimmers. Sie sah kein bisschen mehr so aus wie sie selbst.
Ja, ich bin bei meiner Mom, schreibt Sam Annie zurück. (Rein technisch gesehen.)
Wie geht es ihr?
Gut.
Wie lange bleibst du noch?
Sam schaut auf seine Stoppuhr. Neunundfünfzig Minuten. Nicht allzu lange.
Sag ihr, dass ich morgen vorbeikomme.
Morgen ist Annies Besuchstag. Sie gehen abwechselnd. Jeden Monat klemmt Annie einen Kalender hinten in seinen Terminkalender, den sie selbst am Küchentisch malt, indem sie mit einem Filzstift die Konturen eines Umschlages nachfährt und eine Tabelle hineinmalt. Die blauen Kästchen sind ihre Tage, die rosafarbenen Sams. (Annie mag es, Gender-Normen zu unterlaufen. Das ist ihr wichtig.)
«Findest du, wir müssen jeden Tag zu ihr gehen?», fragte Sam, als sie ihm den ersten Plan zeigte.
«Dass wir deine Mutter besuchen können, war doch der Hauptgrund, aus dem wir hierher gezogen sind», sagte sie. «Natürlich müssen wir sie jeden Tag besuchen. Sie braucht uns, Sam. Sie leidet unter Demenz.»
Frontotemporale Demenz oder Morbus Pick, wenn man genau sein will, was Sam gern ist. Die Krankheit ist durch auffällige Verhaltensänderungen und eine gewisse Enthemmung gekennzeichnet (der Versuch, den Kellner abzulecken), außerdem durch Veränderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen (der Kassiererin zum Beispiel wiederholt sagen, sie sei ein Arschloch), und ist «eine wichtige Ursache für einen frühen Ausbruch der Demenz» (in ihrem Fall: im Alter von vierundsechzig). So hat es der Arzt Sam letztes Jahr erklärt, als er in einem kalten Büro im vierten Stock des St. Luke’s Hospital neben seiner Mutter saß und es ihm die Brust zuschnürte.
Die Krankheit schritt schnell fort. Anfallartige Verwirrtheit, dann Ausbrüche bei der Arbeit. Zuerst waren sie nur leicht, aber dann kam der Tag, an dem sie ins Büro des Schulleiters Wadwhack (des traurigen Sacks) marschierte und ihm verkündete, wenn er nicht sofort zusammen mit ihr einen Hund adoptiere, würde sie die Schule niederbrennen. An diesem Tag verlor seine Mom, Mrs. S., ihren Job. Die liebste Schulsekretärin, die es je an der Brookside High gegeben hatte – viel zu gut für diesen Versager von einem Mathelehrer, der sie für ein Model verlassen hatte (aus dem Talbots-Katalog, aber trotzdem). Sam begann zu recherchieren und stieß schließlich auf dieses Heim. Rushing Waters Elderly Care Center: Versichert. Vertraut. Sechsundsechzig Einzelzimmer auf knapp dreieinhalb schattigen Hektar Land am Ende einer kurvenreichen Bergstraße außerhalb von Chestnut Hill, seiner mittelmäßigen Heimatstadt mitten im Staat New York, in der der größte Arbeitgeber eine mittelmäßige Privatuniversität mit fünftausend Studenten ist. «Chestnut Hill: Merken Sie sich das.» Das ist der Slogan der Stadt, der auf dem Ortsschild steht. Merken Sie sich das. Mehr ist ihnen nicht eingefallen.
Und doch ist er jetzt hier, der Junge, der nach zwanzig Jahren in der Großstadt wieder hierher gezogen ist. Es gibt sogar einen Artikel über ihn in der Lokalzeitung: «Zwanzig Fragen an Dr. Sam Statler.» Seine Immobilienmaklerin Joanne Reedy hatte das vorgeschlagen. Ihre Nichte schrieb die Kolumne in der Lokalzeitung, und Joanne fand, dass das gut für seine Reputation sei. Sam hatte sich die letzten Jahre sehr viel Mühe gegeben, ein netter Kerl zu sein, also stimmte er zu. Es stellte sich heraus, dass die Nichte ein Mädchen war, mit dem er in der Highschool geschlafen hatte, und so musste er eine Stunde lang mit ihr am Telefon über die alten Zeiten reden, bevor sie ihm eine lange Liste hirnrissiger Fragen zu seinen Interessen stellte. Seine Lieblings-Fernsehshow? (West Wing!). Lieblings-Drink für besondere Gelegenheiten? (Johnnie Walker Blue!)
Aufgrund des Mangels an Kunst und Unterhaltung erschien der Artikel auf der ersten Seite der Kunst-und-Unterhaltungs-Beilage, zusammen mit einem Farbfoto von ihm, wie er mit übergeschlagenen Beinen und im Schoß gefalteten Händen dasaß. Der ehemalige Einwohner unserer Stadt (und notorische Herzensbrecher!) Sam Statler zieht wieder zurück. Aber freuen Sie sich nicht zu sehr, meine Damen! Er ist verheiratet!
Annie heftete den Artikel an den Kühlschrank, sodass Sam sein großes, blöde lächelndes Gesicht jedes Mal sah, wenn er die Milch herausholte. Das Gesicht des zauberhaften einzigen Sohns, der wieder in seine Heimatstadt zieht, um sich um seine geliebte angeschlagene Mutter zu kümmern.
Das ist die große Ironie an der ganzen Sache. Er ist angeblich extra in diese beschissene kleine Stadt am Fluss zurückgezogen, um sich um die Mutter zu kümmern, die ihr ganzes Leben ihm gewidmet hatte, und nun kann er es nicht über sich bringen. Tatsächlich hat er seit drei Wochen keinen Fuß in Rushing Waters gesetzt.
Er nimmt einen tiefen Schluck Bier und gibt sich Mühe, nicht darüber nachzudenken, aber wie bei allen Abwehrmechanismen funktioniert auch Verdrängung nicht immer zuverlässig, und die Erinnerung an seinen letzten Besuch kommt ihm sofort wieder in den Sinn. Er sah die Verwirrung in ihrem Gesicht, als er die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, bemerkte die Augenblicke, die sie brauchte, um zu begreifen, wer er war. Ihre guten Tage wurden immer seltener; die meiste Zeit über war sie wütend und schrie das Pflegepersonal an. Er hatte ihr ihr Lieblingsmittagessen mitgebracht – Ziti mit Hackfleischbällchen von Santisiero’s auf der Main Street, der Filiale, die es schon seit zweiunddreißig Jahren hier gab. Sie aß ihre Portion ziemlich unmanierlich und stellte ihm immer wieder dieselben beiden Fragen. Um wie viel Uhr ist Bingo, und wo ist Ribsy? Er erklärte, dass Bingo jeden Mittwoch und Freitag um vier Uhr in der Freizeithalle stattfinde, und Ribsy, der Spaniel der Familie, sei schon 1999 tot umgefallen – in derselben Woche, der kleine Scheißer, in der Sam zum College aufgebrochen war, sodass sie vollkommen allein blieb.
«Du bist genau wie er, weißt du?», sagte Margaret wie aus heiterem Himmel.
«Wie wer?», fragte Sam und riss das harte Ende vom italienischen Brot.
«Was glaubst du denn? Wie dein Vater.» Sie ließ ihre Gabel sinken. «Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das für mich zu behalten, und jetzt kann ich das nicht mehr.»
Das Brot blieb in seiner Kehle stecken. «Wovon redest du, Mom?»
«Du weißt ganz genau, wovon ich rede, Sam. Du bist selbstsüchtig. Egozentrisch. Und du behandelst Frauen wie Scheiße.»
Er musste sich vor Augen führen, dass nicht sie es war, die da sprach, sondern ihre Krankheit. Aber selbst jetzt noch hat er Schwierigkeiten, das Bier herunterzubringen, wenn er an ihren angeekelten Gesichtsausdruck denkt. «Und willst du ein kleines Geheimnis erfahren?» Sie senkte verschwörerisch die Stimme. «Du wirst sie ebenfalls verlassen. Deine nette neue Frau. Du wirst genauso werden wie er.»
Er schob seinen Stuhl zurück und ging aus dem Zimmer, aus dem Gebäude, auf den Parkplatz. Als er wieder zu Hause war, sagte er zu Annie, dass es ihm nicht gut gehe, und ging direkt ins Bett. Sally French, die Leiterin des Altenpflegezentrums, hielt ihn bei seinem nächsten Besuch zwei Tage später im Flur auf und bat ihn, in ihr Büro zu kommen.
«Ihre Mutter spricht nicht mehr», erklärte sie von der anderen Seite des Schreibtisches aus. Sie versicherte, dass das vermutlich nur ein vorübergehendes Krankheitssymptom sei. Aber es war nicht vorübergehend. Tatsächlich sprach Margaret Statler nie wieder ein einziges Wort. Keiner ihrer Ärzte hatte vorausgesehen, dass der Mutismus («die Unfähigkeit zum oral-verbalen Ausdruck», wie es in ihrer Krankenakte hieß) so früh kommen würde. Im Laufe der nächsten Woche hatte Sam sie angebettelt, doch bitte zu sprechen – irgendetwas zu sagen, damit jene nicht ihre letzten Worte sein würden.
Aber sie hatte ihn nur mit leerem Blick angesehen, und ihre Anschuldigungen hingen schwer zwischen ihnen. Du wirst genauso enden wie er. Und so tat er, was er immer tat, wenn das Leben sich anders entwickelte, als er es wollte: Er ging fort.
Er weiß, dass das feige ist, aber seitdem war er nicht mehr bei ihr im Pflegeheim – ein kleines Detail, das er Annie verschwiegen hat – und vermeidet stattdessen den herzzerreißenden Anblick seiner Mutter, indem er im Auto sitzt, Bier trinkt und sich fragt, wie lange er noch bleiben muss.
Er wirft einen Blick auf sein Handy – sechsundsechzig Minuten – und dreht den Schlüssel im Zündschloss.
Gut genug.
Kapitel 4
Es ist offiziell. Ich bin zu Tode gelangweilt.
Es ist nicht so, dass ich mich nicht bemühen würde, denn das tue ich. Neulich, nachdem Sam nach unten zur Arbeit ging, zog ich mir etwas Vernünftiges an und fuhr zur Bäckerei, wo der Kaffee irgendwie verbrannt schmeckte und ich in der «Lifestyle-Boutique» nebenan eine Duftkerze mit Namen «Bookmobile» für achtunddreißig Dollar fand, und mehr musste ich nicht sehen. Chestnut Hill, New York: null Sterne.
Sam würde ich das natürlich nie sagen. Er ist hier gut angekommen, sein Business läuft bestens. Erst vor etwas über zwei Monaten hat er seine Praxis eröffnet, und schon sind seine Tage immer voller. Ehemalige New Yorker stehen Schlange, weil sie verzweifelt einen von ihnen brauchen, bei dem sie sich beschweren können. (Es schadet auch nicht, dass er so gut aussieht. Neulich ging ich durch die Gänge der Drogerie und hörte, wie eine Frau im Windelgang am Telefon über ihn sprach. «Er ist so süß, dass ich schon darüber nachdenke, eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, um einen Termin bei ihm zu bekommen.») Abgesehen davon freue ich mich für ihn. Bereits beim ersten Kennenlernen erzählte er mir, dass er schon seit einiger Zeit davon träume – von einem stillen Leben, einer Privatpraxis außerhalb der Stadt. Er hat es sich verdient. Seit er vor zehn Jahren seine Promotion über die Psychologie von Kindheitstraumata abgeschlossen hatte, arbeitete er in der Psychiatrischen Abteilung für Kinder im Bellevue-Krankenhaus – ein sehr herausfordernder und schwieriger Job.
Inzwischen fühle ich mich minderwertig, wenn ich den ganzen Tag hier im Haus herumhänge. Ich habe nichts zu tun, außer die Pflanzen zu gießen. Weshalb ich beschlossen habe, produktiver zu werden, von heute an. Heute werde ich das angehen, worum ich schon seit Wochen herumschleiche: Agatha Lawrences Arbeitszimmer, der Raum, in dem sie an einem Herzinfarkt starb und in dem all ihre persönlichen Unterlagen liegen.
Das war der Deal mit diesem Haus. Es wurde in dem Zustand übergeben, in dem es war, und wie die Anwältin erklärte, die das Erbe von Agatha Lawrence verwaltet, bedeutete das, «alle Möbel und alle anderen Gegenstände von der vorhergehenden Besitzerin des Hauses Cherry Lane 11» zu übernehmen. Ich hatte nicht gewusst, dass das sechs Aktenschränke mit der gesamten Familiengeschichte der Lawrences bedeutete, die bis ins Jahr 1712 zurückging, als Edward Lawrence Chestnut Hill gründete. Ich habe ein paar Mal den Kopf in das Zimmer gesteckt und mir gewünscht, die Art Mensch zu sein, die die Papiere einer toten Frau einfach so wegwerfen kann. Aber das bin ich nicht, und jedes Mal, wenn ich die Tür wieder schloss, verschob ich mein Vorhaben auf einen anderen Tag.
Auf diesen Tag.
Ich habe die Pflanzen in der Küche gegossen und trage meinen Tee durch den Flur. Ich wappne mich innerlich, bevor ich die Tür öffne. Das Zimmer ist klein und schlicht. Aus dem Fenster kann man in den Garten blicken, der von einem Buchsbaum dominiert wird, der dringend zurückgeschnitten werden müsste. Ich werfe einen Blick in den leeren Schrank und streiche mit den Fingern über die gelbe Tapete. Es ist eine interessante Farbe – Chartreuse-Gelb, und das Muster scheint sich aus sich selbst heraus zu wiederholen. Agatha Lawrence mochte leuchtende Farben, und ich habe überrascht festgestellt, dass sie mir ebenfalls sehr gefallen. Ich habe hier bisher kaum Veränderungen vorgenommen. Apfelgrüne Wände in der Küche, leuchtendes Blau im Wohnzimmer.
Ich höre ein Summen und sehe ungefähr ein Dutzend winziger Motten, die gegen das Fenster fliegen und hinauswollen. Ich gehe durchs Zimmer und öffne es, vorsichtig, damit ich die in der Mitte gesprungene Scheibe nicht zerstöre. Noch etwas, worum ich mich kümmern muss. Ich scheuche die Motten hinaus und sehe, dass Sams Auto weg ist. Er ist vermutlich im Gym, in das er in der Mittagspause oft geht. Er kommt dann immer mit nassem Haar wieder.
Ich schaue mich um und denke nach. Ich könnte das Arbeitszimmer zu einem Gästezimmer umwandeln, aber was sollte das bringen? Oben gibt es bereits drei unbewohnte Schlafzimmer, und wer sollte mich hier besuchen? Linda? Ich bezweifle sehr, dass irgendwer aus der Stadt sich von dem Einkaufszentrum und den Zusätzen zum Ein-Dollar-Menü im Wendy’s an der Route 9 hierher locken lassen würde.
Ich beschließe, die Frage zurückzustellen und mit den Papieren zu beginnen. Schnell begreife ich, dass diese Familie nichts so einfach weggeworfen hat. Originalgrundrisse des Lawrence House, entworfen von einem der seinerzeit renommiertesten Architekten. Zeitungsausschnitte, die bis ins Jahr 1936 zurückreichen, als Charles Lawrence ein Vertrauter Franklin D. Roosevelts war. Massenweise Skizzenbücher mit Zeichnungen stoischer Europäer, die mit durchgedrücktem Rücken auf der Veranda stehen. Die Familiengeschichte nimmt mich so gefangen – sie haben Millionen mit Erdöl und später mit Kunststoffen gemacht –, dass ich ein paar Minuten brauche, bevor ich das Geräusch bemerke, das aus einer der Kisten kommt, die ich in die Ecke des Zimmers geschoben habe.
Eine Stimme.
Ich höre auf zu lesen und lausche. Ich bilde mir das nicht ein. Jemand spricht.