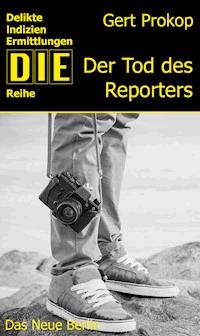Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lange genug hat Herbert Beyrich, der hochqualifizierte Computerfachmann, versucht, einen Job in der Branche zu kriegen. Seine Fähigkeiten sind unbestritten. Warum wird er abgewiesen in den Chefetagen der angesehenen Firmen? Finanziell ist er am Ende, sein Frust wächst. Da plant er den großen Coup, das perfekte Verbrechen! Sein Computer-know-how macht es möglich. Er wird ans große Geld kommen: unblutig, unspektakulär, sicher - todsicher! Gert Prokop (1932 - 1994) zeigt in seiner meisterlich erzählten, spannenden Kriminalgeschichte das bedrückende Bild einer überwachten Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
eISBN 978-3-360-50075-5
© 2014 (1986) Das Neue Berlin, Berlin
Covergestaltung:Verlag
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstraße 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Gert Prokop
Das
todsichere Ding
Das Neue Berlin
Haben Sie wenigstens schon eine Spur, Maurach?«
»Keine.« Der Kriminalrat schüttelte den Kopf. »Ich muß gestehen, daß ich in meiner langen und an Überraschungen weiß Gott nicht armen Laufbahn noch nie einen derartigen Fall hatte. Ich bin keinen Schritt weitergekommen. Vermutungen, nichts als Vermutungen. Keine Spur, kein Indiz. Vielleicht wollen Sie jemand anderen an die Sache setzen?«
»Nein, nein, mein Lieber!« Der Polizeipräsident lachte. »So leicht kommen Sie mir nicht davon.«
Er stand auf, trat an das Fenster und trommelte mit den Fingerspitzen an die Scheibe. Die Stadt war an diesem Herbsttag in eine dichte Schicht von Dunst und Smog getaucht, über der sich nur die Silhouetten der Hochhäuser klar abzeichneten, die Frankfurt den Spitznamen Mainhattan eingebracht hatten. Es dauerte lange, bis er sich umdrehte.
»Was ist mit dem Geld, Maurach?«
»Niemand scheint es zu vermissen.«
»Das ist ja ein tolles Ding«, sagte der Polizeipräsident. »Vier Millionen, die müssen doch irgendwo fehlen, verdammt noch mal!«
Erstes Kapitel
1.
Einmal war Herbert erster Klasse gefahren; daran erinnerte er sich heute noch ungern, mehr noch: Es hatte eine tiefe Narbe in seinem Unterbewußtsein hinterlassen. Er ertappte sich dabei, daß er den Abteilen den Rücken zudrehte, keinen Blick hineinwarf, während er seine schwere Tasche den Gang entlangschleppte, sich an zwei Männem vorbeidrängte, die auf dem Gang standen und rauchten und sich an die Abteilwand preßten, um ihn vorüberzulassen. Er grinste.
Wir alle tragen unsere Wunden mit uns herum, dachte er. Schon von Kindesbeinen an, hatte Perlmoser erklärt, es sei nur eine Frage der Zeit und der Umstände, wann die Verletzungen der Seele sich in einer Psychose manifestierten.
Er mußte ein halbes Dutzend Wagen passieren, bevor er, fast schon am Ende des Zuges, einen Platz in einem Nichtraucherabteil fand. Er ignorierte die Blicke der anderen Reisenden, die ihn wie einen Eindringling musterten, holte das Buch aus der Tasche, das er in Kassel auf dem Bahnhof erstanden hatte, wuchtete die Tasche ins Gepäcknetz, legte den Aktenkoffer dazu, den Mantel, setzte sich, steckte die Beine vorsichtig zwischen die seines Gegenübers, eines alten Mannes mit mürrischer Unterlippe, der unwillig seine Knie anwinkelte, und schlug das Buch auf. Er kam nicht über die ersten Seiten hinaus, dabei zählte Chandler zu seinen Lieblingsautoren, doch heute konnte nicht einmal der berühmte Philip Marlowe die wirren Gedanken vertreiben, die durch sein Gehirn kreisten.
Er blickte zum Fenster hinaus. Der Himmel war grau verhangen, auf den Feldern lagen nur noch vereinzelte, schmutzige Schneebatzen. Die Dämmerung setzte schon ein, doch der Winter schien endgültig vorbei. Er lehnte den Kopf an, schloß die Augen, spürte, wie tiefe Mattigkeit Besitz von ihm ergriff, ein Gefühl aussichtsloser Verlorenheit; eine Erinnerung tauchte auf: der Wald von Lemmingen, herbstlich kahle Stämme, gespenstisch in ihrer feuchten Nacktheit, knietiefes Laub, urplötzlich ringsum Nebelschwaden, die ihn einkreisten, einfingen, gefangenhielten – verloren allein, nirgends ein Laut, nur seine Schreie. Vier Jahre alt mußte er damals gewesen sein. Oder erst drei? Vor Erschöpfung wimmernd, hatte er sich schließlich an einen Baumstamm gehockt und war eingeschlafen. Irgendwann, die Nacht war schon hereingebrochen, hatte Vater ihn gefunden. Und nicht gestreichelt. Geohrfeigt.
Eine irrationale Angst erfaßte ihn, ließ ihn frösteln. Er kämpfte nicht gegen sie an, er ließ sich in das schwarze Loch einer alles umfassenden Sinnlosigkeit fallen, schlief ein.
Jemand stieß an sein Knie, entschuldigte sich laut, Herbert schlug verwirrt die Augen auf. Bis auf die Frau die ihren Mantel auszog und an den Haken am Fensterplatz hängte, war das Abteil leer. Ein leichter Ruck drückte ihn in den Sitz. Er warf einen Blick aus dem Fenster: Frankfurt!
Er sprang auf, zerrte die Reisetasche aus dem Gepäcknetz, den Aktenkoffer, den Mantel, hetzte hinaus. Die Tür schloß sich mit metallischem Schmatzen hinter ihm, der Zug fuhr langsam, fast unhörbar an. Er stand regungslos und blickte den Schlußlichtern nach, bis der Zug in der Kurve am Bahnpostamt verschwand; erst als die abgekoppelte Lokomotive an ihm vorüberzog, schreckte er auf. Er holte sich eine Karre, stellte das Gepäck hinauf und schob sie mit müden Schritten den langen, leeren Bahnsteig entlang. Als er in die abendliche Fülle am Kopf des Bahnhofs tauchte, wurde er munter, sogar vergnügt. Er dirigierte die Karre zum nächsten Büfett und ließ sich einen Becher Kaffee geben stellte sich an einen der Stehtische und beobachtete das Gewimmel rundum.
Wie lange hatte er nicht mehr hier gestanden? Er liebte die Atmosphäre des Bahnhofs. Dieses Bahnhofs. Seit seiner Kindheit zog sie ihn an. Wie viele Stunden hatte er hier verbracht, verheimlichte, gestohlene Stunden, in denen er angeblich mit Bolle zusätzliche Übungen in Mathe machte, ausgerechnet er! Aber mathematischer Eifer, das war ein Grund, den Vater immer akzeptierte, Vater. – Es war unsinnig, geradezu hirnverbrannt, schon heute nach Frankfurt zu fahren, wo doch das Zimmer noch für drei Tage bezahlt gewesen war. Geflüchtet, überstürzt aufgebrochen, ohne nachzudenken dem Drang nachgegeben: fort, fort! Niemanden mehr sehen keine Fragen beantworten müssen, keinen wohlmeinenden Zuspruch hören, keine Tips empfangen, keine Angebote, für ein paar Tage oder gar Wochen kostenlos einwohnen zu dürfen, und etwas zu essen wurde sich allemal finden – fort, fort! Das verwundete Tier schleppt sich immer in seine Höhle zurück …
Nein!« sagte er laut, so laut, daß der Türke, der sich mit einer Currywurst in der Hand seinem Stehtisch näherte, ihn erschrocken ansah, den Kopf zwischen die Schultern zog, eilfertig ein verlegenes Lächeln aufsetzte und sich zum Nebentisch wegdrehte.
»Nein«, sagte Herbert noch einmal, betont freundlich dieses Mal, auffordernd, er tippte dem Mann sogar auf die Schulter und zeigte einladend auf den Tisch. »Ich habe nicht Sie gemeint. Bitte.«
Der Türke zögerte, setzte schließlich seinen Pappteller auf die Tischplatte, nahm die Wurst und biß ab. Herbert lächelte ihm zu. Eine Nuance zu stark, fand er. Die Übertreibung der Unsicherheit. Was ging ihn dieser Mann an, was scherte es ihn ob der ihn für einen Fremdenhasser, einen Türken-’raus-Mann halten mochte? Was zwang ihn zu dieser übertriebenen Freundlichkeit, war es am Ende unterbewußte Ablehnung, tiefverwurzelte Abneigung gegen alles Fremde, mit der Muttermilch und den Vatersprüchen eingesogene Verachtung? Egal. Er wollte in keiner Minute und von niemandem zu jenen Dummköpfen gezählt werden, die er aufs tiefste verachtete. Er holte zwei Becher Kaffee und stellte einen dem verwundert aufblickenden Türken hin. Und haßte sich dann, weil er Wut in sich aufsteigen fühlte, als der andere den brühheißen Kaffee ungeniert schlürfte, ihn immer wieder anlächelte. Herbert war froh, daß sein Gegenüber offensichtlich so schlecht deutsch sprach, daß er es gar nicht erst versuchte. Und erleichtert, als er endlich wieder allein an seinem Tisch stand. – Wie viele Becher Cola mochte er hier getrunken haben, Dosen gab es damals noch nicht, wie viele Zigaretten geraucht, bevor er dann widerwillig nach Hause fuhr … Nein, er würde nicht in die Marburger Straße gehen, auf keinen Fall heute, er könnte sich unmöglich Vaters Fragen aussetzen, diesen erbarmungslos bohrenden, höhnischen Fragen, nicht Mutters flehenden, hilflosen Blicken oder, noch schlimmer, gar einer jovialen, alles verzeihenden Geste, weit geöffneten Spinnenarmen, die ihn willenlos machen; in das heimische Netz ziehen sollten – nein, die Heimkehr des verlorenen Sohnes fand nicht statt!
Er nahm den letzten, schon kalt gewordenen Schluck Kaffee, fuhr in die Passage hinunter und verstaute sein Gepäck in einem Schließfach, dann trat er in eine der Telefonzellen, stapelte Groschen auf den Apparat, holte seinen Taschenkalender hervor und wählte. Niemand meldete sich, auch nicht bei der zweiten, der dritten Nummer. Die Stadt schien sich ihm verschlossen zu haben. Erikas Nummer hatte einen neuen Besitzer, der wütend auf den Anruf reagierte, Bolle, so erfuhr Herbert, lebte jetzt in Hamburg, Kutte hatte einen Job in Südafrika; sein Vater wollte Herbert umständlich erklären, wie gut er es dort getroffen habe und daß sie ihn demnächst besuchen würden, stellen Sie sich vor, Herbert, nach Südafrika … Er legte einfach auf. Mußte er doch in die Marburger Straße? Vielleicht konnte er bei Maria unterkriechen, wenigstens für diese Nacht.
Maria wohnte nicht mehr zu Hause, und ihre Mutter sagte mit weinerlicher Stimme, sie wisse ihre Adresse nicht, ja, in Frankfurt sei sie wohl noch, aber … Herbert mußte einen Schwall von Klagen über sich ergehen lassen, er hörte nicht zu; hielt den Telefonhörer ein Stück vom Ohr ab, wartete, bis das Wehklagen verebbte, in ein Schluchzen mündete, bevor er sich erkundigte, ob sie denn nicht wenigstens einen Hinweis habe, wo er Maria finden könne, es sei wichtig. Auch für Maria, so beteuerte er.
»Ach, Herbert«, sagte sie seufzend, »ich weiß doch nichts, ich – versuchen Sie es in der Kolibri-Bar, vielleicht …«
2.
Das Kolibri war keine Bar, sondern eine Diskothek an der Grenze des Bahnhofsviertels. Auf der einen Seite der Straße beherbergte jedes Haus eine Striptease-Bar, eine Peep-Show oder ein Eros-Center, auf der anderen Seite gab es nur Läden, Restaurants, Bierkneipen. Das Geschäft schien flau, wenige Männer flanierten die Straße hinunter, betrachteten die unverhüllt pornographischen Fotos in den Nachtauslagen der Show-Fenster, die Schlepper stürzten sich auf sie, versuchten, sie mit den angeblich sensationellsten Darbietungen Europas in ihr Etablissement zu locken, wenigstens auf einen Blick, ganz unverbindlich, einer packte Herbert am Ärmel, wollte ihn in die Tür bugsieren, aus der auf modern getrimmte klassische Musik tönte, die seit ein paar Jahren beliebte Backgroundmusik der Sex-Shows; die Vorstellung habe soeben angefangen, sagte er und versprach Herbert zu Mozarts Kleiner Nachtmusik alle Schweinereien, die er sich nur denken könne, und einige, an die zu denken er noch nicht einmal gewagt hätte, sogar eine Frau mit drei Brüsten verhieß er, die es in wenigen Minuten auf der Bühne mit drei Männem zugleich treiben würde; Herbert schüttelte ihn lachend ab und wechselte auf die andere Straßenseite, um von hier aus das Kolibri ausfindig zu machen. Er hoffte inständig, daß es nur eine Bar sein würde, daß er Maria nicht als Darstellerin in einer Porno-Show oder in einem Puff entdecken mußte.
Unversehens stand er vor dem Kolibri. Da er ganz auf die andere Straßenseite fixiert war, hätte er die Diskothek vielleicht übersehen, aber die überlaute Stimme von Janis Joplin erfaßte ihn, ihr heiser geröhrtes Bye-bye, Baby ließ ihn aufblicken, direkt vor seiner Nase leuchtete es kardinalsrot Kolibri.
Eine Kellertreppe, die nur Nüchterne fehlerfrei bewältigen konnten, zwei gewalttätig aussehende und bestimmt zu jeglicher Gewalt fähige Türsteher; zehn Mark Eintritt in die winzige Öffnung einer Panzerglasscheibe geschoben, dann empfing ihn eine ohrenbetäubende Dunkelheit, Wände aus rohem Beton, der die Musik erbarmungslos zurückschleuderte, schmerzhaft verstärkte, ein Schlachtgetöse, in dem Janis Joplin jeden Augenblick unterzugehen drohte, irritierend flimmerndes, im Takt der Musik die Farben wechselndes Licht, von sich drehenden Glitzerkugeln über die Decke, die Wände, die Tanzenden gestreut, eine wogende, fließende, zuckende Masse, die ihn an die unheimlichen Plasmagebilde utopischer Filme erinnerte, neben den Hi-Fi-Batterien des Diskjockeis ein erhöht aufgestellter, angestrahlter Riesenkäfig, in dem ein Mädchen den Rhythmus interpretierte, ein ausgesucht schönes Mädchen, bis auf einen goldenen Minislip nackt, dafür auf dem Kopf einen wallenden bunten Federbusch.
Herbert wollte sich an der Wand entlang zur Bar durchschlängeln, aber hier hallten die Schallkanonaden noch brutaler, er schob sich lieber zwischen die Tanzenden, da erblickte er Maria. Auch sie in einem Käfig, links neben der Tür, durch die er gerade gekommen war. Er drängelte sich in ihre Nähe, doch sie warf keinen Blick in den Saal, schien völlig der Musik hingegeben, tanzte mit fast geschlossenen Augen; Herbert war fasziniert von der Schönheit ihrer zauberhaft fließenden, allem Irdischen entflohenen, aller Welt entrückten Bewegungen. Er sah ihr anderthalb Tänze lang zu, dann drängelte er sich zur Bar durch und schwang sich auf einen frei gewordenen Hocker.
»Haben die Go-Go-Girls auch mal Pause?« fragte er.
»Die sind nicht zu haben«, antwortete die Bardame mit einem Blick, der andeutete, sie sei zu haben.
»Ich will Maria sprechen«, sagte er. »Wir sind alte Kumpel, noch von der Penne.« Die Bardame sah auf die Uhr.
»In fünfzehn Minuten ist Wechsel«, erklärte sie. Herbert bestellte ein Bier, ein kleines.
»Pleite?« fragte sie. Herbert nickte. Sie stellte ihm ein großes Bier hin. »Geht schon in Ordnung«, sagte sie, als er protestieren wollte. Herbert überlegte, ob er am Ende bei ihr für diese Nacht unterkriechen könne. Warum nicht, dachte er. Sie lächelte ihm zweimal zu, während sie sich mit einem Gast unterhielt, dem man auf den ersten Blick seinen Job ansah; so liefen in Frankfurt nur die Zuhälter herum: an jedem Finger ein protziger Ring, weißer Leinenanzug mit messerscharfer Bügelfalte, dazu ein blauschwarzes Hemd, dessen übergroßer, weit offener Kragen eine behaarte Brust und eine Goldkette blicken ließ. Die Musik setzte aus die Mädchen kletterten aus den Käfigen, entzaubert, müde, verschwitzt, ihr maskenhaftes Lächeln konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie erschöpft sie waren. Maria blickte erstaunt auf, als Herbert sie ansprach.
»Du, Bert? Wie kommst du hierher?«
»Deine Mutter gab mir den Tip.«
»Ach so …« Sie lächelte verlegen. Ein Betrunkener legte seine Hand auf ihre Schulter, Maria schüttelte sie ab ohne sich umzudrehen. Herbert rutschte vom Hocker, bot ihr den Platz an. Sie schüttelte müde den Kopf.
»Ich muß in die Garderobe«, sagte sie. »Duschen. Und ausruhen. Bleibst du länger in Frankfurt?«
»Wahrscheinlich. Sag mal – kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Ich will nicht zu meinen Eltern, verstehst du?«
»Versteh ich.« Maria nickte. »Ja, das geht. Aber ich muß noch bis zwei jobben.«
»Ich hole dich ab. Ich gehe solange spazieren.«
»Abgebrannt?«
»Das auch. Aber hier ist es mir zu laut, außerdem habe ich Lust, wieder mal durch die Stadt zu latschen.«
Die Bardame winkte ab, als Herbert bezahlen wollte.
»Kommst du mal wieder?« fragte sie.
»Bestimmt«, versprach er.
Herbert wartete auf der Straße. Er fröstelte. Er hatte sich nicht getraut, nachts mit dem Gepäck durch das Bahnhofsviertel zu gehen. Maria mochte nicht reden. Morgen, erklärte sie, morgen hätten sie noch genug Zeit zum Quatschen. Sie war völlig apathisch, nur einmal wurde sie munter, als Herbert seine Sachen aus dem Schließfach holte und hinter der dicken, abgeschabten Reisetasche der elegante Aktenkoffer zum Vorschein kam. Sie blickte Herbert prüfend an; als er nicht reagierte, kroch sie wieder in sich zusammen und trottete neben ihm her. Sie merkte nicht einmal, daß er am Zeitungskiosk stehenblieb und sie erst kurz vor der Rolltreppe wieder einholte.
»Du«, sagte sie dann, als sie im Taxi saßen, »ich wohne nicht allein.«
»Gibt es Probleme, wenn du mich mitbringst?« fragte er erschrocken.
»Nein. Eine Freundin. Ruth …«, Maria ließ die Stimme schweben, sagte dann aber doch nichts mehr, sondern kuschelte sich an ihn.
Ruth murrte nicht, als Maria sie sanft rüttelte, ihr sagte, sie solle sich vorne hinlegen; sie rappelte sich aus dem Bett, tapste schlaftrunken zur Tür, ein Gegenstück zu der blassen, eher üppigen Maria; knabenhaft schlank und trotz des Winters am ganzen Körper nahtlos braun. Maria trug ihr das Deckbett nach. Herbert blieb an der Tür stehen und sah sich um.
Ein Zimmer in dem er sich sofort wohl fühlte: Trotz der schrägen Fensterwand wirkte es groß. Weiß gestrichene Wände, helle Gardinen, preiswerte Segeltuchsessel, einfache Holzregale voller Bücher und Schallplatten und Krimskrams aus zwei Jahrhunderten: Uhren und Vasen, Schalen und Nippes, ein Elfenbeinfächer, eine stark lädierte hölzerne Madonna, an der Wand zwei Grafiken und ein abstrakter farbiger Druck, nur die als Doppelbett zurechtgemachte Liege irritierte ihn, sollten die beiden …? Maria kam zurück, warf eine Decke auf den Platz, von dem sie soeben die Freundin verscheucht hatte, sah, daß Herbert den Aktenkoffer immer noch in der Hand hielt, lachte.
»Nun zier dich mal nicht«, sagte sie, »das ist schon okay. Die erste Tür rechts auf dem Flur ist das Bad. Ich hau mich gleich hin.« Sie warf die Kleider über einen Stuhl und kroch nackt ins Bett; ihre Atemzüge verrieten, daß sie bereits eingeschlafen war, als Herbert anfing sich auszuziehen.
3.
Er erwachte mit einem Gefühl tiefen Wohlbehagens, einem Gefühl, das er schon lange nicht mehr beim Erwachen gehabt hatte: Geborgensein. Er zog die Decke bis an die Augen, kauerte sich zusammen, atmete tief. Sich schlafend stellen, warten, bis Mutter an das Bett trat, ihr Duft sie verriet, ihre Finger zärtlich über sein Haar streichelten. – Es roch nach Kaffee und einem Duft, der nicht Mutters Seife war und nicht Kölnischwasser. Er schlug die Augen auf. Maria stand in der Tür.
»Steh auf, du Faulpelz«, sagte sie. »Wenn ich mir schon einen schnarchenden Schlummergast aufhalse, dann will ich wenigstens etwas davon haben und nicht allein frühstücken.«
In der Küche erwartete ihn ein einladend gedeckter Tisch, ein Idyll wie aus einem Familienblatt: Blumen, ein Korb voller duftender Hörnchen, zweierlei Marmelade, Honig, Butter, ein Teller mit Schinken, ein Teller mit Käse, Milch, Kaffee; Maria stellte gerade braungefleckte Eier in hölzerne Becher, Herbert reckte sich genüßlich.
»Warum«, sagte er, »warum bin ich nicht schon eher zu dir gekommen?« ·
»Weil du ein Dummkopf bist«, sagte sie freundlich. »Aber nun bist du ja da. Warum eigentlich? Was ist los mit dir?«
»Nichts.«
»Und wegen nichts erinnerst du dich nach Jahren plötzlich wieder an mich?«
»Ich will dir nichts vormachen«, sagte er, »ich brauchte eine Bleibe, das war alles. Obwohl, seit ich dich gestern tanzen gesehen habe …«
»Hat es dir gefallen?« fragte sie leise. Sie sah ihn an, ein wenig ängstlich, so schien es ihm, als ob von seinem Urteil tatsächlich etwas abhinge.
»Du warst sehr schön«, sagte er. »Märchenhaft schön. Es war wie eine Szene in einem surrealistischen Film: Finsternis und Höllenlärm, die brutalen Betonwände, die zuckende dunkle Masse, von Irrlichtern gefangen, und darüber in einen Käfig gesperrt, doch ungebrochen, die Verkörperung alles Schönen, aller Hoffnung, aller Sehnsüchte …«
»Danke schön!« Maria reckte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen flüchtigen Kuß. Herbert faßte sie an den Schultern, da legte sie den Kopf an seine Brust. »Schön, daß du wieder da bist«, flüsterte sie.
»Ach, Maria«, sagte er, »du weißt doch, wir beide …«
»Wir waren zu jung«, sagte sie. »Viel zu jung. Und zu dumm.«
Er wußte nicht, was er sagen sollte. Er streichelte ihren Rücken, spürte ihre glatte Haut unter dem dünnen Stoff des Morgenmantels, spürte das Verlangen in sich aufsteigen, seine Hände tiefer gleiten zu lassen, sie an sich zu drücken, in das Zimmer hinüberzuziehen und mit ihr zu schlafen, und zugleich fühlte er Abwehr. Nicht noch einmal, dachte er. Nicht der Versuchung nachgeben. Es war nicht nur jugendliche Unerfahrenheit.
»Der Kaffee wird kalt«, sagte er leise und drückte ihr einen Kuß auf die Stirn. »Und ich habe einen Mordshunger.«
Sie frühstückten schweigend. Ein wohltuendes, freundliches Schweigen. Die Sonne war über die Dächer gestiegen, leuchtete Fenster und Tisch aus, durch die offene Tür drang Jacques Loussiers sanfte Version Bachscher Präludien, ab und zu begegneten sich ihre Blicke, und Maria lächelte. Spötttsch, erwartungsvoll, sicher? Vielleicht sind wir wirklich nur zu jung gewesen, dachte er. Maria war noch schöner als damals, und sie schien reifer geworden – auch verständnisvoller? Nicht mehr so egozentrisch, so maßlos intolerant und rechthaberisch? Maria unterbrach das Schweigen.
»Was willst du eigentlich in Frankfurt?«
»Mich bewerben. Bei der Unicomp. Und zu meinen Eltern will ich, wenn möglich, nicht.«
»Bleib, solange du willst«, sagte sie. »Wäre das ein guter Job?«
»Ein sehr guter. Unicomp liegt in der Spitzengruppe. International! Wenn es stimmt, was ich gehört habe, können sie auf dem Gebiet der Informatik und in der Mikroelektronik mit den Amis konkurrieren. Dort wird die Welt von morgen entwickelt.«
»Die Welt der Computer!« Es war nicht zu überhören, wie wenig Maria davon hielt.
»Du trägst wohl auch einen Button an der Jacke: »Computer – nein, danke!« sagte Herbert belustigt. »Ob ihr es wollt oder nicht, das ist die Zukunft. Und ich will dabeisein. Auf einer besonders interessanten Strecke: künstliche Intelligenz.«
»Immer macht nur«, erwiderte Maria. »Auch Computer und Roboter schaffen uns nicht die Probleme vom Hals, im Gegenteil, sie schaffen nur neue, das sieht doch ein Blinder.«
»Kein Mensch weiß, was wirklich auf uns zukommt«, sagte er unwillig. »Wir stehen erst ganz am Anfang der Entwicklung. Wir leben in einer Situation wie kurz nach der Erfindung des elektrischen Stroms: Die meisten Erfindungen werden erst noch gemacht. Eine Revolution, die alles umkrempeln wird. Tausende von neuen Produkten, von denen wir nicht einmal etwas ahnen; noch in unserem Jahrhundert wird die Hälfte aller Arbeitsplätze radikal verändert …«
»Oder vernichtet«, sagte Maria. »Rund sieben Millionen Arbeitsplätze werden in den nächsten zehn Jahren verlorengehen. Hat das Bundesforschungsministerium vorausgesagt.«
Herbert feixte.
»Vor zweitausend Jahren«, sagte er, »hat sich der römische Kaiser Vespasian gegen die Verwendung der Wasserkraft ausgesprochen. Weil dadurch Arbeitslosigkeit entstehen würde. Wußtest du das?«
»Nein«, gestand Maria.
»Sicher, alles wird sich ändern. Warum auch nicht? Findest du die Welt in Ordnung, so wie sie ist? Du warst doch immer unsere große Umstürzlerin. Revolution? Ja, aber technische Revolution. Man ändert die Welt nicht durch politische Programme.«
»Sondern durch Computerprogramme?«
»Die Computer haben die Welt schon mehr verändert als alle Politiker.«
»Du zweifelst wohl nie an deinem Fortschritt?«
»Zweifel ist ein notwendiger Bestandteil jeder Wissenschaft«, erklärte er lachend. »Ohne Fragen kein Fortschritt, ohne Zweifel keine Fragen. Das ist von Nobelpreisträger Feynmann. Oder wenn du es lieber von Marx hättest – auf eine Umfrage nach seinem Lieblingsmotto antwortete er: ›An allem ist zu zweifeln.‹«
Maria goß Kaffee nach. »Was mich an deinesgleichen stört«, sagte sie, »ihr definiert Fortschritt immer nur als wissenschaftlich-technische Entwicklung. Euer Fortschitt hat längst unmenschliche Dimensionen angenommen, er macht den Menschen kaputt. Der Mensch sollte das Maß aller Dinge sein – schon mal gehört?«
»Okay, okay.« Herbert hob die Hände. »Aber das ist nicht mein Job. Eher deiner, du bist Soziologin.«
»Mir scheint, du hast genau die richtige Einstellung für eine steile Karriere bei Unicomp.«
»Und, was noch wichtiger ist, eine Empfehlung von Reinholdt, dem Göttinger Mathe-Papst. Diesmal wird es klappen.«
»Und wenn nicht?«
»Ja, dann …« Er zuckte mit den Schultern. »Ein Arbeitsloser mehr. Und ein Obdachloser. Ich wäre gewiß nicht der einzige Stadtstreicher mit Staatsexamen. Oder …« Herbert griff zum Messer, köpfte sein Ei mit einem schnellen Schlag, sah Maria spöttisch an, »oder ich werde Millionär.«
»Millionär?« Maria lachte laut auf. »Warum wirst du es nicht gleich? Millionär ist kein so schlechter Job, finde ich.«
»Ein schmutziger«, erwiderte er. »Zumindest bis man die erste Million zusammen hat. Auf ehrliche Weise ist da nichts zu machen.«
»Willst du Banken ausrauben? Mit Strumpfmaske und Pistole? Bert Beyrich als Gangster!«
»Nicht mit Gewalt. Wenn, dann nur mit Hilfe meiner kleinen grauen Zellen.« Er tippte sich an die Stirn. »Aber ich habe leider Hemmungen. Ich bin halt zu gut erzogen. Ein Opfer der sprichwörtlichen Erziehung meines Vaters. Du kennst doch meinen Alten.« Er ahmte die Stimme seines Vaters nach. »Mein Sohn, die durch Jahrhunderte bewährte Weisheit unseres Volkes steckt in diesen urdeutschen Sprüchen: Ehrlich währt am längsten! Lügen haben kurze Beine! Wer andern eine Grube gräbt … Die über Jahrhunderte bewährten Sprüche zur Disziplinierung der Untertanen.«
»Es heißt aber auch: Jeder ist sich selbst der nächste«, warf Maria ein. »Schade. Ich wollte dir gerade meine Partnerschaft antragen, ich wäre auch gerne mal Millionär. Kannst du deine unpassende Erziehung zur Ehrbarkeit nicht doch überwinden? Mir zuliebe?«
»Kann ich.« Herbert lehnte sich zurück. »Wir brauchen aber ein bißchen Startkapital. Wenn ich schon die schiefe Bahn betrete, dann nur für einen Millionen-Coup. Du hast bestimmt Hunderttausend auf deinem Konto.«
»Klar«, sagte sie. »Ich jobb nur aus Spaß in dem Diskoschuppen.«
»Wie bist du eigentlich da gelandet? Hast du das Studium geschmissen?«
»Nein, ich habe das Staatsexamen gemacht. Nur den Doktor habe ich mir geschenkt, als ich mitbekam, wie der Hase lief. Soziologie, der Schlüssel zur Vermenschlichung der Arbeit!«
Sie lachte bitter. »Hast du mal was von Hörnemann gelesen? Ich habe ihn vergöttert. Er ist ja auch ein Gott: Er schwebt über allen Wolken. ›Die Probleme der modernen Industriegesellschaft sind nur noch mit Hilfe der Soziologie zu bewältigen.‹ Daß ich nicht kichere. Die Gesellschaft braucht uns nicht und die Industrie schon gar nicht«
»Okay«, sagte er, »ihr habt Illusionen gehabt und seid auf die Schnauze gefallen, aber …«
»Die Industrie hat ihren Chefsoziologen gefunden«, unterbrach Maria heftig, »Doktor Arbeitslos. Der macht sogar die Kranken gesund. Du, ich habe eine Untersuchung über die Entwicklung des Krankenstandes in drei großen Unternehmen gemacht – die Industrie braucht keine Soziologen mehr. Die weiche Welle ist vorbei.« Sie nahm sich eine Zigarette, Herbert gab ihr Feuer.
»Bist du denn so spezialisiert, daß du nichts anderes machen kannst?«
»Wir haben nicht nur einen Butterberg und einen Schweineberg«, sagte sie heftig, »wir haben auch einen Soziologenberg! Nur, den kann man nicht durch Export in die Sowjetunion abtragen.«
»Ich weiß«, sagte Herbert. »Aber das geht nicht nur euch Soziologen so, auch den Psychologen und Politologen. Zu viele Lehrer und Biologen, Ingenieure und Juristen, Chemiker und Physiker, sogar Ärzte und Mathematiker.«
»Auch Informatiker?«
»Nein, Informatiker werden gesucht. – So ist es eben: Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt. Wir haben fünf Prozent Hochschulabsolventen zuviel.«
»Fünf Prozent – das klingt richtig harmlos. Viel harmloser als hunderttausend.«
»Trotzdem, Maria, wenn man sucht …«
»Ich habe es versucht«, unterbrach sie wütend. »Monatelang. Und nicht nur in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend von Bewerbungen ich geschrieben habe; das einzige, was ich bekommen konnte, war eine Stelle bei der Stadt, Drogenberatung, aber ich habe das nicht ausgehalten. Ich bin nicht hart genug dafür. Hast du mal mit zwölfjährigen Fixern gesprochen, mit Kindern, die auf den Strich gehen, um sich ihren Schuß kaufen zu können? Ich bin kein Missionarstyp. Da gehe ich lieber als Go-Go-Girl. Ich habe doch schon immer gerne getanzt.« Sie sog hastig an der Zigarette, starrte aus dem Fenster, sah plötzlich hart und alt aus, Herbert bemerkte es voller Verwunderung. Und voller Mitleid. Maria drückte ihre Zigarette aus: Herbert griff über den Tisch, packte ihre Hand, drückte sie.
»Es tut weh, dir zuzuhören. Du sprichst wie eine alte Frau, die sich mit ihrem Leben abgefunden hat. Du warst immer so voller Pläne, voll wunderbarer, verrückter Ideen. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb in dich verguckt. Weißt du noch, wie wir die Pauker einschilderten?«
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, machte es wieder jung. In der Tat, eine verrückte Idee, von der noch lange an der Schule gesprochen wurde. Zum Glück war nie herausgekommen, wer in dem kleinen Siedlungsviertel alle Ausfahrtstraßen mit Verbotsschildern versehen hatte, so daß die vier Pauker, die dort wohnten, morgens fluchend herumirrten und, da sie sich nicht wie andere getrauten, einfach ein Verbotsschild zu überfahren, vergeblich nach einem Weg aus dem Viertel suchten und zu spät zur Schule kamen. Marias Heiterkeit verflog so schnell, wie sie gekommen war.
»Kindereien«, sagte sie, aber es lag Wehmut in ihrer Stimme.
»Du warst immer eine der Besten«, sagte er unbarmherzig, »und jetzt? Du kannst dich doch nicht einfach aufgeben!«
»Wenn ich tanze«, sagte sie, »dann vergesse ich alles. Ich bin glücklich. Und ich verdiene nicht schlecht dabei.«
»Aber das kann goch nicht alles sein! Gerade du, mit deinen Träumen …«
»Träume!« sagte sie verächtlich. Sie blickte auf die Uhr. »Ich muß in die Stadt. Kommst du mit?«
»Wenn du zehn Minuten warten kannst«, sagte er. »Ich muß mich erst verkleiden, sonst läßt mich schon der Pförtner nicht durch.«
Maria staunte nicht schlecht, als sie den »verkleideten« Herbert sah: in tadellosem Anzug, mit Weste, Krawatte und passendem Kavalierstuch, in der Hand den Aktenkoffer, unter dem Arm die Frankfurter Allgemeine, ein junger, dynamischer, durch und durch seriöser Busineßman.
»Na, wenn du da den Job nicht bekommst!« rief sie. »Ich würde dich vom Fleck weg engagieren.«
»Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück«, sagte er lachend.
Maria brachte Herbert zum Unicomp-Gebäude, vor dem Eingang zupfte sie noch einmal an seiner Krawatte, musterte ihn, nickte zufrieden, spuckte symbolisch über seine Schulter.
»Ich drücke dir die Daumen«, sagte sie. »Du bist viel zu schade, um Gangster zu werden.«
»Falsch«, erwiderte Herbert. «Ich bin gerade dabei, mich bei den größten Gangstern in dieser Branche zu bewerben.«
4.
Vom Himmel hoch, da komm ich her … Herbert pfiff es leise vor sich hin, leise, aber übermütig vergnügt und äußerst zufrieden; und er merkte erst, was er da pfiff, als die beiden Männer im Lift ihn verwundert ansahen, zwei Computer-Freaks in seinem Alter, vielleicht bald schon seine Kollegen, sie trugen beide die Plastikkarte mit ihrem Paßbild am Revers, die sie als Mitarbeiter der Unicomp auswies, und die unterschiedlichen Farben ihrer Ausweise bedeuteten mit Sicherheit, daß sie zu unterschiedlichen Abteilungen des Konzerns Zugang hatten. Herbert brach sein Lied nicht ab. Gewiß, Weihnachten war lange vorbei, aber kam er nicht tatsächlich »vom Himmel hoch«? Aus der Chefetage im 27. Stockwerk.
Zuerst hatte die Sekretärin ihn nicht einmal zum Personalchef vorlassen wollen; er solle sich schriftlich bewerben, doch schließlich hatte Herbert sie üperreden können, wenigstens das Empfehlungsschreiben von Professor Reinholdt hineinzubringen und um einen Termin für eine persönliche Vorsprache zu bitten. Dann ging es sogar auf der Stelle, fast auf der Stelle. Natürlich hatte Herbert warten müssen, eine gute halbe Stunde, die Schamfrist, unter der es ein vielbeschäftigter Manager nun einmal nicht machte. Manteufel hatte ihn äußerst freundlich empfangen, offensichtlich war Reinholdt ihm ein Begriff, und was in Kassel nicht geholfen hatte – vielleicht gerade weil es eine Empfehlung von Reinholdt war, was wußte er von den Rivalitäten zwischen den Kapazitäten, was, ungeachtet aller Lobsprüche, in Kassel von den Göttingern und Hamburgern gehalten wurde? –, hier öffnete es ihm die Türen. Manteufel hielt sich nicht lange mit Herbert auf, er blätterte seine Papiere durch, den Lebenslauf las er, ebenso das Verzeichnis, welche Vorlesungen und Seminare Herbert absolviert hatte, dann schickte er ihn zum Chef der Entwicklungsabteilung, der Herbert in ein langes fachliches Kreuzverhör nahm. Als er zurückkam, erkundigte sich Manteufel noch nach seinen Gehalts- und Urlaubsforderungen.
»Sechzigtausend und dreißig Tage Urlaub«, sagte Herbert, ohne mit der Wimper zu zucken, und Manteufel schien das durchaus für angemessen zu halten; Herberts Angebot, für jeden zusätzlichen Urlaubstag auf tausend Mark zu verzichten, lehnte er ab.
»Vielleicht später«, sagte er, »wenn Sie eine Weile hier sind.«
»Die Arbeitszeit?« fragte Herbert. Manteufel lächelte. »Ich nehme an, daß Sie wie die anderen kaum vor halb zehn anfangen wollen. Wir handhaben das großzügig: Sie schreiben selbst auf, wieviele Stunden Sie täglich an welchem Objekt gearbeitet haben. Unsere Erfahrung besagt, daß ein Computerexperte eher zuviel als zuwenig arbeitet, und wenn Sie kein Experte sind – dann taugen Sie nicht für uns.«
Ein Glück, dachte Herbert, als er jetzt das Hochhaus verließ, daß es in Kassel nicht geklappt hatte; was war eine Assistentenstelle an der Gesamthochschule gegen einen Platz in der Entwicklungsabteilung der Unicomp! Und ausgerechnet auf seiner Traumstrecke: Künstliche Intelligenz, Expertensysteme.
Natürlich hatte er den Unicomp-Leuten nichts von der Absage in Kassel verraten, nicht einmal von seiner Bewerbung, auch nichts von früheren Versuchen, im Gegenteil, er hatte durchblicken lassen, daß Unicomp für ihn nur eine Variante sei, daß er auch andere Möglichkeiten erwog; wer stellt schon einen Verlierertyp ein.
Er schlenderte ziellos durch die Straßen, stand plötzlich vor dem gläsernen Erdgeschoß des Dresdner-Hochhauses, ging hinein und setzte sich in einen der schweren Sessel, um einen Augenblick vor sich hin zu träumen, fand aber keine Ruhe, suchte die Herrentoilette auf, um, wieder einmal, in die DresdnerBank zu pinkeln, dieses Mal nicht mit dem albernen Halbstarkenhochgefühl, sondern in der Gewißheit, sein Wasser gerade am rechten Ort abzuschlagen: In ein paar Wochen würde er bei der Dresdner ein Konto eröffnen. Er kämpfte die Versuchung nieder, in ein piekfeines Restaurant zu gehen, sündhaft gut und sündhaft teuer zu essen, ein paar Blaue auf den Kopf zu hauen, den Rest seiner Barschaft, sein Limit für einen ganzen Monat in einer Stunde zu verfressen, doch er wollte nicht die nächsten Tage ganz auf Marias Tasche liegen, und nach Hause …
Er ging zur Hauptwache, fuhr in die Passage hinunter und rief in der Marburger Straße an … Mutter war derart überrascht, seine Stimme zu hören, daß sie vergaß, ihn zu fragen, von wo er anrief, und er sie also nicht anlügen mußte; er versprach, sie in den nächsten Tagen zu besuchen, vormittags, wenn Vater noch in der Penne war. Dann kaufte er sich bei McDonald einen Bigmac und leistete sich zu dem Riesenhamburger noch Pommes frites und eine Portion Zwiebelringe, setzte sich aber nicht in das Restaurant, sondern oben auf eine Steinbrüstung und sah den Frankfurter Jungen zu, die mit ihren Rollschuhen halsbrecherische Kurven zwischen den Passanten drehten. Er fühlte sich sauwohl. Nicht nur, weil das Gespräch bei Unicomp so verlaufen war und weil die Sonne schien: Er war zu Hause. Mochten die Zeitungen schreiben was sie wollten, mochten sie Frankfurt als Bankfurt und Krankfurt und Mainhattan beschimpfen, Frankfurt war schön: lebendig. Eine Weltstadt. Er fragte sich, wie er es so lange in Kassel und Göttingen ausgehalten hatte. War es ein Wunder., wenn er in diesen Provinznestern mißmutig und niedergeschlagen geworden war? Er hatte sich entschieden zu sehr von den miesepetrigen Studenten beeinflussen lassen, die überall ein Haar in der Suppe fanden die einen schon für reaktionär hielten, wenn man mal glücklich war. Man ist so stark, wie man sich fühlt. Er fühlte sich stark genug, Bäume auszureißen. Welch ein Unsinn sich Depressionen hinzugeben, als sei er bereits ein alter Mann.
»Die Welt ist schön«, sagte er laut. Und Deutschland war schön. Sobald er Geld hatte, würde er es sich ansehen. Nicht die USA. Den ersten Urlaub würde er zu einer Rundreise von der Nordsee bis zu den Alpen nutzen, Friesland und Lüneburger Heide, Spessart und Schwarzwald, den Rhein hinunter, Bodensee, München … und auf der Zugspitze war er auch noch nicht gewesen. Jetzt lief er erst einmal die Zeil hinunter, beguckte Schaufenster, ließ sich bei Main-Radio eine Super-Hi-Fi-Anlage vorführen, sah einem Kubaner zu, der im Schaufenster von Palm Zigarren drehte lauschte belustigt den beschwörenden Reden eines Predigers der Moon-Sekte, stellte sich zu drei jungen, schwarzhäutigen Burschen, die phantastischen Oldtime-Jazz machten und zur Feier des Tages genehmigte er sich einen Kinobesuch.
Er hätte lieber ein Buch kaufen und sich auf eine Bank am Main setzen sollen, vielleicht hatte die Sonne sogar schon einige Gastwirte verleitet, Stühle draußen aufzustellen, Roger Moore als James Bond, so fand er war keine zwölf Mark wert, doch er trauerte dem Geld nicht nach. Bald würde es keine Frage mehr für ihn sein, ob er lieber eine Kinokarte, ein Taschenbuch oder etwas zu essen kaufen sollte und daß er zur Parkstraße lief, hatte nichts mit sparen zu tun, sondern mit dem blauen Himmel und der Nachmittagssonne.
Seine gute Laune verflog nicht einmal als er an der Tür feststellte, daß er vergessen hatte, den Schlüssel einzustecken, und die vier Etagen vergeblich hochgelaufen war, niemand reagierte auf sein Klingeln. Als er schon an der Treppe war, rief eine Stimme ihm nach, was er wolle.
»’rein!« sagte er. »Ich bin ein Freund von Maria.« Er ging zur Tür zurück, faßte an die Klinke, eine Kette versperrte ihm den Weg.
»Machen Sie bloß, daß Sie wegkommen« antwortete es drinnen, »der Trick verfängt nicht bei mir. So’n Typ würde Maria nie anschleppen!« Herbert konnte durch den schmalen, dunklen Spalt nicht ausmachen, mit wem er da sprach, aber es konnte nur Ruth sein.
»Erinnern Sie sich nicht?« sagte er. »Heute nacht … Meine Jeans liegen vorne im Zimmer, in der Tasche müssen die Schlüssel stecken, die Maria mir gegeben hat.« Er mußte dreimal bitten, bevor Ruth widerstrebend nachsehen ging. Nicht, ohne die Tür einzuklinken; er hörte, daß sie sogar den Riegel vorschob, und als Ruth ihn schließlich einließ, blickte sie immer noch mißtrauisch.
»Scheint ja zu stimmen«, sagte sie. »Sind Sie ein Verwandter von Maria?«
»Nur ein Schulfreund«, erwiderte Herbert. »Ich werde mal meine Maske ablegen, vielleicht erinnern Sie sich dann.«
Ruth lag quer über den Liegen und telefonierte, als er ins Zimmer kam. »Ist gut«, sagte sie gerade, »verlaß dich auf mich. – Oder wir gucken mal bei dir ’rein.« Nun blickte sie Herbert freundlich an.
»Sehe ich jetzt eher wie ein obdachloser Arbeitsloser aus?« erkundigte er sich.
»Entschuldige«, sagte sie.
»Ich muß mich entschuldigen«, erwiderte er. »Wegen heute Nacht. Aber es war nicht meine Idee …«
»Schon gut. Willst du Tee?« Ruth wartete die Antwort nicht ab, sondern angelte ein zweites Glas vom Regal, goß aus der Kanne ein, die auf einem Stövchen bereitstand, schob ihm die Zuckerdose zu und nahm sich selbst das Tabakpäckchen und Zigarettenpapier. Herbert beobachtete sie, so unauffällig er konnte. Bei Tageslicht gefiel sie ihm noch besser.
Soll ich dir auch eine drehen?« fragte sie. Herbert schüttelte den Kopf. »Maria sagt, du suchst ’nen Job. Was machst du?«
»Informatik«, sagte er. »EDV.«
»Na da brauchst du wenigstens nicht lange rumzurennen. Bei uns suchen sie auch Programmierer, soll ich da mal fragen?«
»Danke.« Er lachte. »Ich suche was anderes: Software-Entwicklung.«
»Und da sind die Jobs knapp?«
»Knapp direkt nicht, doch es gibt nur ein paar Stellen, die wirklich interessante Arbeiten machen, Entwicklungsarbeit, drei, vier Universitäten und eine Handvoll Unternehmen, aber ich glaube, ich habe meinen Job schon in der Tasche.«
»Dann ist es ja gut.« Sie wühlte in den Platten, fragte, ob er Leonhard Cohen möge, und als er nickte, legte sie die Songs of Iove & hate auf. Cohens rauchige Stimme füllte das Zimmer, Ruth legte sich wieder hin, hörte mit geschlossenen Augen zu, nahm tiefe Züge aus ihrer Selbstgedrehten, war so versunken, daß Herbert sich unwillkürlich fragte, ob wirklich nur Tabak in dem Päckchen war, doch es roch eindeutig nicht nach Marihuana. Er wartete, bis sie die Platte umdrehte, bevor er sie ansprach, fragte, woher sie und Maria sich kannten, aus der Disko?
»Ach, das hat sich so ergeben«, sagte sie unwillig.
»Was treibst du?« erkundigte er sich. »Erzähl mir was von dir.«
»Warum?« Sie sah ihn an, als habe er ihr sonstwas zugemutet.
Ja, warum. Weil ich mich auf Anhieb in dich verguckt habe, hätte er antworten müssen, weil du mir von Minute zu Minute besser gefällst, weil ich mich am liebsten zu dir legen und dich in die Arme nehmen würde – nein, nicht um mit ihr zu schlafen: um sie zu streicheln, zu küssen. Ein Gesicht zum Streicheln. Ein Mädchen zum Zärtlichsein, zum Hand-in-Hand-Spazierengehen. Er sagte nichts, er zuckte nur mit den Schultern, Ruth schloß wieder die Augen. Er hockte still in seinem Sessel, blickte sie unverwandt an, studierte ihr Gesicht wie ein Gemälde, und Lenny Cohen sang dazu.
Sie war nicht eigentlich schön, bei weitem nicht so schön wie Maria, und trotzdem. – Warum, dachte er, warum verguckst du dich in so ein schmales, fast hageres Gesicht? Immer wieder. Warum eigentlich liebt der eine schwarze Haare und der andere blonde, liebt man dicke Brüste oder kleine, breite Hüften oder schmale, wann und wie wird man derart geprägt, schon vor der Geburt? Ist es in den Genen verankert, wen zu lieben man verurteilt ist, oder entwickelt sich das in den ersten Wochen nach der Geburt, so, wie die Kücken auf die erste Stimme geprägt werden, die sie vernehmen? Ruth schlug die Augen auf, er lächelte sie an, doch sie reagierte nicht. Warum war sie so abweisend?
Markier nicht den gekränkten Gockel, weil sie nicht gleich auf dich fliegt, sagte er sich. Was weißt du von ihr. Vielleicht hat sie jemanden, hat gerade Sehnsucht nach ihm, oder sie macht sich überhaupt nichts aus Männern. Vielleicht hat einer tiefen Abscheu gegen alles Männliche in ihr ausgelöst, so was gibt es doch: als Kind vergewaltigt, und nun läßt dein Lächeln sie frieren … Alles Quatsch, dachte er. Mach dich nicht lächerlich, versuch nicht, jede Situation gleich analysieren zu wollen, du bist kein Psychologiestudent; am Ende ist es nur der Kater von gestern, purer Zufall, du weißt doch, welche Rolle der Zufall spielt.
Welch unheimliche Rolle: Wenn er mit Kalle zur Fremdenlegion durchgebrannt wäre oder in Marburg bei Hansen angekommen, wenn er jenes Abteil damals nicht betreten, den Job in München bekommen hätte. Oder den in Kassel. Und gestern abend nicht Maria angerufen hätte … Du hättest Ruth nie im Leben gesehen. Wie viele Zufalligkeiten bestimmen doch ein Leben.
Und er hatte sich in der letzten Zeit entschieden zuviel vom Zufall treiben lassen. Aber das wurde nun anders. Unicomp war der Anfang. Von jetzt an würde er jeden Schritt sorgsam prüfen, eisern seinen Weg verfolgen. Als erstes: ein Zimmer suchen, nein, eine kleine Wohnung, die er beziehen konnte, sobald er den Job bei der Unicomp hatte. Ruth riß ihn aus seinen Gedanken.
»Wollen wir essen gehen?« fragte sie . »Und dann ins Kino? Ich lade dich ein. Ich habe Maria versprochen, mich um dich zu kümmern.«
5.
Niemandstage – Zeit zwischen den Zeiten: zwischen Winter und Frühling, Uni und , Spiel und Ernst … das Wetter eine unaufhörliche Folge von Uberrumpelungen: dick verhangener Himmel oder strahlendes Blau, schon am Morgen wärmende Sonne und dann wieder Regen, Hagel, Schnee, dabei war noch nicht mal April. Herbert war viel unterwegs, obwohl er sich in der Parkstraße zu Hause fühlte. Und wußte, daß es kein Zuhause sein konnte. Die Stadt war vertraut und fremd zugleich. Das war nicht mehr sein Frankfurt, obwohl ihn an fast jeder Ecke Erinnerungen überfielen. Er nahm sich viel Zeit fur die Stadt. In den letzten Jahren war er immer nur für ein paar Tage hier gewesen, und die waren voll mit Verabredungen, Terminen, Plänen, jetzt schlenderte er durch die Straßen, Parks, die Wiesen am Main, besuchte die Penne, sogar den Kindergarten, Spietplätze, Knutschplätze, erinnerte sich und war zugleich verwundert, daß alles ganz anders war als in seiner Erinnerung: viel kleiner, nackter, ärmlicher. Stundenlang streifte er durch die Stadt und wußte nicht, war er daheim oder nicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!