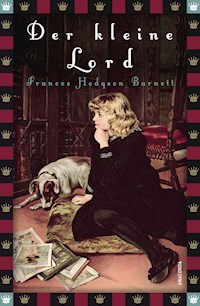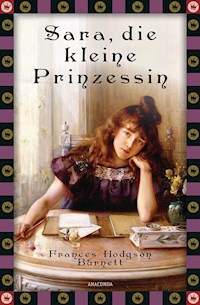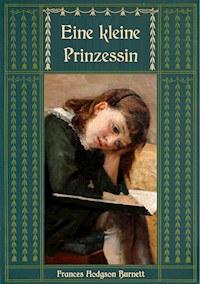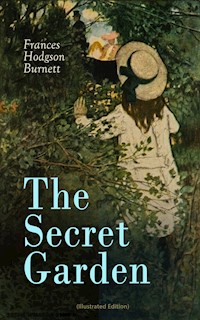29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau, gefangen in den Fängen ihres manipulativen Ehemanns – kann ihre Schwester sie retten? Rosalie Vanderpoel, die gutgläubige Tochter eines vermögenden New Yorkers, lässt sich von der vermeintlichen Romantik einer Ehe mit dem verarmten britischen Adeligen Sir Nigel Anstruthers blenden. Doch als sie ihm auf sein abgelegenes Anwesen Stornham Court folgt, offenbart sich die grausame Realität: Ihr Ehemann beutet sie und ihren Reichtum schamlos aus und unterwirft sie vollends seinem Willen. Als Rosalies Familie lange nichts mehr von ihr hört, macht sich ihre jüngere Schwester Bettina auf nach England, um der Sache auf den Grund zu gehen. Schnell wird ihr klar, dass sie ihre Schwester aus den Klauen dieser toxischen Ehe befreien muss … Frances Hodgson Burnetts fesselnder Klassiker ist eine eindringliche Studie über die Macht der Liebe, die zerstörerische Kraft von Gaslighting und die Zwänge gesellschaftlicher Konventionen. Das verfallene Herrenhaus ist ein zeitloses Meisterwerk, das auch heute noch unter die Haut geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frances Hodgson Burnett
Das verfallene Herrenhaus
Reclam
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Shuttle
New York: Grosset & Dunlap, 1907
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Leo Putz, Frieda Bell (1907) – akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962312-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011485-8
www.reclam.de
Inhalt
Der Pendelverkehr webt sein Netz
Ein Mangel an Auffassungsgabe
Die junge Lady Anstruthers
Ein Fehler des Postjungen
Auf beiden Seiten des Atlantiks
Eine unfaire Gabe
An Bord der Meridiana
Der Passagier zweiter Klasse
Lady Jane Grey
»Ist Lady Anstruthers daheim?«
»Ich dachte, ihr hättet mich alle vergessen«
Ughtred
Eines der New Yorker Kleider
In den Gärten
Der Erste Mensch
Das besondere Ereignis
Townlinson & Sheppard
Der 15. Earl von Mount Dunstan
Frühling in der Bond Street
Es tut sich etwas im Dorf Stornham
Kedgers
Einer von Mr Vanderpoels Briefen
G. Selden wird eingeführt
Die politische Ökonomie von Stornham
»Wir haben begonnen, sie zu heiraten, mein lieber Junge!«
»Wie das sein muss, Sie zu sein – einfach Sie!«
Das Leben
Es gibt ihnen zu denken
Der Faden von G. Selden
Eine Heimkehr
Nein, hätte sie nicht
Ein großer Ball
Für Lady Jane
Godwyn der Rote
Die Gezeitenwelle
Überall am Straßenrand
Verschlossene Korridore
In Shandys Restaurant
In den Sümpfen
»Hör auf damit«
Sie musste einfach etwas tun
Im Ballsaal
Seine Chance
Leise Tritte
Die Totenglocke
Lauschen
»Ich habe kein Wort und keinen Blick, an den ich mich erinnern könnte«
Der Moment
Auf Stornham und Broadmorlands
Das Urzeitliche
Nachwort
Kapitel I
Der Pendelverkehr webt sein Netz
Als durch den Pendelverkehr zunächst langsam und schwerfällig ein Netz von Ufer zu Ufer gewebt worden war, wusste niemand, dass es von der großen Hand des Schicksals gehalten und geführt wurde. Das Schicksal allein verstand die Bedeutung des Netzes, das es webte, seine ganze Macht und seine Stellung in der Weltgeschichte. Die Menschen hielten wenig von dem Netz und dem Weben, das da stattfand, und benannten beides mit anderen, weniger bedeutsamen Namen; noch waren sie sich nicht bewusst, welche Stärke der Faden hatte, der über den schäumenden, wogenden, bald grauen, bald blauen Ozean geworfen wurde.
Das Schicksal und das Leben planten das Weben, und es schien allein den Zeitumständen geschuldet, dass der Pendelverkehr sich zwischen zwei Welten hin und her bewegte, die von einer Kluft getrennt wurden, die breiter und tiefer war als Tausende von Kilometern salzig tosender See: die Kluft eines bitteren Streits, der von Hass und dem Blutvergießen zweier Brüdervölker vertieft worden war. Zwischen den beiden Welten im Osten und im Westen gab es kein Bedürfnis, sich anzunähern. Beide blieben für sich. Diejenigen, die gegen das rebelliert hatten, was ihr Innerstes Tyrannei nannte, die verzweifelt gekämpft und Blut vergossen hatten, um sich zu befreien, wandten ihren unbesiegten Feinden strikt den Rücken zu, brachen mit allen Fesseln, die sie an die Vergangenheit ketteten, verwarfen das Band des gemeinsamen Namens, ihrer Verwandtschaft und ihres Ranges und begannen mit Todesverachtung ein neues Leben.
Diejenigen, gegen die man rebelliert hatte, fanden die Revolutionäre zu leidenschaftlich in ihrer Entschlossenheit und zu unerbittlich in der Verteidigung ihrer Festungen, so dass sie einfach nicht zu besiegen waren. Naserümpfend segelten sie davon, zurück in ihre Welt, die doch so sehr die größere Macht zu sein schien. Sie stürzten sich in neue Schlachten, sie fügten neue Eroberungen und neuen Glanz zu den alten hinzu und schauten mit so etwas wie Verachtung auf den halbwilden Westen, den sie zurückgelassen hatten, damit er seine eigene Zivilisation aufbaute, und das ohne andere Hilfe als die Stärke seiner eigenen Hände und seiner kraftvollen unkultivierten Köpfe.
Aber während die beiden Welten sich fern voneinander hielten, webte der Pendelverkehr langsam durch die große Hand des Schicksals eine Verbindung, zog sie zueinander hin und hielt sie fest, ohne dass sie es merkten, und was zunächst wie Spinnfäden dünn gewesen war, formte bald ein Netz, dessen Stärke sie nicht hätten berechnen können und das sich schwerlich ohne Tragödien und schlimme Katastrophen hätte durchtrennen lassen.
Die Webarbeit war erst in ihren Anfängen und wuchs noch langsam, als unsere Geschichte begann. Dampfschiffe überquerten den Atlantik hin und her in beide Richtungen, aber sie machten ihre Reisen gemächlich, wenn auch mit heftigem Schlingern und all den Unbequemlichkeiten, die kleine Schiffe sich nun einmal leisten. Ihre Suiten und Decks waren noch nicht besetzt mit Leuten, für die die Reise ein Ereignis von vielen war – vielleicht sogar eines, das sie jedes Jahr erlebten. »Eine Überfahrt« war in jenen Tagen noch eine bedeutende Begebenheit, sie wurde akribisch geplant, lange vorher durchdacht, man sprach ausführlich darüber – und das nicht nur einmal – mit den verschiedenen Mitgliedern der Familie, zu der der Reisende gehörte. Man nahm an, dass einem Individuum, das New York, Philadelphia, Boston und dergleichen Städten den Rücken zuwandte und seinen Blick gen »Europa« richtete, eine gewisse Kühnheit anhaftete, die schon beinahe Leichtsinn genannt werden konnte. In diesen Tagen, als der Pendelverkehr noch gemütlich vor sich hin tuckerte, fuhr man nicht einfach nach London oder Paris oder Berlin, vielmehr machte man sich feierlich nach »Europa« auf.
Da es wahrscheinlich war, dass der Reisende die Fahrt nur einmal im Leben unternehmen würde, nahm er sich vor, so viel wie möglich zu sehen, so viele Städte, Kathedralen, Ruinen und Galerien zu besuchen, wie seine Zeit und seine Börse es zuließen. Menschen, die mit einem gewissen Grad von Vertrautheit über den Hyde Park, die Champs-Élysées und den Pincio sprechen konnten, kam eine besondere Würde zu. Die Fähigkeit, mit einem Hauch von Intimität von diesen Orten reden zu können, war eine raison de plus1, zum Tee oder Dinner eingeladen zu werden. Fotografien oder Erinnerungsstücke zu besitzen, europäische Berühmtheiten gesehen zu haben – und sei es auch nur von ferne –, in den Gärten von Dichtern und den Häusern von Philosophen gewandelt zu sein, verdiente einen gewissen Respekt. Diese Epoche war noch weit entfernt von der Zeit, als der Pendelverkehr hin und her schoss, indem er schneller und immer schneller, Woche für Woche, Monat für Monat, neue Fäden in das Netz webte, Jahr für Jahr, Kette und Schuss, bis sie beide Ufer miteinander verbanden.
Es geschah noch in den vergleichsweise frühen Tagen, dass der erste Faden, dem wir folgen, in das Netz eingewebt wurde. Viele seiner Art sind seitdem hinzugekommen und haben sich immer mehr verstärkt und ein festes Band aus Geschlecht, Heimbildung und Familiengründung gedreht. Doch dieser war ein dünner und schwacher, der nur aus dem Lebensfaden einer Tochter eines gewissen Reuben Vanderpoel bestand – dem der hübschen, kleinen, einfachen, deren Name Rosalie lautete.
Sie – die Vanderpoels – gehörten zu den Amerikanern, deren Geschick und Reichtum Teil der Geschichte ihres Landes waren. Dieses aufzubauen hatte Epochen und Krisen geprägt oder gar geschaffen. Ihre Millionen konnte man eigentlich nicht Privateigentum nennen. Zeitungen erzählten davon, wenn man so will, verwendeten sie als Argumente, benutzten sie als Redewendung, bauten sie in ihre Kalkulationstechniken ein. Die Literatur verwies auf sie, Moralsysteme nutzten sie, in Geschichten für die Jugend wurden sie voller Ernst als vorbildlich beschrieben.
Der erste Reuben Vanderpoel, der in den frühen, gefährlichen Tagen mit den Ureinwohnern Pelz- und Tierhandel betrieben hatte, wurde in den Geschichten über Sparsamkeit und Unternehmergeist als Held gelobt. Sein ganzes hart arbeitendes Leben hindurch war er immer von einem Genius des Handels unwiderstehlich angetrieben worden, aktiv zu werden, der sich zu Beginn in ungeheurem Mut beim Tauschhandel manifestierte. Sein wacher Geist, der den potentiellen Wert von Dingen erkannte, und die Möglichkeit, Menschen dazu zu bewegen, das zu tun, was er wollte, hatten ihm dabei wunderbar geholfen. Er hatte zu niedrigen Preisen Dinge gekauft, die in den Augen der weniger Scharfsichtigen wertlos waren, aber wenn er diese Dinge erst einmal besaß, dann wurde den weniger Scharfsichtigen stets klar, dass in seinen Händen der Wert dieser Dinge stieg und er Gelegenheiten fand, daraus Geld zu machen, die er auch nutzte. Nichts blieb unbrauchbar. Der praktisch denkende, schäbige, ungebildete kleine Mann entwickelte die Macht, Nachfrage für seine Waren zu schaffen. Wenn ihm einmal ein Fehler unterlief, so machte er ihn schnell wieder wett. Er konnte nahezu ohne irgendetwas leben und deswegen überall hinreisen auf der Suche nach den Dingen, die er haben wollte. Er konnte kaum lesen und schreiben und wusste nichts von Rechtschreibung, aber er war wagemutig und raffiniert. Sein ungeschultes Gehirn war das eines Financiers, sein Blut brannte im Fieber einer einzigen Begierde – der Begierde, Geld anzuhäufen. Geld war für ihn nicht zum Ausgeben da, sondern ausschließlich dazu, es in kleine oder große Besitztümer zu investieren, die in der nahen oder fernen Zukunft mit Profit verkauft werden konnten. Die Zukunft barg Faszination für ihn. Er kaufte nicht für sein eigenes Vergnügen oder seine eigene Bequemlichkeit, er kaufte nichts als das, was wieder verkauft oder getauscht werden konnte. Er heiratete eine Frau, die die Tochter eines Händlers war und seine Passion für das Geldverdienen teilte. Ihre Familie war aus Nordengland gekommen, ihr Vater war ein knauseriger kleiner Kaufmann in einer unwichtigen Stadt gewesen, der wagemutig genug gewesen war, zu emigrieren, als das noch bedeutete, unbekannten Gefahren in einem halbwilden Land gegenüberzutreten. Sie hatte Reuben Vanderpoels Bewunderung erlangt, als sie einmal an einem bitterkalten Wintertag ihren Unterrock auszog, um ihn einer Squaw im Tausch für ein Schmuckstück zu verkaufen, von dem sie wusste, dass eine andere Squaw dafür mit einer wertvollen Tierhaut bezahlen würde. Die erste Mrs Vanderpoel war genauso wundervoll wie ihr Gatte. Sie waren beide wundervoll. Sie waren die Begründer eines Vermögens, das eineinhalb Jahrhunderte später das Entzücken – im Grunde die pièce de résistance2 – von New Yorker Reportern werden würde, von dessen enormer Größe in runden Zahlen immer wieder berichtet wurde, wenn eine Spalte leer zu bleiben drohte. Die Art, wie man davon sprach, war unendlich vielfältig und immer wieder interessant für eine besondere Klasse, in der einige Individuen es ermutigend fanden, wenn man ihnen versicherte, dass so viel Geld ein persönlicher Besitz sein konnte, während andere die Tatsache als weiteres Argument dafür nutzten, gegen die Niedertracht des Monopols zu wettern.
Der erste Reuben Vanderpoel vermachte seinem Sohn sein angehäuftes Vermögen und sein fiebriges Verlangen, Geld zu verdienen. Er hatte nur das eine Kind. Der zweite Reuben baute auf den Grundlagen, die ihm dadurch gegeben waren, ein Vermögen auf, das viel größer war als das erste, da das schnelle Wachstum und die zunehmenden Möglichkeiten seines Landes ihm immer größere Chancen eröffneten, Geld zu erwerben. Es war nicht länger nötig, mit den Ureinwohnern zu handeln, nun waren seine Fähigkeiten gefordert, mit weißen Männern zurechtzukommen, die in ein neues Land kamen, um sich ihren Lebensunterhalt zu erkämpfen und ein Vermögen zu machen. Einige waren gewitzt, einige verzweifelt, einige unehrlich. Aber in all ihrer Gewitztheit, ihrer Verzweiflung, ihrer Unehrlichkeit überlisteten sie den zweiten Reuben Vanderpoel nie. Jedes dieser Charakteristika fügte sich schließlich seinen eigenen Absichten und Qualitäten, und im Endeffekt blieb er der Gewinner einer jeden Geschäftstransaktion. Es war geradezu sprichwörtlich geworden, zu behaupten, die Vanderpoels verfügten über einen Geldvermehrungszauber. Dieser Zauber bestand in ihrer vollkommenen geistigen wie körperlichen Hingabe an eine einzige Idee. Ihre Besonderheit war nicht so sehr, dass sie reich werden wollten, als vielmehr, dass die Natur sie dazu drängte, Reichtümer anzusammeln, so wie der Magnet vom Eisen angezogen wird. Ohne etwas zu besitzen, waren sie reich geworden, als sie reich waren, wurden sie noch reicher. Sie hatten ihr Vermögen auf kleine Geschäftsvorhaben gegründet, sie vermehrten sie zu gigantischen. Nach und nach erwarben sie diese Allmacht des Reichtums, die scheinbar kein Umstand kontrollieren oder begrenzen kann. Der erste Reuben Vanderpoel wusste nichts von Rechtschreibung, der zweite erlernte sie, der dritte war so gebildet, wie es ein Mann sein kann, dessen einziger Beruf das Geldverdienen ist. Seine Kinder lernten dann alles, was teure Lehrer und teure Schulen ihnen beibringen konnten. Nach der zweiten Generation verbesserte sich die magere und merkantile physische Gestalt der Vanderpoels. Feminines gutes Aussehen erschien auf der Bildfläche, und man machte das Beste daraus. Die Vanderpoels investierten sogar gutes Aussehen zu ihrem Vorteil. Der vierte Reuben Vanderpoel hatte keinen Sohn, nur zwei Töchter. Sie wohnten in einem Brownstone-Haus an einer Durchgangsstraße, durch die der Verkehr rauschte. Man wusste, dass diese »Villa« (das Haus wurde immer so genannt) eine Anzahl von Dollar gekostet hatte, die bis zu den höchsten Höhen der Rocky Mountains bekannt war. Es gab vielleicht sogar Pueblo-Indianer, die Gerüchte über den Preis der Villa gehört hatten. Alle Geschäftsinhaber und Farmer der Vereinigten Staaten hatten Beschreibungen in den Zeitungen gelesen, wie sie eingerichtet war; sie kannten den Wert der Brokatvorhänge in den Schlafzimmern und Boudoirs der Misses Vanderpoel. Man ergötzte sich sehr an der Tatsache, dass Miss Rosalies Badezimmer mit Carrara-Marmor ausgestaltet war, und für all die guten Seelen in den kleinen Städten Neu-Englands und des Westens, die tatkräftig dabei waren, ihre eigene Wäsche zu waschen, war es ein herrlicher Luxus, sich auszumalen, dass das Wasser im Carrara-Marmor-Badezimmer mit Irisduft aus Florenz parfümiert war. Dinge wie diese wurden irgendwie zu ihrem persönlichen Besitz und konnten sogar die Last ihrer schweren Arbeit lindern.
Rosalie Vanderpoel heiratete einen Engländer, der über einen Adelstitel verfügte, und ein Teil der Geschichte ihres Ehelebens bildet meinen Prolog. Ihre Ehe gehörte zu den frühen internationalen Ehen, und der republikanisch gesonnene Geist hatte sich noch nicht an all das gewöhnt, was mit einer solchen Verbindung einhergehen kann. Er war noch unbedarft, voller Phantasie und vertrauensvoll in diesen Dingen. Der Titel eines Barons und ein Herrenhaus, zu dem ein altes englisches Dorf gehörte und Dorfbewohner, die vielleicht sogar noch altmodische schmucke Arbeitskittel trugen, waren für Menschen, deren Kenntnis solcher Dinge sich nur den Romanen von Mrs Oliphant und anderen Schriftstellern verdankte, voll pittoresker Würde. Die einfachsten kleinen Anekdoten, in denen Pfarrhäuser, Wildhüter und Dowager-Witwen3 eine Rolle spielten, waren in diesen frühen Tagen aufregend. Der Name »Sir Nigel Anstruthers« hatte, wenn man ihn auf einer Visitenkarte las, eine Aura von Distinktion, die geradezu erregend wirkte. Sir Nigel war nicht so pittoresk wie sein Name, wenn er auch nicht ganz ohne jede Anziehungskraft daherkam, zumindest solange er aus Gründen, die nur er kannte, beschlossen hatte, sich einigermaßen liebenswürdig zu geben. Er war ein Mann von guter Statur und hatte eine gute Stimme, und wenn da nicht eine gewisse Schwere in seinem Gesicht gewesen wäre – das Resultat einer verwerflichen Lebensweise –, hätte er den Eindruck vermittelt, besser auszusehen, als er es in Wahrheit tat. New York ließ sich von der Tatsache amüsieren und gleichzeitig bezaubern, dass er mit einem »englischen Akzent« sprach. Seine Aussprache war tatsächlich sehr deutlich, und er behandelte seine Vokale gut. Er war ein Mann, der gesellschaftliche Regeln und Höflichkeiten mit ihm anerzogener Genauigkeit sorgfältig beachtete, wenn er es für vorteilhaft hielt, diese zu berücksichtigen. Ein scharfsinniger Mann von Welt hatte einmal über ihn gesagt, dass er sich einerseits zeremoniöser und andererseits zwangloser gebe als Männer, die in Amerika erzogen worden waren.
»Wenn Sie ihn zum Dinner einladen«, war der genaue Wortlaut, »oder wenn man stirbt oder heiratet oder einen Unfall hat, sind seine Beileidskarten prompt und höflich, aber die Wahrheit ist nun mal, dass er sich überhaupt nicht um Sie oder Ihre Verwandten schert, und wenn Sie es ihm nicht in allem recht machen, hat er keine Probleme damit, übellaunig zu werden und unglaublich grob, was ein Amerikaner sich normalerweise niemals erlauben würde.«
Von vielen Leuten wurde Sir Nigel jedoch nicht analysiert, sondern akzeptiert. Er gehörte zu den ersten Engländern, die in der New Yorker Gesellschaft erschienen, und zog einiges Interesse auf sich, weil er mit seinem Herrenhaus und dem alten Familiennamen noch etwas Neues darstellte. Man sprach sehr viel über ihn bei lebhaften Damen-Lunchpartys, und man sprach sehr viel über ihn bei ebenso lebhaften Nachmittagsteegesellschaften. Bei Dinnerpartys beobachtete man ihn häufig verstohlen, aber nach dem Dinner, wenn er mit den Männern beim Wein saß, war er nicht eben beliebt. Zwar stimmte es nicht, dass man ihn gar nicht leiden konnte, aber Männer, deren Hauptinteresse zu dieser Zeit in Börsenfragen und Eisenbahnangelegenheiten bestand, fanden es nicht leicht, sich mit einem Mann zu unterhalten, dessen einzige Beschäftigung das Schießen auf Vögel war und das Jagen von Füchsen, wenn er sich nicht einfach in London herumtrieb, um dort seine Zeit zu vergeuden. Die Geschichten, die er erzählte, und es waren eher wenige, waren meist Anekdoten, deren humorige Pointe darin bestand, dass ein Mann lustigerweise ein unglaublich schlechter Schütze oder Reiter war und entweder einen Wildhüter mit seiner Schrotflinte durchlöchert hatte oder in einen Graben geworfen worden war, als sein Pferd über eine Hecke sprang, und solche Dinge wurden nicht unbedingt interessanter dadurch, dass sie durch Gehirne gefiltert wurden, die sich gewöhnlich mit Börsenspekulation und Handel beschäftigten. Er war keineswegs so dumm, dass er dies nicht bereits in seiner ersten Zeit seines Besuches in New York gemerkt hätte, was wahrscheinlich der Grund war, warum diese Geschichten nicht häufiger erzählt wurden.
Ihm seinerseits erschloss sich nicht so recht der Spaß eines »großen Deals« oder einer Riesenpleite an der Wall Street – oder die Komik von Witzen, die sich darauf bezogen. Alles in allem wäre er froh gewesen, wenn er diese Dinge besser verstanden hätte. Seine Verhältnisse waren derart, dass er nun nicht mehr umhinkonnte, die Welt des Geldverdienens mit so etwas wie verdrießlichem Respekt zu betrachten. »Diese Kerle«, die weder Titel noch irgendwelche großen Anwesen hatten, die sie instand halten mussten, konnten Geld verdienen. Er dagegen musste sich widerwillig eingestehen, dass er viel schlimmer dran war als ein Bettler. Da war vor allem Stornham Court in einem Zustand vollständigen Verfalls – das Anwesen ging völlig den Bach hinunter, die Häuser der Bauern verfielen, und er hatte sozusagen keinen Penny, den er aufbringen konnte; er war bis über beide Ohren verschuldet. Engländer seines Ranges, die in der Vergangenheit nichts mit Handelsfragen zu tun gehabt hatten, hatten begonnen, zumindest ein klein wenig damit zu liebäugeln – die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, die sich damit für die Aristokratie eventuell eröffnen könnten. Es war nicht so, dass Herzoginnen voller Elan Modeläden eröffnet hätten, noch gaben sich waschechte Grafen auf der Bühne die Ehre, aber einige Adlige hatten ein wenig mit dem Bierhandel getändelt und mit der Börse kokettiert. Eine der ersten Handelserrungenschaften war die Entdeckung Amerikas gewesen – insbesondere von New York –, wo man, wenn man sich zu einer so drastischen Maßnahme entschließen konnte, seine Söhne profitabel verheiraten konnte. Am Anfang war das Feld so vielversprechend erschienen, dass es zu übereilten und unbesonnenen Entscheidungen kam bei denjenigen, die nicht viel Menschenkenntnis hatten und sich deswegen in aller Ruhe auf eine Naivität verließen, die, wie sich bald herausstellen sollte, schnell an ihre Grenzen kam. Naivität, die gelegentlich mit bemerkenswertem Scharfsinn einhergeht, ist eher ein amerikanischer Charakterzug als ein englischer und deswegen für Engländer eher irreführend.
Zunächst wurden jüngere Söhne, die ihren Familien »Ärger machten«, nach Westen geschickt. Ihre Namen, ihre Schlösser und Herrenhäuser, ihre distinguierten Verwandten, die Londoner Saison, Fuchsjagden, Buckingham Palace und das Rennen von Goodwood erwiesen sich als pittoreske Verlockungen. Dass die Schlösser und die Herrenhäuser einst den älteren Brüdern gehören würden, dass die distinguierten Verwandten nicht unbedingt auf Verbindungen mit den Unmengen jüngerer Ableger der Familien erpicht waren, dass die Saison in London, die Jagden und Rennen für die Älteren und besser Gestellten gedacht waren, waren Tatsachen, die in ihrer ganzen Bedeutung noch nicht so recht von den republikanischen Köpfen erfasst wurden. Im Laufe der Zeit verstand man das natürlich in seinem ganzen Ausmaß, aber als Rosalie Vanderpoel 19 Jahre alt wurde, waren sie noch Terra incognita. Man kann versichert sein, dass Sir Nigel Anstruthers absolut nichts von einem Gespräch erzählte, das er, bevor er segelte, mit einer überaus übellaunigen Großtante gehabt hatte, die die Gattin eines Bischofs war. Sie war ein grässliches altes Weib mit einem breiten Gesicht, groben Gesichtszügen und einer rauen Stimme, deren Ton ihren Beobachtungen Schärfe verlieh, wenn sie sich ihrer Lieblingsbeschäftigung hingab, sich in die Angelegenheiten ihrer Bekannten und Verwandten einzumischen.
»Ich weiß gar nicht, was das soll, dass du einfach so nach Amerika fahren willst, Nigel«, war ihr Kommentar. »Du kannst es dir gar nicht leisten, und es ist vollkommen lächerlich, wenn du die Absicht hast, zum Vergnügen zu reisen, als wärest du ein Mann von Vermögen, statt jemand, der, wie Maria mir sagte, nicht einmal seinen Schneider bezahlen kann. Weder der Bischof noch ich können etwas für dich tun, und ich denke auch nicht, dass du das erwartest. Ich kann nur hoffen, dass du wenigstens weißt, was du in Amerika tun willst, und dass es etwas Praktischeres ist als Büffel. Du solltest in New York bleiben. Die Töchter dieser großen Ladenbesitzer sind enorm reich, sagt man, und sie freuen sich immens über Aufmerksamkeiten von Männern deines Standes. Es heißt, sie würden jeden heiraten, wenn er nur eine Tante oder eine Großmutter mit einem Titel hat. Du könntest ja die Marquise erwähnen, nicht wahr. Du brauchst ja nicht darüber zu sprechen, dass sie deinen Vater für einen Schurken hielt und deine Mutter für einen Eindringling in die Familie und dass du seit deiner Geburt noch nie nach Broadmere eingeladen worden bist. Du kannst auch in einem Nebensatz mich und den Bischof ins Gespräch bringen oder auch den Bischofspalast. Ein Palast – auch wenn es der eines Bischofs ist – sollte bei Amerikanern doch Eindruck machen. Die werden denken, es sei etwas, das mit der königlichen Familie zu tun hat.« Sie beendete ihre Ausführungen mit einem höchst beleidigenden Schnauben, das als Lachen durchgehen sollte, und Sir Nigel lief dunkelrot an und sah so aus, als hätte er sie gern niedergeschlagen.
Es war jedoch nicht ihre Einstellung, die ihm so entsetzlich zuwider war. Hätte sie nur alles in einer Art und Weise formuliert, die ihm mehr geschmeichelt hätte, so hätte er das Gefühl gehabt, dass sie durchaus nicht unrecht hatte. Tatsächlich hatte er sich die Dinge selbst schon vor einiger Zeit ganz ähnlich zurechtgelegt, und wenn er die amerikanische Angelegenheit in ihrer Gesamtheit betrachtete, war er zu Entscheidungen gelangt, die durchaus wirtschaftlichen Charakter hatten. Der Impuls, sie niederzuschlagen, überkam ihn nur deswegen, weil er brutal übellaunig wurde, wenn man seine Eitelkeit verletzte, und er war so unglaublich wütend, weil sie mit ihm sprach, als wäre er ein Dörfler ohne Arbeit, dem sie Vorhaltungen machen konnte und den sie herumschubsen konnte, wie es ihr passte.
»Für eine Frau, die angeblich aus einer guten Familie stammt«, sagte er danach zu seiner Mutter, »ist Tante Marian das vulgärste alte Weibsstück, das mir je untergekommen ist. Sie hat den Geschmack einer Straßenhändlerin.« Was vollkommen zutraf, aber man durfte nicht vergessen, dass der seine um nichts besser war und dass seine Sicht der Dinge und seine moralische Einstellung vollkommen mit seinem Geschmack übereinstimmten.
Natürlich wusste Rosalie Vanderpoel nichts von dieser Seite der ganzen Sache. Sie war ein liebevoll umsorgtes Schmetterlingskind gewesen, das hübsch war, das man bewunderte und hätschelte von Kindesbeinen an; sie hatte sich dann zu einem gehätschelten Schmetterlingsmädchen entwickelt, hübsch und bewundert und umgeben von übermäßigem Luxus. In ihrer Welt gab es nur freundliche, großzügige Freunde und Verwandte, die das Leben genossen und sich an ihren mädchenhaften Kleiderfragen und Triumphen erfreuten. Sie hatte ihre eine Saison als Belle damit verbracht, von Festivität zu Festivität gewirbelt zu werden und in Räumen zu tanzen, für deren Blumenschmuck man Tausende Dollar ausgegeben hatte. Sie aß an Tischen, die beladen waren mit Rosen und Veilchen und Orchideen, sie trug aus den Ballsälen und von den Festen wunderbare kleine »Gefälligkeiten« und Geschenke mit nach Hause, deren Preis, wenn er in den Zeitungen veröffentlicht wurde, einen Wonneschauer von Entzücken oder Neid durch das Land laufen ließ. Sie war ein schmales kleines Geschöpf, mit einer Fülle leichter fedriger Haare wie die einer französischen Puppe. Sie hatte kleine Hände und Füße und eine schmale Taille – und auch, das musste man zugeben, ein kleines Gehirn, aber sie war ein unschuldiges, gutherziges Mädchen mit einer kindlichen Einfachheit im Denken. Kurz gesagt, sie war genau die Art von Mädchen, die Sir Nigels tyrannisches Temperament zugleich eindrucksvoll und attraktiv finden musste, solange es unter dem zeremoniellen Mäntelchen äußerlich guter Manieren daherkam.
Ihre Schwester Bettina, die noch ein Kind war, war von stärkerer und weniger leicht zu beeindruckender Natur. Betty hatte – mit ihren acht Jahren – lange Beine und ein eckiges, aber doch zartes kleines Gesicht. Ihre offenen stahlblauen Augen waren bemerkenswert wegen der ziemlich auffallenden tintenschwarzen Wimpern und einem geraden, jungen Blick, der anklagend, ja manchmal auch verdammend wirkte. Sie wurde in einer ruinös teuren Schule zusammen mit anderen unglaublich reichen kleinen Mädchen erzogen, die wie sie allzu wunderbare Kleider trugen und allzu üppig mit Taschengeld versorgt wurden. Die Schule hielt sich für besonders vornehm und auserlesen, war aber im Grunde auf eine sehr interessante Weise vulgär.
Die unglaublich reichen kleinen Mädchen, von denen die meisten hübsche und vergeistigte oder hübsche und reizvolle Gesichter hatten, aßen Unmengen von Bonbons und plauderten endlos in hohen unmodulierten Stimmen über die Partys, zu denen ihre Schwestern und anderen Verwandten gingen, und über die Kleider, die sie trugen. Einige von ihnen waren nette kleine Geschöpfe, die in der Zukunft aus ihrem Larvenstadium zu hinreißenden Frauen werden würden, aber sie verwendeten ohne Scheu umgangssprachliche Redewendungen und hatten die Angewohnheit, ganz unschuldig über die Preise von allem zu reden. Bettina Vanderpoel, die die reichste und klügste unter ihnen, deren gutes Aussehen am vielversprechendsten war, grenzte in ihrer Sprache beinahe schon an Slang, aber sie hatte eine tiefe weiche Kinderstimme und eine ganz erstaunliche Haltung.
Sie konnte Sir Nigel Anstruthers kaum ertragen, und da sie nun einmal ein amerikanisches Kind war, nahm sie kein Blatt vor den Mund, auch wenn das zu Grobheiten führte. »Er ist ein grässlicher Kerl«, sagte sie, »ich verabscheue ihn. Er ist hochnäsig, und er meint, du hättest Angst vor ihm, und findet das auch noch gut.«
Sir Nigel hatte bisher nur englische Kinder kennengelernt, kleine Mädchen, die in jenem diskreten Teil im Stadthaus ihrer Eltern lebten, den man »Schulzimmer« nannte, und die scheinbar nur zu den täglichen Spaziergängen mit ihren Erzieherinnen erschienen; Mädchen mit langem Haar und Jungen mit kleinen Zylindern und Gesichtchen, die sonderbarerweise irgendwie dazu zu passen schienen. Beide, Jungen wie Mädchen, wurden, wie sich das gehört, von der Bildfläche ferngehalten, und man beachtete sie nicht groß, außer wenn man sie in den Ferien zur Inspektion hervorholte oder zu einem Kindertheaterspiel mitnahm.
Es war Sir Nigel nicht klargewesen, dass ein amerikanisches Kind ein Faktor war, mit dem man durchaus rechnen musste, und ein »junges Ding«, das in den Salon kam, wann es ihm passte, und sich ohne Furcht an der Unterhaltung der Erwachsenen beteiligte, war etwas, das ihn einfach ärgerte. Es stimmte schon, dass Bettina zu viel redete und manchmal unerwünschte Kommentare abgab, aber man hatte ihr nun einmal nicht erklärt, dass die Erfahrungen ihrer acht Lebensjahre nicht immer von fesselndem Interesse für ein wenig reifere Menschen waren. Sir Nigel war dumm genug, sich in etwas einzumischen, das ihn nun einmal nichts anging, und zwar auf eine Art, die ihn zum Feind des Mädchens hätte werden lassen, selbst wenn dessen Instinkt sich nicht ohnehin von Anfang an gegen ihn gewandt hätte.
»Ihr amerikanischen jungen Dinger seid einfach zu dreist«, sagte er bei einer Gelegenheit, als Betty zu viel geredet hatte. »Wenn du meine Schwester wärest und in Stornham Court lebtest, würdest du deine Lektionen im Schulzimmer lernen und eine Schürze tragen. Niemand hat meine Schwester Emily jemals gesehen, als sie in deinem Alter war.«
»Tja, ich bin nun einmal nicht Ihre Schwester Emily«, gab Betty zurück, »und ich denke mal, ich bin ganz froh darüber.«
Das war wirklich unverschämt von ihr, aber es war leider so, dass sie nicht eben selten unverschämt auf eine dreiste Kleinmädchen-Art war, dabei war sie sich dieser Tatsache jedoch ganz und gar nicht bewusst.
Sir Nigel lief rot an und lachte sein kurzes unangenehmes Lachen. Wenn sie seine Schwester Emily gewesen wäre, wäre es ihr in diesem Moment schlecht ergangen, denn sein teuflisch böses Temperament wäre mit ihm durchgegangen.
»Ich ›denke mal‹, ich kann mir dazu auch gratulieren«, höhnte er.
»Wenn ich irgendjemandes Schwester Emily wäre«, sagte Betty, ein wenig von Kampfgeist beflügelt, »würde ich jedenfalls nicht Ihre sein wollen.«
»Also Betty, jetzt sei nicht so abscheulich«, mischte sich Rosalie lachend ein, doch ihr Lachen wirkte nervös. »Da kommt gerade Mina Thalberg die Treppe zur Haustür herauf. Geh mal zu ihr.«
Rosalie, das arme Mädchen, merkte, dass sie immer nervös wurde, wenn Sir Nigel und Betty sich im selben Raum befanden. Sie erkannte instinktiv deren Feindschaft und fürchtete, Betty könnte etwas tun, was ein englischer Baron als vulgär empfinden würde. Ihr einfach gestricktes Gehirn konnte nicht erklären, woher sie wusste, dass Sir Nigel New Yorker oft vulgär fand. Sie war sich jedoch durchaus dieser schlecht verhohlenen Tatsache bewusst und hatte den schüchternen Wunsch, alles zu erklären.
Als Betty mit bewundernswert guter Haltung aus dem Zimmer marschierte, ließ Rosalie ein beschwichtigendes Lachen hören.
»Sie dürfen sie nicht so ernst nehmen«, sagte sie. »Eigentlich ist sie ein prächtiges kleines Ding, aber sie hat nun einmal ein aufbrausendes Naturell. Das ist nach einer Minute wieder vorüber.«
»In England würde man ihr das nicht durchgehen lassen«, sagte Sir Nigel. »Sie ist entsetzlich verzogen, wissen Sie.«
Er verabscheute das Kind. Er mochte Kinder generell nicht, aber dieses weckte in ihm mehr als nur Ablehnung. Später sollte Betty zu einer brillanten und fesselnden Persönlichkeit werden. Aber tatsächlich erkannte ihr noch nicht ganz entwickelter Intellekt schon damals, auch wenn sie sich der tieferen Wahrheit nicht bewusst war, ihn vage als das, was er war. Sie sah ihn als einen skrupellosen, erbärmlichen Wüstling, einen in seinem Unterfangen so gewissenlosen Abenteurer und Schwindler, als wäre er darauf aus, Schecks zu fälschen oder enorme Juwelendiebstähle zu planen, statt nur ein Mädchen dazu zu bringen, eine unvorteilhafte Ehe einzugehen, dessen Sanftmut und Vermögen einem Schurken mit vornehmem Namen zum Vorteil gereichen sollten. Der Mann war kaltblütig genug, zu verstehen, dass Rosalies sanfte Schwachheit durchaus ihren Wert hatte, weil sie so leicht drangsaliert werden konnte. Mit ihrem Geld konnte er rechnen, weil er es für sich selbst und seine unnatürlichen Laster ausgeben konnte sowie für seinen Namen und sein Anwesen, die beide in Ruinen darniederlagen und möglichst bald wieder aufgebaut und mit neuen Gütern gefüllt werden mussten, sonst würden sie endgültig verfallen, was schändlich wäre, das ließ sich nicht leugnen. Betty mit ihren anklagenden Augen wusste zwar nicht, dass ihr Instinkt in den Tiefen ihres noch ungehobelten jungen Denkens das Potential eines ungewöhnlich feinen Exemplars des britischen Schurken erkannte, aber das war nichtsdestotrotz die faszinierende Wahrheit. Als man ihr später sagte, ihre Schwester habe sich mit Sir Nigel Anstruthers verlobt, entbrannte ihr kleines Gesicht flammendrot, sie starrte einen Moment stumm vor sich hin, dann biss sie sich auf die Lippen und brach in Tränen aus.
»Also wirklich, Bett«, rief Rosalie, »du bist das sonderbarste Mädchen, das ich je gesehen habe.«
Bettinas Tränen waren ein Ausbruch, nicht ein Fließen. Sie wischte sie wütend mit ihrem kleinen Taschentuch weg.
»Er wird dir etwas Schreckliches antun«, sagte sie. »Er wird dich beinahe umbringen. Ich weiß, dass er das tun wird. Ich wäre lieber selbst tot.«
Sie rannte aus dem Zimmer und konnte nie mehr dazu gebracht werden, ein Wort mehr über das Thema zu verlieren. Es wäre ihr auch gar nicht möglich gewesen, ihre heftige Abneigung und ihre Ahnung von kommendem Verhängnis in Worte zu fassen. Ihr fehlten noch die Formulierungsmöglichkeiten, um das Problem klar zu umreißen, sogar in ihrem eigenen Kopf. Und was kann man schon bewirken, wenn man erst acht Jahre alt ist?
Kapitel II
Ein Mangel an Auffassungsgabe
Obwohl die Amerikaner in dem Ruf standen, überaus merkantil zu denken, dachten sie nach Sir Nigel Anstruthers’ Ansicht in einigen Punkten unfassbar wenig kaufmännisch. Was das vollkommen eindeutige und einfache Überschreiben des Vermögens seiner Tochter anging, fand er, dass Reuben Vanderpoel sich begriffsstutzig bis zur Idiotie anstellte. Er schien in keinem einzigen Punkt den üblichen Sichtweisen anzuhängen. Selbstverständlich gab es für Anstruthers nur eine einzige richtige Sichtweise. Ein Mann von hoher Geburt und hohem Rang, so argumentierte er, mache nicht den weiten Weg über den Atlantik, um eine New Yorker Millionärstochter zu heiraten, wenn er sich nicht von dieser Allianz gewisse Vorteile erhoffe. Solch ein Mann – also Anstruthers’ Sorte von Mann – hätte eine reiche Frau nicht einmal in seinem eigenen Land geheiratet, ohne sicherzustellen, dass die Vorteile dieser Verbindung bei ihm zusammenlaufen würden. »In England«, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, »gab es diesbezüglich keinen Humbug.« Das Vermögen einer Frau gehörte ebenso wie sie selbst ihrem Ehemann, und ein Mann, der Herr im Hause war, konnte über seine Frau bestimmen, wie es ihm passte. Er hatte gesehen, wie einige Jungs, die ihre Frauen an der kurzen Leine hielten, die Mädchen, die das Geld eingebracht hatten, ganz hervorragend handhabten. Die ließen sich nicht von Tränen rühren und erlaubten einfach nicht, dass sie mit ihren Verwandten Kontakt aufnahmen. Wenn er den Wunsch gehabt hätte, zu heiraten, und es sich hätte leisten können, eine Frau zu nehmen, die keinen Penny besaß, so gab es Hunderte von unvermögenden Mädchen, die Gott auf den Knien danken würden für die Chance, in sichere Verhältnisse zu kommen. Dafür hätte man nicht sein Heimatland verlassen müssen.
Aber Sir Nigel hatte nie das Bedürfnis gehabt, sich eine häusliche Bürde aufzuladen; tatsächlich hätte ihn nichts und niemand dazu gebracht, diesen Schritt überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, wenn ihn nicht die grausamen Umstände in diese harte Lage gebracht hätten. Seine Verhältnisse hatten ein Stadium erreicht, in dem Geld einfach irgendwo herkommen musste – wie auch immer. Er und seine Mutter hatten seit Jahren sozusagen von der Hand in den Mund gelebt und hatten dabei auch noch den Schein wahren müssen, was sogar für Menschen mit freundlichem Naturell manchmal bitter ist. Es stimmte, dass Lady Anstruthers auf dem Lande in so knauseriger Weise lebte, wie es nur eben möglich war. Sie hatte ihr Leben auf das absolut Nötigste eingeschränkt und hielt gleichzeitig gegenüber den Menschen, die sie trafen, von der kärglichen Dienerschaft bis zum Dorf, dem Pfarrer und seiner Frau und den wenigen weit entfernten Nachbarn, die vielleicht einmal im Jahr herüberfuhren, um einen Besuch zu machen oder wenigstens eine Karte dazulassen, eine furchtbar strenge, schroffe Fassade aufrecht. Sie war eine alte Frau, so wenig anziehend, dass sie keine Schwierigkeiten hatte, ihren Bekanntenkreis kleinzuhalten. Ihre unvorteilhafte Garderobe, die sie im Laufe der Jahre erstanden hatte, wurde von der Schneiderin im Dorf wieder und wieder neu zurechtgenäht. Sie trug armselige alte Seidenkleider mit entsetzlichen Hauben und Umhängen, an denen rostige Fransen und Signalhorn-Perlen baumelten, aber diese minderten nicht im Geringsten die unbeirrbare Arroganz ihres Wesens, noch dämpften sie die schlichtweg intolerante Grobheit, die sie für Leute ihres Schlages für angemessen hielt. Wobei sie natürlich nicht der Meinung war, dass es viele Leute ihres Schlages gab.
Dass die Gesellschaft an dieser Tatsache Gefallen fand, zeige einfach nur, wie minderwertig und närrisch sie war. Während sie sich einschränkte und ihre wenigen Dienstboten in Stornham herumkommandierte, war es natürlich notwendig, dass sich Sir Nigel in der Stadt sehen ließ und sich dabei so anständig wie möglich präsentierte. Seine Eitelkeit war von viel zu großer Arroganz, als dass er sich erlaubt hätte, die große Welt hinter sich zu lassen, die er sich im Grunde gar nicht leisten konnte. Dass man ihn vergessen oder ignoriert hätte, wäre für ihn unerträglich gewesen. Für ein paar Jahre wurde er noch in den guten Häusern zum Dinner eingeladen und konnte in Schieß- und Jagdgesellschaften die Gastfreundschaft seiner Bekannten genießen. Aber ein Mann, der Gastfreundschaft nicht erwidern kann, wird herausfinden, dass er nicht bis zum Ende seines Lebens Nutzen daraus ziehen kann, wenn er nicht eine ausgesprochen einnehmende Persönlichkeit hat. Sir Nigel Anstruthers hatte keine einnehmende Persönlichkeit. Er verschwendete nie einen Gedanken an die Bequemlichkeit oder das Interesse eines anderen Menschen als seiner selbst. Außerdem ließ er sich von einem üblen Jähzorn leiten. Wann immer er diesem nachgab, zeigte sich, dass Sir Nigel ihn nicht einmal dann kontrollieren konnte, wenn seine Wut ihm eindeutig schadete.
Als man merkte, dass er keine Gegengabe hatte für das, was er nahm, hörte man nach und nach auf, sich an seine Existenz zu erinnern. Den Handelsleuten, die er von oben herab behandelt hatte, wurde bald klar, dass er die Sorte Mann war, die man immer wieder zu mahnen hatte, und dass man das auch unbedingt tun sollte, und deswegen machten sie ihm das Leben zur Hölle. In seinen Clubs war er nie ein Mitglied gewesen, das von allen herzlich begrüßt wurde und über dessen Erscheinen sich jedermann freute. Mit der Zeit bekam er das ungute Gefühl, dass man ihn eher mied, und er versuchte seine Würde zu wahren, indem er sich übellaunig gab und bissige Bemerkungen machte, wenn man sich ihm näherte. Wenn der Druck dieser Umstände ihn manchmal dazu zwang, nach Stornham zu fahren, so fand er die Aussichten dort noch düsterer.
Lady Anstruthers führte ihm die Unfruchtbarkeit seines Anwesens vor Augen, ohne auch nur den Versuch zu machen, die unangenehme Situation ein wenig milder darzustellen. Wenn er herumschleichen und trübsinnig dreinschauen konnte, so konnte sie stillsitzen und seine Aufmerksamkeit auf unangenehme Wahrheiten lenken, die er einfach nicht zu leugnen im Stande war. Sie konnte ihn darauf hinweisen, dass er kein Geld hatte und dass die Pächter nicht in Häusern wohnen wollten, die vollkommen verfielen, und auch kein Land bearbeiten wollten, das ausgehungert war. Sie konnte ihm genau sagen, wie viel Zeit vergangen war, seit die letzten Löhne gezahlt und seit Rechnungen beglichen worden waren. Und sie hatte eine ganz reizend unbefangene Art, diese unerträglichen Dinge klarzumachen, so wie sie sie formulierte.
»Du stellst das Ganze so unerfreulich dar, wie du nur kannst«, knurrte Nigel dann wütend.
»Ich nenne nur die reinen Fakten«, antwortete sie mit beißender Gelassenheit.
Ein Mann, der sein Anwesen nicht erhalten noch seinen Schneider und seine Wohnung in der Stadt bezahlen kann, ist in einer Notlage, die ihn völlig verzweifeln lassen könnte. Also borgte sich Sir Nigel Anstruthers etwas Geld, fuhr nach New York und machte der lieben kleinen dummen Rosalie Vanderpoel den Hof.
Aber die ganze Angelegenheit war unerwartet enttäuschend, und überall ergaben sich Irritationen. Er fand sich einer Sachlage gegenüber, die er sich so nicht vorgestellt hatte. In England konnten, wenn ein Mann heiratete, gewisse praktische Dinge von Anwälten überprüft und arrangiert werden: die Höhe des Vermögens, das die Braut erhalten würde, die Stellung des Bräutigams, was Geldfragen anging. Um es einfach auszudrücken, ein Mann fand schnell heraus, wo er stand und was er dabei verdienen würde. Aber Sir Nigel merkte nach und nach, zunächst zu seiner bitteren Belustigung und später zu seinem empörten Verdruss, dass die Amerikaner, was Heiraten anging, eine naive Tendenz zeigten, an sentimentale Gefühle der beiden Beteiligten zu glauben. Die allgemeine Ansicht schien zu sein, dass ein Mann ausschließlich um der Liebe willen heiratete und dass seine Feinfühligkeit es ihm unmöglich machte, Fragen danach zu stellen, was den Eltern der Braut zur Verfügung stand, um es ihm als eine Art Abfindung für den Verlust seines Junggesellenstatus auszuhändigen. Anstruthers entdeckte diese Tatsache schon, als er noch nicht lange in New York war. Er kam zu dieser Erkenntnis durch eine Art Ausschlussverfahren, indem er zufällige Bemerkungen aufschnappte, die die Menschen um ihn herum fallenließen, indem er rundheraus oder vorsichtig nachfragte, indem er Männer und Frauen dazu brachte, sich über ihren eigenen Standpunkt auszulassen. Millionäre hatten nicht die Absicht, schien es, den Männern, die ihre Töchter heirateten, Unterhaltszahlungen zu machen; es stellte sich heraus, dass es jungen Frauen absolut nicht bewusst war, dass ein Mann großzügig mit Einkommen versorgt werden sollte, wenn er die Pflichten eines Ehemannes übernahm. Wenn reiche Väter Unterhaltszahlungen machten, so gingen diese an ihre Töchter, die damit machen konnten, was ihnen gefiel. In diesem Fall, so legte sich Sir Nigel das im Geheimen zurecht, oblag es natürlich dem Ehemann, zuzusehen, dass das, was seiner Frau gefiel, mit dem übereinstimmte, was er für sinnvoll und richtig hielt.
Am erhellendsten war für ihn gewesen, als er einigen Männern zugehört hatte, nüchternen reichen Börsenmaklern mit einem wirklich vulgären Sinn für Humor, die eines Nachts gellend laut in einem Club über eine Geschichte gelacht hatten, die einer von ihnen erzählte über einen nicht sehr vielversprechenden Schwiegersohn aus Deutschland, der ein Einkommen verlangt hatte. Dieser Mann mit einem niederen Adelstitel hatte die Tochter des Erzählers geheiratet, und nachdem die beiden jungen Leute einige Monate im Haus ihres Schwiegervaters verbracht hatten, hatte der Schwiegersohn es für geboten gehalten, dass seine finanzielle Situation praktisch geklärt werden sollte.
»Er hat sie nach der Hochzeitsreise zu uns zurückgebracht, um uns einen Besuch zu machen«, sagte der Erzähler der Geschichte, ein Mann mit scharfen Gesichtszügen und einem kurios schiefen Mund, auf dem eine ständig unterdrückte Zufriedenheit mit dem Verlauf der Dinge zu liegen schien. »Ich hatte ja nichts dagegen einzuwenden, weil wir alle froh waren, sie daheim wiederzusehen, und ihre Mutter sie schon vermisst hatte. Aber Wochen vergingen, und Monate vergingen, und es wurde gar nicht mehr davon gesprochen, dass sie sich in dem Schlosch niederlassen wollten, von dem wir so oft gehört hatten, und dann kam heraus, dass dieses Schlosch-Dings« – Anstruthers erkannte mit Verbitterung, dass der ›Barbar‹, wie er ihn nannte, ›Schloss‹ meinte und dass seine falsche Aussprache gleichzeitig der Komik und seiner Herablassung geschuldet war – »ihm gar nicht gehörte. Es gehörte seinem älteren Bruder. Die waren alle Grafen, und keiner von ihnen hatte auch nur einen Penny in der Tasche. Der Schlosch-Graf hatte nicht mehr als ein paar Cents und war überhaupt nicht die Sorte Mensch, die davon etwas an seine Familie abgegeben hätte. Also hätte Lilys Graf als Angestellter in einem Kurzwarenladen arbeiten müssen, um sich ein Einkommen zu verdienen. Er hatte aber nicht die Absicht, das zu tun. Er hatte wohl gedacht, er könnte sich ins gemachte Nest setzen. Wir sind natürlich eher von der lockeren Sorte und hätten ihn schon ertragen, wenn er ein netter Kerl gewesen wäre. War er aber nicht. Lilys Mutter fand sie dauernd weinend in ihrem Zimmer, und nach und nach kam heraus, dass das an Adolf lag, der mit ihr gestritten und sich abfällig über ihre Familie geäußert hatte. Als ihre Mutter mit ihm sprach, wurde er ausfallend. Dann kamen die Rechnungen herein, und von Lily hat er wohl erwartet, dass sie mich dazu bringt, sie zu bezahlen. Und das waren keine Rechnungen, die zu bezahlen ein anständiger Kerl von einem anderen Mann verlangen sollte. Aber ich hab’s natürlich fünf-, sechsmal gemacht, um ihr das Leben zu erleichtern. Hab ihr auch nicht gesagt, dass jemandem in meinem Alter die Situation in einem ganz anderen Licht erscheint. Aber das klappte nicht so besonders gut. Er dachte, ich hätte es gemacht, weil ich es machen musste, und er wurde ziemlich leichtsinnig und gab sich keine Mühe mehr, sich ein wenig bedeckt zu halten, als er mir ein neues Päckchen zuschickte. Dann meinte er auch noch, er sei der Herr im Haus. Er machte Andeutungen, dass ihm ja wohl eine Privatkarosse zustünde. Er sagte, er komme sich vor wie ein Bettler, wenn er Rücksicht auf den Rest der Familie nehmen müsse, wenn er ausgehen wolle. Als mir das alles klarwurde, fing ich an, meinen Spaß zu haben. Ich ließ ihn eine Weile machen, nur um einmal zu schauen, wie sich das entwickeln würde. Großer Gott! Ich hätte nie geglaubt, dass irgendjemand sich so dämlich anstellen konnte wie der. Er drehte nach einem Monat völlig durch und behandelte mich von oben herab, als wäre ich ein Stiefelputzer, dem er eine Lehre erteilen müsste. Deswegen habe ich mich schließlich und endlich mit Lily unterhalten und ihr gesagt, jetzt sei aber Schluss. Natürlich hat sie geweint und sich halb zu Tode gefürchtet, aber zu dem Zeitpunkt hatte er sie dermaßen schlecht behandelt, dass sie ihn nur noch loswerden wollte. Also hab ich ihn kommen lassen und ihn mir in meinem Büro einmal vorgeknöpft. Ich ließ ihn erst einmal alles sagen, was er zu sagen hatte. Er erklärte mir, welche Herablassung es doch sei, wenn ein Mann wie er ein Mädchen wie Lily heiratete. Er malte ein gediegenes, anrührendes Bild von all den Nachteilen einer solchen Allianz und all den Vorteilen, die sie zum Ausgleich dafür einem Mann einbringen sollte, der sich darauf eingelassen habe. Ich kratzte mir den Kopf und schaute dann und wann besorgt drein und räusperte mich entschuldigend, um ihn so richtig in Fahrt zu bringen. Ich kann euch sagen, der Kerl war glücklich, absolut glücklich, als er sah, wie demütig ich ihm zuhörte. Er dachte, nun würde sich alles zum Guten wenden, so richtig gut werden. Er schwoll regelrecht an vor lauter Hoffnung und Zufriedenheit. Ich würde zahlen, so wie die vulgären New Yorker Schwiegerväter es tun sollten, und dem lieben Gott für das grandiose Privileg danken. Also, er wurde richtig wortgewaltig, als es um sein blaues Blut und seine Ahnen und das in Ehren ergraute Schlosch ging. Als er schließlich zum Ende kam, habe ich mich noch einmal auf so eine nervöse und schmeichlerische Art geräuspert und ihn ein wenig ängstlich gefragt, was denn ein so niedrig geborener New Yorker Millionär seiner Meinung nach tunlichst unter diesen Umständen machen sollte – was würde er denn für richtig halten?«
Zu Sir Nigels großer Empörung sah er, dass sich der Mund des Erzählers zu einem süßlichen, gerissenen, unterdrückten Grinsen verzog, woraufhin er in das nächstgelegene Gefäß spuckte. Dieses Grinsen wurde mit lautem Lachen von seinen Gefährten beantwortet.
»Was hat er denn gesagt, Stebbins?«, rief jemand.
»Er sagte«, erklärte Mr Stebbins bedächtig, »er sagte, dass eine Unterhaltszahlung ihm doch wohl zustehen würde. Er sagte, dass ein Mann von seinem Rang Kapital brauche und dass es unwürdig für ihn sei, seine Frau oder den Vater seiner Frau um Geld zu bitten, wenn er etwas haben wollte. Er sagte, eine Unterhaltszahlung würde ihm seiner Einschätzung nach zustehen. Dann zwirbelte er seinen Bart und sagte, ›was ich denn so vorschlagen würde‹ – was würde ich ihm denn wohl zukommen lassen?«
Die Zuhörer des Erzählers kannten diesen anscheinend gut. Ihr Gelächter war lauter als zuvor.
»Lass uns mal hören, Joe! Lass hören!«
»Nun«, erwiderte Mr Stebbins nahezu gedankenverloren, »ich bin dann bloß aufgestanden und habe gesagt, es würde nicht lange dauern, diese Frage zu beantworten. Ich hätte immer sehr an meinen Kindern gehangen, und Lily wäre nun mal mein Liebling. Sie hätte immer alles bekommen, was sie sich wünschte, und würde das auch in Zukunft tun. Sie wär ein gutes Mädchen und würde es verdienen. ›Ich gebe Ihnen …‹« Die nachdrückliche amerikanische Dehnung seiner Sprache war kaum zu beschreiben. »›Ich gebe Ihnen jetzt fünf Minuten, aus diesem Zimmer zu verschwinden, bevor ich Sie mit einem Fußtritt hinausbefördere, ich werde Sie die Treppen hinunterwerfen, und wenn ich das geschafft habe, bin ich so richtig in Stimmung, und dann befördere ich Sie mit Fußtritten die Straße hinunter und um den Block herum und bis nach Hoboken, denn Sie werden dort das nächste Dampfschiff nehmen und dahin verschwinden, wo Sie hergekommen sind, bis zu dem Schlosch-Dings oder wie Sie es auch immer nennen. Wir können Ihre Sorte hier absolut nicht brauchen.‹ Und Sie werden es nicht glauben, Gentlemen…«, er schaute mit seinem schiefen Lächeln in die Runde, »der hat die Schiffspassage genommen und ist zurückgegangen. Und Lily lebt bei ihrer Mutter, und ich habe vor, sie bei mir zu behalten.«
Sir Nigel erhob sich und verließ den Club, als die Geschichte beendet war. Er machte einen langen Spaziergang den Broadway hinunter, kaute auf seinen Lippen herum und hielt seinen Kopf hoch erhoben. Er bediente sich mit unterdrückter Stimme immer einmal wieder so manch eines blasphemischen Ausdrucks. Einige davon enthielten Vorwürfe an das Schicksal, andere verfluchten die geschäftsmäßige Grobheit und Beschränktheit anderer Menschen.
»Die wissen ja gar nicht, wovon sie reden«, sagte er. »Das ist mir ja noch nie untergekommen. Was erwarten die eigentlich? So hätte ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Verdammt! Ich stecke wie eine Ratte in der Falle.«
Offensichtlich konnte er seine Vermögensangelegenheiten nicht so regeln, wie er sich das gedacht hatte, als er beschloss, der kleinen, rosigweißen, puppengesichtigen Rosy Vanderpoel den Hof zu machen. Wenn er auch nur den Versuch machen würde, finanzielle Vorteile für sich bei den Familienmitgliedern seiner künftigen Frau zu erwähnen, wenn man ihre Mitgift festlegte, würde er Verdacht erregen, und das würde Erkundigungen nach sich ziehen. Erkundigungen wollte er jedoch in jedem Fall vermeiden, sowohl was seine eigenen Finanzen als auch was sein Vorleben anging. Menschen, die ihn hassten, würden mit Sicherheit plötzlich mit Geschichten über Dinge auftauchen, die man besser ruhen lassen sollte. Es gab immer Narren, die sich bereitwillig in alles einmischten.
Sein Spaziergang war lang und voll wilder Gedanken. Dann und wann, wenn ihm bewusst wurde, wie uneigennützig seine Gefühle eigentlich sein sollten, brach ein kurzes Lachen aus ihm hervor, das doch sehr an das Schnauben der Frau des Bischofs erinnerte.
»Ich soll tatsächlich vollkommen verrückt nach einem amerikanischen Kindchen sein – verrückt nach ihm! Verdammt!« Aber als er in sein Hotel zurückkehrte, hatte er sich eine Entscheidung abgerungen und fing an, die Situation böse und kaltblütig zu betrachten. Die Sache musste jetzt ohne langes Hin und Her erledigt werden, er war gerissen genug, um zu wissen, dass mit seinem übellaunigen Naturell und den verschiedenen Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, ein schüchternes Mädchen leicht zu handhaben sein würde. Er hatte schon in einem frühen Stadium ihrer Bekanntschaft gemerkt, dass Rosy enorm beeindruckt war von der überlegenen Haltung, die er an den Tag legte, dass er sie dazu bringen konnte, vor Verlegenheit zu erröten, indem er sie wissen ließ, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Er konnte sie vollkommen aus der Fassung bringen, wenn er hochmütig und steif reagierte. Das Waffenarsenal eines Mannes war bestens ausgestattet, wenn er einer Frau das Gefühl von Unbeholfenheit vermitteln konnte, von Unerfahrenheit und Unzulänglichkeit. Sobald er erst einmal im sicheren Hafen der Ehe angekommen wäre, würde er schon Mittel und Wege finden, dahin zu gelangen, was er für das einzig richtige und brauchbare Ziel hielt.
Wenn er eine Frau mit einem besseren Kopf heiraten würde, wäre es auch schwieriger, sie unter seine Kontrolle zu bringen, aber für Rosalie Vanderpoel musste man sich keine genialen Methoden überlegen. Wenn man sie mit Anklagen, Schmollen und höhnischen Bemerkungen schockierte, verwirrte und einschüchterte, versetzte man ihren armen unschuldigen Kopf in einen solchen Tumult, dass der Rest leicht sein würde. Es war also doch möglich, dass die ganze Sache nicht so teuflisch übel ausgehen würde. Man stelle sich nur vor, ihre Schwester Bettina sei das Mädchen im heiratsfähigen Alter gewesen! Im vollen Bewusstsein all der Gründe zur Freude, dass sie es nicht war, ging er voll finsterer Gedanken heim.
Kapitel III
Die junge Lady Anstruthers
Als die Hochzeit stattfand, wurde das große Ereignis mit einer unschuldigen, freudig erregten Fanfare von Trompeten begleitet. Miss Vanderpoels Kleider waren zahlreich und wundervoll, wie auch ihre Juwelen, die man bei Tiffany’s gekauft hatte. Sie nahm tausend Truhen mit über den Atlantik – also in etwa tausend. Als das Schiff sich dampfend vom Dock entfernte, sah der Kai aus wie ein Blumengarten angesichts der Farbenpracht der glanzvollen und feinen Kleidung, die Verwandte und Freunde trugen, die ihr mit ihren Taschentüchern winkten und lachend gute Abschiedswünsche zuriefen.
Sir Nigels Einstellung dagegen war weder mitfühlend noch bewundernd, als er an der Seite seiner Braut stand und zurückschaute. Wenn Rosys halb glückliche, halb tränenvolle Aufregung ihr die Möglichkeit gelassen hätte, über seinen Gesichtsausdruck nachzudenken, hätte sie ihn nicht unbedingt ermutigend gefunden.
»Was machen die Amerikaner nur für ein verdammtes Theater«, sagte er, noch bevor sie außerhalb der Reichweite der vielen Stimmen waren. »Es wird wahrlich regelrecht erholsam sein, sich in einem Land aufzuhalten, wo die Frauen nicht vor Lachen gackern und kreischen.«
Er sagte das mit der schlichten Grobheit, die manchmal nahezu unpersönlich zu sein schien; Rosalie hatte sich immer versucht einzureden, sie ergebe sich aus dem kühlen britischen Humor. Aber diesmal erschrak sie ein wenig bei seinen Worten.
»Kann schon sein, dass wir ein wenig mehr Lärm machen als Engländer«, gab sie etwa eine Sekunde später zu. »Ich frage mich bloß, warum?« Und ohne auf eine Antwort zu warten – so, als hätte sie keine erwartet oder keine gewollt –, lehnte sie sich ein wenig weiter über die Reling, um zurückzuschauen, winkte mit ihrem kleinen, flatternden Taschentuch den vielen Menschen und dem Tumult auf dem Kai zu. Sie war nicht scharfsinnig oder schnell genug, um beleidigt zu sein oder zu erkennen, dass diese Bemerkung von Bedeutung sein könnte und dass Sir Nigel bereits mit einer Strategie begonnen hatte, die er fortführen würde. Es war keineswegs seine Absicht, die Rolle eines amerikanischen Ehemannes zu übernehmen, der ganz offensichtlich über keinen Deut Autorität verfügte. Amerikaner ließen ihre Gattinnen alles Mögliche sagen und tun und brachten es tatsächlich fertig, ihnen Dinge zu holen oder zu tragen. Er hatte einen Mann gesehen, der die Treppe hinaufgerannt war, um seiner Frau ihren Umhang zu holen, bester Laune, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass dieser Service die Aufgabe eines Laufburschen war, wenn man einen im Hause hatte, oder eines Dienstmädchens, wenn das nicht der Fall war. Sir Nigel war in den guten alten Tagen der frühviktorianischen Zeit aufgewachsen, als »eine nette kleine Frau, die dir die Hausschuhe holt« in bestimmten Kreisen eine Umschreibung für häusliches Glück war. Mädchen wurden dazu erzogen, Hausschuhe zu holen, so wie man Retriever dazu abrichtete, ins Wasser zu gehen, um Stöckchen zu holen, und Terriern beibrachte, Bälle zurückzubringen.
Es sollte sich noch zeigen, dass die neue Lady Anstruthers mehrere Gelegenheiten hatte, zu einer neuen Sicht auf den Charakter ihres Ehemannes zu gelangen, bevor ihre Reise über den Atlantik vorüber war. Zu jener Zeit, als das Weben des Pendelverkehrs noch langsamer und mühsamer war, wusste die Welt noch nichts von den Möglichkeiten, die die ganz schnellen Schiffe einmal bieten würden. Eine Reise über den Atlantik gewährte einer Braut und einem Bräutigam ausreichend Zeit, um einen Blick in die Zukunft zu werfen, der sie schon ahnen ließ, dass ihre Hochzeitsreise zu Ende gehen würde, und das insbesondere, wenn sie nicht seefest waren, so dass sie schon bald zu wünschen begannen, zumindest die erste Hälfte wäre bald vorüber. Rosalie war der Reise nicht überdrüssig, aber sie begann, sich verunsichert zu fühlen. Da sie nie ein besonders kluges Mädchen oder von besonders schneller Auffassungsgabe gewesen war und ihr ganzes Leben unter amerikanischen Männern verbracht hatte, die Frauen gern verwöhnten, kannte sie keine Präzedenzfälle, die ihre Situation zu erklären vermocht hätten. Als Sir Nigel zum ersten Mal einen Wutanfall bekam, starrte sie ihn nur mit Augen an, die die eines verblüfften, verwunderten Kindes hätten sein können. Dann ließ sie ihr nervöses kleines Lachen hören, weil sie nicht wusste, was sie sonst hätte tun können. Bei seinem zweiten Ausbruch war ihr Blick eher verschreckt, und sie lachte nicht mehr.
Dann wurden ihr langsam voll Angst gewisse Stimmungen von Schwermut bewusst oder solche, die wie Schwermut wirkten, zu denen er eine gewisse Neigung zeigte. Wenn sie in ihrem Liegestuhl auf Deck lag, marschierte er manchmal mit steifem Rücken auf dem Schiff auf und ab, anscheinend ohne irgendeine andere Existenz wahrzunehmen als seine eigene, mit einem Gesichtsausdruck, der irgendwie trüben Groll auszudrücken schien, dessen Unerklärlichkeit sie insgeheim in Furcht versetzte. Sie war nicht klug genug, das arme Mädchen, ihn einfach in Ruhe zu lassen, und wenn sie mit unschuldigen Fragen versuchte herauszubringen, warum er so schlechter Laune war, wunderte sie sich immer darüber, dass er die Macht hatte, ihr zu vermitteln, dass sie sich ihm gegenüber Freiheiten herausnahm und einen Mangel an Takt und Weitsicht zeigte.
»Ist etwas, Nigel?«, fragte sie anfangs, wobei sie überlegte, ob es wohl albern wäre, wenn sie ihre Hand in die seine gleiten ließe. Es wurde ihr klar, dass sie mit ihren Befürchtungen ganz richtig lag, als er ihr seine Antwort gab.
»Nein«, sagte er abweisend.
»Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist nicht glücklich«, erwiderte sie. »Du bist irgendwie so – so anders.«
»Ich habe auch allen Grund, niedergeschlagen zu sein«, meinte er daraufhin, und das mit einer steifen Endgültigkeit, die den Klang einer Warnung hatte und zu erkennen gab, dass es besser wäre, wenn sie so viel Takt an den Tag legen würde, ihre naiven Bemühungen einzustellen.
Sie hatte das vage Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, und ihm war es ganz recht, dass sie so dachte. Es war die beste Vorbereitung für all die Launen, die ihm in Zukunft noch zum Vorteil gereichen würden. Er setzte sich nämlich zu dieser Zeit voller Selbstverachtung mit seiner aktuellen Position auseinander. Er hatte sie im Schlepptau und kam zu seinen Verwandten zurück, ohne irgendeinen Vorteil vorweisen zu können, der sich aus seiner Heirat ergeben hätte. Man hatte ihr ein Einkommen überschrieben, aber er hatte keine Kontrolle darüber. Das wäre anders gewesen, wäre er nicht in einer derart üblen Lage gewesen, dass er Angst hatte, seine Chancen aufs Spiel zu setzen, wenn er sich gegen die jetzige Situation gewehrt hätte. Eine Ehefrau zu haben, die Geld hatte und ein etwas dümmliches, freundliches Naturell ohne eigenen Willen, war natürlich besser, als ohne einen Penny dazustehen, bis über beide Ohren in Schulden zu stecken und von allen Seiten von Schwierigkeiten bedrängt zu werden. Er hatte Frauen kennengelernt, die man dazu gebracht hatte, lieber ständig nachzugeben, als in der Öffentlichkeit schikaniert zu werden, und die im Endeffekt jeder Forderung entsprachen, wenn sie nur nicht die Schande ertragen mussten, die eine gewisse Art von Szene vor den Bediensteten oder unverfrorene Frechheiten vor Verwandten oder Gästen mit sich brachten. Die Eigenschaft, die ihn bei Rosalie fast um den Verstand brachte, war ihr gänzlich fehlendes Bewusstsein dafür, dass es vollkommen natürlich und korrekt wäre, wenn ihr Geld in den Händen ihres Gatten läge. Er hatte doch wirklich in diesen frühen Tagen ihrer Ehe schon einen vorsichtigen Versuch gemacht und ihr suggeriert, dass es so sein müsste; er hatte ihr Möglichkeiten eröffnet, ihm die Gelegenheit zu geben, die Dinge auf eine praktische Basis zu stellen, aber sie hatte nie die Intelligenz aufgebracht, zu erkennen, was er andeutete, und er hatte sich in seinen Bemerkungen schon geradezu peinlich abstrampeln müssen, während sie ihn ohne zu verstehen mit ihren naiven, ängstlichen blauen Augen anschaute. Dieses Geschöpf versuchte ihn ernstlich zu verstehen und schaffte es nicht. Das war wirklich das Schlimmste: die blanke Wand ihres Unverständnisses, ihr kindlicher Glaube, dass er eine viel zu grandiose Person war, als dass er jemals irgendetwas gebraucht hätte. Das waren die Gedanken, die ihn beschäftigten, als er in wenig liebenswürdiger Einsamkeit auf Deck auf und ab ging. Rosy wurde nach und nach bewusst, dass er, anstatt sich über ihre luxuriöse und hübsche Kleidung und Ausstattung zu freuen, diese nicht leiden konnte und zu verachten schien.
»Ihr Amerikanerinnen wechselt eure Kleider zu oft und denkt überhaupt viel zu viel darüber nach«, war einer seiner ersten freundlichen Kritikpunkte. »Ihr gebt mehr Geld für Kleider und Hauben aus, als es sich für wohlerzogene Frauen gehört. In New York fällt Engländern immer auf, dass die Frauen festtäglich angezogen sind, zu welcher Zeit auch immer man ihnen über den Weg läuft.«
»Oh, Nigel!«, rief Rosy traurig. Ihr fiel nichts ein, was sie noch hätte sagen können. »Oh, Nigel!«
»Ich bedaure ja, dass ich das sagen muss«, erwiderte er hochmütig. Dass sie Amerikanerin und New Yorkerin war, wurde der armen kleinen Lady Anstruthers auf eine neue Art vor Augen geführt – irgendwie so, als enthalte das reine kalte Feststellen des Faktums einen Hauch von Sarkasmus. Sie war zu unschuldig in ihrer Loyalität, als dass sie gewünscht hätte, sie sei weder das eine noch das andere, aber es wäre ihr doch lieber gewesen, wenn Nigel nicht so voller Vorurteile gegen Orte und Menschen gewesen wäre, die ihr so viel bedeuteten.
Sie saß in ihrer Suite, eingehüllt in einen Morgenrock, der mit Kaskaden aus Spitze verziert war und mit einem bestickten Band zusammengehalten wurde, und ihre Zofe Hannah, die sie sehr bewunderte, bürstete ihr blondes langes Haar mit einer mit Gold eingefassten Bürste, die ihr Monogramm aus Edelsteinen trug.