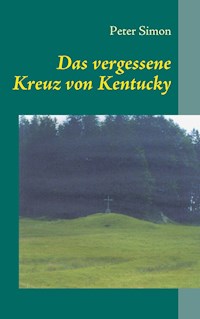
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während des Zweiten Weltkriegs fristet ein deutscher Soldat sein Dasein in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Inhaftiert in einem Gefangenenlager in Fort Knox, Kentucky, stößt er bei Rodungsarbeiten auf ein geheimnisvolles Kreuz, welches ihn auf sonderbare Weise berührt - er spürt, dass seine Vergangenheit und sein Schicksal eng mit diesem Kreuz verbunden sind ... Eine wahre Geschichte, die fließend in einen Roman übergeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für meinen Vater
dein Sohn
Peter
Originalzeichnung (Deckblatt des Manuskripts) von 1956
Krieg ist das abscheulichste Verbrechen,
das die Menschen sich selbst auferlegt haben.
In der Hoffnung,
dass in der Zukunft die Vernunft
immer der Sieger bleiben wird.
Peter Simon
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Autor
Kurzvita und meine Bücher
Inhalt
Vorwort
zur Geschichte meines Vaters als er Gefangener im 2. Weltkrieg war
Mein Vater kam als junger Soldat im Alter von 22 Jahren als Gefreiter an die Front.
Während eines Gefechts in der Eifel wurde er durch die US-Armee gefangen genommen. Mein Vater gehörte zu einer Fallschirmjägereinheit und wurde noch in der Nähe der Front von Offizieren der US-Armee verhört. Nach dem Verhör wurde er weit zurück hinter die Kampflinie transportiert. Später wurde er mit vielen seiner überlebenden Kameraden in einem großen Gefangenentransport nach Cherbourg in Frankreich gebracht, wo er dann zunächst in französische Kriegsgefangenschaft genommen wurde. Dort wurden sie nach ihren ehemaligen Waffengattungen aussortiert. Mein Vater kam mit Kameraden der Luftwaffe und der Marine in ein weiteres Gefangenenlager in Frankreich.
Etwa im Herbst 1944 wurde er mit vielen anderen seiner Kameraden im Hafen von Bolbec, einer Stadt in der Normandie nordöstlich von Le Havre, auf ein Schiff gebracht. Aufgrund der ständigen Transporte und Inhaftierungen waren sie ausgehungert, verdreckt und verlaust, als sie auf diesem Schiff landeten. Wie er erst später erfuhr, handelte es sich bei diesem Schiff um die „Queen Mary“. Erst hier erfuhr er, dass er nach Amerika transportiert wird. Da mein Vater und seine Kameraden zu einer Spezialtruppe gehört hatten, wollten die Amerikaner diese außerhalb der Reichweite von Deutschland haben.
Auf der „Queen Mary“ erhielten sie erstmals guten Kaffee und gutes Essen. Sie waren überrascht, als sie nach vielen Tagen auf hoher See in New York ankamen. Denn die Einstellung zu den amerikanischen Soldaten, die sie infolge der Kriegspropaganda als böse Unmenschen betrachtet hatten, entwickelte sich zum Positiven. Die Amerikaner versorgten ihre Gefangenen mit ausreichend Nahrung und behandelten sie gut.
Nach der Ankunft in New York kam mein Vater zunächst für kurze Zeit (ca. 6 bis 8 Wochen) mit etwa 1000 weiteren Kameraden in das Camp Atterbury, Indiana, in der Nähe von Indianapolis. Dort wurden sie mit Kaffee und Kuchen empfangen und konnten erst gar nicht verstehen, was mit ihnen geschieht. Von diesem Lager aus hatte mein Vater auch zum ersten Mal die Möglichkeit an seine Familie in der Heimat eine Mitteilung zu schicken, die ihn bis zu diesem Zeitpunkt für vermisst hielt.
Vom Camp Atterbury wurde Vater in das Camp Fort Knox bei Louisville in Kentucky transportiert. Dort lebte er mit seinen Kameraden in Baracken, die sich nicht von den Unterkünften der amerikanischen Soldaten unterschieden. Jegliche Arbeit machten die Gefangenen dort ohne Zwang. Vaters Arbeit begann in einer Heißmangelstube. Es war eine Wäscherei der amerikanischen Soldaten. Die Gefangenen trugen auch bald keine deutsche Uniform mehr, sondern wurden mit Khakijacken und entsprechenden Khakihosen aus Militärbeständen der US-Armee neu eingekleidet. Die Jacken waren jedoch auf dem Rücken und die Hosen an den Beinen mit „POW“ gekennzeichnet. „POW“ bedeutete Prisoner of War – Kriegsgefangener.
Vater hatte sich sehr schnell an seine Situation angepasst, zumal er auch Kontakte zu den dortigen Farmern aufbauen konnte, bei denen er als Erntehelfer (Tomaten-, Gemüse-, Bohnen- und Tabakfarmen) eingesetzt wurde. Die Behandlung der Gefangenen durch ihre Bewacher im Lager und auf den Farmen war gut. Sie wurden als Menschen und nicht mehr als Kriegsgegner behandelt. Aus dieser Zeit existiert heute noch eine kleine Ausgabe des „Neuen Testaments“, das ihm dort ausgehändigt wurde.
In der Freizeit konnten die Gefangenen den Sportplatz benutzen und hatten sogar eine eigene Theatergruppe gebildet.
Obwohl der Krieg schon zu Ende war, musste mein Vater fast noch ein Jahr in Amerika in der Gefangenschaft bleiben. Er wäre auch anschließend am liebsten ganz in den Staaten geblieben. Aber die Vorschriften ließen dies nicht zu und so wurde er Anfang 1946 wieder zurück nach Europa gebracht – zunächst wieder in ein französisches Lager, wo allen Entlassenen die guten Kleider wieder abgenommen wurden und wo sie auch nur unzureichendes Essen erhielten. Abgemagert und ausgehungert kam er dann einige Monate später nach Deutschland, ins damalige Saargebiet, zu seinen Eltern zurück.
Am 7. April 1947 heiratete mein Vater meine Mutter Edith. In den Jahren 1948, 1951 und 1955 wurden die Söhne Gerd, Peter und Edgar geboren. Vater wurde nach dem Krieg Polizeibeamter und ging als Polizeihauptmeister in den Ruhestand.
1956 begann mein Vater seinen Roman, „Das vergessene Kreuz von Kentucky“ zu schreiben. Der Roman handelt unter anderem von ehemaligen Auswanderern, die ihr Glück in der Neuen Welt suchten, von der Zeit seiner Gefangenschaft im Camp Fort Knox, von einem Kreuz, das er bei Rodungsarbeiten im Spätherbst 1945 auf einer Farm (namens Johannafarm) in der Kennedy-Road der amerikanischen Stadt Brandenburg gefunden hatte, von seiner Entlassung in die Heimat, sowie seiner späteren Rückkehr nach Kentucky, um das Geheimnis des Kreuzes zu lüften. Der Roman beginnt in einer Bar dieser Stadt Brandenburg, im nördlichen Gebiet von Kentucky.
Am 9. Oktober 2001 verstarb mein Vater. Er hinterließ mir seinen wenige Seiten umfassenden Romanentwurf von 1956 und die Aufzeichnungen über seine Zeit als Kriegsgefangener. Diese Aufzeichnungen hatte er erst Mitte der 90er Jahre verfasst. Den Romanentwurf und die Aufzeichnungen fasste ich zusammen und schrieb daraus dieses Vorwort. In seinen Aufzeichnungen hat mein Vater nur selten ein genaues Datum oder genaue Ortsbeschreibungen genannt. Viele seiner Ausdrücke und Ausführungen habe ich auch wörtlich von ihm übernommen, um dem Leser einen besseren Eindruck vermitteln zu können, wie er über diese Zeit dachte, wie er in dieser Zeit lebte und wie er diese Zeit in Erinnerung behielt. Den Roman ergänzte ich mit kleinen Familiengeschichten und Episoden. Deshalb beinhaltet dieser Roman tatsächlich Erlebtes meines Vaters während seiner Gefangenschaft und wahre Geschichten unserer Familie.
Aus gesundheitlichen Gründen war es meinem Vater nicht mehr möglich, tatsächlich noch einmal zurück nach Fort Knox zu reisen. Deshalb wollte ich ihm seinen Traum auf diese Weise erfüllen und schrieb seinen Roman zu Ende.
Dörrenbach, im Oktober 2013
Kapitel 1
Vor der unerträglichen Hitze, die auf die Städte, Dörfer und Farmen von Kentucky in diesem Spätsommermonat September unerbittlich nieder brannte, versuchten die Straßenpassanten in die mehr oder weniger kühlen Kneipen zu flüchten. Der Verkehr in den Straßen, soweit man davon überhaupt reden konnte, war regelrecht durch die Trägheit des Tages lahmgelegt. Jeder ging nur mit Widerwillen seinem täglichen Tun nach und suchte sich einen kühlen Platz, egal wo.
In der Kennedy-Road der amerikanischen Stadt Brandenburg war an diesem Tag und bei dieser Hitze kaum noch eine Menschenseele zu sehen, nicht einmal in den sonst mehr oder weniger überfüllten Geschäften. Alle suchten den labenden Schatten oder begaben sich in irgendeine Bar, um sich den ausgedörrten Gaumen etwas anfeuchten zu können.
Die Prohibition, also das Verbot der Alkoholherstellung und des Alkoholverkaufs war zwar in ganz Amerika seit 1933 wieder abgeschafft, doch während der heißen Monate begnügte man sich in der Regel besser mit anderen Getränken und legte sich selbst ein Alkoholverbot auf. Die Hauptsache war, dass man eine wohltuende Feuchtigkeit bei diesen Temperaturen zu sich nehmen konnte.
Kentucky, auch Bluegrass State genannt, weil in der Hauptblütezeit im Mai ein großer Bereich des Grases eine bläuliche Färbung annimmt, heißt auch „Das Tor zum Westen“, da der Cumberland Gap Pass in den Appalachen die Schlüsselstelle für die vielen Siedler war, die dort Ende des 18. Jahrhunderts angekommen sind.
Schwerpunktmäßig wurde in dieser Gegend Mais, Tabak, Weizen und Baumwolle angebaut, vereinzelt wurde auch Öl gefördert. Neben diesen hauptsächlichen landwirtschaftlichen Produkten war die Pferdeindustrie eine der wichtigsten Stütze dieses Staates.
Viele Jahr zuvor wurden die letzten Indianer aus ihren Wäldern vertrieben. Sie mussten einer moderneren Welt weichen. Das Kriegsbeil sollte für immer und ewig begraben sein und kein Ureinwohner wagte es mehr, sich gegen die weißen Männer aufzulehnen, die die Wälder ihrer Ahnen rücksichtslos rodeten, Äcker anlegten und das Land so bebauten, wie sie es wollten. Am Anfang errichteten sie Blockhütten, später wuchsen dazwischen ein- und zweistöckige Häuser, die von reichen Abenteurern, Auswanderern und von Siedlern, die hauptsächlich aus dem fernen Europa kamen, erbaut wurden.
Die einfachen Blockhütten verschwanden dann nach und nach. Viele Geldherren suchten nun ihr Glück in der damals noch dünn besiedelten Gegend und versuchten, ihr zum Teil schmutziges Geld an den Mann zu bringen.
1792 wurde Kentucky schließlich 15. Staat von Amerika.
Heute, viele Jahre später, nachdem ich aus dem Zug ausgestiegen und froh darüber war, endlich die lange Bahnfahrt von New York hierher hinter mir zu haben, schlenderte ich durch die brütende Hitze. Nach einiger Zeit gelangte ich in eine Kneipe, die mit Durstigen gut gefüllt war. Meine Erscheinung erregte etwas Aufsehen, da man mir wohl sofort anmerkte, dass ich einer war, der nicht aus dieser Gegend zu kommen schien.
Der Schweiß lief mir in Strömen an den Schläfen und am Rücken herunter. Am Eingang der Kneipe, gleich hinter den für dieses Land so typischen Schwingtüren, schaute ich mich nach einem geeigneten Platz um.
Direkt neben dem Eingangsbereich sah ich einen kleinen runden, aus massivem Eichenholz gezimmerten rustikalen Tisch. Von diesem Platz aus konnte man leicht durch die niedrigen, von Zigaretten- und Zigarrenrauch getrübten Fensterscheiben auf die Straße und auf das dortige Treiben sehen.
Es saß aber noch ein alter, bärtiger Mann an diesem Tisch. Ich fragte diesen deshalb, ob gegenüber von ihm der Platz noch frei sei. Daraufhin schaute er nur kurz auf, musterte mich aber intensiv und mit einem kleinen Kopfnicken erlaubte er mir dann, mich zu ihm an den Tisch zu setzen. Mit der linken Hand wischte er sodann lässig über die Tischplatte, dass man fast meinen konnte, er hätte einen langen Bart vom Tisch geschoben, um mir dann gebieterisch meinen Platz anzuweisen.
Dieser alte Mann faszinierte mich auf Anhieb. So wie ich ihn nach meinem ersten Eindruck einschätzte, musste auf seinen Schultern einstmals eine sehr schwere Last gelegen haben.
Sein Gesicht war durchfurcht von langen geschlängelten Linien. Seinen massigen Körper konnte man leicht mit einem Riesen vergleichen. Seine Hände zeugten von einer ehemals starken Kraft, die jedoch durch sein Alter vermutlich deutlich nachgelassen hatte. Sein raues Aussehen, das durch die derbe Kleidung bekräftigt wurde, wurde jedoch gemildert durch den gutmütigen, ja man konnte fast meinen sanften und herzlichen Blick, den er mir nun zuwarf.
Nachdem ich mich ihm gesetzt hatte, musterte er mich noch einmal einen kurzen Augenblick mit seinen scharfen Augen und ich fühlte mich dabei so, als könne er direkt in meine Seele sehen. Ich hielt diesem Blick mit einem leichten Unwohlsein stand. Der alte Mann nickte mir aber befriedigend zu. Ich rückte meinen Stuhl zurecht, so, dass ich gleichzeitig die Bar im Auge hatte und auch auf die Straße schauen konnte.
In etwas höflicher Zurückhaltung stand neben mir auch schon ein hübsches Mädchen, um mich nach meinem Getränkewunsch zu fragen. Ich musterte sie mit einem, wie ich meinte, Kennerblick und stellte aber gleichzeitig fest, dass dieses Mädchen eigentlich viel zu schade für eine solche Kneipe war. Sie mag etwa fünfzehn Jahre alt gewesen sein und hatte trotzdem ein reifes Aussehen.
Der Alte erhob sein ergrautes Haupt und mit seiner rauen und gleichzeitig ruhigen Stimme sagte er dem Mädchen, ohne mich vorher zu fragen: „Bring dem Fremden etwas zu trinken. Der ist ja bestimmt schon bis zu den Knochen ausgedörrt. Für mich, kleine Lona“, ergänzte er nach einem kurzen Augenblick, „kannst du auch etwas mitbringen. Du weißt ja schon, mein Stammgetränk.“
Lona wie das Mädchen demnach hieß, machte einen kleinen Knicks und lief eilig davon, um die bestellten Getränke zu holen.
„Lona ist doch ein nettes Dingelchen“, erklärte mir der Alte, obwohl ich, außer nach dem freien Platz an seinem Tisch zu fragen, noch nichts zu ihm gesagt hatte. „Sie ist die Enkeltochter eines alten Freundes von mir. Leider musste ihr Vater seine Farm, sie war nördlich hier von Brandenburg, aufgeben, weil seine Spielleidenschaft alles was er hatte, hinwegraffte. Und irgendwann später einmal hatte er sich dann auch noch tot gesoffen.“
Da war ich doch sehr überrascht, dass dieser alte, gutmütig aussehende Mann meine Heimatsprache fast einwandfrei, doch mit einem eindeutig amerikanischen Akzent sprach. Demnach musste er mich scheinbar auch gleich für einen Deutschen gehalten haben. Denn warum hätte er mich sonst sofort in meiner Sprache angesprochen? Und da war noch ein besonderer Punkt, der mich schnell stutzig machte. Er sprach doch soeben von der Gegend nördlich von Brandenburg. Gerade diese Gegend hatte es mir doch vor über drei Jahrzehnten angetan.
Es war im Jahr 1944, im Spätherbst, da kam ich als Kriegsgefangener der amerikanischen Armee in das Camp Fort Knox und hatte dadurch zwangsläufig die Gelegenheit, Kentucky, oder genauer gesagt, vielmehr nur die Gegend um Fort Knox und um Brandenburg, etwas näher kennenzulernen.
Ein Jahr vorher wurde ich als Zweiundzwanzigjähriger mit mehreren meiner Kameraden in amerikanische Gefangenschaft genommen. Man brachte uns damals in ein provisorisches Lager in der Nähe des Rheins, im Rheinland. Eigentlich war dies kein wirkliches Lager. Es handelte sich vielmehr um ein großes Areal von Wiesen und Ackerflächen, das von einem mehrstufigen Zaun mit Stacheldraht umgrenzt war. An den langen Seiten dieses Areals standen die Wachtürme der amerikanischen Armee, von denen uns die Wachsoldaten mit Maschinengewehren bewaffnet in Schach hielten. Die Wachtürme waren jeweils so aufgestellt, dass die Soldaten von dort einen guten Überblick über das Lager hatten. Auf diesem Areal gab es keine Baracken, keine Toiletten und sonst rein gar nichts, wo man als Gefangener Unterschlupf hätte finden können.
Im Laufe der Zeit fingen einzelne Gruppen von Gefangenen an, sich selbstständig Löcher und Wälle zu graben, in denen und hinter denen sie einigermaßen Schutz vor dem Wetter finden konnten. Jedoch war der Sommer im Jahr meiner Gefangennahme extrem heiß, sodass schon in kurzer Zeit noch nicht einmal mehr Gras auf dem Boden des Lagers vorhanden war. Wir saßen und bewegten uns auf dem blanken Erdboden. Die amerikanische Armee war schon zu diesem Zeitpunkt damit total überfordert, die Gefangenen, inzwischen waren es mehrere Hunderttausend, richtig zu versorgen und unterzubringen. Die Folge davon war, dass unser Lager nach kräftigen Regenschauern nur noch ein einziges Schlammloch war. Einige unserer Kameraden, die sich Erdlöcher gebaut hatten, in denen sie sich zum Schutz vor dem Wetter aufhielten, kamen darin erbärmlich um. Denn der viele Regen hatte zur Folge, dass manche dieser Löcher unter dem Druck des nun nassen Erdreichs einbrachen. Viele Kameraden die nicht mehr rechtzeitig herausgekommen waren, erstickten in den Schlammmassen, ehe wir anderen die Möglichkeit hatten sie wieder auszugraben. Denn zum Graben standen uns keine Spaten oder Schaufeln zur Verfügung. Wir gruben mit unseren bloßen Händen oder setzten das eigene Kochgeschirr ein, soweit dies überhaupt noch vorhanden war.
Auch entstanden in dieser Zeit richtige Machtkämpfe unter den deutschen Soldaten, weil sie nur noch ums nackte Überleben kämpfen mussten. Es bildeten sich regelrechte Banden die versuchten, andere Gruppen von einem vermeintlich besseren Stück Erdboden zu vertreiben.
Darüber hinaus wurden einfache kleinere Löcher in den Boden gegraben, die dann als Toilette benutzt wurden. Dies führte wiederum dazu, dass es im gesamten Lager erbärmlich stank.
Infolge der ständigen Nässe und den zum Himmel schreienden hygienischen Bedingungen erkrankten sehr viele Gefangene an Ruhr. Viele der Erkrankten starben kurze Zeit später daran, da der Nachschub an heilenden und helfenden Medikamenten nicht funktionierte. Selbst das durch die Amerikaner angelieferte Essen reichte schon nach wenigen Wochen nicht mehr aus, um alle Gefangenen richtig und einigermaßen ausreichend zu ernähren. In der Regel gab es nur Suppe mit Geschmack nach Irgendetwas und ab und zu ein Stück Brot, das jeder für sich verteidigen musste, wenn er nicht verhungern wollte. Ganz zu schweigen vom Mangel an Frischwasser. Dies führte dazu, dass in diesem extrem heißen Sommer viele schon alleine an Kreislaufschwäche infolge von Flüssigkeitsmangel starben. Um dieser ganzen Notlage etwas Abhilfe zu schaffen, wurde durch die deutsche Zivilbevölkerung, die in der Nähe des Lagers noch in den Überresten ihrer zerstörten Ortschaften und Häuser lebten, Lebensmittel und Wasser herbeigeschafft, um das Elend der eigenen Landsleute ein wenig zu mildern.
Dieser für die deutschen Soldaten schreckliche Zustand rührte daher, dass die amerikanische Armee mit dem Einmarsch in der Eifel und im Hunsrück zwar viele Gefangene machte, mit diesen Gefangenen jedoch total überfordert war. Auch überraschte es die amerikanische Armee, dass es den deutschen Landsern gar nicht so gut ging, wie es ihnen von ihren Armeeführern zunächst beschrieben worden war. Die GIs merkten schnell, dass sie es hier größtenteils nur mit einfachen, armen und geschundenen Menschen zu tun hatten, die von ihrem Führer dazu gezwungen worden waren, für das Heimatland Deutschland in diesen sinnlosen Krieg zu ziehen. Dort mussten sie unter Einsatz ihres Lebens sinnlose Befehle befolgen.
Mehrere Wochen später, nachdem viele der Kameraden gestorben waren, kamen die überlebende Kriegsgefangene in französische, englische, amerikanische, sibirische oder russische Kriegsgefangenenlager.
Ich hatte das Glück dieses Martyrium ausgehungert und verdreckt überlebt zu haben. Dann kam ich jedoch in einem großen Gefangenentransport in die Hände der französischen Armee. Dort wussten wir lange Zeit nicht, was mit uns passieren würde. Bis wir eines Tages nach Waffengattungen getrennt und sortiert wurden. Ich kam mit etlichen anderen Kameraden der Luftwaffe und der Marine in ein Lager nach Bolbec, in der Nähe von Le Havre. Dort erfuhren wir nun, dass wir wieder in die amerikanische Gefangenschaft übergeben wurden. Wir wurden dann, verdreckt, verlaust und ausgehungert wie wir waren, auf ein großes Schiff gebracht, bei dem es sich, wie ich erst später erfuhr, um die „Queen Mary“ handelte. Wir waren bestimmt eintausend Kameraden und wir waren alle ziemlich hoffnungslos, weil wir zunächst dachten, dass wir nicht mehr lange weiterleben würden.
Doch zu unserer aller Überraschung wurden wir auf diesem Schiff gründlich entlaust. Wir konnten uns verhältnismäßig vernünftig waschen und erhielten außer trockener und sauberer Kleidung zum ersten Mal wieder ausreichend Essen und, was ich nicht vergessen werde, wir erhielten einen guten Bohnenkaffee. Nachdem es uns nun wieder ein klein wenig besser ging, bekamen wir Rasierapparate. Unsere Bärte mussten ab und die Haare mussten radikal kurz geschnitten werden. Im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen und Monaten kamen wir uns vor, als wären wir im Paradies gelandet. Jetzt erst erfuhren wir, warum wir auf dieses Schiff gebracht wurden. Da wir zum Teil zu Spezialeinheiten gehörten, wollte man uns aus Deutschland fort haben. Die Gründe dafür wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich gehörte allerdings zu den Fallschirmjägern. Vor diesen hatten die Amis jedoch reichlich Respekt.
Andererseits waren wir über den Weitertransport auch erfreut, weil wir uns sagten, dass sie uns nicht irgendwohin bringen würden, um uns dann zu erschießen. Das hätten sie bereits früher machen können, wenn sie dies denn wirklich gewollt hätten.
Wir wurden in einer mehrere Tage dauernde Reise über den großen Teich nach New York gebracht. Von dort aus kamen wir nach Indiana, in das für Kriegsgefangene gebaute Camp Atterbury, das in der Nähe von Indianapolis lag. Dort mussten wir zunächst einige Wochen bleiben.
Beim Fußmarsch in dieses Lager waren wir dann doch etwas bedrückt und unsicher. Aber zu unserer aller Überraschung wurden wir im Camp Atterbury schon fast wie Gäste und nicht wie Kriegsgefangene empfangen. Heute noch sehe ich das Eingangstor vor mir, über dem ein großes Schild angebracht war. Auf diesem Schild stand in großen Buchstaben: „Prisoners of War, United States Military Reservation“
In diesem Camp reihten sich rechts und links des Hauptweges und der Seitenwege dutzende Baracken, die für die nächsten Wochen unsere Unterkünfte wurden. An allen Ecken des Lagers standen Türme, auf denen uns Soldaten, mit Maschinengewehren ausgestattet, bewachten. Zusätzlich hatten diese Wachsoldaten noch große und starke Scheinwerfer für die Nacht zur Verfügung. Damit hatten die Bewacher auch bei Dunkelheit eine Übersicht über das gesamte Lager und konnten so auch speziell die Zäune im Auge behalten.
Das Lager selbst war abgeriegelt mit einem relativ einfachen, aber zwei Meter hohen Doppelzaun. Auf diesem bestand allerdings die oberste Reihe aus gefährlichem Stacheldraht. Der Zaun war alle drei Meter durch einen dicken Pfosten im Boden verankert. Am Eingangsbereich des Lagers stand eine kleinere Baracke, in der die Wachsoldaten ihre Pausen verbrachten, wenn sie nicht gerade Dienst auf den Wachtürmen schieben mussten. Unsere Baracken waren alle aus Holz gefertigt. Sie hatten ausreichende Fenster, sodass es darin tagsüber hell genug war. Für uns war es besonders wichtig, dass wir nun wieder richtige Betten für uns zur Verfügung hatten. Es waren keine Feldbetten, nein, es waren richtige feste Betten mit Wolldecken und Kopfkissen. Und um alles dann noch komplett zu machen, hatten wir eine extra Baracke, in der wir uns waschen konnten. In dieser Baracke waren mindestens dreißig Waschbecken aneinandergereiht, dieselbe Anzahl noch einmal direkt gegenüber. Diese Doppelreihe gab es gleich zweimal darin, sodass sich gleichzeitig etwa einhundertzwanzig Mann dort waschen konnten. Die Waschbecken waren einfach, aber zweckmäßig. Jeder hatte sogar einen Spiegel für sich alleine. Wer unser erstes schreckliches Gefangenenlager in der Eifel noch in Erinnerung hatte, der hätte sich auch mit viel weniger zufriedengegeben. In unseren Schlaf- und Aufenthaltsräumen standen unsere Betten nicht direkt nebeneinander, sodass jeder für sich einen kleinen Platz beanspruchen konnte.
Unsere Toiletten waren einfach, aber nicht mehr mit unseren Donnerbalken oder Erdlöchern zu vergleichen. Zugegeben, etwas gewöhnungsbedürftig waren sie schon, denn es konnte keiner die Toilette benutzen, ohne von den anderen dabei gesehen zu werden. Ohne Sichtblenden befanden sich in der Toilettenbaracke etwa zehn Sitztoiletten direkt nebeneinander. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich die Urinalbecken, ebenfalls ohne Sichtschutz. Dies machte aber keinem von uns wirklich etwas aus, weil wir seit geraumer Zeit ganz andere Verhältnisse gewohnt waren und die jetzigen Zustände nun als Bereicherung, ja sogar als Komfort empfanden.
Einige von uns, die gesundheitlich noch einigermaßen in Ordnung waren, wurden kurz nach unserer Ankunft in die Küche abgeordnet, in der in sehr großen Kochtöpfen das Essen für uns zubereitet wurde. Wir erhielten reichlich und ausnahmslos gutes Essen. Dies mussten wir wieder in einer separaten Baracke einnehmen. In einer solchen Baracke standen etwa zwanzig Tische, an denen jeweils acht Mann sitzen konnten. Hier wurde besonders darauf geachtet, dass wir unseren Tisch sauber deckten und diesen auch wieder sauber verließen.
Zu unser aller Überraschung hatten wir in diesem Lager sogar einen Theatersaal. Dort wurden uns auch Spielfilme gezeigt und die eine oder andere Musikshow präsentiert. Ab und zu wurden auch wir durch die Lagerkommandantur aufgefordert, ein Theaterstück einzustudieren und selbst vorzuführen. Dies hatte wohl den Zweck, dass keine Langeweile für uns aufkommen sollte. Wir waren nämlich dann zu beschäftigt, um auf dumme Gedanken, wie Flucht aus dem Lager, zu kommen.
Von diesen Theaterstücken ist mir noch ein Stück ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil wir herzlich lachen konnten und von unserem eigentlichen Schicksal, zumindest für ein paar Stunden, abgelenkt waren.
Vier deutsche Soldaten studierten ein Instrumentalstück ein, in dem diese als Clowns auftraten, von denen jeder ein anderes Musikinstrument spielte, aber keiner von denen wirklich Noten lesen konnte. An einem anderen Abend führten zwei Kameraden ein Theaterstück auf, das uns alle ein wenig melancholisch machte. Es wurde ein Stück aus unserer Heimat gespielt. Ein Stück aus dem Schwarzwald.
Die Kameraden, die länger im Camp Atterbury blieben, gründeten später ihr eigenes Orchester. Diese durften sogar nach Ende der Gefangenschaft die Instrumente mit nach Hause nehmen.
Selbst für unsere Gesundheit wurde gesorgt. So hatten wir nicht nur die Möglichkeit, uns ärztlich versorgen zu lassen, es wurde sogar von der Lagerleitung darauf bestanden, dass wir uns sportlich betätigten. Was lag da näher, als gleich mehrere Fußballgruppen zu gründen, die dann gegeneinander antreten konnten?
Die freie Zeit im Camp Atterbury verbrachten auch manche Kameraden mit Malereien, Schnitzereien und Schreibarbeiten.
Dass gerade die Holzschnitzerei mich später noch beschäftigen und auf mich und mein Leben Einfluss nehmen würde, hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht gedacht.
Um unseren Angehörigen zu Hause mitteilen zu können, dass wir noch am Leben waren, durften wir und das wurde sogar von der Lagerleitung unterstützt, Fotos von einzelnen Kameraden oder Gruppen machen, die dann später mit Unterstützung des Roten Kreuzes nach Deutschland an die Angehörigen geschickt wurden.
Ich schickte über das Rote Kreuz vom Camp Atterbury eine „Message-Express“, wie sie offiziell genannt wurde an meinen Bruder Ernst nach Fischbach, einem kleinen Ort in der Nähe von Saarbrücken, der zum damaligen Zeitpunkt in der französischen Zone lag. Ich hatte nicht viel Platz für meine Nachricht. So blieben mir nur die Sätze: „Meine Lieben, will Euch kurz mitteilen, dass es mir noch gut geht, was ich auch von Euch hoffe. Auf ein baldiges Wiedersehen, Euer Willi.“
Warum ich diese Nachricht damals an meinen Bruder Ernst adressierte, weiß ich selbst nicht mehr. Vielleicht wollte ich meine Eltern nicht beunruhigen und hoffte, dass mein Bruder diese Nachricht meinen Eltern behutsam beibringen könne. Es wusste ja niemand, dass ich in amerikanischer Gefangenschaft war und dass ich mich in Amerika befand. Erst viel später erfuhr ich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt schon als vermisst registriert war und eigentlich niemand mehr damit gerechnet hatte, dass ich je wieder nach Hause kommen würde.
Neue Kriegsgefangene kamen nun fast täglich mit dem Schiff in Amerika an. Diese Gefangenen wurden dann mit der Eisenbahn in die Lager, die über ganz Amerika verteilt waren, weitertransportiert. Da Amerika nicht nur in Deutschland mit der großen Zahl der Kriegsgefangenen überlastet war, wurden eiligst in den verschiedensten amerikanischen Bundesstaaten Gefangenenlager errichtet. Bis zum Ende des Krieges entstanden so etwa einhundert dieser Lager.
Die Gefangenen, die in unser Camp kamen, wurden von uns freudig am Bahnsteig empfangen und gleich befragt was es Neues aus der Heimat gab.
Total überrascht wurden wir in unserem Camp jedoch von der Großzügigkeit der Lagerverwaltung. Diejenigen Gefangenen, die sich nach einer gewissen Zeit immer noch ordnungsgemäß an die Lagervorschriften hielten, bekamen einen Passierschein ausgestellt. Dieser berechtigte sie, natürlich mit einer Aufsicht, in die nahe gelegene Stadt zu gehen. Dort konnten wir dann das Geld ausgeben, das wir bei unseren Arbeitseinsätzen bei den Farmern verdienten.
Ja, wir wurden tatsächlich auch noch für unsere Arbeit bezahlt. Zum Teil erhielten wir Geld, nicht viel, aber zumindest etwas. Zum Teil erhielten wir aber auch „POW scrips“, eine Art Gutschein, den wir im lagereigenen Einkaufsshop gegen Zigaretten oder Limonade einlösen konnten. Einen Teil unseres Geldes mussten wir allerdings auch an die Lagerverwaltung abgeben. Damit trugen wir einen Teil zu unseren Verpflegungskosten bei.
Durch all diese Großzügigkeiten seitens der Verwaltung sahen unsere Baracken schon beinahe heimisch aus. Fast jeder von uns fing an, seinen Platz individuell zu gestalten. Sei es mit selbst gemalten Bildern oder mit Postkarten aus der Heimat, die der eine oder andere in der Zwischenzeit erhalten hatte. Alles wurde dazu verwendet die kahlen Barackenwände zu verzieren.
Aber es wurde auch auf Ordnung und Sauberkeit geachtet. So wurde strengstens darauf bestanden, dass die Baracken täglich gekehrt wurden und dass einmal in der Woche die gesamte Baracke nass ausgewischt wurde. Ganz besonderen Wert wurde auf die Sauberkeit der Toilettenanlagen und der Waschräume gelegt. Da war die Lagerverwaltung sehr penibel und ließ nichts durchgehen. Wenn in diesem Bereich etwas zu beanstanden war, gab es von den Aufsehern so lange kein Pardon, bis der Mangel abgestellt war. Doch schon in unserem eigenen Interesse waren wir deutschen Soldaten für Ordnung und Sauberkeit. Dies hatten wir ja auch schon während unserer Ausbildung gelernt.
Natürlich gab es auch hie und da einmal diverse Streitigkeiten zwischen den Soldaten selbst. Ganz besonderes zwischen den Bewohnern der verschiedenen Baracken. Doch diese Streitigkeiten wurden durch die Lagersprecher, das waren von den deutschen Soldaten gewählte Kameraden jeder einzelnen Baracke, schnell wieder beigelegt und selbst geregelt, sodass die Lagerverwaltung nicht, oder nur selten einschreiten musste.
Aus Dankbarkeit für die gute Behandlung wurde im Lagerinnenhof auf einem großen freien Platz von den Gefangenen die amerikanische Flagge aus vielen kleinen Kieselsteinen zusammengesetzt. Dies wurde von Seiten der Lagerverwaltung wiederum mit Respekt angenommen und positiv registriert.
Insgesamt bestand unser Lager aus etwa einhundert Baracken für die Unterkünfte und aus etwa zwanzig Versorgungsbaracken, die allesamt aus Holz gezimmert worden waren.
Dass es im Camp für uns besonders menschlich zuging, machte eine Geschichte deutlich, die mir noch bestens in Erinnerung geblieben ist.
Nachts wurde in den Baracken durch die Bewacher immer ein Kontrollgang durchgeführt. Alle Gefangenen mussten dann zu diesem Kontrollzeitpunkt in ihren Betten liegen. Eines Abends, einige der Gefangenen schliefen schon, führte ein Aufseher die Kontrolle durch und sah, dass einer der schon fest schlief, seinen Fuß nicht unter der Bettdecke hatte. Der Bewacher ging zu ihm hin und deckte ihn richtig zu. Am nächsten Abend, es hatte der gleiche Aufseher Dienst, musste er zu seiner Überraschung feststellen, dass fast alle Insassen dieser Baracke schliefen, oder sich zumindest schlafend stellten und alle ihre Füße nicht zugedeckt hatten.
In diesem Lager ging es mir sehr gut. Doch nach etlichen Wochen wurde ich mit einigen anderen Kameraden weiter in das Camp nach Fort Knox in Kentucky gebracht. In diesem Kriegsgefangenenlager mussten wir auch arbeiten.
Dort wurde ich in einer großen Wäscherei der US-Armee an der Heißmangel und daneben auch wieder als Erntehelfer eingesetzt.
Bei dem Farmer bei dem ich eingesetzt war, bauten wir damals eine Tomatenfarm auf, die regelrecht aus dem Dickicht gestampft werden musste. Dabei mussten wir auch mehrere Baumriesen umsägen. Doch diesen Auftrag führte ich sehr gerne aus, da ich so durch diese harte Arbeit von meinen Gedanken an die Heimat abgelenkt wurde. Denn das große Heimweh fürchtete ich wie das Fegefeuer.
Die Arbeit machte mir Spaß, weil ich auch eine gute Behandlung durch die Aufseher und die Farmer erfuhr. Wir alle fühlten uns eigentlich schon gar nicht mehr als Kriegsgefangene. Allerdings mussten wir uns immer wieder gegenseitig mit einer großen Schablone die Buchstaben P und W auf den Rücken der Jacke und auf die Rückseite der Hosenbeine aufmalen, sobald diese Buchstaben nicht mehr richtig erkennbar waren. PW stand für „Prisoner of War“. Jeder, ob Zivilist oder Militärangehöriger, konnte uns dadurch natürlich sofort als Gefangener erkennen.
In das Lager in Fort Knox kamen viele Kameraden, die dem Afrikakorps angehört hatten. Diese hatten als Erkennungszeichen eine Palme an ihren persönlichen Sachen angebracht. Manche von ihnen hatten sich dieses Symbol sogar auf den Arm tätowieren lassen. Wie in allen Heeresgruppen waren auch in dieser Gruppe viele Handwerker. Das machte sich natürlich die amerikanische Armee in Fort Knox zum Nutzen und setzte diese kostenlosen Arbeitskräfte als Handwerker dort ein, wo sie benötigt wurden.
So waren unter den Kameraden vom Afrikakorps auch Kaminbauer. Diese wurden natürlich ihrer Fähigkeit nach eingesetzt. Was die amerikanische Führung nicht bemerkte war jedoch, dass überall dort, wo diese etwas aufbauten oder auszubessern hatten, ihr Symbol, die Palme, anbrachten.
Ich konnte mir damals schon gut vorstellen, dass viele Jahre später, wenn der Krieg einmal zu Ende sein würde, der ein oder andere Hauseigentümer durch Zufall ein solches Symbol findet und durch entsprechende Recherchen erfahren wird, wem er dieses zu verdanken hat und was dies zu bedeuten hatte.
Wir hatten wieder Freizeit, konnten uns auch sportlich betätigen, hatten auch hier eine Theatergruppe gegründet und durften uns innerhalb des Camps einigermaßen frei bewegen. Wir hatten die Möglichkeit, im lagereigenen Kiosk das einzukaufen, was wir benötigten oder was dort zu haben war. Natürlich bekamen wir keinen Alkohol.
Die große Angst vor dem bösen Feind, die wir in Form von Propagandameldungen als junge Soldaten in der Heimat erfahren hatten wich sehr schnell der Freude, diesen fürchterlichen Krieg überlebt zu haben und „nur“ in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten zu sein.
Viele Jahre später erfuhren wir wie es unseren Kameraden ergangen war, die in russischer Gefangenschaft gewesen waren – unvorstellbar schlechter. Viel schlimmer und grausamer. Etliche von denen kamen erst viele Jahre nach Kriegsende nach Hause. Viele aber auch leider überhaupt nicht mehr, weil sie die Gefangenschaft nicht überlebten.
Bei einem meiner Arbeitseinsätze auf einer Farm bemerkte ich in dem Wirrwarr von Gebüsch und Gestrüpp ein altes Holzkreuz. Es stand schief und wackelig im weichen Waldboden. Eine Entzifferung der grob geschnitzten Buchstaben war mir unmöglich, da das Kreuz wohl schon einige Zeit hier im Wald zu stehen schien und sehr verwittert war. An vielen Stellen war es schon morsch und fing an, auseinanderzufallen. Möglicherweise aber war es noch gar nicht so alt wie es auf den ersten Blick schien. Denn es war ja auch möglich, dass nur durch die ständige Feuchtigkeit, die im Wald herrschte, das Holz schnell morsch wurde und das Kreuz dadurch verfallen war. Das Kreuz war mit Moos überzogen und um die überwucherten Bretter rankten Dornen. Ringsherum standen Vergissmeinnicht-Blumen. Es schien so, als wollten diese Blumen meine Aufmerksamkeit erregen und sagen: „Fremder, geh nicht achtlos an uns vorbei.“
Ich ging auch nicht achtlos an dieser Stelle vorbei. Dieses Kreuz berührte mich so stark und es zog meine Gedanken ganz und gar in seinen Bann. Noch nie im Leben hatte ich ein solch starkes Gefühl verspürt.
In Gedanken versunken stand ich nun vor einem mir unbekannten Schicksal und ich hatte unwillkürlich das Gefühl, dass sich hier ein Drama abgespielt haben musste. Denn dieses Kreuz stand so versteckt im Dickicht, dass es normalerweise keine Menschenseele bemerken konnte oder vielleicht auch nicht bemerken sollte, zumal hier fast wieder der reinste Urwald sein Recht zurückgeholt hatte.
Es gab einen kleinen Hügel an diesem Ort. Rings um diesen Hügel standen sehr dicke, alte Baumriesen.
Ich weiß nicht wie lange ich an dieser Stelle verharrt hatte. Aber ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich irgendwie mit diesem Kreuz verbunden war. Etwas eigenartig Ergreifendes ging von diesem Kreuz auf mich aus. Es war unbeschreiblich.
Leise und behutsam, um die Totenruhe nicht zu stören, beugte ich mich nieder und konnte am Fuß dieses Kreuzes noch zwei Buchstaben erkennen, die ich als M und J deutete. Mit inniger Freude bemerkte ich, dass sich meine kleine Entdeckungsreise doch gelohnt hatte, obwohl ich noch keine Ahnung hatte, was sich an dieser Stelle einmal vor langer Zeit abgespielt haben musste.
Auf Zehenspitzen verließ ich das fast undurchdringliche Dickicht und ging vorsichtig zurück auf die bereits gehauene Lichtung, so als könnte ich durch lautes Auftreten diese geweihte Stätte und den dort in Frieden Ruhenden stören.
Von diesem Moment an war ich wie gefesselt von meiner Entdeckung und meine Gedanken kreisten ständig um diese.
Natürlich würde ich meinen Kameraden nichts erzählen und dieses Geheimnis wie ein Kleinod bewahren, da ich die Vorstellung hatte, dass durch das Wissen anderer diese Stelle entweiht werden könnte. Die aufgescheuchten bunten Vögel, deren Namen ich nicht kannte, flogen nach meinem Fortgehen wieder zurück an ihren Platz, so, als wollten sie diese friedliche Stelle nun weiter beschützen und aufpassen, dass nicht durch meine Entdeckung ein Geheimnis preisgegeben würde. Das Vogelgezwitscher machte diese Stille noch friedlicher, als sie ohnehin schon war.
Ob ich wollte oder nicht, ich konnte mich einfach nicht mehr mit meinen Gedanken von diesem Kreuz lösen. Wenn ich nachts im Lager auf meiner Pritsche lag und die tropische Nachtschwüle mich nicht zur Ruhe kommen ließ, schwebten mir die Buchstaben M und J in meinen Träumen vor. Dabei sah ich dieses traurige verlassene Kreuz, als wollte es zu mir sprechen und mir sein Geheimnis offenbaren. Man könnte fast glauben, dass es Gott so gewollt hatte, dass es sich an einer solch versteckten Stelle verborgen hielt, um möglichst lange dem Wetter standzuhalten, bis eines Tages jemand kommen und sein Geheimnis lüften würde. Unwillkürlich musste ich an meine Familie zu Hause und ganz besonders an meine Schwester, die ich nie kennenlernte, denken. Denn sie war bereits von zu Hause fortgegangen, als ich noch ein Kind war.
Viele Tage begab ich mich an dieses scheinbar verlassene oder vergessene Kreuz. Aber immer wieder verließ ich vorsichtig diesen Ort, um ja nicht von meinen Gefangenenkameraden bemerkt zu werden. Sie wären bestimmt wie eine Elefantenherde achtlos über diese stille Stelle getrampelt und hätten damit ihren rätselhaften Zauber gestört.
Obwohl ich gerne in Amerika geblieben wäre, wurde ich nach zwei Jahren, es war irgendwann im Herbst 1946, mit einigen meiner Kameraden bei Nacht und Nebel und ziemlich überraschend für uns, wieder auf ein Schiff gebracht und zurück nach Europa transportiert. Wir freuten uns weil wir wussten, dass der Krieg nun zu Ende ist und wir wieder zurück zu unseren Familien kommen würden. Doch in Europa angekommen, brachte man uns zunächst in ein französisches Gefangenenlager, wo wir dann zum Teil in Bergwerken arbeiten mussten. Ich wurde aber bald darauf wegen einer Erkrankung aus meiner Gefangenschaft entlassen. Entlassen in eine zerstörte, geschundene Heimat.
Durch die Wiedersehensfreude mit meiner Familie, die jetzt leider vorerst in einer mehr oder weniger stabilen Baracke wohnen musste, weil unser Haus im Krieg total zerbombt worden war und meinem Start in ein neues Leben hatte ich das Kreuz in Kentucky schnell wieder vergessen. Ja ich hatte es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt vergessen, bis die Notjahre nach dem Krieg auch für uns vorbei waren. Nach den entbehrungsreichen Nachkriegsjahren begann ich mich mehr und mehr mit meiner gesamten Familie zu beschäftigen. Ich wollte sie nun endlich alle kennenlernen, wissen wo sie geblieben sind und nach ihren Wurzeln forschen. Denn dazu hatte ich die ganzen Jahre über keine Gelegenheit und wollte dies jetzt nachholen. Seltsamerweise verspürte ich dabei plötzlich Heimweh. Es war ein Gefühl, das ich so bisher noch nicht gekannt hatte. Dieses Heimweh zog mich aber nach Amerika, das ich leider nur als Kriegsgefangener betreten hatte und von dem ich auch nur einen sehr kleinen Teil sehen durfte.
Zu diesem Heimweh gesellten sich Träume, wie ich sie schon damals im Kriegsgefangenenlager gehabt hatte. Diese Träume erinnerten mich immer wieder an dieses Kreuz, das ich bei den Rodungsarbeiten gefunden hatte. Dieses Kreuz ließ mir jetzt keine Ruhe mehr. Es ließ mir so lange keine Ruhe, bis ich eines Tages die Gelegenheit wahrnahm, wieder nach Amerika, nach Kentucky zu reisen und dort das Kreuz wieder zu suchen. Ich war mir sicher, dass dort doch ein Geheimnis auf mich wartet, das von mir endlich gelöst werden musste.
Meinen Wunsch oder meinen Traum um dieses Geheimnis lüften zu können, sollte ich noch viel eher erfüllt bekommen, als ich mir dies überhaupt vorstellen konnte.
Durch ein vorsichtiges Räuspern wurde ich aus meinen Gedanken aufgeschreckt und in die Gegenwart zurückgeholt. Ich sah nun wieder das hübsche junge Mädchen mit einem Tablett neben mir stehen, auf dem unsere Getränke standen, die der alte Mann für uns bestellt hatte. Das Mädchen Lona lächelte mich freundlich an und bemerkte, dass ich wohl mit meinen Gedanken anderswo gewesen war. Ja, ich war tatsächlich ganz weit weg gewesen und ich war mir in diesem Moment auch gar nicht bewusst, dass ich in einer Kneipe in der Kennedy-Road, irgendwo in Kentucky, saß und dass dieses Mädchen auch meine Sprache spricht. Ich musste ein sehr überraschtes Gesicht gemacht haben als ich so aus meinen Träumen aufgeschreckt wurde. Denn einige der Gäste die uns zufällig beobachteten, lächelten, ohne jedoch eine Bemerkung zu machen. Sie wollten wahrscheinlich nicht unhöflich sein, da sie mich doch als Fremden erkannten. Nun vernahm ich auch wieder die Stimme des alten Mannes der mir gegenüber saß und ich kam erst jetzt wieder richtig in die Wirklichkeit zurück.
„Wohl geträumt?“, fragte mich der alte Mann.
„Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich war tatsächlich in meinem Traumland versunken und kramte ganz tief in meinen Erinnerungen“, erklärte ich ihm, wobei ich lächeln musste. Wie seltsam. Wie eine längst vergangene Zeit einen berühren konnte.





























