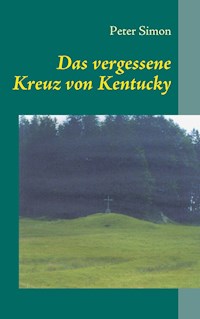Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Papst ist tot, es lebe der Papst.
Nachdem Papst Petrus II. ermordet worden ist, wird das Konklave einberufen. Schon als sich die 127 Kardinäle versammeln, geschehen merkwürdige Dinge. Einer der würdigen Herren wird tot aufgefunden, ein anderer vergiftet, ein dritter beginnt, als wäre er stigmatisiert, an Händen und Füßen zu bluten. Während die Gläubigen vor dem Petersdom auf das Rauchwölkchen warten, beginnen die Kardinäle trotz allem mit dem ersten Wahlgang. Doch einer der abgegebenen Stimmzettel ist ungültig; statt eines Namens stehen darauf zwei Worte: "ER KOMMT". Der Wahlleiter lässt den Zettel verschwinden, doch da taucht ein Fremder auf, der geheimnisvolle Reden hält. Als dieser dann auch noch behauptet, der wahrhaftige Heiland zu sein, greift der Glaubensminister des Vatikans zu einem ungewöhnlichen Mittel, um den Störenfried loszuwerden …
Voll himmlischer Spottlust beschreibt Peter Simon, was passiert, wenn der Heiland zurückkehrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Peter Simon
Peter Simon (Pseudonym) studierte an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er ist promovierter Theologe, ehemaliger Priester und schaut auf eine langjährige Tätigkeit im Vatikan zurück.
Informationen zum Buch
Der Papst ist tot, es lebe der Papst!
Nachdem Papst Petrus II. ermordet worden ist, wird das Konklave einberufen. Schon als sich die 127 Kardinäle versammeln, geschehen merkwürdige Dinge. Einer der würdigen Herren wird tot aufgefunden, ein anderer vergiftet, ein dritter beginnt, als wäre er stigmatisiert, an Händen und Füßen zu bluten. Während die Gläubigen vor dem Petersdom auf das Rauchwölkchen warten, beginnen die Kardinäle trotz allem mit dem ersten Wahlgang. Doch einer der abgegebenen Stimmzettel ist ungültig; statt eines Namens stehen darauf zwei Worte: »ER KOMMT«. Der Wahlleiter lässt den Zettel verschwinden, doch da taucht ein Fremder auf, der geheimnisvolle Reden hält. Als dieser dann auch noch behauptet, der wahrhaftige Heiland zu sein, greift der Glaubensminister des Vatikans zu einem ungewöhnlichen Mittel, um den Störenfried loszuwerden …
Voll himmlischer Spottlust beschreibt Peter Simon, was passiert, wenn der Heiland zurückkehrt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Peter Simon
Im Vatikan ist die Hölle los
Roman
Inhaltsübersicht
Über Peter Simon
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Impressum
1
Rätselhaft hatte es schon begonnen.
Der 15. August würde ein drückender Tag werden. Im Hochsommer war Rom, ohnedies eine schwierige, träge, anstrengende Stadt, jedes Jahr die Hölle. Wer nicht ans Meer fahren konnte, betrachtete seine Schicksalsgenossen voll Mitgefühl. Nur die Touristen aus dem Norden waren begeistert. Sie brauchten die Sehenswürdigkeiten wochenlang mit niemandem zu teilen.
Seit dem frühen Morgen stand die Sonne über der Ewigen Stadt. Ihre Glut trieb die Thermometer höher und höher, hinterließ jedoch einen zwiespältigen Eindruck. Statt vom samtblauen Himmel Italiens zu strahlen und nur ein paar zerzupfte Wolkenfetzchen zu dulden, schien sich die Sonne zu zieren. Offenbar fiel ihr die Entscheidung schwer, ob sie sich auch heute von ihrer guten Seite zeigen wollte. Gewiss war die Scheibe immer wieder ungemein sichtbar, brannte hell und klar und heiß, doch verbarg sie sich ebenso gern hinter dicken rötlichen Schleiern, als wünsche sie, dass man ihr Rund nur erahne.
Die Kirche schickte sich gerade an, das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel zu begehen. An diesem vielversprechenden Morgen wurde der Hochwürdigste Herr Pablo Picador y Morcilla unversehens vor das Gericht seines Heilands gerufen.
Ein steinalter Klosterbruder hatte den Kardinal entdeckt. Wie immer hatte der geistliche Butler die Tür zum Arbeitszimmer Seiner Eminenz mit dem Fuß aufgestoßen, weil er beide Hände für das Tablett brauchte, auf dem er den Tee servierte.
Genau in diesem Moment erschreckte ihn eine Stimme, die aus dem Hintergrund kam.
»Gelobt sei Jesus Christus«, sagte jemand in einem gepflegt öligen Tonfall, »und ein besonderes Ave an alle Schwestern, die Maria heißen.«
Der Ordensmann stockte. Dann seufzte er auf. Dem Kardinal musste etwas zugestoßen sein.
Der Hochwürdigste Herr hat offensichtlich vergessen, das Radio abzustellen, bevor er sich für die paar Stunden zu Bett begab, die er überhaupt noch schlafen kann, überlegte der Butler.
Dieser Fehler ist ihm noch nie unterlaufen. Er geizt derart mit jeder Münze, dass ihm ein Kollege gegen Ende eines hitzigen Wortwechsels schon die passende Höllenstrafe in Aussicht gestellt hat: Geizhälse würden, an den Füßen aufgehängt, einen Guss Gold schlucken müssen.
Der Diener klirrte mit Tasse und Teller auf ein Tischchen zu, stellte das Tablett ab, zog die Vorhänge zurück, ließ Morgenlicht ins Zimmer und knipste zittrig das Lämpchen auf dem Schreibtisch an, um noch besser zu sehen.
Der Herr saß unmittelbar vor dem Radio, in dem einzigen noch brauchbaren Sessel seines Haushalts, mit dem Rücken zur Tür. Das gelbgestreifte kleine Kissen, das seinen Nacken stützte, war vor Alter und Mangel an Luft stockfleckig.
Der Klosterbruder ging vorsichtig auf den Sitzenden zu. Als erstes fielen ihm die Hände auf. Sie hielten ein Blatt, das er ihnen nur mit Mühe entwinden konnte. Viel stand nicht darauf. Er versuchte den Namen zu lesen, der unterstrichen war: Cabeza oder so ähnlich.
Dann kramte er in seiner Kutte herum. Ärgerlich, dass er seine Lesebrille nicht eingesteckt hatte. Doch wer hätte annehmen können, dass er sie an diesem Morgen brauchen würde? Um den dünnen Tee aufzutragen? Noch nie hatte er in den dreißig Jahren, in denen er den Kardinal bediente, eine Brille dabei.
Der Kardinal hätte ihn ausgelacht. Seine Eminenz benutzte keine Brille. Knauserig, wie er war, schien der Hochwürdigste Herr zu glauben, Augengläser nutzten sich durch ständigen Gebrauch ab.
Eine Sensation, dass sich der Kardinal den Luxus eines Radios leistet, dachte der Ordensbruder. Leiden nicht auch die Ohren durch unablässige Benutzung?
Der Diener schämte sich im gleichen Moment. Den Herrn zu bespötteln war jetzt nicht die Zeit. Er überlegte besser, was da geschrieben war.
Heißt es Cabeza, so ist das ein Name, den ich kenne. Doch darunter steht in halb verwischten Großbuchstaben ER KOMMT.
Eine verwirrende Botschaft. Wer soll eintreffen? Wer ist so wichtig, dass sein Besuch in solchen Lettern angekündigt werden muss?
Der Ordensmann stutzte.
Etwa Seine Heiligkeit?
Das ergab keinen Sinn. Kein Papst suchte einen Kardinal auf. Er befahl die Eminenzen zu sich. Zudem war der päpstliche Thron zur Zeit verwaist. Petrus II. war seit anderthalb Wochen tot.
Eine andere Eminenz? Eine einflussreiche Persönlichkeit? Der Mann mit Namen Cabeza?
Der Diener zuckte zusammen. Er hatte sich erinnert, dass er anderes zu tun hatte, als über Buchstaben zu brüten, die nicht für ihn bestimmt waren.
Die Finger des Kardinals waren ihm sonderbar gekrümmt erschienen. Doch er beruhigte sich.
Eine Folge der Gicht, an der der Zweiundneunzigjährige leidet, dachte der Ordensmann. Um Kosten zu sparen, wäscht Seine Eminenz die Hände in kaltem Wasser. Das formt Gelenke zu Knoten. Und die Arterien des Herrn müssen ohnedies so verkalkt sein, dass der Kardinal in allen Fugen kracht, wenn er sich bewegt.
Der Klosterbruder schüttelte den Kopf.
Ein Wunder, dass die Eminenz bisher keine Gelegenheit ausgelassen hatte, aufwendige Gottesdienste in den fremden, feuchten Domen zu zelebrieren, in die man ihn einlud. In diesem Alter blieb man besser aus Kathedralen fort; in ihren Gewölben lauerte der Rheumatismus.
Picadors Nase tröpfelte nicht von ungefähr das halbe Kirchenjahr hindurch. Der Schnupfen des Kardinals pflegte um den ersten Advent herum einzusetzen; er reichte bis in die Zeit kurz vor Mariä Verkündigung im März.
Der Klosterbruder war beinahe vier Jahre jünger als sein Herr, ein Geschenk der Natur, das ihm eine um so diebischere Freude bereitete, je älter er wurde. Doch auch er kannte sich mit den Gebrechen aus, die der Lebensabend mit sich bringt.
Jetzt bemerkte er, dass der Kopf des Alten auf seltsame Weise nach oben gerichtet war. In dieser Haltung hatte er noch niemanden Radio hören sehen. Er überlegte und kam zu dem Schluss, dass der Kardinal gar nicht auf die Sendung lauschte, die Radio Vaticana ausstrahlte. Sein Interesse schien einer Stimme zu gelten, die von ferne zu ihm sprach. Die Eminenz glich einem gealterten Schauspieler, der größte Schwierigkeiten hatte, die Souffleuse zu verstehen.
Unwillkürlich blickte der Ordensbruder in die Richtung, die der Greisenkopf wies. Er hoffte, an der Decke etwas Besonderes zu entdecken, das die Situation geklärt hätte. Doch außer einigen Flecken war nichts zu sehen.
Er kannte jeden von ihnen, hatte es aber aufgegeben, ihnen auf den Leib zu rücken. Der Kardinal hatte die Nachlässigkeit nicht beanstandet. Seine Sehkraft war zu schwach, als dass sie bis an die Zimmerdecke gereicht hätte.
Ohnedies war die meiste Arbeit vergeblich getan: Gleichmäßiger, geduldiger, beharrlicher Staub nistete in den Beschlägen der Schränke, den verblassten Vergoldungen, verblichenen Deckchen, farblos gewordenen Vorhängen, in den Rillen der Bilderrahmen, in den vertrockneten Buchsbaumzweigchen hinter dem Kruzifix.
Ist überhaupt etwas ewig, dann sind es nicht die Bauten der Menschen, sondern es ist der Staub, zu dem sie zerfallen: die Gebäude und die Bauherren.
Der Diener faltete die Hände, versuchte ein Stoßgebet und ertappte sich dabei, wie er den Himmel um die ewige Ruhe für den Hochwürdigsten Herrn bat. Rasch nahm er die Hände auseinander, als hätten sie Verbotenes getan.
Zumindest hatte er voreilig gehandelt. Vielleicht war Seine Eminenz nur tief eingeschlafen. Doch wahrscheinlicher erschien ihm sofort wieder die zweite Lösung: Der Kardinal schlief bereits so tief, dass niemand mehr ihn erweckte.
Da hat Seine Eminenz gut sechzig Jahre über das ewige Leben gepredigt und ein paar tausend Männer zu Priestern geweiht, damit sie dieses ewige Leben verkündigen. Jeden Morgen hat der Kardinal bei der Messe den Leib Christi in den Händen gehalten. Und nun steht er selbst …
Schon schlossen sich die Hände des Klosterbruders wieder. Dann fasste er sich ein Herz, schlug mehrmals das Kreuz und sprach den Hochwürdigsten Herrn an. Und da eine Reaktion ausblieb, berührte er mit schweißfeuchten Fingern den Kopf des Kardinals, den ein Kranz von wenigen verbliebenen und um so sorgsamer gekämmten Strähnen umgab. Er wagte sogar, an einem der Haare zu zupfen, die wie angeklebt wirkten.
Als die Eminenz sich nicht rührte, wurde der Butler für einen Moment unschlüssig, ob er bleiben oder weglaufen sollte. Hier war sein Dienst zu Ende. Für immer. Dabei war gar nicht mit dem Tod zu rechnen gewesen. Der Kardinal Picador war doch längst über das Alter hinaus, in dem man stirbt …
»Heute ist ein besonderer Tag für uns Christen.«
Erst als er die Stimme dies sagen hörte, schrie der Diener und schrie und schrie.
Und während er seinen Schreien zuhörte, staunte er über sich selbst. Eine so starke Stimme hätte er sich nicht mehr zugetraut.
»In wenigen Stunden wird das Konklave eröffnet«, sagte der Mann im Radio. »Wir wollen deshalb für alle Kardinäle beten. Sie werden in diesen Tagen den Heiligen Geist nötiger brauchen als wir.«
2
Annibale Duca, Kardinalkämmerer der Heiligen Römischen Kirche, fühlte sich miserabel. Seine Misslaune war diesmal nicht auf die Erfahrung zurückzuführen, die er machte, sooft die tägliche Spritze statt der Fettschicht seines Bauches einen Nerv oder gar ein Gefäß getroffen hatte, das den fehlerhaften Einstich sofort mit einem dicklich herausquellenden Blutstropfen beantwortete.
Erst recht nicht war der Kardinal schlecht gelaunt, weil die Waage erneut ein Übergewicht angezeigt hatte, das sich nicht mehr beheben lassen würde. Er stieg zwar noch immer nicht freudig auf die Waage, doch pfiff er zunehmend auf seine Figur.
Für wen oder für was ist es überhaupt von Bedeutung, ob ich fett oder mager bin? fragte er sich. Einige verzehren sich für das Reich Gottes, und andere gehen darin auf.
Manchmal redete Duca sich auch ein, er habe seine Fülle förmlich zu pflegen, damit das Schlimme, das er Tag für Tag hinter den Kulissen seines Amtes sah, nicht allzu nah an ihn herankomme. Und kroch Verzweiflung auf ihn zu, erklärte er sich sogar die Vorliebe für eine Zigarre mit dem Zwang, seinen Mund, durch den das Ungeheuerliche hereinbrechen könnte, wenigstens für eine Stunde verstopfen zu müssen.
Von Diäten hielt er nicht viel, und Sport war seine Sache nicht. Ein Fahrrad zu besteigen, schickte sich allenfalls für einen Dorfpfarrer wie Don Camillo, jedoch nicht für eine Hochwürdigste Eminenz. Kurienkardinäle, die wie er nicht ohne Grund zu den nächsten Mitarbeitern Seiner Heiligkeit zählten, hatten ihren Dienst am päpstlichen Hof zu tun, aber nicht auf einem Drahtesel durch die Gassen der Ewigen Stadt zu hetzen.
Churchill auf dem Fahrrad? Und Duca?
Auch hatte niemand den Kardinalkämmerer je schwimmen sehen, seit Duca sich, es mochte vierzig Jahre her sein, total erschöpft, aber hochbefriedigt, nicht ertrunken zu sein, an den Strand geschleppt hatte.
Der Kardinal liebte andere Dinge. Die Kleinigkeiten zum Beispiel, die gerade als modische Herrenaccessoires galten und seinem persönlichen Mythos Festigkeit zu verleihen schienen. Duca kleidete sich mit einer Sorgfalt, die den Rang unterstrich, den er durch Gottes und des Papstes Gnade einnahm. Doch der Besuch bei Maßschneidern half wenig gegen die füllige Gedrungenheit, die seine Herkunft verriet. Er kam aus einem Bauerngeschlecht, und wenn er sich mit seiner umständlichen Kardinalsgarderobe abmühte oder wie heute morgen einen seiner wappengeschmückten Manschettenknöpfe nicht finden konnte, musste er daran denken, dass er besser den Hof übernommen hätte. Dann wäre er sich nicht wie ein Junge vorgekommen, der den großen Mann spielen muss.
Duca stand sonst gern zeitig auf. Er war der Ansicht, früh auf den Beinen zu sein, verleihe dem Vorgesetzten einen moralischen Vorsprung. Während die anderen noch schliefen, konnte er einen gut Teil seines Tagwerkes erledigen und die Spätaufsteher unter den Prälaten damit überraschen, dass der Chef bereits im Amt gesessen war, als sie sich nochmals umdrehten und mit sich rangen, ob sie nicht von einem tückischen Virus befallen sein sollten.
Heute aber war alles anders. Heute wäre auch Duca lieber im Bett geblieben.
Es gibt leichteres, überlegte er, als eine Kirche wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Nachdem ihr Papst so unvermutet gestorben ist.
Der Kardinal hatte seltsam sehnsüchtig geträumt, bevor er mit Erschrecken aus dem Schlaf gefahren war. Und noch immer verspürte er Angst vor dem, was die nächsten Tage bringen würden. Dieses Gefühl kannte er; es näherte sich mehr und mehr der Verzweiflung. Sooft er einer solchen Trostlosigkeit verfiel und ängstlich auf das Pochen seines Herzens hörte, war es ihm, als schlage ein Vogel in ihm, als stoße dieser ständig gegen eine Wand, als flattere er mit seinen Flügeln, um endlich den Ausweg zu finden, seine Sehnsucht zu befreien und hinaus in eine unendliche Freiheit zu fliegen.
»Der Vogel hat gewiss purpurne Flügel. Dann passt er zu dir«, war Vittorias Kommentar, als der Kardinal seiner Geliebten von dieser Erfahrung erzählt hatte.
Nicht dass Duca ein Hasenfuß gewesen wäre: Schon die stattliche Erscheinung und der schwere Gang wiesen darauf hin, dass dieser Mann über Autorität verfügte und sie auch ausspielen konnte, falls er wollte. Er gehörte zu den Menschen, die einen Raum nur zu betreten brauchen, um allgemein die Empfindung auszulösen, nun sei die Hauptperson, der Signore, eingetroffen und alle, die gewartet hatten, könnten sicher sein, dass niemand von Rang mehr komme.
Duca hatte erfahren, wie signoril – so nannten es die Landsleute – er wirkte. Selbst der Papst hatte es schwer gehabt, sein eigenes, ungleich höheres Amt zur Geltung zu bringen.
Wer ihn kannte, hieß Duca einen Herrn. Um seiner Würde gerecht zu werden, hätte man gut und gern ein halbes Dutzend weiterer Titel aufwenden können.
Die Bäume des Kardinals wären gewiss in den Himmel gewachsen, wäre er nicht sich selbst im Weg gestanden. Die Wirkung der zum Zupacken neigenden Persönlichkeit des Annibale Duca wurde stark gemindert durch die eigene Bequemlichkeit, die er freilich zunehmend als Tugend der Geduld auszugeben pflegte. Duca hatte immerhin selbst seinen Jähzorn mit einer Aura von Altersmilde zu umgeben verstanden, und die Zündschnur seiner Geduld brannte langsamer herab als früher.
Immer häufiger sprach der Kardinalkämmerer davon, dass im Reich Gottes auch die Gemütlichkeit ein Plätzchen zu beanspruchen habe. Ähnliches gelte für die heitere Gleichgültigkeit, die er an den Tag lege, selbst wenn sie manchen liederlich erscheine. Im übrigen sei er nicht zum Gipfelstürmer geboren. Seine Gedrungenheit – er sähe ja aus wie ein Korken, fügte er hinzu, wenn er besonders gut gelaunt war – bringe es nun einmal mit sich, dass er sich mit einer Höhe zu begnügen habe, von der er einen nur mittelmäßigen Rundblick habe.
Im Vatikan wussten viele, dass dieser Kardinal Größeres hätte leisten können. Zwar hatte er, wie er selbst am besten wusste, nicht das Zeug zum Organisator. Doch ging er ohnehin davon aus, dass auf Erden nichts Bestand haben konnte, niemand von Bedeutung war und nur wenig sich wirklich planen ließ.
Duca hatte mit dem verstorbenen Papst die Liebe zu Gärten geteilt. Und so wusste er, wie schnell die Ordnung in ein Chaos umkippen kann. Häufig verfiel er in die Sorge, ob alles anwachsen, Wurzeln schlagen und Frucht tragen würde, bevor ein einziger Hagelschauer es zunichte machte. Das Gleichnis diente ihm dazu, Welt und Kirche wie ein Gärtner zu betrachten, der aus bitterer Erfahrung weiß, dass nichts auf Dauer organisiert und erhalten werden kann.
Man brauchte sich nur in der Ewigen Stadt umzusehen, um zu erkennen, dass Rom ebenso viele Weltuntergänge wie Neugeburten erlebt hatte. Die überall herumliegenden Reste boten einen Anschauungsunterricht wie nirgends sonst: Gerade weil die Überbleibsel inzwischen sorgsam freigelegt und die klotzigen Brocken mit Seltenheitswert für die immer neuen Ströme staunender Touristen beschriftet worden waren, bewiesen sie nichts als die Tatsache, dass Macht und Glanz auch der gewaltigsten Imperien von Kaisern und Päpsten sich gegen die Katastrophen des Menschseins nicht hatten behaupten können.
Dagegen half auch das geweihte Öl nicht, das unter hundert Marienbildern in der Stadt brannte. Selbst der Glaube an das Blut der abertausend Märtyrer, die sich die längst unfromm gewordene Stadt des Papstes hielt, kam nicht gegen den Zerfall an. Alles wirkte nur noch wie eine surrealistische Selbstinszenierung.
Wo auch der Glaube zu herrschen schien, sah es nicht anders aus. Duca hatte sich einmal mit dem Kollegen unterhalten, der sich zum Hirten der Seelen Neapels bestellt sah. Der Neapolitaner hatte voll Besitzerstolz erklärt, dass die Kirche San Gennaro sieben Hauptpatrone zähle. Doch das sei beileibe nicht alles, denn diesen Heiligen müssten noch jene zweiter Ordnung hinzugefügt werden.
Duca hatte sich gerade von seinem Schrecken erholt, als der Kollege fortfuhr. Hinzu kämen noch die sechs heiligen Fränze: Francesco di Paola, Franz von Assisi …
Duca hatte ihn unterbrochen und gemeint, wenn eine Stadt unter soviel Schutz stehe, könne der Vesuv eigentlich nichts mehr ausrichten. Der Neapolitaner hatte sich brüsk abgewandt und seither kein Wort mehr mit ihm gewechselt.
Gut, dass Vittoria aus anderem Holz war. Sie hatten oft miteinander diskutiert. Alles, was die Kirche lehrte oder wirkte, erschien ihr zu glatt. Und in den oberen Etagen der Firma sei alles eine Spur zu erstklassig, hatte sie gesagt, zu markenartikelhaft.
»Eure vaticani sind geleckt, gefällig, geschniegelt.«
Duca hatte den Satz nicht vergessen.
Er zählte zwar zur elitären Klasse der palatinischen Kardinäle, weil er nicht nur seinen Dienstsitz im Apostolischen Palast hatte, sondern auch im Vatikan wohnte. Doch manchmal verspürte er große Lust, das Pflaster vor dem Petersdom aufzureißen und mit dem Stein eine Scheibe im Palast einzuschmeißen.
»Protzt die Kirche nicht seit eh und je?«
Vittoria hatte nicht studiert, doch sie verstand es, ein Problem, das er selbst lange durchdenken musste, mit wenigen Worten auf den Punkt zu bringen.
»Mit dem, was ausnahmslos von den Gläubigen erbracht worden ist. Und nicht vom Klerus.«
Sie hatte recht.
Duca, Mitglied der Vatikanischen Baukommission, hatte sich an einen Bericht erinnert. Innerhalb dreier Jahrhunderte hatte allein Frankreich, älteste Tochter der Kirche, achtzig Kathedralen, fünfhundert große Kirchen und Tausende von Pfarrkirchen errichtet.
Und wer hatte die Steine für diese Bauten herangeschleppt? Wer das Ganze finanziert? Doch wohl nicht die geistlichen Herren. Die Sklaven blieben dieselben. Seit den Tagen, da die Pharaonen Pyramiden hatten auftürmen lassen.
»Wenn ihr schon Touristen durch den Petersdom führen lasst, müsst ihr sie auch an diese Tatsache erinnern«, hatte Vittoria zornig gesagt. »Die einfachen Leute schufteten und zahlten. Nicht ihr.«
Was den Kardinal besonders ärgerte: Der trügerische Glaube, der auf Steine statt auf Menschen setzte, hatte sich erhalten. Erst in den letzten Jahren hatte Johannes Paul II. sich einen Afrikanischen Petersdom schenken lassen und sogar darauf gedrängt, dass in Rom, das nun wirklich keinen Mangel litt, weitere Kirchen geplant wurden.
Vittorias Gespür wies den Weg. Gerade das angeblich Sakrosankte, das Zeremonielle, ja das Bizarre war einige Nummern zu groß, zu üppig, zu intensiv. Wer hellwach war, und Duca schmeichelte sich, mit Vittorias Hilfe diesen seltenen Zustand erreicht zu haben, sah durch die Schwaden von Weihrauch hindurch, mit denen die Kirche sich einnebelte: Klar, auch die gewaltigste Ära ging einmal zu Ende.
Während in der Ewigen Stadt phantastische Morgen-, Mittags-, Abendmessen zelebriert wurden, die kaum jemand besuchte, schauten die heidnischen Götter in Stein und Bronze schadenfroh auf das Spektakel herab, das ihnen die Katholiken boten.
»Jupiter und Merkur können sich sicher sein«, hatte der Kardinal gesagt, »dass die christlich geprägte Zeit nur eine Epoche in der Geschichte der Menschheit war.«
»Und keine glückliche«, hatte Vittoria hinzugefügt.
Es waren die verachteten Heiden der Antike gewesen, die eine Welt das Denken gelehrt und die wichtigsten Kulturtechniken eingeführt hatten. Und verdankte Europa nicht den Arabern, die mittlerweile als tumbe Muslime galten, das Leder, den Reis, die Orangen, die Pfirsiche, den Spargel, den Safran, die Baumwolle, das Zuckerrohr, den Kaffee?
Die Christen hatten nur angeknüpft. Sie hatten entgegengenommen, was ihnen in den Schoß fiel – und schließlich so getan, als seien sie die Erfinder des wahren Denkens, der Nächstenliebe und so fort.
Saß der Kardinalkämmerer nach einem solchen Gespräch mit Vittoria wieder inmitten der Pracht des Palastes über seinen Aktenbergen, fühlte er sich entmutigt. Sah denn keiner, was geschehen war? Was geschah?
In seinen einsamsten Stunden war Duca drauf und dran, sich von dem Anachronismus des Amtes zu befreien, den Purpur für immer abzulegen und zusammen mit Vittoria einen Hof zu suchen, um sich die Jahre, die ihm noch verblieben, als Bauer durchzuschlagen.
Vittoria streichelte ihm über den Kopf, sooft er von diesen Plänen berichtete.
»Nein, Balli, das wäre eine Flucht. Leute wie dich braucht der Vatikan. Du bist eine zu seltene Erscheinung.«
»Meinst du?« fragte er geschmeichelt.
»Wenn ich daran denke, wie du dich hast hochkämpfen müssen«, schob Vittoria nach. Sie flötete auf der höchsten Tonleiter ihrer Schmeichelei.
Recht hat sie, dachte der Kardinal. Ich musste Stufe um Stufe klettern. Nichts wurde mir geschenkt.
»Ich saß nicht wie manche Kollegen schon als Kind auf der obersten Sprosse«, sagte er schließlich.
»Ich muss deinen Beruf gegen dich in Schutz nehmen. Du solltest im Vatikan ändern, was überhaupt zu ändern ist. Übrigens sind die Revolutionäre von heute keine unrasierten Asketen mehr. Wenn sie das je waren. Heute tragen sie Bäuche und Krawatten. Und manchmal, ganz selten, tragen sie auch … den Purpur.«
Er hätte sie küssen können. Und warum sollte er es nicht auf der Stelle tun?
3
»Immer der gleiche Dreck«, sagte der Kardinaldekan Pierre Evariste Comte de Valmy vor sich hin. Er hatte gegen sieben das Radio eingeschaltet, um die ersten Nachrichten dieses Tages zu hören. Doch offenbar hatte sich in der Zwischenzeit jemand an dem Gerät zu schaffen gemacht. Nicht der gewohnte Sender war zu hören, sondern Radio Vaticana. Die waren sich für Meldungen zu schade. Lieber ließen sie wieder beten.
Valmy lag schwerleibig auf dem Ledersofa. Er hatte die Nacht im Kreis der Vertrauten verbracht. Konversation war das schönste Spiel, das es gab. Die feinsten Gedanken kamen einem nicht auf der Kanzel, sondern im Gespräch mit Freunden.
Das Thema hatte schon festgestanden, als sie sich verabredeten. Was konnte man in diesen Tagen anderes tun, als die Nachfolge des Papstes zu besprechen? Am ehesten schien der Leiter des Glaubensministeriums die Mehrheit für sich gewinnen zu können. Auch in den Medien wurde sein Name am häufigsten genannt. Ein Bistumsblatt stellte ihn sogar in die »vorderste Reihe der zeitgenössischen Denker«.
»Cabeza ist gewiss ein feiner Kopf«, hatte Valmy in einem Ton gesagt, der zu erkennen gab, dass er den Kollegen für einen ausgemachten Trottel hielt. Nach seiner Meinung hatte der ignorante Cabeza in seinem Leben überhaupt nur einen Gedanken gehabt – und der war falsch gewesen. Der Glaubensminister hatte seinerzeit einen Katechismus in Spanien durchgesetzt. Darin war die Wahl einer nichtchristlichen Partei als Todsünde gebrandmarkt worden. Und, äußerstes Zugeständnis an die Moderne, in einer liberalen Zeitung sollte ein Katholik ausschließlich die Börsenkurse lesen dürfen …
»Ausgeschlossen, nur über meine Leiche! Dieser Gouvernante stehen die Vorurteile im Gesicht wie eine Kriegsbemalung.«
Der Glaubensminister, ein Spanier mit scharfen Augen, gebogener zugespitzter Nase und schmalen Lippen, gehörte zu den Kardinälen, die schon so lange in der Kirche herumkommandierten, dass sie meinten, sie gehöre ihnen persönlich.
»Und er frömmelt. Jede Handlung soll einen übernatürlichen Charakter bekommen. Also löffelt er seine Suppe zu Ehren des Vaters, schneidet das Filet zu Ehren des Sohnes und spachtelt Pommes zu Ehren des Heiligen Geistes.«
Die Diskussion war lauter geworden. Und je leidenschaftlicher das Gespräch um den Kandidaten für das höchste Amt geführt wurde, das die Kirche zu vergeben hatte, desto mehr musste getrunken werden. Keiner von den Anwesenden gehörte zu dem Typ des stumpfen Alleinsäufers. Wenn überhaupt, dann waren sie Geselligkeitstrinker, geradezu sympathische Gesellen.
Als sie schließlich aufbrachen, rief eine erste Glocke zur Frühmesse. Valmy dachte in diesem Moment, die ständige Bimmelei in Rom erinnere weniger an die Ewigkeit als an die Tatsache, dass sich alle Menschen der Zeit unterworfen hatten. Gerade in dem Augenblick, da man sich dem Glück der Zeitlosigkeit hingeben wollte, mahnte einen der fatale Schlag an die Wirklichkeit.
Und wenig mehr sprach gegen die Lebensklugheit eines Menschen, als Zeit zu haben und diese auch noch vorzuweisen.
Valmy wusste, dass es sich kaum lohnen würde, sich auszuziehen und ins Bett zu gehen. Immerhin musste er gegen zehn im Apostolischen Palast sein, um an der Papstwahl teilzunehmen. Also hatte er es sich in seiner seidenen Hausjacke auf dem Sofa bequem gemacht, um die paar Stunden zu schlafen, die ihm verblieben.
»Ein Maul voll schmieriger Worte. Mit einem Wort: die Gesalbten des HERRN.«
Die Eminenz drückte auf den Knopf der Fernbedienung. Dann stand der Kardinal nochmals auf, um ein Glas Mineralwasser zu trinken.
Er stutzte. Die Flasche war zwar bis oben gefüllt, aber nicht verschlossen. Dabei hätte er schwören können, dass sie gestern abend, als er sie in den Kühlschrank gestellt hatte, noch nicht angebrochen war.
Wahrscheinlich sehe ich Gespenster, kein Wunder bei meinem Zustand, dachte Valmy und genehmigte sich einen herzhaften Schluck.
Als er einschlief, bemerkte er gerade noch, wie ein paar Muskeln in seinem Körper zuckten. Er dachte kurz daran, dass es wie bei einem Fisch sei, der schon nicht mehr lebt. Doch er kümmerte sich nicht darum.
Mitten in seinem unruhigen Schlaf war ihm aber, als fasse ihn einer an der Hand, als wolle er ihn fortziehen. Daher machte sich der Kardinal so schwer wie möglich. Gegen seinen Willen wollte er auf keinen Fall mitgenommen werden, erst recht nicht an einen Ort, den er nicht bestimmt hatte.
Irgend etwas plagte ihn. Die Alarmsirene steckte direkt in seinem Kopf. Nicht eine, deren Ton an- und abschwillt, sie drehte sich und lärmte ununterbrochen, war ein nicht abzustellendes Geheul, ein einziger, nicht aufhören wollender, erschütternder Schrei.
Aber er fühlte auch eine rätselhafte Ruhe in sich, wie er sie noch nie erfahren hatte. Genauer: sie kam erst auf ihn zu. Hätte er ausdrücken können, in welchem Zustand er sich befand, befinden wollte, befinden würde, hätte er auf einer Kanzel gestanden, hätte er vom himmlischen Frieden gesprochen.
Er spitzte schon den Mund, um genau dies den Menschen in der Kathedrale zu sagen, doch brachte er zu seinem Erstaunen keinen Ton heraus, jedenfalls keinen, der einem menschlichen Wort geglichen hätte. Das Ächzen, das er von sich gab, klang nach jener dankbaren Zufriedenheit, in der alte Männer eine Last abstellen.
Minutenlang war Valmy nicht sicher, ob er nicht einem Traum nachlief. Er wollte aufwachen und fühlte doch die Angst, er werde von einem Augenblick zum anderen wach sein und das ganze Elend eines Erwachens erleben müssen.
Und was er für unmöglich gehalten hätte, wäre er danach befragt worden: Mitten im Schlaf fühlte er Tränen über sein Gesicht laufen. So mochte es Schwerkranken ergehen, die keine Chance mehr sehen, als auch nur annähernd Gesunde ins Leben der anderen zurückzukehren.
Er wäre dankbar gewesen, hätte er wenigstens als Wrack mit ein klein wenig Anrecht auf das Altwerden weiterleben dürfen. Doch schien ihm die Chance endgültig genommen zu sein. Er wehrte sich gegen den Gedanken, begann zu strampeln wie ein Kleinkind und fühlte verwundert, wie die Seide plötzlich über seinem Gesicht hing.
Es roch nach Schweiß und Deodorant, nach Whisky und Zigarren. Jemand riss ihn hoch, entfernte die Jacke und klatschte ihm links und rechts auf die Wangen. Von sehr weit hörte er auch eine Frau auf sich einreden und schließlich beschwörend seinen Namen rufen.
Nun werden sie anfangen, für mich zu beten, dachte der Kardinal. Fragt sich nur, in welche Richtung.
Er versuchte zu erkennen, wer sich um ihn sorgte, aber es wurde immer dunkler um ihn. Als äußerstes Zugeständnis an die Todesangst, die überraschend klar wirkte, verfiel Valmy in Resignation.
Sein letzter Gedanke war, es sich bequem zu machen. Er hatte einzig vor, sich auszustrecken, um sich endlich von den Mühen dieser Nacht zu entspannen. Doch nur das rechte Bein gehorchte, und auch dieses versagte einen Augenblick später den Dienst.
4
»Es lässt sich nicht verschieben.«
Der Kardinalkämmerer Duca schnitt das dritte Brötchen auf. Er bestrich die Hälften mit Butter, belegte jede mit einer dicken Scheibe Mortadella und schob die erste in den Mund.
Schon fing er an zu würgen und zu husten. Duca griff sich an den Hals und lockerte den gestärkten weißen Kragen. Vittoria überlegte bereits, ob sie ihm auf den Rücken klopfen sollte. Sie ließ es lieber: Ein Mann lässt sich nun mal nicht gern helfen; er löst alle Probleme allein. Denkt er wenigstens.
»Ich sollte nicht soviel auf einmal in mich hineinstopfen«, meinte der Kardinal, nachdem er wieder Luft bekommen hatte. »Keine Würde, keine Disziplin, könnte Cabeza jetzt sagen.«
Vittoria erinnerte sich widerwillig an den Glaubensminister. Ihm hätte sie zusammen mit Annibale nie begegnen dürfen. Kardinal Cabeza, aufrecht wie ein Marterpfahl und ebenso attraktiv, gehörte zu den Entschiedenen. Der geierhalsige Aristokrat Christi, ein Mann mit einem früh abgearbeiteten, welkenden Gesicht, das um einiges älter erschien als er selbst, benahm sich so anmaßend, als habe er das Evangelium verfasst oder zumindest vervollständigt. Sogar Duca musste sich vor ihm hüten.
Die Frau wischte ein paar Krümel von der Tischdecke. Sie wunderte sich, dass die Fliege sich nicht stören ließ. Statt aufzufliegen, mühte sie sich nach wie vor, möglichst viel von dem Honig zu ergattern, der auf den Tisch getropft war.
Alles ist zu massig, dachte der Kardinalkämmerer gerade. Wie Vittoria immer sagt: Ihr fahrt mit einem Flugzeugträger herum, um eine Handvoll Sardinen zu fischen.
Religion war eine feine Sache, wenn man sie in Maßen genoss. Rom übertrieb alles; vermutlich aus Unsicherheit, wenn nicht aus Unglauben. Nirgendwo fand sich etwas Leichtes, Spielerisches. Was die Kirche anfasste, musste bedeutungsschwer sein. Kein Wunder, dass die Kollegen sich nicht nur hinter den Kulissen des Palastes aufführten, als hätten sie allein das Leid der Welt zu tragen. Dabei konnte keiner von ihnen als Heiland der Mühseligen und Beladenen durchgehen, und erst recht hätte keine Eminenz jemals das Kreuz auf sich genommen.
Was fehlte, war ein Mensch, der sich nicht so ernst nahm wie die üblichen Frommen. Einer, der den Mut hatte, alles stehen- und liegenzulassen, was der Vatikan für wichtig erklärte. Ein Mensch, der selbst dem starren Protokoll des Palastes, ja der steifen Feierlichkeit der Weltkirche unverwechselbar leichte Zeichen einritzte. Einer, der inmitten der bedeutungsschwangeren Purpurmänner einfach zu lachen und zu tanzen begann.
Ihn hieße ich den HERRN, überlegte Duca. Denn der Gott, den ich mir wünsche, zählt nicht wie in der Zwergschule des Glaubensministeriums: erst Demütigung, dann Zuwendung, erst Reue, dann Vergebung. Er hält nichts von den Papstpfauen, die ständig ihr Rad schlagen. Er will vor allem nicht, dass die Nachfolge des armen Jesus von Nazareth sich sichtbar lohnt, in Prunk, Palast, Prälatur.
»Weshalb macht Gott nicht allem ein Ende?« fragte der Kardinal. Er brummte wie ein uraltes Radio, dessen Röhren erst warm werden müssen.
Diesmal konnte Vittoria nicht auf Anhieb folgen.
»Ist SEINE Geduld unerschöpflich?« sagte Duca. Das Radio war mittlerweile angewärmt, doch klang seine Stimme wie ein Störgeräusch.
»Gewiss nicht«, sagte die Geliebte. Sie war auf einmal so munter wie eine Frau, der zu spät einfällt, dass sie einen Kuchen im Herd hat. »Eines Tages wird es sogar ihm zuviel.«
Der Kardinal versank erneut ins Grübeln. Er machte dabei ein Gesicht wie damals, als er mit dem ersten Weisheitszahn zu tun hatte.
Vittoria wusste, dass der Palast über Duca tuschelte. Mehr als ein Prälat, der ihn auf einem Spaziergang in den Vatikanischen Gärten begleitet hatte, musste von den Anfällen nachdenklicher Trauer berichtet haben, die der Chef hin und wieder erlitt. Der Kardinal sprach zwar mit seinen Untergebenen nie über die Vorstellungen, die er von Gott hatte. Um so häufiger gab er zu erkennen, was er von Gottes Welt und Gottes Menschen hielt.
Duca blieb bei solchen Gelegenheiten mitten im Gespräch stehen, fixierte einen der uralten Bäume und meinte, dieser habe schon soviel gesehen und werde noch soviel sehen, dass alle Menschen, Prälaten, Kardinäle, Päpste im Vergleich mit ihm flüchtige Schatten blieben.
»Kann ich abräumen?« fragte Vittoria.
Der Kardinal antwortete nicht. Er schien die Frage nicht gehört zu haben.
Nun lag Petrus II., ein erloschenes Licht mehr, seit Tagen unter einer Marmorplatte, in weißgoldene Gewänder gewickelt und geschmückt mit Insignien, die die Macht und die Geschichte des Papsttums bezeugen sollten. Die Lobreden auf den Toten waren verklungen, und die Erinnerung an den 267. Papst der Kirchengeschichte begann zu verblassen.
Wer nicht eingeweiht war wie Duca, ahnte ohnedies nicht, dass dieser zweite Petrus, ein Fels, dem die Pforten der Hölle nichts anhaben konnten, von innen her zersprungen war. Lange vor dem Attentat, das ihn endgültig Abschied nehmen ließ, war er erstickt unter der unbarmherzigen Unterwürfigkeit, die das Milieu auf ihn geschichtet hatte, um ihn unter Wattebäuschen mundtot zu halten. Die Lügen hatten ihn tödlich erschöpft, die der Vatikan tagtäglich an ihm erprobt hatte und gegen die er sich nicht hatte zur Wehr setzen können.
Duca war nicht nur einmal in die Grotten unter dem Petersdom hinabgestiegen, um vor dem Grab des Freundes still zu werden. Die Zeit rückte heran, sich selbst um einen Sarkophag zu kümmern.
Der Kardinal bedauerte sich: Er hatte einen Job, der sich mit seinem Leben nicht deckte. So erging es freilich allen Menschen.
Erst letzte Woche hatte er durch einen dummen Zufall erfahren, wie es nach Meinung der anderen um ihn stand. Er hatte gerade die Tür hinter seinem Privatsekretär richtig schließen wollen, als er auf dem Flur eine unbekannte Stimme sagen hörte: »Es geht immer mehr bergab mit ihm, finden Sie nicht auch?« Die andere, wohlbekannte hatte geantwortet. Die Worte selbst waren in verhaltenem Gelächter untergegangen.
Da flatterte er wieder, der tiefdunkel purpurne Vogel.
Duca hatte bereits den Text für seine Grabinschrift entworfen und hinterlegt. Unter seinem Namen sollten nur drei Worte stehen. Dubius non perturbatus. Genug, um ein Leben zusammenzufassen.
Ein in tiefem Zweifel Befangener war er, doch keiner, der sich deswegen aufgegeben hätte.
Für eine Grille – Keckes Wagen! – / Hab’ ich das Leben eingesetzt; / Und nun das Spiel verloren jetzt, / Mein Herz, du darfst dich nicht beklagen. Auch dieser Spruch, den ihm ein deutscher Prälat übersetzt hatte, wäre Duca lieb gewesen. Doch hätte ihn niemand verstanden. Die Kardinalswürde eine Grille, das Amt eines Oberhirten im Vatikan ein keckes Wagen zu heißen, überstieg die Fassungskraft der Theologen.
Zikaden gehörten in die Vatikanischen Gärten. Dort zirpten sie jetzt wie verrückt unter der Hitze.
Duca griff nach der bittersüßen Orangenmarmelade. Vittoria wunderte sich nicht. Es war ein besonderer Tag.
Genug der Gräber und Grotten, dachte der Kardinalkämmerer. Da oben, in der kühlen Welt des Papstpalastes, habe ich zu handeln. Obgleich ich den Abschied vom Leben vorbereite, muss ich den vaticani den Eindruck nicht anzweifelbarer Arbeitskraft vermitteln. Unter meiner Leitung ist so schnell wie möglich ein Nachfolger zu wählen. Und selbst wenn der Neue, was kaum auszuschließen ist, nicht einmal zum Repräsentieren, geschweige denn zum Regieren taugt, kann er zumindest seinen Namen schwungvoll unter die Abertausende von Schriftstücken setzen, die der Vatikan so unverdrossen in die Welt schickt.
Duca ärgerte sich. Sogar während er frühstückte, gab ihn der Palast nicht frei. Er musste daran denken, wie der Vatikan versuchte, einer ungläubig gewordenen Welt die eine Wahrheit zu verkünden: Gott existiert. Doch Duca fragte sich zugleich, ob der Heilige Stuhl Beweis genug für diese Tatsache war oder nicht selbst die überzeugendsten Gegenargumente lieferte.
»Empia razza!«
Bei Verdi, dessen Opern Vittoria ebenso schätzte wie er, wurden die Priester so genannt. Eine gotteslästerliche Bande: Das galt nicht nur für die Zeit der Pharaonen.
Jedenfalls schien es den Vatikan nicht im geringsten zu stören, dass Gottes Sohn gesagt hatte, er komme wieder.
5
Der Frühbus zum Petersplatz verspätete sich. Die Reihe der Wartenden wurde immer länger. Als das Fahrzeug endlich um die Ecke bog, waren gereizte Rufe zu hören.
Die junge Frau hatte geduldiger als die anderen gewartet. Sie schien es gewohnt zu sein, nicht auf Anhieb mitgenommen zu werden. Der dunkelgrüne Rucksack, den sie trug, zeigte zusammen mit dem aufgerollten Schlafsack, der oben herausguckte, dass sie sich auf einer Tramptour befand. Sie musste zu warten gelernt haben.
Auch ihr Äußeres war kaum dazu angetan, dass sich alle Türen öffneten. Ihre Haut war gebräunt, doch die hohen Wangenknochen, die Schultern und die Nase leuchteten röter als der Rest und schuppten sich bereits. Offenbar hatte sie wenig Ahnung von der Wirkung der italienischen Sonne. Ihr krauses Haar hatte sie von der Stirn aus streng nach hinten gezogen. Es erforderte gewiss jeden Morgen einige Mühe, bis sie das Aussehen einer ältlichen Jungfer erreicht hatte. Und die unmoderne schwere Brille mit jenen dicken Gläsern, die stets die Augen größer erscheinen lassen, verlieh ihr, wie auch wohlmeinende Freundinnen zugeben mussten, den Blick einer unergründlichen Eule.
Sie kam im Bus neben einem Herrn in blauem Jackett und heller Hose zu sitzen. Der Mann mit der Denkerstirn war ihr bisher nicht aufgefallen, obwohl er einen gepflegten Bart und eine bunt gemusterte Krawatte trug, auf der sich kleine Waschbären tummelten. Während der Fahrt erwies sich der elegant Gekleidete, sehr zum Leidwesen der Frau, als schweigsam. Hin und wieder lächelte er, vor allem wenn er die Werbeaufschriften im Bus studierte.
Er hatte sich nur kurz gefragt, ob er die Frau anbaggern solle. Wie der Kenner wusste, waren es nicht die Schönheiten, die sich sofort herumkriegen ließen. Spätestens seit Casanova stand fest, dass gerade die wenig attraktiven Weiber dankbar waren, wenn sich einer um sie kümmerte. Sie waren stets zu haben.