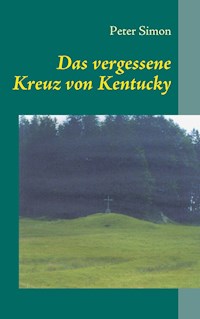Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem heiteren Augustmorgen findet man Papst Petrus II. erschossen in den Vatikangärten. Man will nicht, dass sich fremde Schnüffler in die Angelegenheiten des Kirchenstaates einmischen und lehnt italienische Ermittler ab. Aber ohnehin interessieren sich außer Testa, Sekretär des Papstes, nur wenige für den Täter. Die Kardinäle sind vollauf damit beschäftigt, Aufbahrung und Totenmesse pompös auszurichten und sich vor allem im Machtkampf um die Nachfolge zu behaupten. Könnte sich der Mörder unter ihnen befinden? Monsignore Testa kommt nicht weiter, was auch daran liegt, dass er zum ersten Mal verliebt ist. Da beginnt Schwester Assunta, Haushälterin des Papstes, ein wenig Miss Marple zu spielen … Ein ebenso spannender wie amüsanter Roman, von erfrischender Respektlosigkeit, wie sie nur die intime Kenntnis des Schauplatzes hervorbringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über Peter Simon
Peter Simon (Pseudonym) studierte an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er ist promovierter Theologe, ehemaliger Priester und schaut auf eine langjährige Tätigkeit im Vatikan zurück.
Informationen zum Buch
An einem heiteren Augustmorgen findet man Papst Petrus II. erschossen in den Vatikangärten. Man will nicht, dass sich fremde Schnüffler in die Angelegenheiten des Kirchenstaates einmischen und lehnt italienische Ermittler ab. Aber ohnehin interessieren sich außer Testa, Sekretär des Papstes, nur wenige für den Täter. Die Kardinäle sind vollauf damit beschäftigt, Aufbahrung und Totenmesse pompös auszurichten und sich vor allem im Machtkampf um die Nachfolge zu behaupten. Könnte sich der Mörder unter ihnen befinden? Monsignore Testa kommt nicht weiter, was auch daran liegt, dass er zum ersten Mal verliebt ist. Da beginnt Schwester Assunta, Haushälterin des Papstes, ein wenig Miss Marple zu spielen …
Ein ebenso spannender wie amüsanter Roman, von erfrischender Respektlosigkeit, wie sie nur die intime Kenntnis des Schauplatzes hervorbringt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Peter Simon
Der Papst, die Prophezeiung und das Nest der Waschbären
Roman
Inhaltsübersicht
Über Peter Simon
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Impressum
1
Er lag einfach da.
In den Gärten des Palastes, auf einem frisch geharkten Weg.
Nicoletti ruhte zwischen Rosenbeeten, im vierten Jahr nun gelb statt rot, unter einem von Klematis überwachsenen Bogen im älteren Teil des Parks, drei Steinwürfe vom Dom.
Auf dem Weg war kein bisschen Unkraut zu sehen, da nichts Unordentliches den Heiligen Vater bei seinen Spaziergängen ablenken sollte. Nur der Körper beeinträchtigte das Bild.
Noch störender wirkte, dass es der Papst war, der da lag.
Allerdings sah Petrus II. so gut aus wie immer. Nicoletti machte tatsächlich nicht nur auf Nonnen Eindruck, wie Kardinal de Valmy, Dekan des Kollegiums, jedem anvertraute, der es nicht hören wollte.
Der Papst schien friedlich eingeschlafen.
Der Privatsekretär war kurze Zeit im Zweifel gewesen, ob der Heilige Vater nicht nur aus Erschöpfung niedergesunken war.
Monsignore Testa, Prälat Seiner Heiligkeit, war gegen acht Uhr losgegangen, um den Papst zu suchen. Dieser hatte sich auf dem Spaziergang verspätet, den er jeden Morgen nach der Heiligen Messe und dem Frühstück machte. Da der erste Termin des Samstags, eine Audienz für Kardinal O’Duffy, den eben ernannten Chef der Finanzen, verstrichen war, eine für diesen Papst ungewöhnliche Unhöflichkeit, war Testa die Wege abgeschritten, von denen er wusste, dass Petrus II. sie liebte.
In Höhe des Gouverneurspalastes war ihm Volterra begegnet.
»Morgen, Monsignore, Morgen«, hatte der Gendarm gerufen. Er kam sich wichtig vor, weil er Mitglied des vatikanischen Corpo di Vigilanza war und ab und zu die Aufsicht in einem Abschnitt der Neuen Gärten hatte.
»Wie geht es denn? Haben Sie gesehen, Herr Prälat?«
»Gut, immer besser!«
Testa hatte keine Lust, von dem Mann ins Gespräch gezogen zu werden. Volterra war ihm ein Stück nachgelaufen. Es schien ihm ernst gewesen zu sein.
Als Testa den Schritt beschleunigt hatte, um dem fetten Gendarmen zu entkommen, hatte er beiläufig das Papstwappen wahrgenommen, das vor dem Gouverneurspalast prangte.
Das Gebilde war kaum zu übersehen gewesen, ein Gemisch aus weißgelben Blumen. Unästhetisch das Ganze, nicht im Sinn des Gartenliebhabers Petrus II., doch die Frucht vieler Überstunden.
Die Gärtnerei legte sich ins Zeug. Das Wappen machte Arbeit. Das Kreuz und der simple Buchstabe M, mit dem Johannes Paul II. sein Wappen hatte gestalten lassen, waren ein Kinderspiel gewesen im Vergleich mit den Ansprüchen des regierenden Papstes: Krone, Zacken, Raute, Schild, ein Tier in Gold, das einem Einhorn auf drei Beinen ähnlich sah. Man hätte meinen können, die Nicoletti seien keine Tischler, sondern von Wappenadel gewesen.
»Mein Gott!«
Fast wäre Testa über den Papst gestolpert.
»Heiligkeit! Was ist?«
Da Petrus II. stumm blieb, versuchte der Sekretär, voller Ehrfurcht, den Oberkörper des Liegenden anzuheben. Wie sich herausstellte, war der Heilige Vater nicht ohnmächtig. Blut fand sich zwar wenig, doch oberhalb der rechten Schläfe ein Loch.
Testas Arme gaben nach, der Kopf des Papstes kippte nach hinten, ein Auge öffnete sich, und der Erschossene schaute dem Sekretär von unten ins Gesicht.
Testa ließ den Toten fallen. Die Leiche hatte sich, durch das leichte Tuch des Talars hindurch, unerwartet lebendig angefühlt, lauwarm, beweglich, beseelt, für Sekunden eine verwirrende Empfindung, die der Prälat nicht vergessen würde.
Er legte seine Hände ineinander. Es war ihm, als flösse aus der Verbindung der Finger Stärke. Er würde sie brauchen können. Gern hätte er gebetet.
Nun war es doch geschehen.
»Eigentlich«, hatte der Papst vor Monaten gemeint, als sie unter den Platanen spazierengegangen waren, »eigentlich sind die Gärten unsicher.«
»Aber, Heiligkeit, ich weiß nicht …«
»Falls ein Attentat geplant ist, dann nicht wie bei Karol Wojtyla auf dem Petersplatz«, hatte Petrus II. hinzugefügt.
»Schrecklich, was soll ich …?«
»Sondern in diesem Park. Hier gibt es keinen Schutz. Bei uns steht nicht hinter jedem Baum ein Mann vom Wachdienst wie im Weißen Haus. Der Garten ist vor allem weiter oben unübersichtlich, in der Nähe der Lourdesgrotte, an der Mauer Leos IV.«
»Meinen Sie? Leo IV.?«
»Der fürchtete die Sarazenen.«
»Vor tausend Jahren.«
»Oder im Nordteil«, hatte der Papst gesagt, »hinter der Akademie, beim Casino Pius’ IV., beim Turm Johannes’ XXIII. Und so fort.«
Testa hatte sich umgeschaut. Die Päpste hatten häufig auf- und umgebaut, ohne sich um die Sicherheit zu kümmern.
»Die Mauern und Türme waren brauchbar«, Petrus II. hatte gelächelt, »als wilde Reiter den Palast einnehmen wollten.«
Die Worte des Papstes hatten wie ein Zitat geklungen.
»Gegen die Waffen von heute bieten sie keinen Schutz.«
»Gibt es einen besseren Platz? Mehr Sicherheit als im Garten?« Testa hatte verlegen an seinem Talar gezupft.
»Unwahrscheinlich, dass wir von Hubschraubern angegriffen werden«, hatte ihn der Heilige Vater getröstet. »Daher käme nur das Dach in Frage. Das finde ich unpassend.«
Mehr hatte Petrus II. nicht gesagt. Vielleicht wollte er keinen Vorgänger kritisieren.
Den Dachgarten hatte Paul VI. vor Jahrzehnten anlegen und mit Steineichen bepflanzen lassen. Wozu aber brauchte einer, der über die grandiosen Vatikanischen Gärten verfügen konnte, noch einen gesonderten Park? Auf dem Dach des Palastes?
Auch der Swimmingpool, den polnische Katholiken aus den USA seinem Vorgänger geschenkt hatten, war Petrus II. ein Ärgernis. Nicoletti hatte den Kopf geschüttelt, als er in der Sommerresidenz Castelgandolfo den marmorgesäumten und mit handgeformten olivgrünen Kacheln ausgestatteten Pool sah.
»Zwölf mal fünfundzwanzig Meter! Für einen einzigen Menschen!«
Es wäre ihm nicht eingefallen, ein solches Privatbad zu nutzen.
»Wünschen Heiligkeit auch beim Spaziergang einen Bodyguard? Den Arzt? Den Notkoffer?« hatte Testa gefragt.
»Statt der Schweizer die Argyll and Sutherland Highlanders? Oder ein paar schlagkräftige Marines? Die GSG 9 der Deutschen?«
Der Privatsekretär hatte gefühlt, dass er eine Lektion bekam.
»Ich brauche keine Wache. Und erst recht keinen Geheimdienst. Ich möchte nicht dauernd kontrolliert werden. Ein Papst will auch mal allein sein. Im übrigen, Monsignore, ist mein Leben in Gottes Hand. Er allein bestimmt, wann es zu Ende ist.«
Testa hatte diesen Sätzen damals wenig Bedeutung zugemessen. Jetzt fühlte er sich überfordert. Er hatte Finsternis, Blitz und Donner mit seinen Vorstellungen von einem Mord verbunden, eine gespenstische Stimmung, eine Inszenierung wie bei Lady Macbeth persönlich, bluttriefende Hände, Dolche, Schreie.
Und nun, im Angesicht eines der großen Verbrechen der Kirchengeschichte, Ruhe, himmlisch heiteres Wetter, ein Garten, der still in der Morgensonne blühte. Offenbar wollte Gott den gewaltsamen Tod des Stellvertreters Christi auf Erden nicht noch mit düsteren Wolken begleiten.
Der Himmel blieb blank.
Testa hatte sich das Ende eines Lebens, wenn überhaupt, geruhsam gedacht. Aus der Distanz des jungen Klerikers, die seiner Predigt Gemütsruhe garantierte, hatte er den Tod, wie Theologen anrieten, mit dem Erlöschen einer herabgebrannten Kerze verglichen. Oder, eine weitere Lesefrucht, mit dem Stich einer Mücke, die lange auf dich gelauert hat und startet, kaum hast du das Licht am Bett gelöscht.
Nun aber hatte der Tod ohne Vorwarnung sein Gesicht gezeigt. Jetzt war nicht nur eine entsetzlich endgültige Entscheidung getroffen, auch alle Vorstellungen waren schlagartig abgelöst worden. Kein heransurrendes Insekt mehr, kein still sterbendes Licht, nein, das Auto, das von einer Sekunde zur anderen auf dich zurast und dich lehrt, dass es Dinge gibt, denen du nicht entkommen wirst, der erste falsch eingeschätzte Wagen, der das Vertrauen auf den Fußgängerüberweg jäh zerstört.
Unpassend, so ein Tod, dachte der Prälat, und unfair.
Er rannte in Richtung Palast, vom Fundort weg, immer bergab, die Reihen korrekt geschnittener Buchsbäume entlang, an dem Stück Berliner Mauer vorbei, das Johannes Paul II. vermacht worden war, zwischen Hecken wie in einem Labyrinth auf und ab, hin und her, bis zu den gepflasterten Gassen, die den Petersdom umgeben.
Ohne es richtig wahrzunehmen, hatte er in diesen Minuten mit dem Rosenkranz in der Tasche gespielt, den starren Leib des Gekreuzigten zwischen den Fingern gespürt, sich schließlich an dessen Todesqual erinnert.
Unterwegs hatte Testa einem Gärtner und dann Volterra zugerufen, der Heilige Vater dürfe heute unter keinen Umständen gestört werden, er wolle ganz allein sein.
Der Gendarm hatte die Hand an die Mütze gelegt.
»Geht in Ordnung, Monsignore«, hatte er gesagt und ihm nachgerufen: »Fallen Sie nicht!« Und, als er weiter weg war: »Haben Sie es jetzt gesehen?«
Was mochte der aufgeblasene Kerl gemeint haben? Den Toten nicht. Sonst hätte Volterra bereits den Palast alarmiert, Notärzte und Feuerwehr mobilisiert.
Der Prälat hastete weiter, schloss mit zitternden Fingern eine Geheimtür auf, blieb mit Seitenstechen auf einem der unteren Flure stehen.
Diesmal nur nicht zu bemänteln suchen wie die damals bei Johannes Paul I., den sie im Bett aufgefunden haben wollten. Bei geistlicher Lektüre vom Herzschlag getroffen.
Testa wusste, das würde nicht noch einmal klappen. Schon der Gedanke an die Lüge war nichtswürdig. Er ballte die Hand so fest zur Faust, dass sich die Nägel in den Ballen gruben.
Nein, nicht verfälschen, diesmal nicht. Kein Herzstillstand. Kein frommes Buch. Wieder mal Mord.
Unglaublich, der Papst soeben in seinem Garten umgebracht. Ein Loch in der Schläfe, ein Blutfaden.
Es wurde Testa klar, dass er, mit Ausnahme des Täters oder der Täter, für Minuten der einzige Wissende war. Kurz fühlte er ein Allmachtsgefühl in sich aufsteigen.
Massimo Testa, Superkopf, Informant der Welt.
Kindisch.
Cäsar im Senat, Lincoln in der Loge, und Nicoletti im Garten, lauter Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung. Nein, das auch wieder nicht, sagte sich der Prälat, in diese Reihe passt der Papst kaum. Als hätte ich nicht Wichtigeres zu bedenken!
Wer war Brutus in diesem Stück?
Eher unbewusst räumte Testa im Arbeitszimmer Petrus’ II. hellgrüne Briefumschläge zur Seite, zog die abgegriffene Ledertasche weg, hob eine Schatulle mit Briefmarken hoch, raffte Dokumente zusammen, die den Stempel Sub secreto trugen und als geheim galten, legte sie auf den Stapel zurück, schaute die Suite des Heiligen Vaters und die Gästeappartements durch, warf einen Blick auf den Käfig mit dem Haustier Seiner Heiligkeit, aber fand das Tagebuch, das er, ohne es sich einzugestehen, gesucht hatte, auch nicht in der Minibar des Zimmers. Dafür waren in den Räumen viele Seiten mit Notizen verstreut, die sich Petrus II. wahrscheinlich für die erwartete Moral-Enzyklika gemacht hatte.
Aus der wird nichts mehr, überlegte der Monsignore. Dabei hat Nicoletti viel an ihr gearbeitet.
Der Papst war fleißig gewesen. Immerhin hatte er das erste Jahr seiner Amtszeit im Palast verbracht, um die Aktenberge abzutragen, die der Vorgänger, der lieber auf Reisen war, aufgehäuft hatte.
Testa schaute gedankenverloren auf eine Rolle Pfefferminzdrops, die neben dem Brevier auf dem Tisch lag. Dann griff er nach der goldbraun gewirkten Kordel, die links, hinter dem Schreibtisch, an der Wand hing, und klingelte nach Schwester Assunta.
Die Haushälterin, aus einem Flecken in Apulien, war eine Eiche von Frau. Ihre zupackende Art hatte den Papst ein wenig geängstigt. Wer sie nicht mochte, nannte die Unbeschuhte Karmelitin bärbeißig. Doch sie war sensibler, als sie zu erkennen gab.
Nach nicht einmal einer Minute klopfte Assunta an die Tür und stand im Zimmer. Sie schien Teig an den Händen zu haben. Vielleicht war sie damit beschäftigt gewesen, das Lieblingsdessert Petrus’ II. zuzubereiten. Sonntags gab es Schokoladen-Nusstorte mit der von Wojtyla übernommenen Aufschrift Sto lat, hundert Jahre soll er leben.
2
»Sie haben geläutet, Monsignore?«
»Der Papst! Sie haben den Papst erschossen!«
»Tot?«
»Ja«, sagte Testa tonlos.
»Woher wissen Sie …?« Assunta kreuzte die Arme abwehrend vor der Brust.
»Ich habe ihn gerade gefunden. Im Garten.«
Der Nonne schoss der Spruch durch den Kopf, ein Papst sei grundsätzlich kerngesund – bis er sehr schnell sterbe. Sie wunderte sich über sich selbst und versuchte ein Ave Maria, begann mit den vertrauten Worten, stockte, fing von vorne an, wusste wieder nicht weiter, bemühte sich, das tausendfach geübte Gebet zusammenzubekommen.
Nein, sie würde nicht weinen, sondern nüchtern reagieren. Zumindest hoffte sie auf ihre Kraft.
Assunta dachte im schrecklichsten Augenblick ihres Nonnenlebens nur kurz an die Zukunft. Sie musste realistisch sein. Es war eine Tatsache, dass ihre Zeit als Bedienerin des Bischofs, Kardinals und Papstes Nicoletti nach siebenundzwanzig Jahren unwiderruflich zu Ende war.
»Ich werde auch bald gehen müssen«, murmelte sie in Richtung des Prälaten, ohne ihn anzusprechen, »in ein Kloster umziehen. Im Süden.«
Weshalb sie soeben von der Provinz gesprochen hatte, hätte sie nicht erklären können. Mochte sein, sie hatte an ihre Heimat gedacht, an einen Ort, der möglichst weit weg war, an ein Zuhause, das nichts mit dem Vatikan zu schaffen hatte, diesem Ort des Todes.
Sie stand aufrecht, hielt sich jedoch am Schreibtisch fest.
»Da bleibe ich eingeschlossen. Bis zu meinem Tod.«
Assunta richtete ihren Blick an Testa vorbei auf einen Punkt über dessen linker Schulter. Dort hing das Kreuz. Sie selbst hatte es mit einem Kräuterbüschel geschmückt.
In der Tat, überlegte Testa, da wird sie von Erinnerungen leben, an ihren Papst und die Zeit in seinem Dienst denken.
»Und alle Mitschwestern platzen vor Neid«, fügte sie hinzu.
Assunta war ohne Trost. Doch ihre Stimme hatte sie wieder unter Kontrolle. Zumindest schien es dem Prälaten, als habe die Nonne alle Gefühle hinter einem zunehmend resoluten Ton zu verstecken begonnen. Das mit den Mitschwestern hätte sie sonst nicht gesagt, vor allem nicht so abfällig.
Ich bin selbst aus der Fassung, sagte sich Testa und schaute in ihr fahles Gesicht.
Wenige Augenblicke später rückte Assunta ihren Schleier zurecht und nahm die Angelegenheit in die Hand.
»Eines ist ausgeschlossen. Der Vatikan kann den Papst nicht im Garten präsentieren. Petrus II. muss in seine Suite gebracht werden. Er hat Anspruch auf besondere Würde.« Sie schluckte. »Wir schaffen ihn hier herauf. Dann richten wir den Leichnam her. Erst danach, Monsignore, werden andere informiert.«
Testa nickte. Was sie gesagt hatte, war logisch.
»Ich kann aber nicht mit Ihnen zusammen den Papst aus dem Garten holen«, entschied Assunta. »Eine Klosterfrau und ein Prälat, diese Klosterfrau und dieser Prälat – und eine zugedeckte Bahre, unmöglich.«
»Ich nehme an«, sagte Testa, »auch ein Gärtner scheidet aus. Schmutzige Hände.«
»Mit denen er den Papst anfasst, und mit der Schubkarre … Nein.«
Testas Blick verriet, dass er diese Direktheit weder bei ihr noch bei sich erwartet hatte.
Assunta sah noch entschlossener aus. »Wir brauchen zwei Männer, Schweizer. Wir müssen sie sofort einweihen.«
Sie wartete auf seine Antwort.
»Oder Gendarmen?« Testa dachte an Volterra. Was hatte der nur gesehen?
»Nein, die zuletzt. Italiener schweigen nicht!«
Sie öffnete den Mund, als wolle sie noch etwas über ihre Landsleute sagen, und überlegte es sich dann.
»Und die Ehrengarde? Die wäre angemessen.«
»Unsinn, Monsignore. Entschuldigung. Ich muss es so deutlich sagen. Die schlafen noch. Und bis die sich ausstaffiert haben, rote Hosen, Kürassierhelme, Rossschweif, Schleppsäbel! Lauter unpraktisches Zeug.«
Der Prälat nickte. Er war froh, Assunta bei sich zu haben.
»Sollen wir so noble Herren eine Leiche tragen lassen?« fragte die Nonne. »Unauffällig?«
Also telefonierte Testa.
Er traf auf respektvolles Erstaunen im Mannschaftsraum der Schweizergarde. Es war nicht üblich, vom Sekretär des Papstes angerufen zu werden.
»Ich brauche sofort, … sofort, hier oben zwei von euch!«
»Schnell geht das nicht, Monsignore«, sagte der Hellebardier Hansruedi Kümmerli jr., »wir müssen uns noch ankleiden.«
»Was?« Der Prälat fasste den Hörer fester.
»In Schale werfen. Für Seine Heiligkeit, verstehen Sie?«
»Nein, nein, heute nicht!«
»Nicht? Wieso?«
»Kommen Sie, wie Sie sind!«
»Es ist Vorschrift! Unser Weibel wird fuchsteufelswild, oder? Bei der Vereidigung mussten wir …«
»Sie schicken zwei Männer herauf, sofort, verstanden! Ohne Karabiner bitte!«
»Wir kommen in Teufels Küche. Ruebli hat gesagt, wir …«
»Das ist ein Befehl!«
»Befehlen kann uns nur der Obrist, oder?«
»Nochmals: Sie kommen sofort. Sonst gibt es Ärger mit dem Papst!« Testa hielt den Hörer noch einen Moment in der Hand, strich mit dem Zeigefinger darüber, legte auf.
Was hat dieser Apparat schon alles gehört, dachte er.
Kaum waren die beiden Männer in blauem Wams mit bauschigen Ärmeln erschienen, gleiche Mützen, gleiche Gesichter, redete Testa auf sie ein. Sie wurden zusehends blasser, da sie Petrus II. begegnen sollten.
Gegen neun Uhr dreißig zog er endlich mit Robert Gschwendi und Jörg Ziegelkatz los. Die zwei hatten nur nach einigem Zureden ihre Hellebarden zurückgelassen. Der eine hatte die leichte Bahre geschultert, die Assunta wer weiß wo aufgetrieben hatte, der zweite trug ein zusammengefaltetes Laken über dem Arm.
Unterwegs kein Wort.
Nach einer Schreckminute, in der die Schweizer ihre Kappen abgelegt, wieder aufgesetzt und vor dem Toten zu salutieren versucht hatten, legten sie zu dritt den Körper auf die Trage, rückten ihn zurecht und deckten ihn zu. Der Monsignore vergewisserte sich, dass sie nichts vergessen hatten.
Hier ist der Fundort Tatort, schloss Testa, keine Spuren. Der Papst wurde nicht hierhergeschleppt.
Der Zug setzte sich in Bewegung. Er verursachte kein Aufsehen, da die Gärten nicht für das Publikum geöffnet waren und keine Passierscheine mehr ausgestellt wurden, nicht einmal ein Permesso für Nichten und Neffen von Kardinälen. Niemand von den wenigen Angestellten, die hätten Augenzeugen werden können, wäre auf die Idee gekommen, ihr oberster Dienstherr werde gerade vorbeigetragen.
Im Palast tat sich nicht viel. Am Wochenende arbeitete ein Notdienst. Es gelang den dreien, unbemerkt den reservierten Aufzug zu erreichen.
Die Türen, Messing mit tiefgraviertem Papstwappen, jeden Tag von Fingerabdrücken gesäubert und blankgescheuert, öffneten sich lautlos. Eine in Samt ausgeschlagene und mit einer thronähnlichen Sitzgelegenheit aus Plüsch versehene Kabine wurde sichtbar. Für einen lebenden Papst bot sie Platz genug. Die Bahre passte freilich nicht hinein.
»Man kann ihn nicht auf den Sessel setzen. Oder an die Wand lehnen.«
Gschwendi hatte ausgesprochen, was alle dachten. Gleich darauf bekam er rote Ohren und guckte an die Decke.
Dem Monsignore fiel ein, was er bei einem Schriftsteller gelesen hatte, der über seine Arbeit klagte: Morden ist leicht, Leichen beseitigen schwer. Daran zu denken war unpassend, doch in solchen Augenblicken kommen einem die schlimmsten Gedanken.
»Sie folgen mir in einem Abstand von fünf Metern!«
Testa wollte vorausgehen und dafür sorgen, dass ihnen niemand über den Weg lief. Das hätte noch gefehlt, womöglich eine Begegnung mit einem aufgeweckteren Kardinal, dessen Fragen ein rangniedriger Prälat wie er nicht hätte abwiegeln können.
Wie erkläre ich eine verhüllte Bahre mitten im Vatikan? Er geriet bereits bei dem Gedanken in Panik.
Die oberste Etage des Palastes war hermetisch abgeriegelt. Keinem Papst sollte passieren, was die ehemalige Queen erlebt hatte: Ein Fremder im Schlafzimmer, eingestiegen, ohne dass eine Wache ihn bemerkt hatte.
Die Treppen erwiesen sich als nicht sehr zweckmäßig.
»Das ist verwickelt!« meinte Gschwendi.
»Ein Problem«, sagte Ziegelkatz und kratzte sich am Kopf.
Manche Treppen waren vor Jahrhunderten so gebaut worden, dass hohe Herren sie zu Pferd nehmen konnten. Für den Transport einer sperrigen Leiche waren sie ungeeignet. Die drei mussten mehrmals umkehren.
»Problematisch, oder?« sagte Ziegelkatz. »Auf und ab.«
»Hü und hott«, darauf Gschwendi.
Endlich fanden sie eine Treppe, die breit genug war, die Bahre von Stufe zu Stufe hochzuheben, Testa voraus, die Träger links und rechts, Petrus II. in der Mitte.
Die Gardisten, Männer um die Zwanzig, kamen ins Schwitzen. Obgleich ihre Dienstvorschrift Militärtauglichkeit und eine Mindestgröße von 174 cm verlangte, wirkten sie überanstrengt. Sie schienen erleichtert, hin und wieder die Trage absetzen zu können.
3
Endlich.
Das Arbeitszimmer des Ermordeten. Es glich eher einem Heiligtum als einer Kommandozentrale. Trotzdem gab es nicht den Kitsch aus zwei Jahrhunderten Papstgeschichte wie bei früheren Bewohnern, keine Statuen, Votivtafeln, Schaukästen, ausgeliehen von den Vatikanischen Museen.
Testa war zusammengezuckt, als er die geheiligten Räume vor vier Jahren zum erstenmal betreten hatte. Damals hatte er noch Relikte des vorigen Pontifikats vorgefunden. Am scheußlichsten war die Vitrine gewesen, in der sich drei Wachsmasken befanden. Sie stellten eine Frau dar, auf deren Zügen sich das Leben im Jenseits spiegelte, holdselig im Himmel, traurig im Fegefeuer, in der Hölle angstverzerrt. Anima Beata – Purgante – Dannata stand auf einem Klebezettel.
»Eine grässliche Vorstellung. Ich singe Halleluja, während ein Mitmensch im Feuer schmort«, hatte Schwester Assunta gesagt, die ihn begleitet hatte.
»Petrus II. betreibt gewiss kein Geschäft mit der Angst«, hatte Testa erwidert.
Die Zeiten sind vorbei, hoffte er, da die Gläubigen einem Papst abnahmen, ihre Chancen, der Hölle zu entkommen, stünden eins zu hunderttausend.
Die Wachsmasken waren weg. Doch wie bei allen Leuten standen persönliche Erinnerungsstücke herum, Fotos aus der Zeit im römischen Seminar, Nicoletti als Neupriester, als Bischof von Perugia, als Erzbischof in Turin.
Aufnahmen mit Staatsmännern fehlten. Kein Papst hatte es nötig, wie ein Präsident, Premierminister oder Bundeskanzler damit anzugeben, wer ihm sein Konterfei signiert hatte. Der Vatikan wusste, dass alle froh waren, ihrerseits mit einem Bild Petrus’ II. renommieren zu können.
Geschmack hatte Petrus II. gehabt und Ordnungssinn. Testa war aufgefallen, wie akkurat die Bücher mit den Lederrücken und Goldprägungen, vermutlich Erstausgaben, ausgerichtet waren. Die Sitzgarnitur war aus dem achtzehnten, Louis-quinze, der schwere Refektoriumstisch, der als Schreibtisch diente, aus dem sechzehnten Jahrhundert.
Auch zwei kleinere Gemälde hingen im Arbeitszimmer, eine Kreuzigung von Andrea Mantegna, wie der Papst erklärt hatte, und, wenig passend, wie dem Monsignore schien, die Morgenszene eines französischen Impressionisten. Testa hatte sich nie nah genug an das Bild herangewagt, um die Signatur entziffern zu können. Es schien ein Seurat zu sein. Oder ein Renoir. Er hatte nicht fragen wollen.
»Alles ist vorbereitet. So gut es ging.«
Assunta hatte die Fensterläden eingeholt und die Fenster geschlossen, darunter das weltberühmte, von dem aus der Papst sonntags eine Kurzansprache an die Gläubigen richtet.
»Ihr zwei sagt kein Wort!« Die Ordensfrau hatte ein Trinkgeld besorgt. Sie kannte schwarze Kassen. »Da! Bitte. Schnell!«
Gschwendi wollte zugreifen. Ziegelkatz schien entrüstet. Gschwendi zog die Hand zurück und fand an ihr eine Stelle zum Kratzen.
»Es gehört sich nicht«, brachte er hervor.
»Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert.«
Assunta zuckte die Achseln, die beiden verstanden nichts, sie steckte das Geld wieder ein, bot ersatzweise eine Medaille an, vom Papst geweiht, schickte die Gardisten weg und besprach mit Testa, was zu tun war.
»Hier liegt er nicht richtig. Er muss raus aus diesem Zimmer und runter von der Bahre.«
Testa und sie schleppten die Trage zwei Türen weiter ins Schlafzimmer. Dort hoben sie den Körper hoch und legten ihn vorsichtig ab.
Gut, dass ich das Bett noch nicht gemacht habe, dachte Assunta. Ihr Herz hämmerte. Sie spürte es zum erstenmal. Meinen Papst tragen zu müssen, ihn getragen zu haben. Das Atmen fiel ihr noch schwerer.
Die Ordensfrau hatte den Pyjama des Papstes auf einen Stuhl neben das Bett gelegt und dabei den Duft des Körpers wahrgenommen, der an dem Kleidungsstück haftete. Auch dieser Geruch hatte ihr fast den Atem genommen.
Petrus II. lag auf dem Bett, einem schmalen Messinggestell mit der Rosshaarmatratze, die er wegen seiner Rückenschmerzen vor Jahren ausgesucht hatte. Gegenüber stand der Heimtrainer.
»Jetzt bekomme ich Arbeit.«
Was für eine, dachte sie, kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, was für eine.
Die Haushälterin schloss zuerst das Auge des Papstes, indem sie das Lid mit dem Daumen nach unten schob und leicht andrückte. Dann ordnete sie die Lage des Körpers, richtete die Beine aus, die Füße, legte die Arme über Kreuz, hob den rechten Arm, der heruntergerutscht war, wieder hoch, strich Falten an der Soutane glatt, zog einen Scheitel durch das silbergraue Haar, das Petrus II. so fotogen gemacht hatte, und wunderte sich wieder über das Loch in der Schläfe.
Es hatte nur den Durchmesser eines dünnen Bleistifts, und doch starrte es grausam.
»Wie oft habe ich gesehen, und Sie auch, Monsignore, dass der Heilige Vater sich die Schläfen einrieb. Er hatte häufig Kopfweh. Gerade in den letzten Wochen. Viele Sorgen.«
Assunta entschied sich, die Leiche zu schminken. Sie war der Meinung, das Oberhaupt der Weltkirche könne in seinem jetzigen Zustand noch ein wenig mehr Kosmetik als sonst vertragen. Die Nonne schaute fragend.
»In einem Toilettenschränkchen finden Sie sicher was Brauchbares, Schwester. Ich nehme an, Sie wollen …« Kaum hatte Testa das gesagt, reute es ihn. Die Haushälterin musste das doch wissen.
»Ich kann aus meinen Beständen nicht aushelfen«, sagte sie in einem Anflug von Selbstmitleid, »ich Klosterfrau.«
Die Nonne wusste viel, wenn nicht alles, über die Gewohnheiten ihres Chefs. Das Wissen teilte sie mit den Kammerdienern der Großen dieser Welt. Für sie war der Papst ein Mann, der mit Rasierklingen, After-shave und Blutstillstift hantierte wie Millionen andere auch, die sich nass rasierten. Deodorants, Duftwässer? Nichts Ungewohntes für einen solchen Mann.
Ihn auf dem Bett herzurichten, wie es ihren Vorstellungen von einem toten Papst entsprach, fiel nicht schwer. Von dem schaurigen Anlass abgesehen.
»Pfuschen wir der Mordkommission nicht ins Handwerk?« Testa kam sich nachlässig vor. Das hätte er längst fragen müssen.
»Absolut nicht. Es wird keine Kommission geben, Herr Prälat!«
Assunta tat, als handle es sich um die unwichtigste Frage der Welt. Ihre Antwort hatte festgestanden. Sie pflückte Steinchen von der Soutane und säuberte das Gesicht des Toten von den Sandkörnern des Gartenweges.
»Der Papst, tot oder lebendig, ist Chef eines souveränen Staates.«
»Keiner Polizei unterworfen.«
»Monsignore, das machen wir allein«, sagte sie. »Eine Mordkommission im Palast, das fehlte noch. Was sollen die Leute denken!«
Testa dachte eine Sekunde lang an die Morde, die dem Vatikan seit Jahrhunderten angelastet wurden. Waren sie nur Schnappschüsse im Fotoalbum der Päpstlichen Familie?
»Sollen wir den Papst vor einem Kommissar identifizieren?« Assunta hatte das letzte Hälmchen weggezupft. »Und der Schreibkram, die Verhöre, die Leute mit den gierigen Augen. Das unersättliche Gesindel hier oben? In der Suite? Alles muss ausgebreitet werden, alle Schubladen öffnen sie, jedes Buch schlagen sie auf, jedes Bild drehen sie um.«
Sie nahm sich vor, auch diese Arbeit selbst zu tun.
Nochmals eine Falte zurechtgerückt. Der Papst sah immer besser aus. Freilich hatte sich das Auge wieder etwas geöffnet, und ein blinder weißer Halbmond war unter dem Lid erschienen. Assunta griff ein.
»Richtig. Draußen lassen«, sagte Testa, »auch den Ballistiker, der die Kugel herausholt und untersucht. Feststellen will, welcher Schusswinkel …«
»Hören Sie auf, Monsignore«, unterbrach ihn die Haushälterin. »Wir wollen uns nicht selber quälen. Mit Schussbahnen, Kalibern, Verteilung von Blutspritzern.« Sie schaute ihm in die Augen.
Ein lauter Schuss.
Von fern, doch gut zu hören. Beide zuckten zusammen. Vieles konnten sie jetzt brauchen, nur keine Schüsse.
»Das war die Kanone vom Gianicolo.« Sie fassten sich wieder.
Der Schuss verkündete, dass es zwölf Uhr Mittag war. Seit einiger Zeit schoss man wieder, wie es Verteidigungsminister De Bonis (Sammlungsbewegung) seinem Kollegen Pellegrini von den Neofaschisten zugesagt hatte, der für den Fremdenverkehr zuständig war.
»Jetzt schalten sie in den Büros die Computer aus, gehen zur Stechuhr und machen Pause. Und wir fangen erst an«, sagte Testa mit dünner Stimme.
»Unsinn«, wies ihn die Ordensfrau zurecht, »heute ist Samstag. Niemand packt mit dem Schuss ein.«
Der Prälat sagte nichts mehr. Sein Gewissen machte ihm zu schaffen.
Wir sind draußen herumgetrampelt, überlegte er, haben Spuren vernichtet. Keine Polizei der Welt wird Verständnis haben. Aber den Mörder müssten wir schon fassen.
Testa hatte das Ende einer langen Geschichte wie einen Faden in der Hand. Es kam darauf an, sich bis zum Anfang durchzuarbeiten.
»Wo ist das Käppchen?«
Die Nonne hatte die Kleidung des Papstes überprüft und das weiße Käppi vermisst.
»Hat er es überhaupt getragen? Im Garten?«
»Ich habe ihm nicht nur einmal gesagt, dass er es da nicht braucht. Aber er hört nicht auf mich.«
Assunta schien gekränkt, und Testa musste losgehen. Wertvolle Zeit verstrich, weil er das dumme Ding nicht fand. Er suchte am Tatort, schaute in das Gebüsch am Rand des Weges, hob Äste, schüttelte Zweige, hinterließ weitere Spuren.
Hoffentlich sieht mich Volterra nicht noch einmal, ging es ihm durch den Kopf.
Wozu das Ganze? Das Käppchen war unwichtig, schließlich gab es Ersatz. Petrus II. hatte aus aller Welt Nachschub bekommen; die Frömmsten wollten ihm immer wieder ein Käppi schenken – und Dank und Segen erhalten.
Was schenkte man einem Papst? Einen Petersdom in Afrika oder, wie vor einem Dutzend Jahren, ein Hotel? Damit anreisende Kardinäle eine standesgemäße Bettstatt fanden?
Gab es kein Vorratslager im Vatikan, wo die Geschenke aufbewahrt wurden, die Gläubige und Ungläubige gemacht hatten? Weinflaschen, Messgewänder, Armbanduhren, Monstranzen, Bücher, Schwimmflossen, Skier, Tauchermasken, Rennräder, Paddel, Fußbälle, Autos, Korallen, altes Elfenbein, ausgestopfte Echsen?
Die Ordensfrau war in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen. Der Papst sah attraktiv aus. Assunta hatte auch den Strauß gelber Rosen, der auf dem Schreibtisch gestanden hatte, neben das Bett gestellt. Jetzt konnten die wichtigen Leute verständigt werden.
»Nun habe ich ganz den Kardinal O’Duffy vergessen. Der wartet womöglich noch immer auf seine Audienz.«
»Monsignore, seien Sie freundlich zu ihm, das mag er. Und dann bitten Sie ihn, in seine Behörde zurückzufahren. Der Papst fühlte sich von einem Moment zum anderen nicht wohl.«
So entscheidend der Finanzmann O’Duffy im Vatikan war, jetzt konnte das Haus ihn nicht brauchen.
»Alle Termine sind abzusagen. Wer sofort kommen muss, ist Bechtli.«
»In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Was soll er bloß den Journalisten erzählen?«
Neben Bechtli, dem Pressesprecher des Vatikans, war noch ein anderer zu informieren.
Annibale Kardinal Duca trug den Titel Kämmerer der Heiligen Römischen Kirche. Dieser Camerlengo war nach dem Tod des Papstes plötzlich zum wichtigsten Mann an der Kurie geworden.
4
Seine Eminenz fluchte herzhaft.
Jetzt wollte Duca sich entspannen. Er liebte es nicht, in diesen Stunden gestört zu werden. Sein Sekretär wusste das. Zumindest hätte er es ahnen müssen. Cavolo taugte nichts.
Nur er kann wissen, wo ich bin. Duca stemmte sich vom Bett hoch. Warum stört mich der Tropf?
Der Kardinal, von vertrauenerweckender Fülle, suchte seine Socken und band den blauen Bademantel mit dunkelgrünen Tupfen zu, ein Geschenk aus Liebe, das er nicht mochte. Dann zog er die Unterhose hoch.
Alles durcheinander. Nichts klappt heute.
Duca brauchte einige Zeit, um aus dem schlingernden Gang eines Seebären herauszufinden. Er stolperte auf dem Flur über eine Falte im Läufer.
»Lass doch, komm kuscheln! Hier ist es schön warm.«
»Nein!«
»Stell dich tot!«
Vittoria hatte gerufen.
Duca knallte die nächste Tür. Die Frau lärmte weiter.
Vittoria. Ein passender Name. Der Camerlengo machte gern das Victory-Zeichen, hatte er den Gipfel erreicht.
Sex in der Jugend und Liebe im Alter sind zwei Paar Stiefel, pflegte er zu sagen, junge Hüpfer springen dreimal hintereinander, ohne abzusetzen. Ich bin froh, wenn der Berg nicht zu steil ist, wenn ich unterwegs nicht aufgehalten werde und keuchend von vorn beginnen muss.
Das Victory-Zeichen. Warum nicht? Andere greifen zur Zigarette, redete er sich ein. Seinen Bischofsring, einen wasserhellen Aquamarin, nahm er jedesmal ab: Nicht, weil es unschicklich war, Vittoria angetan mit den Insignien seiner Würde zu lieben, sondern weil der Ring beim Spiel störte.
Die Geliebte hatte das italienische Bild oft verwandt: »Alter, du hast Stroh im Schnabel, bist unsäglich verknallt!«
Duca mochte sie. So aufrichtig, wie das ein zum Zölibat verpflichteter Mann tun kann. Eine bessere Wochenendbekanntschaft gewiss, nicht mehr. Aber sie hielt schon fast zehn Jahre. Viele verstohlene Gemeinsamkeiten, das verbindet.
Er bedauerte, dass er Vittoria nur selten begleiten durfte, und in die Innenstadt gar nicht. Es hätte ihm Spaß gemacht, mit ihr eine Parfümerie aufzusuchen, etwa Materozzoli, und stundenlang Düfte auszuprobieren, wie es sich in seiner Vorstellung für Ehemänner von Stand geziemte.
Schließlich, war er überzeugt, schickte kein Mann, der auf sich hielt, seine Frau mit einem Packen Kreditkarten los, damit sie einkaufte, was ein Paar hätte gemeinsam aussuchen müssen. Doch es ließ sich nicht ändern. Er war nie dabei, wenn Vittoria ihre Seidenunterwäsche bei Emmy Funaro an der Spanischen Treppe kaufte. Umgekehrt musste der Kardinal bei den Brüdern Gamarelli in der Via di Santa Chiara die Stoffe für seine Robe allein auswählen.
Er hätte Vittoria auch geheiratet. Aus Liebe. Er wollte sich nicht mit den abgelebten Achtzigjährigen vergleichen lassen, die am Arm von wasserstoffblonden Models aus dem Standesamt schlurften.
Manchmal sah er ihr Hermès-Tuch mit den gefleckten Pferden zwischen den Leuten leuchten, wenn er das Pontifikalamt zelebrierte, in Goldbrokat gekleidet auf dem Bischofsthron seiner Titelkirche saß und sich mit mächtigen Schwüngen des Rauchfasses ehren ließ. Vittoria trug das Tuch noch lieber, seit Duca ihr erklärt hatte, warum Frauen in den Kirchen des Südens den Kopf zu bedecken hatten.
»Ihr führt sonst die Engel in Versuchung.«
»Oh, là, là. Ihr habt für alles eine himmlische Erklärung.«
»Eine himmelschreiende?«
Sie hätten sich gern in der Kirche zugezwinkert. Das wäre schön gefährlich gewesen.
Duca, Sternzeichen Löwe, gefiel sich in der Rolle des sorgenden Gatten. Vittoria, gut dreißig Jahre jünger, gab ihm das Gefühl, gebraucht zu werden.
Er galt seinen paar Untergebenen als ein umgänglicher Chef, auch wenn er oft heftig wurde und auf Bagatellen wütend reagierte. Seine Anfälle waren bekannt. Doch alle im Dorf Vatikan wussten, dass sich die Gewitter schnell verzogen. Seinerseits erzählte der Camerlengo gern, nachdem sein Zorn verraucht war, der aufbrausende Gründer des Jesuitenordens habe beinahe einen Schwarzen erschlagen, der die Jungfräulichkeit Mariens angezweifelt hatte.
Gern wäre Duca Vater, Großvater gewesen, der Kinder auf dem Schoß schaukelte und ihnen die Welt erklärte. So lebensklug kam er sich vor, so erfahren.
Er hätte seine Tricks fürs Überleben weitergeben wollen, aber kaum jemand hörte ihm zu. Alle vaticani schienen mit ihren eigenen Tagträumen ausgelastet zu sein.
Wenn Vittoria ihn anerkennend liebkoste, glaubte der Kardinal, seine Haut reagiere wie die eines jungen Mannes. Doch sein Körper beunruhigte ihn stärker, als er zugab. Es war nicht das Haar, das sich über den Schläfen weiß gefärbt hatte. Er wurde das Gefühl nicht los, dass Knie, Blase und Herz sich verabredet hatten, ihn zum besten zu halten.
Nicht nur der launisch gewordene, ausleiernde Leib machte ihm zu schaffen. Mehr und mehr empfand er eine Schwermut, die sich bereits in den Jahren, die er die besten genannt hatte, in sein Leben geschlichen haben musste. Er hatte sie nur zögernd bemerkt, überhaupt zu spät aufgespürt, widerwillig zur Kenntnis genommen. Das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber sich selber ärgerte ihn. Doch da er die Melancholie mit Valmy und da Silva teilte, konnten sie ihn nicht beruhigen.
Sein Sekretär schien den Verfall zu registrieren. Duca ahnte, dass Cavolo mit den Beobachtungen hausieren ging. Gewiss streute der Prälat in seinen Klatsch die Bemerkung ein: »Unser Camerlengo ist verbraucht. Schließlich ist er über sechzig. Er darf müde sein, er hat alles hinter sich.«
Annibale Duca wollte nichts hinter sich wissen, sondern ein Kämpfer bleiben, zumindest den Eindruck vermitteln, er sei einer. Daher hatte er zu Neujahr den Vorsatz erneuert, jetzt, in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts, unter keinen Umständen mehr von den neunziger Jahren als der guten alten Zeit zu sprechen. Oder an seine knapp bemessene Zukunft zu denken, mit dem Zählen der Jahre zu beginnen.
Was würde von ihm bleiben? Ein Leichnam unter einer Marmorplatte in der Titelkirche. Eine nichtssagende Aufschrift in Latein.
Duca wankte zur Wohnungstür.
Cavolo ist verdorben, dachte er, der Kerl hat verräterische, flackernde Äuglein, einer aus Süditalien. Wer im Ministerium für die Bischöfe beschäftigt ist, muss korrupt sein. Aber gleich so …? Es wäre hilfreich, das Meer für Minuten einen Meter steigen zu lassen – das Problem Süditalien wäre gelöst.
Der Camerlengo brach seine Überlegungen ab, kratzte sich am Unterleib, knöpfte die Hose vollends zu, dachte, hoffentlich ist es nicht Cavolo, und öffnete die Tür.
Es war Cavolo. Der Kardinal, unrasiert, bläuliche Schatten im Gesicht, brüllte los:
»Sie wissen doch, dass ich nicht gestört sein will! Haben Sie kein Telefon? Mussten Sie kommen?«
Cavolo war kreidebleich. »Der Papst ist tot.«
»Jetzt schon? Ich meine, wieso. Habe ihn noch gestern gesprochen.«
»Erschossen.«
»Gottverdammt, Pardon, Gott!, wollte ich sagen!«