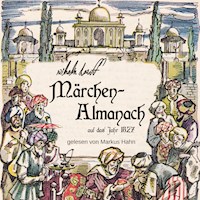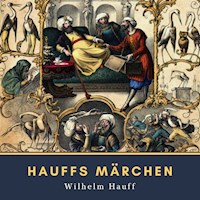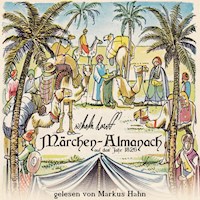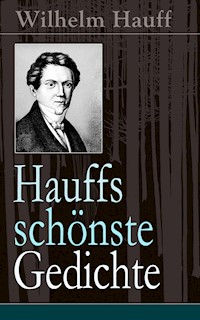3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei junge Schmiedegesellen wandern durch den verrufenen Spessart. Es wird Nacht und sie kehren in einem Wirtshaus ein. Bald schon ahnen die beiden, dass die Inhaber desselben mit einer Räuberbande in Verbindung stehen und sie im Schlaf ausgeraubt werden sollen. Um wach und abwehrbereit zu bleiben, erzählen sie sich die ganze Nacht über unheimliche und spannende Geschichten ...
Coverbild: Nikola Knezevic/Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Wirtshaus im Spessart
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + Das Wirtshaus im Spessart
Zum Buch:
Wilhelm Hauff
Das Wirtshaus im Spessart
Coverbild: Nikola Knezevic/Shutterstock.com
Das Wirtshaus im Spessart
Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig wie jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte achtzehn Jahre alt sein und war ein Zirkelschmied, der andere, ein Goldarbeiter, konnte nach seinem Aussehen kaum sechzehn Jahre haben und machte wohl jetzt eben seine erste Reise in die Welt.
Der Abend war schon heraufgekommen, und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden wanderten.
Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit Munter, seinem Hund, und schien sich nicht viel darum zu kümmern, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge sei.
Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Bäume rauschte, so war es ihm, als höre er Schritte hinter sich; wenn das Gesträuch am Wege hin und her wankte und sich teilte, glaubte er Gesichter hinter den Büschen lauern zu sehen.
Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch oder mutlos. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden für einen unerschrockenen Burschen, dem das Herz auf dem rechten Fleck sitze; aber heute war ihm doch sonderbar zu Mut.
Man hatte ihm vom Spessart so mancherlei erzählt. Eine große Räuberbande sollte dort ihr Wesen treiben, viele Reisende wären in den letzten Wochen ausgeplündert worden, ja man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die vor nicht langer Zeit dort vorgefallen seien. Da war ihm nun doch etwas bange für sein Leben, denn sie waren ja nur zu zwei und konnten gegen bewaffnete Räuber gar wenig ausrichten. Oft gereute es ihn, dass er dem Zirkelschmied gefolgt war, noch eine Station zu gehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht zu bleiben.
„Und wenn ich heute Nacht tot geschlagen werde und um Leben und alles komme, was ich bei mir habe, so ist’s nur deine Schuld, Zirkelschmied, denn du hast mich in den schrecklichen Wald hineingeschwatzt.“
„Sei kein Hasenfuß“, erwiderte der andere, „ein rechter Handwerksbursche soll eigentlich sich gar nicht fürchten. Und was meinst du denn? Meinst du, die Herren Räuber im Spessart werden uns die Ehre antun, uns zu überfallen und tot zu schlagen? Warum sollten sie sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrocks, den ich im Ranzen habe, oder wegen des Zehrpfennigs von einem Taler? Da muss man schon mit Vieren fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe wert finden, einen tot zu schlagen.“
„Halt! Hörst du nicht etwas pfeifen im Wald?“, rief Felix ängstlich.
„Das war der Wind, der um die Bäume pfeift; geh nur rasch vorwärts, lange kann es nicht mehr dauern.“
„Ja, du hast gut reden wegen des Totschlagens“, fuhr der Goldarbeiter fort. „Dich fragen sie, was du hast, durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und dreißig Kreuzer. Aber mich, mich schlagen sie gleich anfangs tot, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe.“
„Ei warum sollten sie dich totschlagen deswegen? Kämen jetzt vier oder fünf dort aus dem Busch, mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten, und fragten ganz höflich: Ihr Herren, was habt Ihr bei Euch? und Machet es Euch bequem, wir wollen’s Euch tragen helfen und was dergleichen anmutige Redensarten sind, da wärest du wohl kein Tor, machtest dein Ränzchen auf und legtest die gelbe Weste, den blauen Rock, zwei Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme, und was du sonst noch hast, höflich auf die Erde, und bedanktest dich fürs Leben, das sie dir schenkten.“
„So, meinst du“, entgegnete Felix sehr eifrig, „den Schmuck für meine Frau Pate, die liebe Frau Gräfin, soll ich hergeben? Eher mein Leben; eher lass ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und seit meinem zehnten Jahre mich aufziehen lassen? Hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt und Kleider und alles? Und jetzt, da ich sie besuchen darf, und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich das alles hergeben und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe? Nein, lieber sterben, als dass ich den schlechten Menschen meiner Frau Pate Geschmeide gebe!“
„Sei kein Narr!“, rief der Zirkelschmied. „Wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dennoch nicht; drum ist es besser, du gibst ihn her und erhältst dein Leben.“
Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen und bei dem ungewissen Schein des Neumonds konnte man kaum auf fünf Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinen Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht.
Noch eine Stunde beinahe waren sie so fortgegangen, da erblickten sie in der Ferne ein Licht. Der junge Goldschmied meinte aber, man dürfe nicht trauen, vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein, aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass die Räuber ihre Häuser oder Höhlen unter der Erde haben, und dies müsse das Wirtshaus sein, das ihnen ein Mann am Eingang des Waldes beschrieben.
Es war ein langes, aber niedriges Haus, ein Karren stand davor, und nebenan im Stalle hörte man Pferde wiehern.
Der Zirkelschmied winkte seinem Gesellen an ein Fenster, dessen Läden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen in einem Armstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Türe sein konnte. An der andern Seite des Ofens saßen ein Weib und ein Mädchen und spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich, den Kopf in die Hände gestützt hatte, sodass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, dass es ein vornehmer Herr sein müsse.
Als sie noch auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause an. Munter, des Zirkelschmieds Hund, antwortete, und eine Magd erschien in der Türe und schaute nach den Fremden heraus. Man versprach, ihnen Nachtessen und Betten geben zu können. Sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecken und setzten sich zu dem Herrn am Tische.
Dieser richtete sich bei ihrem Gruße auf, und sie erblickten einen feinen jungen Mann, der ihnen freundlich für ihren Gruß dankte.
„Ihr seid spät auf der Bahn“, sagte er. „Habt Ihr Euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spessart zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde weiter geritten wäre.“
„Da habt Ihr allerdings Recht gehabt, Herr!“, erwiderte der Zirkelschmied. „Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit; aber wenn ein Paar arme Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, welchen die Räuber eher selbst etwas schenken könnten, da heben sie keinen Fuß auf!“
„Das ist wohl wahr“, entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden erweckt, auch an den Tisch getreten war; „einem armen Mann können sie nicht viel anhaben seines Geldes willen;.aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute nur aus Mordlust niederstießen, oder sie zwangen unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen.“
„Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald“, bemerkte der junge Goldschmied, „so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu vier, und mit dem Hausknecht fünf; wenn es ihnen einfällt, zu zehn uns zu überfallen, was können wir gegen sie? Und überdies“, setzte er leise flüsternd hinzu, „wer steht uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind?“
„Da hat es gute Wege“, erwiderte der Fuhrmann. „Ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als zehn Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Hause, man sagt, er treibe Weinhandel; die Frau aber ist eine stille Frau, die niemand Böses will; nein, diesen tut Ihr Unrecht, Herr!“
„Und doch“, nahm der junge vornehme Herr das Wort, „doch möchte ich nicht so ganz verwerfen, was er gesagt. Erinnert Euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie werden in diesem Wirtshaus übernachten, und als man nach zwei oder drei Wochen nichts von ihnen vernahm, ihrem Weg nachforschte und auch hier im Wirtshause nachfragte; da soll nun keiner gesehen worden sein; verdächtig ist es doch.“
„Weiß Gott“, rief der Zirkelschmied, „da handelten wir ja vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten besten Baum unser Nachtlager nähmen als hier in diesen vier Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Türe besetzt haben; denn die Fenster sind vergittert.“
Sie waren alle durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Wald, sei es gezwungen oder freiwillig, im Einverständnis mit den Räubern sei. Die Nacht schien ihnen daher gefährlich; denn wie manche Sage hatten sie gehört von Wanderern, die man im Schlaf überfallen und gemordet hatte; und sollte es auch nicht an ihr Leben gehen, so war doch ein Teil der Gäste in der Waldschenke von so beschränkten Mitteln, dass ihnen ein Raub an einem Teil ihrer Habe sehr empfindlich gewesen wäre.
Sie schauten verdrießlich und düster in ihre Gläser. Der junge Herr wünschte auf seinem Ross durch ein sicheres, offenes Tal zu traben, der Zirkelschmied wünschte sich zwölf seiner handfesten Kameraden, mit Knütteln bewaffnet, als Leibgarde; Felix dem Goldarbeiter, war bange, mehr um den Schmuck seiner Wohltäterin als um sein Leben; der Fuhrmann aber, der einige Male den Rauch seiner Pfeife nachdenklich vor sich hingeblasen, sprach leise:
„Ihr Herren, im Schlaf wenigstens sollen sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn nur noch einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben.“
„Das will ich auch.“ – „Ich auch“, riefen die drei Übrigen.
„Schlafen könnte ich doch nicht“, setzte der junge Herr hinzu.
„Nun, so wollen wir etwas treiben, dass wir wach bleiben“, sagte der Fuhrmann. „Ich denke, weil wir doch gerade zu vier sind, könnten wir Karten spielen, das hält wach und vertreibt die Zeit.“
„Ich spiele niemals Karten“, erwiderte der junge Herr, „darum kam ich wenigstens nicht mithalten.“
„Und ich kenne die Karten gar nicht“, setzte Felix hinzu.
„Was können wir denn aber anfangen, wenn wir nicht spielen?“, sprach der Zirkelschmied. „Singen? Das geht nicht und würde nur das Gesindel herbeilocken; einander Rätsel und Sprüche aufgeben zum Erraten? Das dauert auch nicht lange. Wisst Ihr was? Wie wäre es, wenn wir uns etwas erzählten? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie Kartenspiel.“
„Ich bin’s zufrieden, wenn Ihr anfangen sollet“, sagte der junge Herr lächelnd. „Ihr Herren vom Handwerk kommet in allen Ländern herum und könnet schon etwas erzählen; hat doch jede Stadt ihre eigenen Sagen und Geschichten.“
„Ja, ja, man hört manches“, erwiderte der Zirkelschmied, „dafür studieren Herren wie Ihr fleißig in den Büchern, wo gar wundervolle Sachen geschrieben stehen; da wüsstet Ihr noch Klügeres und Schöneres zu erzählen als ein schlichter Handwerksbursche wie unsereiner. Mich müsste alles trügen, oder Ihr seid ein Student, ein Gelehrter.“
„Ein Gelehrter nicht“, lächelte der junge Herr, „wohl aber ein Student und will in den Ferien nach der Heimat reisen; doch was in unsern Büchern steht, eignet sich weniger zum Erzählen, als was Ihr hie und dort gehöret. Darum hebet immer an, wenn anders diese da gerne zuhören.“
„Noch höher als Kartenspiel“, erwiderte der Fuhrmann, „gilt bei mir, wenn einer eine schöne Geschichte erzählt. Oft fahre ich auf der Landstraße lieber im elendesten Schritt und höre einem zu, der nebenher geht und etwas Schönes erzählt. Manchen habe ich schon im schlechten Wetter auf den Karren genommen, unter der Bedingung, dass er etwas erzähle, und einen Kameraden von mir habe ich, glaube ich, nur deswegen so lieb, weil er Geschichten weiß, die sieben Stunden lang und länger dauern.“
„So geht es auch mir“, setzte der junge Goldarbeiter hinzu, „erzählen höre ich für mein Leben gerne und mein Meister in Würzburg musste mir die Bücher ordentlich verbieten, dass ich nicht zu viel Geschichten las und die Arbeit darüber vernachlässigte. Drum gib nur etwas Schönes preis, Zirkelschmied, ich weiß, du könntest erzählen von jetzt an, bis es Tag wird, ehe dein Vorrat ausginge.“
Der Zirkelschmied trank, um sich zu seinem Vortrag zu stärken, und hub alsdann also an:
Die Sage vom Hirschgulden
In Oberschwaben stehen noch heutzutage die Mauern einer Burg, die einst die stattlichste der Gegend war, Hohenzollern. Sie erhebt sich auf einem runden steilen Berg, und von ihrer schroffen Höhe sieht und frei ins Land.
So weit und noch viel weiter, als man diese Burg im Land umher sehen kann, ward das tapfere Geschlecht der Zollern gefürchtet, und ihren Namen kannte und ehrte man in allen deutschen Landen.
Nun lebte vor mehreren hundert Jahren, ich glaube das Schießpulver war kaum erfunden, auf dieser Feste ein Zollern, der von Natur ein sonderbarer Mensch war.
Man konnte nicht sagen, dass er seine Untertanen hart gedrückt oder mit seinen Nachbarn in Fehde gelebt hätte, aber dennoch traute ihm niemand über den Weg ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirne und seinem einsilbigen, mürrischen Wesen.
Es gab wenige Leute außer dem Schlossgesinde, die ihn je hätten ordentlich sprechen hören wie andere Menschen; denn wenn er durch das Tal ritt, einer ihm begegnete und schnell die Mütze abnahm, sich hinstelle und sagte: „Guten Abend, Herr Graf, heute ist es schön Wetter“, so antwortete er: „Dummes Zeug“ oder „Weiß schon.“
Hatte aber einer etwas nicht recht gemacht für ihn oder seine Rosse, begegnete ihm ein Bauer im Hohlweg mit dem Karren, dass er auf seinem Rappen nicht schnell genug vorüberkommen konnte, so entlud sich sein Ingrimm in einem Donner von Flüchen; doch hat man nie gehört, dass er bei solchen Gelegenheiten einen Bauern geschlagen hätte. In der Gegend aber hieß man ihn „das böse Wetter von Zollern.“
Das böse Wetter von Zollern hatte eine Frau, die der Widerwart von und so mild und freundlich war wie ein Maitag. Oft hat sie Leute, die ihr Eheherr durch harte Reden beleidigt hatte, durch freundliche Worte und ihre gütigen Blicke wieder mit ihm ausgesöhnt; den Armen aber tat sie Gutes, wo sie konnte, und ließ es sich nicht verdrießen, sogar im heißen Sommer oder im schrecklichsten Schneegestöber den steilen Berg herab zu gehen, um arme Leute oder kranke Kinder zu besuchen. Begegnete ihr auf solchen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch: „Weiß schon, dummes Zeug“, und ritt weiter.
Manch andere Frau hätte dieses mürrische Wesen abgeschreckt oder eingeschüchtert; die eine hätte gedacht, was gehen mich die armen Leute an, wenn mein Herr sie für dummes Zeug hält; die andere hätte vielleicht aus Stolz oder Unmut die Liebe gegen einen so mürrischen Gemahl erkalten lassen; doch nicht also Frau Hedwig von Zollern. Sie liebte ihn nach wie vor, suchte mit ihrer schönen weißen Hand die Falten von seiner braunen Stirne zu streichen, und liebte und ehrte ihn.
Als aber nach Jahr und Tag der Himmel ein junges Gräflein zum Angebinde bescherte, liebte sie ihren Gatten nicht minder, indem sie ihrem Söhnlein dennoch alle Pflichten einer zärtlichen Mutter erzeigte.
Drei Jahre lang vergingen, und der Graf von Zollern sah seinen Sohn nur alle Sonntage nach Tische, wo er ihn von der Amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte etwas in den Bart und gab ihn der Amme zurück.
Als jedoch der Kleine Vater sagen konnte, schenkte der Graf der Amme einen Gulden – dem Kind machte er kein fröhlicheres Gesicht.
An seinem dritten Geburtstag aber ließ der Graf seinem Sohn die ersten Höslein anziehen und kleidete ihn prächtig in Samt und Seide; dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Ross vorzuführen, nahm den Kleinen auf den Arm und fing an, mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinabzusteigen.
Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war sonst gewohnt, nicht zu fragen, wo aus und wann heim?, wenn er ausritt, aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen.
„Wollet Ihr ausreiten, Herr Graf?“, sprach sie; er gab keine Antwort.
„Wozu denn den Kleinen?“, fragte sie weiter. „Cuno wird mit mir spazieren gehen.“
„Weiß schon“, entgegnete das böse Wetter von Zollern und ging weiter; und als er im Hof stand, nahm er den Knaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgtore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm.
Dem Kleinen schien es anfangs großes Vergnügen zü gewähren, mit dem Vater den Berg hinab zu reiten. Er klopfte in die Hände, er lachte und schüttelte sein Rösslein an den Mähnen, damit es schneller laufen sollte, und der Graf hatte seine Freude daran, rief auch einige Male:
„Kannst ein wackerer Bursche werden!“
Als sie aber in der Ebene angekommen waren, und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da vergingen dem Kleinen die Sinne; er bat anfangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten, als es aber immer schneller ging, und der heftige Wind dem armen Cuno beinahe den Atem nahm, da fing er an, still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften.
„Weiß schon! Dummes Zeug!“, fing jetzt sein Vater an. „Heult der Junge beim ersten Ritt; schweig, oder m –“
Doch den Augenblick, als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bäumte sich sein Ross, der Zügel des andern entfiel seiner Hand, er arbeitete sich ab, Meister seines Tieres zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kinde umsah, erblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief.
So ein harter, finsterer Mann der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz; er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgend, so weit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaben; schon stellte er sich vor, das scheu gewordene Ross habe ihn in einen Wassergraben geschleudert, der neben dem Wege lag.
Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rufen, und als er sich flugs umwandte – sieh! – da saß ein altes Weib unweit der Straße unter einem Baum und wiegte den Kleinen auf ihren Knien.
„Wie kömmst du zu dem Knaben, alte Hexe?“, schrie der Graf in großem Zorn. „Sogleich bringe ihn heran zu mir!“
„Nicht so rasch, nicht so rasch, Euer Gnaden!“, lachte die alte, hässliche Frau. „Könntet sonst auch ein Unglück nehmen auf Eurem stolzem Roß! Wie ich zu dem Junkerlein kam, fraget Ihr? Nun, sein Pferd ging durch, und er hing nur noch mit einem Füßchen angebunden, und das Haar streifte fast am Boden, da habe ich ihn aufgefangen in meiner Schürze.“
„Weiß schon!“, rief der Herr von Zollern unmutig. „Gib ihn jetzt her; ich kann nicht wohl absteigen; das Ross ist wild und könnte ihn schlagen.“
„Schenket mir einen Hirschgulden!“, erwiderte die Frau demütig bittend.
„Dummes Zeug!“, schrie der Graf und warf ihr einige Pfennige unter den Baum.
„Nein, einen Hirschgulden könnte ich gut brauchen“, fuhr sie fort.
„Was, Hirschgulden! Bist selbst keinen Hirschgulden wert!“, eiferte der Graf. „Schnell das Kind her, oder ich hetze die Hunde auf dich!“
„So? Bin ich keinen Hirschgulden wert?“, antwortete jene mit höhnischem Lächeln. „Na! Man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist; aber da, die Pfennige behaltet für Euch!“
Indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupferstücke dem Grafen zu, und so gut konnte die Alte werfen, dass alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel fielen, den der Graf noch in der Hand hielt.
Der Graf wusste einige Minuten vor Staunen über diese wunderbare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen, endlich aber löste sich sein Staunen in Wut auf. Er fasste seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte.
Diese herzte und küsste ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hin hielt, dass ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen.
„Bist ein guter, frommer Junge“, sprach sie, „bleibe nur so und es wird dir nicht fehlen.“
Dann ließ sie ihn los, dräute dem Grafen mit dem Finger:
„Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt Ihr mir noch schuldig!“, rief sie und schlich, unbekümmert um die Schimpfworte des Grafen, an einem Buchsbaumstäbchen in den Wald.
Conrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Ross, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihm auf und ritt seinem Gebieter nach, den Schlossberg hinauf.
Es war dies das erste und letzte Mal gewesen, dass das böse Wetter von Zollern sein Söhnlein mitnahm zum Spazierenreiten; denn er hielt ihn, weil er geweint und geschrieen, als die Pferde im Trab gingen, für einen weichlichen Jungen, aus dem nicht viel Gutes zu machen sei, sah ihn nur mit Unlust an, und sooft der Knabe, der seinen Vater herzlich liebte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Knien kam, winkte er ihm fortzugehen und rief:
„Weiß schon! Dummes Zeug!“
Frau Hedwig hatte alle bösen Launen ihres Gemahls gerne getragen, aber dieses unfreundliche Benehmen gegen das unschuldige Kind kränkte sie tief; sie erkrankte mehrere Male aus Schrecken, wenn der finstere Graf den Kleinen wegen irgendeines geringen Fehlers hart abgestraft hatte, und starb endlich in ihren besten Jahren, von ihrem Gesinde und der ganzen Umgegend, am schmerzlichsten aber von ihrem Sohne beweint.
Von jetzt an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr von dem Kleinen ab; er gab ihn seiner Amme und dem Hauskaplan zur Erziehung und sah nicht viel nach ihm um, besonders da er bald darauf wieder ein reiches Fräulein heiratete, das ihm nach Jahresfrist Zwillinge, zwei junge Gräflein, schenkte.
Cunos liebster Spaziergang war zu dem alten Weiblein, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie erzählte ihm immer vieles von seiner verstorbenen Mutter und wie viel Gutes diese an ihr getan habe.
Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er solle nicht so viel zu der Frau Feldheimerin, so hieß die Alte, gehen, weil sie nichts mehr und nichts weniger als eine Hexe sei; aber der Kleine fürchtete sich nicht, denn der Schlosskaplan hatte ihn gelehrt, dass es keine Hexen gebe, und dass die Sage, dass gewisse Frauen zaubern können und auf der Ofengabel durch die Luft und auf den Brocken reiten, erlogen sei.
Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte; des Kunststückchens mit den drei Pfennigen, die sie seinem Vater so geschickt in den Beutel geworfen, erinnerte er sich noch ganz wohl, auch konnte sie allerhand künstliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Vieh heilte; aber das war nicht wahr, was man ihr nachsagte, dass sie eine Wetterpfanne habe, und wenn sie die über das Feuer hänge, komme ein schreckliches Donnerwetter.
Sie lehrte den kleinen Grafen mancherlei, was ihm nützlich war, zum Beispiel allerlei Mittel für kranke Pferde, einen Trank gegen die Hundswut. eine Lockpfeife für Fische und viele andere nützliche Sachen.
Die Frau Feldheimerin war auch bald seine einzige Gesellschaft, denn seine Amme starb, und seine Stiefmutter kümmerte sich nicht um ihn.
Als seine Brüder nach und nach heranwuchsen, hatte Cuno ein noch traurigeres Leben als zuvor, sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferde zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tage mit ihnen aus, und lehrte sie alles, was er selbst verstand.
Da lernten sie aber nicht viel Gutes; lesen und schreiben konnte er selbst nicht, und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht die Zeit damit verderben; aber schon in ihrem zehnten Jahre konnten sie so grässlich fluchen wie ihr Vater, fingen mit jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie ein Hund und Kater, und nur wenn sie gegen Cuno Streiche verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde.
Ihrer Mutter machte dies nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balgten; aber dem alten Grafen sagte es eines Tages ein Diener, und er antwortete zwar: „Weiß schon, dummes Zeug!“ nahm sich aber dennoch vor, für die Zukunft auf ein Mittel zu sinnen, dass sich seine Söhne nicht gegenseitig totschlügen; denn die Drohung der Feldheimerin, die er in seinem Herzen für eine ausgemachte Hexe hielt: „Na, man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist“, lag ihm noch immer in seinem Sinn.
Eines Tages, da er in der Umgegend seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, die ihrer Form wegen wie zu Schlössern geschaffen schienen, und sogleich beschloss er, auch dort zu bauen.
Er baute auf dem einen das Schloss Schalksberg, das er nach dem Kleinen der Zwillingen so nannte, weil dieser wegen allerlei böser Streiche längst von ihm den Namen „kleiner Schalk“ erhalten hatte; das andere Schloss, das er baute, wollte er anfänglich Hirschgulden nennen, um die Hexe zu verhöhnen, weil sie sein Erbe nicht einmal eines Hirschguldens wert achtete, er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden, und so heißen die beiden Berge noch bis auf den heutigen Tag, und wer die Alb bereist, kann sie sich zeigen lassen.
Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem kleinen Schalk Schalksberg und dem andern Hirschberg im Testament zu vermachen; aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte.
„Der dumme Cuno“, so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, „der dumme Cuno ist ohnedies reich genug durch das, was er von seiner Mutter erbte, und er soll auch noch das schöne, reiche Zollern haben und meine Söhne sollen nichts bekommen, als jeder eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald?“
Vergebens stellte ihr der Graf vor, dass man Cuno billigerweise das Erstgeburtsrecht nicht rauben dürfe; sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst niemand sich fügte, des lieben Friedens willen nachgab und im Testament dem kleinen Schalk Schalksberg, Wolf, dem größeren Zwillingsbruder, Zollern, und Cuno Hirschberg mit dem Städtchen Balingen verschrieb.
Bald darauf, nachdem er also verfügt hatte, fiel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, dass er sterben müsse, sagte er: „Ich weiß schon;“ und dem Schlosskaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er: „Dummes Zeug“, fluchte und raste fort, und starb, wie er gelebt hatte, roh und als ein großer Sünder.
Aber sein Leichnam war noch nicht beigesetzt, so kam die Frau Gräfin schon mit dem Testament herbei, sagte zu Cuno, ihrem Stiefsohn, spöttisch, er möchte jetzt seine Gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen, was im Testament stehe, nämlich, dass er in Zollern nichts mehr zu tun habe, und freute sich mit ihren Söhnen über das schöne Vermögen und die beiden Schlösser, die sie ihm, den Erstgeborenen, entrissen hatten.
Cuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen; aber mit Tränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren wurde, seine gute Mutter begraben lag, und wo der gute Schlosskaplan und nahe dabei seine einzige alte Freundin, Frau Feldheimerin, wohnte.
Das Schloss Hirschberg war zwar ein schönes, stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden.
Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schlossberg hinab; da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde heraufritt, und dem eine prachtvolle Sänfte, von zwei Maultieren getragen, und mehrere Knechte folgten.
Sie rieten lange hin und her, wer es wohl sein möchte, da rief endlich der kleine Schalk:
„Ei, das ist niemand anders, als unser Herr Bruder von Hirschberg.“
„Der dumme Cuno?“, sprach die Frau Gräfin verwundert. „Ei, der wird uns die Ehre antun, uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänfte hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirschberg; nein, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Cuno, nicht zugetraut; eine Höflichkeit ist der andern wert: Lasset uns hinabsteigen an das Schlosstor, ihn zu empfangen; macht auch freundliche Gesichter, vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas, dir ein Pferd und dir einen Harnisch, und den Schmuck seiner Mutter hätte ich schon lange gerne gehabt.“
„Geschenkt mag ich nichts von dem dummen Cuno“, antwortete Wolf, „und ein gutes Gesicht mach’ ich ihm auch nicht; aber unserem seligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen, dann würden wir Hirschberg erben und alles, und Euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen.“
„So, du Range!“, eiferte die Mutter. „Abkaufen soll ich Euch den Schmuck? Ist das der Dank dafür, dass ich Euch Zollern verschafft habe? Kleiner Schalk, nicht wahr, ich soll den Schmuck umsonst haben?“
„Umsonst ist der Tod, Frau Mutter!“, erwiderte der Sohn lachend. „Und wenn es wahr ist, dass der Schmuck so viel wert ist wie manches Schloss, so werden wir wohl nicht die Toren sein, ihn Euch um den Hals zu hängen. Sobald Cuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, teilen ab, und meinen Part am Schmuck verkaufe ich. Gebt Ihr dann mehr als der Jude, Frau Mutter, so sollt Ihr ihn haben.“
Sie waren unter diesem Gespräche bis unter das Schlosstor gekommen, und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken, denn soeben ritt Graf Cuno über die Zugbrücke.
Als er seine Stiefmutter und seine Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höflich; denn, obgleich sie ihm viel Leids angetan, bedachte er doch, dass es seine Brüder seien und dass sein Vater diese böse Frau geliebt habe.
„Ei, das ist ja schön, dass der Herr Sohn uns auch besucht“, sagte die Frau Gräfin mit süßer Stimme und huldreichen Lächeln. „Wie geht es denn auf Hirschberg? Kann man sich dort eingewöhnen? Und gar eine Sänfte hat man sich angeschafft? Ei, nun wie prächtig, es dürfte sich keine Kaiserin daran schämen; nun wird wohl auch die Hausfrau nicht mehr lange fehlen, dass sie darin im Lande umherreist.“
„Habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter“, erwiderte Cuno, „will mir deswegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Haus nehmen und bin deswegen mit der Sänfte hierher gereist.“
„Ei, Ihr seid gütig und besorgt“, unterbrach ihn die Dame, indem sie sich verneigte und lächelte.
„Denn er kommt doch nicht mehr gut zu Pferde fort“, sprach Cuno ganz ruhig weiter, „der Pater Joseph nämlich, der Schlosskaplan. Ich will ihn zu mir nehmen, denn er ist mein alter Lehrer, und wir haben es so abgemacht, als ich Zollern verließ. Will auch unten am Berge die alte Frau Feldheimerin mitnehmen. Lieber Gott! Sie ist jetzt steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum ersten Mal ausritt mit meinem seligen Vater; habe ja Zimmer genug in Hirschberg, und dort soll sie absterben.“