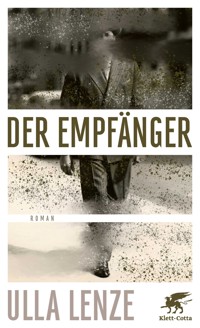Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ulla Lenze schreibt eine tolle, empfindungsintensive Prosa. Echt und wahr und ehrlich.«David Wagner Die Fabrikarbeiterin Anna wird als Medium verehrt, Johanna Schellmann ist Schriftstellerin. In den Heilstätten Beelitz entsteht eine Verbindung zwischen den ungleichen Frauen, von der beide profitieren – bis der Kampf um Anerkennung und Aufstieg sie zu Rivalinnen macht. Ulla Lenze hat in ihrer unvergleichlich kristallinen Prosa einen großen Roman über die Verführungskraft der Selbsterlösung geschrieben. Versteckt in den Kiefernwäldern vor den Toren Berlins liegen die Arbeiter-Lungenheilstätten Beelitz. Als sich die Fabrikarbeiterin Anna Brenner und die Schriftstellerin Johanna Schellmann hier im Jahr 1907 begegnen, hat das für beide Frauen existenzielle Folgen. Anna gilt als hellsichtig, und obwohl die Avantgarde der Kaiserzeit begeistert mit dem Okkulten experimentiert, wird Annas wachsende Anhängerschaft für den Leiter der Heilstätten zum Problem. In Johanna legt die Begegnung eine tief verschüttete Spiritualität frei, und sie ahnt, dass Anna eine Schlüsselrolle in ihrem literarischen Schaffen spielen könnte. Nur: Anna lässt sich nicht vereinnahmen, von niemandem. Sechzig Jahre später versucht Johanna Schellmann Worte für ihre Verstrickungen in der Vergangenheit zu finden, doch erst Vanessa, ihre Urenkelin, bringt Licht ins Dunkel – mitten in einem luxussanierten Beelitz, durch das noch die Geister der Vergangenheit wehen. Vom Kaiserreich bis in die Gegenwart porträtiert Ulla Lenze drei Frauenleben, die Befreiung und Aufstieg erfahren und sich doch nicht vor dem drohenden Bedeutungsverlust retten können.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulla Lenze
Das Wohlbefinden
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer KI-generierten Abbildung (Midjourney)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98685-3
E-Book ISBN 978-3-608-12346-3
1
Beelitz Heilstätten 2020
Der leere Gehweg vor dem Haus war bereits verdächtig. Ein junges Pärchen stieg aus einem schwarzen Geländewagen. Es scannte Vanessa mit forscher Feindseligkeit ab.
Sie musste den Makler auf die Mietwohnungen ansprechen. Es war ein Missverständnis gewesen, ganz klar. Doch die Arroganz des Pärchens, das sich offenbar schon durch die Doppelung im Vorteil sah, machte sie trotzig.
Der Makler zog seine Maske auf und reichte erst Vanessa, dann dem Pärchen mehrere Seiten Papier in Klarsichtfolie. Sie las: Kleine Hideaways mit großem studioartigem Raum für Singles und Paare.
66 m², 370 000 Euro. Ein Schnäppchen.
Als Contentmanagerin für ein Internetshoppingportal verdiente Vanessa 2400 Euro brutto, ihr Limit für eine Mietwohnung lag bei 950 Euro, in der Innenstadt fand sich dafür rein gar nichts. Also suchte sie nun außerhalb des S-Bahn-Rings.
Sie betraten eine leere, strahlend weiße Eingangshalle. Das Pärchen stellte Fragen. Nach einem Supermarkt, nach Ärzten. »Das Creative Village macht die Gegend sehr attraktiv und zieht natürlich Infrastruktur nach sich. Das ist alles in Planung. Wir stehen hier übrigens im Postgebäude der ehemaligen Lungenheilstätten.«
Vanessas Yoga-App meldete sich, und sie hatte zu entscheiden: Abo verlängern ja nein. Das Pärchen war ekelhaft. Dieses dreiste Selbstbewusstsein und das fette Auto, ihre schlanke, mit Personal Trainern punktgenau designte Figur und diese Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Knete vor sich hertrugen.
Das Pärchen lief durch die Räume, als wäre es schon eingezogen, faselte von Zweitwohnsitz in der Natur und Homeoffice. Sie nahmen Vanessa keineswegs als Konkurrenz wahr. »Ich möchte kaufen«, sagte Vanessa deshalb.
»Wir auch«, sagte das Pärchen.
»Schicken Sie mir Ihre Angebote schriftlich«, sagte der Makler, »zusammen mit einem Vermögensnachweis.«
»Ich hatte eine Urgroßmutter, die über die Arbeiterheilstätten Beelitz geschrieben hat«, sagte Vanessa, als wäre das ein Grund, sie zu bevorzugen. »Sie hieß Johanna Schellmann.«
Der Makler nickte. »Hier wurde schon viel geschrieben und gedreht. Wie wir ja sagen: Creative Village.«
Die Straße war dicht befahren, und zu beiden Seiten ragten steil die Kiefern auf. Vanessa wollte nicht sofort in die Bahn steigen und verraten, dass sie nicht mit dem Auto hier war, denn, nein, sie hatte keins. Sie folgte einem Schild Richtung Heilstätten, lief jetzt mit großen Schritten, geradezu einer Unbeherrschtheit. Die Werbung, die währenddessen auf ihrem Telefon eingeblendet wurde, verhielt sich wie ein ausgelagertes Unterbewusstsein, kommentierte und spiegelte ihr vorangegangenes Surfverhalten. War es möglich, dass das Telefon ihr deshalb Mindfulness/Forgiveness-Übungen vorschlug, weil sie in letzter Zeit so viel heulte, stimmte das mit dem Mikrofon?
Der Eintritt zu den ehemaligen Arbeiterheilstätten kostete so viel wie ein kleines Sake-Mittagsmenü in Mitte, also in Ordnung. Ein Drehkreuz schubste Vanessa in eine verwunschene Gartenlandschaft mit vielen Schildern und in Wildwuchs versunkenen Backsteingebäuden. Unter den hohen Kiefern standen vereinzelt eiserne Bettgestelle, dekoriert mit bunten Kissen und Tüchern, um die Idee des Krankseins zu veranschaulichen. In der ehemaligen Liegehalle war ein Café untergebracht, in dem es Crêpes und Softeis gab, gegenüber dämmerte die dunkle Ruine des sogenannten, Vanessa neigte sich dem Schild zu, Alpenhauses vor sich hin. Das Dach fehlte, aus den Fenstern wuchsen Bäume.
Eine geführte Tour war ihr zu teuer. Das wären ja noch mal zwölf Euro. Sie erfuhr also nicht, dass die Beelitz Heilstätten nach dem Zweiten Weltkrieg das größte Militärkrankenhaus der UDSSR im Ausland darstellten. Sie erfuhr nicht, dass im Ersten Weltkrieg, als die Heilstätten ein Lazarett waren, Hitler hier mit verletztem Oberschenkel lag und angeblich immer noch kriegsbegeistert war, was ihn unter den Mitpatienten sehr unbeliebt machte. Ob das stimmte oder die Unbeliebtheit im Nachhinein so erdichtet wurde, weil Beelitz natürlich nur ehrenwerte Patienten hatte, würde Vanessa sich nicht fragen, und auch nicht, was sie davon halten sollte, dass es bis jetzt keine Beweise für hier durchgeführte Euthanasie gab, immer nur diese Gerüchte.
Nieselregen fiel auf den Park herab, die Gruppe links von ihr redete laut auf Italienisch.
Vanessa erfuhr nicht, dass schon um 1900 herum nur Elektroautos auf dem Gelände im Einsatz waren, um Motorenlärm und Abgase von den Patienten fernzuhalten; Wohlbefinden war das oberste Therapeutikum. Sie erfuhr nicht, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, die oft unterernährt waren, hier mit fünf üppigen Mahlzeiten am Tag versorgt wurden, von Kalbsbraten bis Königsberger Klopse und Schokoladenpudding. Sie erfuhr aber, es stand auf einer der Tafeln, dass die Arbeitswoche ab 1900 auf 60 Stunden gekürzt wurde, ein Riesenfortschritt. Sie erfuhr, dass die Landesversicherungsanstalt die Heilstätten zwischen 1898 und 1907 errichtet hatte, über beträchtliche finanzielle Mittel verfügte und diese großzügig für die sogenannte Arbeiterrückführung einsetzte. Vierzig Prozent der Todesfälle entfiel bei den 20–30-Jährigen auf Tuberkulose. Okay, das reichte erstmal.
Sie hatte Lust auf ein Softeis, stöpselte sich Kopfhörer ein, was das Gesicht des extrem langsamen und sehr jungen Eisverkäufers mit sphärischem Wummern unterlegte, electronic ambient, und angenehm auf Abstand hielt. Gesichter, Augen, Nasen, Münder: Das alles war ihr oft zu viel.
Eine Besuchergruppe mit Schutzhelmen trat aus einem zerbröselnden Gebäude. Es gab nichts Gruseligeres als verfallene Heilstätten, dachte Vanessa. Als hätte die Idee der Heilung schließlich aufgegeben. Bereits die Eingangshalle badete von Boden bis Decke in Graffiti wie in Ganzkörpertattoos und verlieh den ursprünglich vornehmen Gebäuden etwas Tribalistisches. Vanessa wusste vom nächtlichen Vandalismus nach der Wende, als die Heilstätten jahrelang unbewacht waren, von den Freaks, die noch letzte Bilder der intakten Originalräume schossen, in der Hoffnung, sie im Anschluss an ihr Zerstörungswerk besonders teuer verkaufen zu können. Sie wusste vom Partyvolk und von den Geisterjägern, denn Beelitz war einer der Orte, an denen es spukte. Vorsprünge, Erker, Sonnenterrassen, überwuchert von Efeu, Wein und Hopfen. Wo saßen die Geister wohl tagsüber?
In diesem Moment hörte die sphärische Wummermusik auf und eine sanfte Frauenstimme raunte: Gehe mit den Generationen, die vor dir waren, durch die Zeit. Deine Ahnen. Spüre sie als Kraftfeld, das dich trägt, dem du dein Leben verdankst. Lade sie liebevoll zu einem Spaziergang ein, um generationenübergreifende Traumata aufzulösen.
Ja, sie hatte also diese Schriftsteller-Urgroßmutter, die Bücher gab es noch in Online-Antiquariaten. Erst vor zwei Wochen hatte eine Literaturwissenschaftlerin angerufen und gefragt, ob es noch etwas aus dem Familienbesitz gebe, Erzählungen, Schriftstücke, Gegenstände, und ob Vanessa eigentlich wisse, dass die Schellmann auch über die Heilstätten Beelitz geschrieben habe? In der Verlagskorrespondenz aus den späten Sechzigern fänden sich dazu einige Hinweise, es sei aber nie etwas veröffentlicht worden.
Weil Vanessa völlig überrumpelt war und beklommen schwieg, redete die Frau weiter: Schellmann sei ja im Deutschen Kaiserreich ein Literaturstar gewesen, Dichterin der modernen Frauenpsyche, wegweisend für eine ganze Generation, eine wichtige Stütze für die Frauenbewegung damals. Und gerade in gendersensiblen Zeiten wie heute, in denen weibliche Erfahrung und weibliches Schreiben wieder ernst genommen würden, lohne ein Blick auf die Literatur der Schellmann, denn auch wir fragen uns ja: Welche Räume können wir uns erschließen gerade in und mit unserem Weiblichsein? Bei der Schellmann wurde dieser Perspektive bereits vor einhundertzehn Jahren rigoros Raum gegeben, und das Sensationelle sei, genau damit habe sie Erfolg gehabt, Sie wissen ja, Das Schmuckzimmer, zwanzig Auflagen. Die Schellmann wurde damals für etwas gefeiert, wofür Frauen heute immer noch Ablehnung erfahren: eine Frau zu sein! Und das alles sei noch vor dem Ersten Weltkrieg passiert, die Kaiserzeit ja eine ungemein spannende Zeit. Blabla. In sechs Wochen musste Vanessa ihre Wohnung räumen, und die Literaturwissenschaftlerin kam ihr mit »Räume erschließen mit unserem Weiblichsein.« Sie steigerte sich immer mehr in irgendwas hinein, und das Interesse, das Vanessa anfangs noch hatte, schlug um in Ärger. Okay, die war irgendwie nicht ganz dicht, aber was genau wollte sie von Vanessa? Da schien so etwas wie Verehrung mit im Spiel zu sein und vielleicht die Hoffnung, von Vanessa, der Urenkelin, könne irgendwas weiblich Wegweisendes abstrahlen. Und tatsächlich sagte die Frau in diesem Augenblick: »Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen, einer direkten Nachfahrin der Schellmann!«
»Dann lassen Sie mich doch auch mal etwas sagen«, sagte Vanessa und hörte ein neugierig fittes, »ja, natürlich«, und Vanessa merkte, sie hatte rein gar nichts zu sagen.
»Mir fällt nichts ein.«
»Sie sind wie die Schellmann«, lachte die Literaturwissenschaftlerin. »So ehrlich! Es stimmt, ich rede zu viel. Wenn ich mein Gegenüber sehen kann, passiert mir das nicht. Wollen wir uns treffen? Oder zumindest ein Zoom-Meeting? Es würde mir wirklich viel bedeuten.«
Vanessa legte auf.
Dann blockierte sie die Nummer.
Über den Mülleimern kreisten Wespen. Die Wespen flogen in so dichtem Abstand, dass die Luft dort flimmerte, ein seidiges Grau, ein Knistern wie von weicher Elektrizität. Vanessa warf die aufgeweichte Waffel in einen der summenden Mülleimer und schaute sich zwischen den Gebäuden um, die inmitten der weitläufigen Parkanlage fast eine kleine Stadt bildeten. Ihr Blick wanderte über malerische Liegeterrassen zwischen Zierfachwerk, verspielten Giebeln, Rundbögen, Laternen und Gauben. Sie überlegte, was es wohl gewesen sein könnte, das ihre Urgroßmutter über Beelitz geschrieben hatte. Welche Hinweise auf was genau fanden sich wohl in der Verlagskorrespondenz?
Schellmann war 1967 gestorben. Da fing auch allmählich Vanessas eigene Geschichte an, nämlich damit, dass Vanessas Vater mit der kurz vor dem Krieg nach Kanada ausgewanderten Familie zu Schellmanns Beerdigung nach Berlin anreiste. Er war Anfang zwanzig, und als er den toten Körper der ihm unbekannten Großmutter sah, entschied er sich, ihren Namen anzunehmen und zu bleiben. Eine Ansage gegen die Familie, die mit der Schellmann nie so richtig warm geworden war, sie alle waren ein anderer Schlag Mensch, Menschen der Tat, und man suchte größtmöglichen Abstand zu allem Künstlerischen. Denn man sah ja an der Schellmann, dass sie trotz ihrer angeblichen Bedeutung im entscheidenden Moment menschlich versagt hatte, floh sie doch später ins Jugendbuchschreiben, statt ihre Bekanntheit zu nutzen, dem Widerstand eine Stimme zu geben. Großmutter Emmy und Großvater Benno hingegen, beide zu kommunistisch für das neue Deutschland, gerieten vorübergehend ins Gefängnis und machten sich anschließend nach Kanada auf.
Vanessa hatte von den zahlreichen Romanen nur Das Schmuckzimmer gelesen. Vor allem erinnerte sie sich an den hohen Ton, an abwechselnd Gejammer und Gejauchze, an eine ungemütliche Dringlichkeit. Am Ende wurde die Heldin verrückt und starb. Insgesamt anstrengend (war das also das weibliche Schreiben?).
1986 wurde Vanessa geboren. Im elterlichen Wohnzimmer hing die Schwarzweißfotografie der Schellmann in Arbeitspose, enger Rüschenkragen bis zum Kinn, gereizter Blick, die Hände auf den Tasten ihrer Olympia; schon als Baby blickte Vanessa immerzu dort hin, wenn der Vater sie durchs Wohnzimmer trug. Vanessas Vater hatte seine Großmutter stets in Ehren gehalten. Sollte Vanessa ihn mal anrufen? Aber er war so schwierig geworden, so weinerlich und sentimental, weil alle nach und nach starben, die Verwandten und die Freunde, und weil er etwas suchte, sagte er, das nicht mehr zu finden war. Die Zeit raffe alles dahin, »Vanessa, Mädchen!«; emotionale Erpressung pur, sich um ihn zu kümmern, und er erreichte damit das Gegenteil.
Dunkelheit und feuchtbrauner Himmel, als Vanessa in die S-Bahn nach Berlin stieg. Sie sah in der Fensterscheibe ihr oystergray gefärbtes Haar über die brandenburgische Landschaft gleiten. Auf dem Bahnscreen wurde Werbung für eine Meditationsapp eingeblendet. Ein Unbehagen gegen schier alles regte sich plötzlich in ihr. Sollen wir also die Nerven behalten, während wir aus den Wohnungen verdrängt werden, wir unsere Jobs verlieren? Hey, ich hab zwar bald kein Zuhause mehr, aber, Leute, einmal tief ein- und ausatmen, und ich bin zumindest in meiner Mitte. Nee, schon klar, sie versprechen dir keine Wohnung, aber jene Balance und Power, mit der du genauso ein Arschloch werden kannst wie dein Vermieter, der dir wegen Eigenbedarf kündigt. Und wenn nicht das, kannst du dich wenigstens gut fühlen, während alles den Bach runtergeht.
Am Alexanderplatz stieg sie um in die U8. Sieben Stationen später stieg sie im Wedding aus.
Hier kamen die meisten her, die damals in Beelitz genesen sollten. Arbeiterviertel. Hier wohnte sie, ausgerechnet. Ihre berühmte Urgroßmutter hatte in Dahlem gewohnt. Villa, Garten und alles. Die Adresse wusste niemand mehr, aber irgendwo Nähe Botanischer Garten; bestimmt wusste es die Literaturwissenschaftlerin.
War Vanessa eine Arbeiterin? Was war man heute, wenn man unterbezahlt in Büros aus Beton und Holz saß und mittags eine Bowl mit Avocado, Reis und Edamame aß?
In ihrer kleinen Erdgeschosswohnung im Hinterhaus konnte Vanessa die Beklemmung nicht länger wegatmen, es wurde nur noch schlimmer, ein Backlash, irgendetwas rebellierte gegen ihre Bemühungen und rastete dann richtig aus.
Wegen des schwachen Internets musste sie mit den bereits heruntergeladenen Meditationen der Krankenkasse vorliebnehmen. Eine Meditation empfahl ihr, alles ohne Urteil zu fühlen und zuzulassen, denn was man unterdrücke, gewinne nur umso mehr Macht; der Trick sei, es zu fühlen und es dadurch in Besitz zu nehmen – anstatt davon beherrscht zu werden. Die Angst zum Beispiel als ein dumpfes, beklemmendes Etwas oder was auch immer anzunehmen, mit Offenheit und vielleicht sogar mit Neugier, ohne das Gefühlte zu bewerten. Meist entwickelte sich bei Vanessa dann ein Tsunami an Traurigkeit, Vanessa heulte los, anschließend war sie aber etwas erleichtert.
Die andere Meditation begann ähnlich, bog aber völlig anders ab. Vanessa sollte sich bewusst machen, was sie da fühlte, und es labeln: Schmerz, Wut, Verzweiflung. Im nächsten Schritt sollte sie ihr Verhältnis zu diesem Content klären; etwa, ob sie sich für ihn schämte, ihn leugnete, ihn bekämpfte, und das alles galt es dann möglichst abzustellen durch liebevolles Umarmen. Sie fühlte sich dabei gevierteilt und zu sehr im Kopf, das war alles so kompliziert und anstrengend, dass sie das eigentliche Gefühl darüber aus dem Blick verlor. Obendrein gab es noch den Rat, den Atem zu beobachten, um einen Anker zu etablieren, zu dem man stets zurückkehren konnte; das Atmen als Zuhause. Das funktionierte am besten, es war eine Art Drink ohne Alkohol, jetzt heulte sie wieder.
In sechs Wochen musste sie aus der Wohnung raus. Der Kollege sagte, sie könne sein Sofa haben.
Vanessa schluchzte. Heulen, hemmungslos und dabei so allein, dass sie fast galaktisch anschwoll bis an den Rand des Universums, als wäre sie all-eins. Ist doch eigentlich egal, dachte sie nun, was mit mir und meinem Leben geschieht. Dass ich die Wohnung verliere. Dass ich sterbe. Dass ich mein Leben lang nur Scheißjobs haben werde.
Das warme pulsierende Gefühl im Körper, das auf die Heulerei folgte, hüllte sie nun ganz ein, ja, es tröstete.
Zeit für einen Film (sie hatte sich im Büro mehrere heruntergeladen). Das Tollste war, dabei die warme Heizdecke auf Beinen und Bauch zu spüren und im Mund die Eiswürfel des Aperol Spritz kreisen zu lassen.
Während sich Bob Odenkirk eine bunte Krawatte umband, überlegte Vanessa erneut, ob sie eine Therapie machen sollte, aber dazu hätte sie mindestens sechs Monate warten müssen, und es kam ihr unseriös vor, ihre psychische Bedürftigkeit auf einen Zeitpunkt in sechs Monaten zu planen, vielleicht ging es ihr da schon wieder gut, wer wusste das schon. Dann müsste sie dort sitzen und so tun, als sei sie depressiv. Okay, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie das wäre. Aber sie wollte ehrlich sein (oh, Sie sind wie die Schellmann, so ehrlich!), und die Ehrlichkeit sagte, dass sie jetzt Hilfe brauchte, jetzt und nicht in sechs Monaten. Gefühle kannten keine Planung.
Die Gefühle, die Vanessa als Content Managerin beim Product Placement hervorrufen sollte, waren standardisiert, digital Storytelling, daher planbar. Es ging um die Vorhersehbarkeit.
Da war sie ganz gut drin.
Aber Leben war anders.
Das Handy klingelte. Der Makler. Warum keine Mail? Sie ging nicht dran. Widerwillig wählte sie sich Minuten später in die Mailbox ein und hörte ihn sagen, dass es nicht um die Wohnung gehe, da sei noch nichts entschieden, aber um etwas anderes, etwas Persönliches. Ein gruseliges Schweigen und noch gruseligeres Einatmen und Ausatmen.
Er hatte sie doch kaum beachtet. Aber gut, sie hatte schon alles erlebt. Nein, sie würde nicht zurückrufen. Oder doch? Nach einer Stunde war die Neugier zu groß, und sie drückte auf die Nummer.
»Frau Schellmann?«
»Ja, um was geht es?« Ihre Stimme klang ganz heiser, und sie zupfte an ihrem Pulloverbündchen.
»Ich komme gleich zur Sache. Sie haben erzählt, dass Ihre Urgroßmutter Verbindung zu den Heilstätten Beelitz hatte.«
Tatsächlich hatte sie das gesagt. Peinlich.
»Ich habe da so einen Schreibmaschinentext von Ihrer Urgroßmutter. Wieso, das würde ich Ihnen gern in Ruhe erklären. Können wir uns treffen?«
2
West-Berlin 1967
Im Fernsehen war stundenlang das Pontifikalrequiem übertragen worden, nun fuhr man Adenauer in einem Schiff hoch nach Rhöndorf. Zweiundneunzig war er geworden, aber Hoffnung machte das nicht, in letzter Zeit geriet bei Johanna vieles durcheinander. Sie schaltete den Fernseher aus, griff nach Mantel, Hut und Regenschirm, um die Runde im Park zu drehen, die der Hausarzt ihr verordnet hatte.
Bei ihrer Rückkehr ragte unten aus dem Briefkasten ein dicker Umschlag. Als wäre er nichts Wichtiges, stopfte sie ihn unter den Arm. Den Supermarktprospekt legte sie obenauf, um die Beiläufigkeit der Situation zu unterstreichen. Aber auch vor sechzig Jahren bedeutete ein zurückgesandtes Manuskript immer nur eins: eine Absage.
Die Stufen kosteten Kraft. Sie schnappte nach Luft, und hatte plötzlich Sorge, im Treppenhaus zu sterben. Sie wollte nicht im Treppenhaus sterben, wenigstens in ihre Wohnung wollte sie es noch schaffen.
Das Nächste, was sie wahrnahm, war ein Standardschreiben. »Sollten Sie in absehbarer Zeit wieder eine Geschichte für uns haben, sind wir …«
Sie nahm im Sessel Platz und starrte auf das Manuskript. Zwei Jahre hatte sie geschrieben. Sie hatte es selbst kaum für möglich gehalten, aber ja, sie hatte jeden Tag mit der Schreibmaschine Buchstaben ins Papier gehauen, und die Einkaufsliste für Klaus bestand zeitweise nur aus Papier und Farbband. Man vergaß im Alter vieles, aber sie konnte erfreut feststellen, dass der alte Mechanismus noch wirkte, die Worte begannen zu ihr zu strömen, aus jenem tiefen Alleinsein, in dem sie mit allem verbunden war. Sie hatte das Manuskript in einen großen Umschlag gesteckt und ihn eigenhändig am Postschalter abgegeben.
Sie suchte nach einer Telefonnummer auf dem Anschreiben. Ihr Herz klopfte erneut unerträglich hart, als sie mit jeder Drehung der Wählscheibe dem gefürchteten Gespräch näherkam.
»Wolkenfeld Verlag, guten Tag«, hörte sie eine freundliche junge Stimme.
»Guten Tag, Sie sprechen mit Johanna Schellmann.«
Sie hielt inne und wartete ab, was ihr Name auslöste, und als der Sekundenbruchteil eines jubelnden Erkennens überschritten war, fügte sie hinzu: »Junge Dame, mein Name sagt Ihnen doch etwas?«
»Ich bin neu hier.«
»Sie sollten mich kennen, egal wie kurz oder lang Sie im Verlag arbeiten!«
Das Fräulein schwieg einen Moment und sagte dann reserviert: »Was kann ich für Sie tun?«
»Den Verleger bitte.«
»Herr Dobenrath ist gerade nicht zu sprechen.«
Diesen Namen hörte Johanna zum ersten Mal. Zuletzt hatte sie mit Franz Wolkenfeld zu tun gehabt. Lebte Franz nicht mehr?
»Sie haben mir einen Absagebrief zukommen lassen«, sagte Johanna vorwurfsvoll.
»Wir verschicken täglich Dutzende Absagen. Wir erhalten auch täglich Dutzende unverlangt eingesandte Manuskripte.«
Unverlangt eingesandt. War da plötzlich eine leicht hochmütige Note in der Stimme?
»Hören Sie mal gut zu, mein Fräulein. Sie würden heute nicht auf Ihrem Platz sitzen, hätte mein Roman Das Schmuckzimmer damals nicht den Verlag gerettet, er stand kurz vor der Schließung. Das war 1909. Jetzt haben wir 1967. Dass es den Verlag noch gibt, ist mir zu verdanken. Und jetzt holen Sie den Verleger ans Telefon.«
Sie nahm mit Genugtuung wahr, dass ihr Vorgehen Wirkung zeigte. Das Fräulein bat um ihre Nummer, der Verleger rufe zurück. Begann ihre Nummer mit sechs sieben oder sieben sechs? In letzter Zeit verdrehte sie die Zahlen und ihr Hirn reproduzierte jedes Mal einen Augenblick der Verwirrung statt den der Lösung.
»Ich kann meine Nummer gerade nicht finden.«
Sie spürte ihre Zunge übergroß und schwer werden, und da war nun auch dieses mitleidige Zögern am anderen Ende, das sie so oft in letzter Zeit im Kontakt mit anderen wahrnahm.
»Frau Schellmann, warten Sie bitte.«
Es wurde still. Auf dem Literaturkalender mit Gedichten von Theodor Storm stand der 25. April 1967. Den Kalender schickte Emmy jedes Jahr aus Kanada, auf diese Weise begleitete ihre Tochter sie Tag für Tag. Zweimal im Jahr telefonierten sie, hielten sich aber kurz wegen der hohen Kosten. Auch Emmy war inzwischen eine alte Frau mit Rheuma und Arthrose, und sie hatten sich dreißig Jahre nicht gesehen.
Sie hörte ein Knacken in der Leitung und meinte, noch die Ausläufer eines Gelächters zu hören.
»Frau Schellmann? Herr Dobenrath ruft Sie in etwa einer Stunde zurück. Wir haben Ihre Nummer.«
»Selbstverständlich haben Sie die.«
Ja, man wusste, wer sie war.
Radieschen, Leber, Kochkäse, sie machte mit Kugelschreiber Kreuze in den Prospekt, für Klaus. Manchmal ritzte sie das Papier versehentlich ein und dachte dann große Gedanken wie die Verletzlichkeit der Dinge. Früher hätte sie so etwas notiert. Sie glaubte nicht mehr, durch Worte etwas bewahren oder beschwören zu können. Das war alles an Erkenntnis, nachdem sie zuvor ein Leben lang mit dem Wort gegen dieses Wissen angekämpft hatte.
Das Schreiben ihrer Memoiren war von anderer Art gewesen. Ohnehin schien der Verlag jene Werke, die sich über Jahrzehnte blendend verkauft hatten, jetzt für seicht zu halten, gar für Frauenliteratur, dabei war sie damals als Pionierin einer neuen Epoche gefeiert worden, innovativ in ihrer Ehrlichkeit und Drastik, ja, Das Schmuckzimmer galt als Identifikationsbuch einer ganzen Generation. Und nun wurde sie nicht mehr nachgedruckt.
Eine Kritikerin namens Dr. Angelika Röttel hatte vor drei Jahren in der F.A.Z. schließlich mit ihr abgerechnet, völlig gefahrlos, denn wer würde die in Vergessenheit geratene Dichterin schon verteidigen? Der Beitrag »Dichterinnen der Kaiserzeit – Wegbereiterinnen und Verräterinnen der Frauenbewegung« warf Johanna Schellmann Erzählmuster vor, die dem wilhelminischen Denken verhaftet seien und das Klassendenken nie überwunden hätten. Schellmann habe damals mit ihrem Lamento zweifellos einen Nerv getroffen, aber nur in der eigenen großbürgerlichen Schicht, eine gesamtgesellschaftliche Vision sei sie schuldig geblieben. Die beiden grausamsten Sätze lauteten: 1. Johanna Schellmann war zwar eine erfolgreiche Frau, aber dadurch noch lange keine Feministin. 2. Das Herz auf der Zunge hatte Schellmann durchaus, aber das macht noch keine große Literatur.
Tagsüber war Johanna wütend, nachts machten sich diese beiden Sätze in ihrer hässlichen Gleichgebautheit über sie her und drehten Runden in ihrem Kopf, als müsste sie bloß endlich rufen: Frau Dr. Röttel, ja, Sie haben recht, es stimmt alles! Ich bin keine gute Schriftstellerin und zu Recht bin ich heute vergessen!
Aber etwas in ihr war überzeugt, dass sie gut war. Die Worte von Angelika Röttel waren ungerecht.
Eines Morgens begann sie, dieser Ungerechtigkeit etwas entgegenzusetzen. Eine eigene Erzählung über ihr Leben, und zwar von Anfang an.
Hochverehrte Herrschaften,
in meinem fünfundachtzigsten Lebensjahr habe ich mich entschlossen, meine Erinnerungen für die Nachwelt niederzuschreiben. Sie halten mein Leben in Händen, beginnend mit meiner Kindheit in Konstantinopel als Tochter eines Diplomaten, einer glanzvollen Jugend in Berlin, dem Ringen um den Sinn des Lebens als junge Ehefrau, hin- und hergerissen zwischen bürgerlichen Pflichten und dem Drang nach einer Freiheit, wie sie uns nur in der Zwischenwelt des Geistigen geschenkt wird. Sie lesen von meinem Durchbruch als Schriftstellerin im zarten Alter von nur siebenundzwanzig Jahren. Mögen Ihnen meine Erzählungen gefallen!
Hochachtungsvoll
Johanna Schellmann
Sie ließ das Anschreiben sinken. So schrieb man heute nicht mehr, das wusste sie. Nun war es sowieso zu spät. Sie griff nach den Manuskriptseiten und versuchte, an kleinen Abnutzungszeichen zu erkennen, ob überhaupt zu Ende gelesen worden war. Auf Seite zweiundfünfzig entdeckte sie am Rand einen Bleistiftstrich: »Ich habe Anna nie zu ihrer Arbeit in der Fabrik befragt.«
Eine Seite später ein nervöser Kringel, als wären die Bedenken bereits in die Hand gekrochen und schüttelten vor Entsetzen den Bleistift: »Anna konnte im stockdunklen Keller die richtige Flasche Wein finden.«
Aber wenn es doch so war? Um sich abzulenken, blätterte sie erneut im Supermarktprospekt. Sie war aufgewühlt und erschöpft zugleich, ein grässlicher Zustand. Wie gern hätte sie jetzt jemanden zum Reden gehabt, einen verständnisvollen Zuhörer. Sie schaltete den Fernseher wieder ein; das Schiff fuhr den toten Adenauer immer noch über den Rhein. Sie starrte auf den Bildschirm, Menschenmassen am Ufer, Traurigkeit und Feierlichkeit, trauriger grauer Himmel und trauriger Rhein.
Sie wachte von einem Geräusch auf, und als Nächstes stand Klaus in der Wohnzimmertür. Sie hatte es nicht klingeln gehört, aber er hatte ja neuerdings einen Schlüssel.
»Ah, gut, Sie leben, Frau Schellmann.«
»Ja, immer noch. Und klingeln Sie bitte das nächste Mal.«
»Was glauben Sie, was ich getan habe?«
Sie hörte ihn in die Küche gehen und dort den Kühlschrank einräumen. Sie meinte, jedes einzelne Teil am Klang erkennen zu können, das Hühnerbrustfilet, die Petersilie, Karotten und Schnittlauch.
»Klaus? Klaus? Klaus!«
Die Dielen knarrten, dann stand er vor ihr. Sie schämte sich ihres kindlichen Gequengels, denn Klaus war, nach wie vor, ein Mann. Ein gutaussehender, junger Mann mit glattrasiertem Kinn, schönen starken Augenbrauen, sensibel geschwungenen Lippen und mit dieser weißen Porzellanhaut, auf der sich Gemütsregungen immer als plötzlich aufblühende Rötungen verrieten. Solche Männer überspielten ihre Sensibilität in besonders ruppigem Auftreten, und genau das rührte Johanna. So war auch Clemens gewesen.
Gleichzeitig nahm sie sich selbst überdeutlich wahr, wie damals als junge Frau, wenn ein Mann vor ihr stand. Sie spürte einen leichten Stromschlag durch ihren Körper fahren und hob Kinn und Augenbrauen, um alles im Gesicht zu glätten und zu straffen.
»Klaus, Sie wissen, dass ich einmal sehr berühmt war?«
»Das haben Sie erzählt. Und da stehen ja auch Ihre Bücher.« Er zuckte mit dem Kinn zum Wandregal. »Aber man hat Sie vergessen. Niemand liest heute mehr Ihre Bücher. Auch das haben Sie gesagt.«
Sie schwieg verärgert und schaltete den Fernseher aus.
»Ich kenne mich mit Literatur nicht gut aus«, sagte er einlenkend. »Soll ich das Fenster öffnen?«
»Womit kennen Sie sich denn aus? Was studieren Sie überhaupt?«
Er schien nachzudenken, aber eher, ob er sich auf ein solches Gespräch einlassen sollte. Mit einer Zigarette im Mund kam er vom Fenster zurück.
»Geschichte und Politikwissenschaften.«
Das Feuerzeug klickte.
Sie knetete ihre Finger, spürte die sich verschiebende, lockere Haut und wusste nicht weiter.
»Ich habe nie Schmuck getragen, was sehr ungewöhnlich war, besonders damals. Ich wollte mich nicht fühlen wie ein Gegenstand, der aufgewertet werden muss. Welchen Grund könnte es schon geben, kleine Portionen Edelsteine und Edelmetalle sichtbar am Körper mit sich zu führen? Einen praktischen gewiss nicht. Es soll also etwas anderes bezwecken. Können Sie mir folgen?«
Klaus nickte, zog an seiner Zigarette und schaute nachdenklich auf den Supermarktprospekt. Er blieb nach den Einkäufen immer noch ein Weilchen bei ihr, warum, wusste sie nicht, manchmal schien es so, als hätte irgendwer ihm das befohlen. Meist schauten sie Fernsehen, und nach einer halben Stunde sprang er ganz plötzlich auf und war weg. Johannas Blick fiel auf das abgelehnte Manuskript.
»Klaus, können Sie mir einen Gefallen tun? Lesen Sie das und sagen Sie mir Ihre ehrliche Meinung.«
Sie zeigte auf das Manuskript.
»Das haben Sie doch in den letzten Monaten geschrieben? Dafür sollte ich die Farbbänder und das Papier holen?«
»Lesen Sie.«
»Jetzt? Hier?«
»Fangen Sie an. Und das hier ist für den nächsten Einkauf. Ich habe alles angekreuzt.«
Sie schob den Prospekt zum Manuskript, als gehörten sie nun zusammen.
»Ich will Ihre ehrliche Meinung.«
»Warum gerade meine Meinung?«
Weil ich niemanden habe, dachte sie, und sagte: »Weil Sie jung sind. Wie das Fräulein am Telefon. Alle sind jung. Vielleicht können Sie mir erklären, was an diesem Manuskript nicht stimmt. Es ist nämlich abgelehnt worden.«
Es auszusprechen, war befreiend.
»Hier, setzen Sie sich.« Sie kämpfte sich schwerfällig aus ihrem Sessel heraus, schlug ärgerlich seine Hand weg, als er sie stützen wollte, und ging auf bloßen Strümpfen in die Küche. »Ich mache uns einen Tee!«, rief sie von dort. »Außerdem kann ich das nicht mitansehen, wenn jemand meine Texte liest. Das konnte ich noch nie!«, ihre Stimme wurde immer trällernder und vergnügter.
Auf den Steinfliesen in der Küche wurden ihre Füße sofort kalt. Sie stieg auf einen Topflappen, den sie dazu auf den Boden fallen ließ. Immer schon war sie frei und daher erfinderisch gewesen. Von ihrer Mutter hätte es jetzt eine Mahnung gegeben. Mama. Das Wort stieg mit einem weinerlichen Gefühl auf. »Möchtest du auch einen Tee, Mama?«, flüsterte sie leise, aber goss, trotz des deutlich zu vernehmenden »Ja« ihrer Mutter, nur für Klaus und sich ein. Sie wusste ja, dass die Mutter schon lange tot war und daher nur eingebildet. Doch sie hörte neuerdings ihre Stimme, wahrscheinlich hatte das mit dem Schreiben zu tun.
Sie trug das Tablett ins geheizte Wohnzimmer, und erst als sie es auf dem Couchtisch abstellte, bemerkte sie, dass plötzlich doch drei Tassen darauf standen. Hastig pflückte sie die dritte Tasse weg und verbarg sie hinter dem Rücken.
»Wie weit sind Sie, Klaus?«
»Bei Ihrer Geburt 1882 in Konstantinopel.«
»Heute heißt das Istanbul.«
»Die türkische Amme sagt Ihnen aufgrund Ihrer prägnanten Nase eine Dichterinnenkarriere voraus.«
»Das ist tatsächlich passiert!«, strahlte sie, und weil Klaus mitlächelte, wurde ihr plötzlich ganz warm ums Herz, so dass sie die Tasse hinter dem Rücken vergaß und einfach vor Klaus stehen blieb, wie ein Kind, das weitere Bonbons erwartete. Nach einer Weile, weil nichts geschah, machte sie einen Schritt zurück. Jetzt konnte sie ihn besser betrachten. Ja, sie fand Gefallen am Stillleben Mann, Leselampe, Tee. Er wäre für sie infrage gekommen, wäre sie noch jung. Er war ein bisschen grob, nicht wirklich höflich, und man musste ihn immer motivieren (Klaus, bitte sagen Sie dem Metzger, er soll den Parmaschinken diesmal sehr dünn schneiden!). Man musste ihn geradezu erobern – diese Art Mann hatte immer einen Reiz auf sie ausgeübt. Und sie würde ihm Geld geben. Sie hatte immer gutes Trinkgeld gegeben. Das Telefon! Erschrocken schaute sie zu Klaus, der nicht reagierte, und hob dann besonders schwungvoll ab.
Die Stimme des Verlegers war sehr jung und sehr freundlich. Natürlich werde er ihr den Grund für die Manuskriptablehnung mitteilen, es tue ihm übrigens sehr leid, dass der Verlag nicht sofort den persönlichen Weg gewählt habe, da sei ein Fehler unterlaufen.
Sie spürte ein bisschen Genugtuung, aber ließ sich nichts anmerken: »Nun gut. Ich höre!«
»Frau Schellmann, selbstverständlich wissen wir um Ihre Bedeutung für den Verlag. Und auch heute noch können viele mit Ihrem Namen etwas verbinden; Das Schmuckzimmer, Das Innere der Welt, Die Verlorenen, Regeln für die Nacht, Der Winter aus Papier. Niemand hat das weibliche Leiden in patriarchalen Strukturen so präzise und aufrichtig erkundet wie Sie. Aber Sie haben ein Vierteljahrhundert nicht mehr veröffentlicht, und es ist verlegerisch schwer, dann gleich mit Memoiren …«
»Ich bin Ihnen also nicht mehr berühmt genug«, fiel sie ihm ins Wort und schaute kokettierend zu Klaus, der aber so tat, als wäre er in ihr Manuskript versunken.
»Nun, es gibt auch ein stilistisches Problem. Sie beschreiben Ihr Leben im ungebrochenen Abenteuerstil, schwärmerisch und gefühlig. Alles geht immer gut aus, jede Krise hat einen höheren Sinn …«
»Haben Sie das denn nicht gern gelesen?«
»Diese teleologischen Lebensmodelle, in denen alles im Nachhinein einen geradezu gottgelenkten Sinn offenbart, sind heute schwierig. Es fehlt uns jenes Element, für das unser Verlag nach 1945 umso mehr steht, das politische und gesellschaftskritische Bewusstsein. Außerdem …«
»Herr Dobenrath. Meine Romane waren immer politisch. Ich habe mich aber vor keinen Karren spannen lassen. Ich möchte behaupten, gerade deshalb ist meine Literatur politisch! Etwa die Geschehnisse um Anna«, sie hielt inne, ein Schreck durchfuhr sie, und sie sprach gegen den eigenen Widerstand nur mit Mühe weiter: »Sie halten auch diese Episode sicherlich für trivial, aber Sie wissen ja gar nicht, um was es da wirklich geht und wie politisch das letztlich ist.«
»Um was geht es denn?«, fragte er freundlich, und sie spürte Ärger und überlegte, ob sie einfach auflegen sollte. Dann sprach sie beherrscht: »Es geht um die Seele.«
Das Wort war gewichtig. Sie schwiegen einen Moment lang; feierlich, wie ihr schien.
»Die Geschichte des Mediums Anna Brenner ist tatsächlich interessant. Aber geht es da nicht auch um Machtverhältnisse und Klasse? Warum streifen Sie das nur so kurz? Auch die Arbeiterheilstätten Beelitz sind interessant, sie sind gewissermaßen der Zauberberg der Proletarier. Das verdient doch mehr Raum als nur ein Kapitel. Und heute hat dort die Rote Armee ihr Militärkrankenhaus. Nur leider kommen wir da nicht ohne Weiteres hin, falls wir«, er korrigiert sich, »falls Sie recherchieren wollen.«
»Ja, vielleicht.«
»Wissen Sie denn, was aus Anna später geworden ist, Frau Schellmann?«
»Nein. Aber während der Schlacht um Verdun haben sich plötzlich sehr viele Menschen um Anna versammelt, meine Güte, jeder wollte wissen, ob der eigene Mann noch lebt oder welche Hoffnung es gibt. Ja, zu so etwas hat sie sich herabgelassen!«
Sie blickte zu Klaus, der sich daraufhin durchs Haar fuhr, aber weiterhin Versunkenheit mimte. Sie fühlte, dass ihr Mund plötzlich ganz trocken war und die Kehle schmerzte.
»Unser Volontär wird mal recherchieren. Falls wir fündig werden und es Sie interessiert, melden wir uns.«
»Natürlich interessiert mich das«, sagte sie leise.
»Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung. Vieles ist nicht dokumentiert worden, und was mit den Grenzwissenschaften zu tun hat, wurde ja immer schon vernachlässigt.«
»Damals gerade nicht, Herr Dobenrath«, sagte sie nun lebhaft. »Der Okkultismus war in jener Zeit in aller Munde und nicht so anrüchig wie heute. Man hat sogar strenge empirische Forschung betrieben! Schriftsteller wie Döblin, Kafka, Rilke und Mann haben sich mit den Geistern beschäftigt. Ja, ihre Werke sind gar nicht denkbar ohne den Kontakt mit diesen Zwischenwelten. Den hatten sie nämlich. Lesen Sie deren Bücher nochmal genauer, es spukt in ihnen!« Sie lachte, sie war ganz erfreut über ihren plötzlichen Schwung.
»Das war in der Tat eine interessante kulturelle Phase«, belehrte er sie zurück, »aber das allgemeine wissenschaftliche Interesse hörte wieder auf, weil die okkulte Forschung, etwa die von Schrenck-Notzing, sich wegen mangelnder wissenschaftlicher Methodik und Reproduzierbarkeit nicht etablieren konnte. Einige seiner Medien wurden auch des Betrugs überführt. Wann haben Sie denn zuletzt von Anna gehört, Frau Schellmann?«
»Gestern.«
»Sie lebt?«
»Natürlich. Sie war hier. Wir haben Tee getrunken.«
»Dann müsste sie inzwischen wie alt sein …?«
»Fünfunddreißig. Das weiß ich sofort.«
Eine Pause entstand. Hatte sie etwas Falsches gesagt? Sie merkte in letzter Zeit öfter, dass die Leute plötzlich mitten im Gespräch verstummten.
»Gut, verehrte Frau Schellmann. Ich werde mich melden, wenn wir mehr wissen.«
Sie begann zu zittern. Da schien etwas körperlich nicht in Ordnung, etwas Unüberschaubares geriet in die Situation.
»Auf jeden Fall ist das ein interessantes Thema, wenn ich das über Anna Brenner sagen darf, die ja schließlich eine Freundin war, vielleicht auch eine Art Mentorin.«
»Junger Mann, Sie hören von mir«, sagte sie in ihrem Kommando-Ton und legte auf. Das war wieder falsch gewesen. Ihr Inneres fühlte sich an, als hätte man zwei verschiedene Puzzles ineinandergeschüttet.
Sie blinzelte. Schneeregen vor dem Fenster. Nicht einmal der Zigarettenrauch wollte nach draußen. Sie betrachtete die hintereinander gelagerten Schichten aus grauen Rauchschlieren und herabsausendem Eiswasser, fühlte die Kälte durchs Zusehen schon in die Knochen steigen. Klaus war immer noch mit ihrem Manuskript beschäftigt. Also doch ein Leser, sie hatte es gewusst!
Sie atmete einmal schwer aus und fragte: »Sie haben alles mitgehört?«
Er nickte und schaute auf.
»Dann sagen Sie doch mal etwas zu der Situation, in der wir uns befinden.«
»Vielleicht liegt es daran, dass es bedeutsamere Biografien gibt als die Ihre? Im Dritten Reich sind Sie mit Ihren Büchern nicht gerade Risiken eingegangen. Und einmal haben Sie einen Förderantrag mit Heil Hitler unterschrieben.«
Sie zuckte zusammen. Hatte sie ihm das wirklich anvertraut? Das hatte sie doch immer geheim gehalten.
»Ich hätte den Antrag sonst gar nicht erst zu stellen brauchen.«
»Eben, Sie hätten es ja lassen können.«
Er warf mit einem verächtlichen Ruck eine lange Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Junger Mann. Mein gesamtes Vermögen hatte sich in der Wirtschaftskrise aufgelöst. Zu Ihrer Beruhigung: Ich habe das Stipendium nicht bekommen.«
»Jedenfalls gibt es Stimmen, die zu hören wichtiger sind, Frau Schellmann. Sie sind nicht gerade ein leuchtendes Beispiel für Intellektuelle im Widerstand.«
»Klaus, das ist ganz richtig«, schlug sie einen versöhnlichen und vertraulichen Ton an. »Der Verleger hat aber eine ganz andere Kritik. Er findet meinen Ton nicht zeitgemäß.«
»Das gehört doch zusammen.«
Da hatte er recht. Er war schlauer, als er tat. Er trottete immer so unbedarft hier rein, stellte Einkäufe ab, schaute mit ihr fern und verschwand. Aber er war viel mehr als das. Ein Gefühl von Verliebtheit regte sich in ihr, und sie schaute ihn dankbar an. »Sie sind ein Guter!« Doch in diesem Moment schien ihr, als sei sein Blick plötzlich kalt und fern, als gehe in ihm etwas vor, das er ihr verheimlichte.
Später, an der Tür, drückte sie ihm zehn Mark in die Hand.
3
Beelitz Heilstätten 1907
Jeden Morgen um 6:32 Uhr ging Anna durch den breiten Flur aus dreifach gebrannten Villeroy&Boch-Fliesen, denen man eine Lebensdauer von hundert Jahren prophezeite, zum Waschraum und suchte sich ein freies Becken. Das Wasser war heiß und kam direkt aus der Wand, und man sagte, nicht einmal der Kaiser genieße diesen Luxus.
Anschließend trat Anna an den gluckernden Sputum-Kochapparat, der wie eine Gottheit am Ende des Gangs thronte, und kippte aus einem blauen Fläschchen ihren abgehusteten infektiösen Schleim hinein. An diesem Ort war vieles geheimnisvoll. Anna fühlte sich in ihn übergehen, ihren Körperflüssigkeiten nachfolgend, Schleim, Blut, Urin, die bereits in die verschiedensten Gläser und Behälter der Ärzte gewandert waren.
Bislang hatte Anna ihr Zimmer nicht teilen müssen. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie eine Tür hinter sich schließen und war allein. Sie hatte nicht geahnt, wie viel Genuss darin lag, nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Doch als sie an diesem Morgen aus dem Waschraum zurückkehrte, saß auf dem zweiten Bett plötzlich eine fremde Frau. Anna griff nach ihrem Gebetbuch und flüsterte: O Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau.
Die Neue hustete, dann sprach sie heiser: »Ich heiße Margarete. Ich war erst in einem anderen Zimmer, aber dort war es zu voll. Und wie heißt du?«
Anna schwieg.
»Ich habe Berlin auch noch nie verlassen. In Berlin …«
»Anna.«
Sie kannte diese Gespräche. Sie wollte nicht über das sprechen, was man in Berlin hinter sich ließ, den trinkenden Mann, die zerlumpten Kinder und die vornehmen Damen von der Wohlfahrt, die mit einem Lächeln Wolldecken zwischen rußschwarzen Wänden abluden.
Je länger Anna nun hier war, desto unverständlicher wurde ihr das Geschwätz der Frauen. Fürs Schwatzen hätte sie jedes Mal Anna sein müssen, Anna das Dienstmädchen, Anna die Fabrikarbeiterin, und diese Kraft hatte sie nicht. Ja, diese unbedeutende Person zu sein, hatte Kraft gekostet: das Kaminfeuer bei Laune halten. Den Boden fegen. Ein Essen servieren. Mit stets aufmerksamer und doch teilnahmsloser Miene. Den gnädigen Herrschaften immer ein bisschen voraus sein, damit nicht das Glöckchen nach einem bimmelte. Erraten, in welches Zimmer, in welchen Saal die Herrschaften als Nächstes gehen würden, was sie dort als Nächstes vermissen würden (Die Post! Die Zeitung! Einen Cognac!). Abwägen, ob ein paar Minuten blieben, um etwas zu tun, das nur einem selbst gehörte: Ans Fenster treten, als wäre das dahinter der eigene prächtige Garten. Vielleicht nichts davon, nur wissen, dass man für ein paar Momente sich selbst überlassen war, weil die Herrschaften nichts brauchten und einen daher vergessen hatten. Dann war es einen Versuch wert, auch umgekehrt die Herrschaften zu vergessen.
Schritte näherten sich, federnd und fest. Mit Eimer, Waschlappen und sachverständigem Blick trat die Pflegerin ein. Anna schloss die Augen. Das Eiskalte war vom Heißen fast nicht zu unterscheiden. Es prickelte auf der Haut, versiegelte den Körper. Noch einmal tauchte die Pflegerin den Waschlappen in das Eiswasser, wrang ihn aus und klatschte ihn auf Annas Rücken. Sie spürte die Umrisse ihres eigenen Körpers so deutlich, als zeichnete ihn jemand vor ihr auf. Vor zwei Monaten, beim ersten Mal, waren Anna dabei Tränen gekommen.
»Nimm dich vor der Anna in Acht«, sagte die Pflegerin plötzlich, »mit der Anna will keine wohnen, darum war sie bislang allein.«
Anna öffnete die Augen. Hatten sich etwa gewisse Dinge über sie herumgesprochen?
Die Schwester gab Anna zum Abschluss einen gutmütigen Klaps und drehte sich zur Neuen um: »Na, worauf wartet die gnädige Frau? Hemd ausziehen.«
Die fremde Frau schlang schützend die Arme über ihre Brust. So hatte sich auch Anna gefühlt, als sie zum ersten Mal auf der Bettkante saß. Sie hatte dabei das Bild vor Augen, wie der Vater die Mutter mit Vorliebe spätabends prügelte, so dass sie manchmal ohne Kleidung nach draußen fliehen musste, was eine zusätzliche Schande war. Anna schaute der nun wimmernden Frau mit einer gewissen Neugier zu.
»Anna, was ist mit der Margarete los? Du weißt doch alles, hat man mir erzählt.«
Man hatte also über sie gesprochen!
Anna schüttelte den Kopf und vergrub ihren Blick wieder ins Gebetbuch. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin! Auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.
Doch statt an Christus dachte Anna an Professor Blomberg: »Atmen. Atme tief ein und aus.«
Er hatte das Stethoskop sanft an ihren Rücken gedrückt und gelauscht. In diesen ärztlichen Gesten lag so viel Ruhe, sie waren frei von Verlangen und Gier. Selbst wenn er einen nackten Busen vor sich hatte, dachte er an nichts als an seine Forschung, und das ließ Raum für so viel vornehme Sanftheit.
Außerdem war Professor Blomberg der erste Mensch, der sich für Anna interessierte. Ein rundlicher Mann mit ähnlich rundlicher Art zu reden, was Anna das Antworten leichter machte. Wo Anna aufgewachsen sei (»in der Nähe von Berlin, den Ort kennt niemand«), wie viele Geschwister, wie viele Jahre zur Volksschule. Wenn Anna über sich selbst sprach, war ihr, als würde sie alles erfinden. Sie war nicht gewohnt, über sich zu sprechen. Auch das konnte sie Blomberg sagen, und er nickte verständnisvoll.
Seit sie zum ersten Mal im Leben Zeit habe, Tage in Stille verbringe, käme jedoch alles zurück. Bilder, Worte, Gesichter tauchten auf. Und auch das, was sie verbannt habe.
»Was meinst du?«
Zögernd erzählte sie von ihrer Kindheit. Dass sie einerseits kaum je allein gewesen sei auf dem Bauernhof, wo die Eltern als Knecht und Magd arbeiteten. Trotzdem trennten stets hohe Mauern sie von den anderen. Dass sie unwissend gehalten wurde wie alle Kinder, die Mädchen ganz besonders. Dass sie sich mit den Geschwistern im Dunkeln auszog und lange Zeit nicht wusste, dass es zwei Geschlechter gab.
»Aber das ist doch normal«, lachte Blomberg, »auch die Damen der höheren Gesellschaft finden das erst spät heraus.«
Anna lachte nicht mit.
Dass eines Tages, da war sie noch ein Kind, etwas in ihr aufgestiegen sei. Eine Stimme. Ja, sie hielt damals die Stimme für die Stimme Jesu. Manchmal war es auch die Stimme Marias. Vielleicht war es auch ein Engel. Sie wisse es nicht. Auf dem Friedhof, der Ort, an dem sie sich manchmal versteckte, sprachen stets die Toten zu ihr. Sie nickte, als Blomberg fragte, ob das echte Tote waren oder nur eingebildete in der Fantasie.
»Echte.«
Blomberg machte eine Notiz in sein Buch und ließ sich Zeit mit der nächsten Frage.
»Und warum hast du die Stimmen verbannt, Anna?«
»Die Stimmen sagen stets die Wahrheit. Nicht jeder möchte das hören.«
»Zu welchem Zeitpunkt haben deine Gaben aufgehört?«
Sie dachte nach. Aufgehört hatten sie ja eigentlich nie, aber Anna hatte ihnen keine Beachtung mehr geschenkt.
»Sie sind zurück.«
»Ja, das spricht sich herum. Du löst hier viel Unruhe aus.«
Die Schwester schloss knallend die Tür hinter sich. Das war eigentlich verboten. Mit der einsetzenden Morgendämmerung erkannte Anna nun, dass es in der Nacht geschneit hatte. Opernhaft wölbte sich der Schnee über die Büsche und Bäume, dramatische Formen wuchsen aus dem dämmrigen Garten. Anna trat ans Fenster und sang leise ein Lied, das sie noch aus ihrer Schulzeit kannte:
Gefroren hat es heuer
noch gar kein festes Eis
Das Büblein steht am Weiher
und spricht zu sich ganz leis:
»Ich will es einmal wagen
das Eis, es muss doch tragen
Wer weiß?«
»Was singst du da?«, rief die Frau vom Bett aus.
»Ein Lied halt.«
Ein kalter Luftzug griff in diesem Moment nach Anna. Die Kälte kam nicht vom Fenster. Sie kannte diese Art von Kälte, sie wusste, dass sie ein Vorbote war. Sie schloss die Augen, als könnte sie damit den Lauf der Dinge anhalten. Doch etwas zwang sie, die Augen wieder zu öffnen, und da erkannte sie in der Spiegelung der Fensterscheibe hinter sich einen rätselhaften Vorgang: Ein kleiner Junge trat durch die Wand in das Zimmer ein. Der Junge trug Mütze und Schal, seine Lippen und Finger waren blau und das Gesicht leichenblass. Der Junge blieb vor Margarete stehen und schaute sie mit einem Ausdruck aus Entsetzen und Schmerz an.
»Siehst du ihn auch?«, fragte Anna leise und ohne sich zu bewegen, »den Jungen?«
»Ich sehe, dass mit dir etwas nicht stimmt, das sehe ich!«, sagte Margarete ärgerlich. Daraufhin drehte sich Anna ruckartig ins Zimmer um. Da war kein Junge. Nur Margarete und sie. Und doch schrie Margarete leise. Auf den Fliesen mitten im Zimmer war plötzlich eine Wasserpfütze.
»Wo kommt das Wasser her? Ist es bei den kalten Abreibungen verspritzt? Hatte der Eimer ein Leck?«
Anna beugte sich zu Margarete herab und flüsterte: »Es tut mir sehr leid. Dein Junge ist tot. Er ist ertrunken.«
Es sprach einfach aus ihr heraus. Die Ohrfeige, die darauf folgte, schien ihr daher unverdient. Margarete begann sofort, ihren Koffer zu packen, murmelte gelegentlich »Teufel« und sagte zum Abschluss: »Kein Wunder, dass niemand ein Zimmer mit dieser Frau teilen will.«
»Hau ab«, sagte Anna.
Beim Frühstück saß Anna etwas abseits. Ihre Aussicht ging auf eine einzelne Kiefer, deren schneebepuderte Krone sich majestätisch auffächerte. An und für sich wollte Anna normal sein. Sie hatte es immer erstrebenswert gefunden, nicht aufzufallen, denn sie fiel zu schnell auf, allein schon durch ihr Äußeres. Sie war dürr und hochgewachsen, hatte aber, so sagte man ihr, ein schönes Gesicht (sie selbst hatte dafür kein Gespür).
Daher auch stets ihre Verwirrung über Dr. Steiner. Wie konnte man auf die Idee kommen, mit seinen Gaben auch noch an die Öffentlichkeit zu treten? Die alte Bozena hatte ihr stets geraten, sie geheim zu halten. Von dieser Frau hatte Anna Professor Blomberg nicht erzählt, von dieser robusten geheimnisvollen Seele, zu der damals selbst der Bürgermeister ging, wenn er vor Schmerzen schrie. Nun, auch die Bozena hatte es nicht wirklich geheim halten können.
Anna steckte sich das letzte Stück Schinkenbrot in den Mund. Dann starrte sie auf den leeren Teller. Die Teller im richtigen Abstand zur Tischkante. Die Ordnungen einhalten, bis man die eingesoßten, klebrigen Teller wieder einsammelte und ins Durcheinander des Schmutzwassers gab.
Dr. Steiner, oder der Meister, hatte die Angewohnheit, auf seinem Teller stets einen kleinen Rest zu lassen, eine halbe Kartoffel, ein bisschen Sauce. Ein wirklich feiner Herr würde den Dienstboten nicht extra Arbeit aufhalsen. Anna musste die Essensreste vom Teller erst in den Mülleimer kratzen, bevor sie ins heiße Spülwasser durften. Es war einmal Bücken und ein Handgriff mehr, und das begann Anna, dem Meister übel zu nehmen.
Der Meister brauchte besonders oft etwas von ihr. Alle verehrten ihn; sie nicht. Wenn man jemandem das Klo putzen musste, konnte man ihn nicht verehren. Er war nur ein Mensch wie alle anderen, auch er pupste manchmal, was er mit einem Geräusch wie einem abrupten Stuhlrücken zu übertönen versuchte.