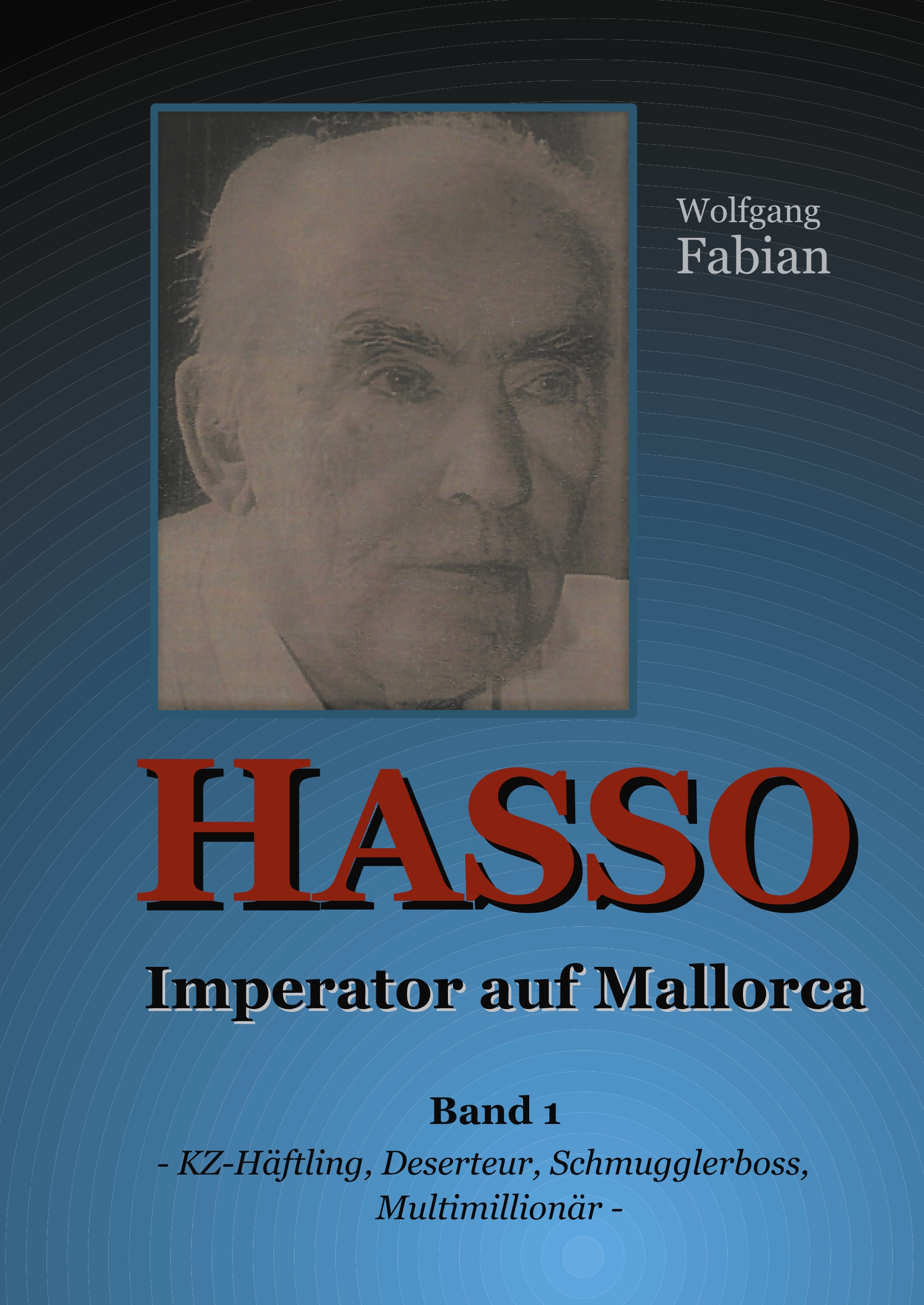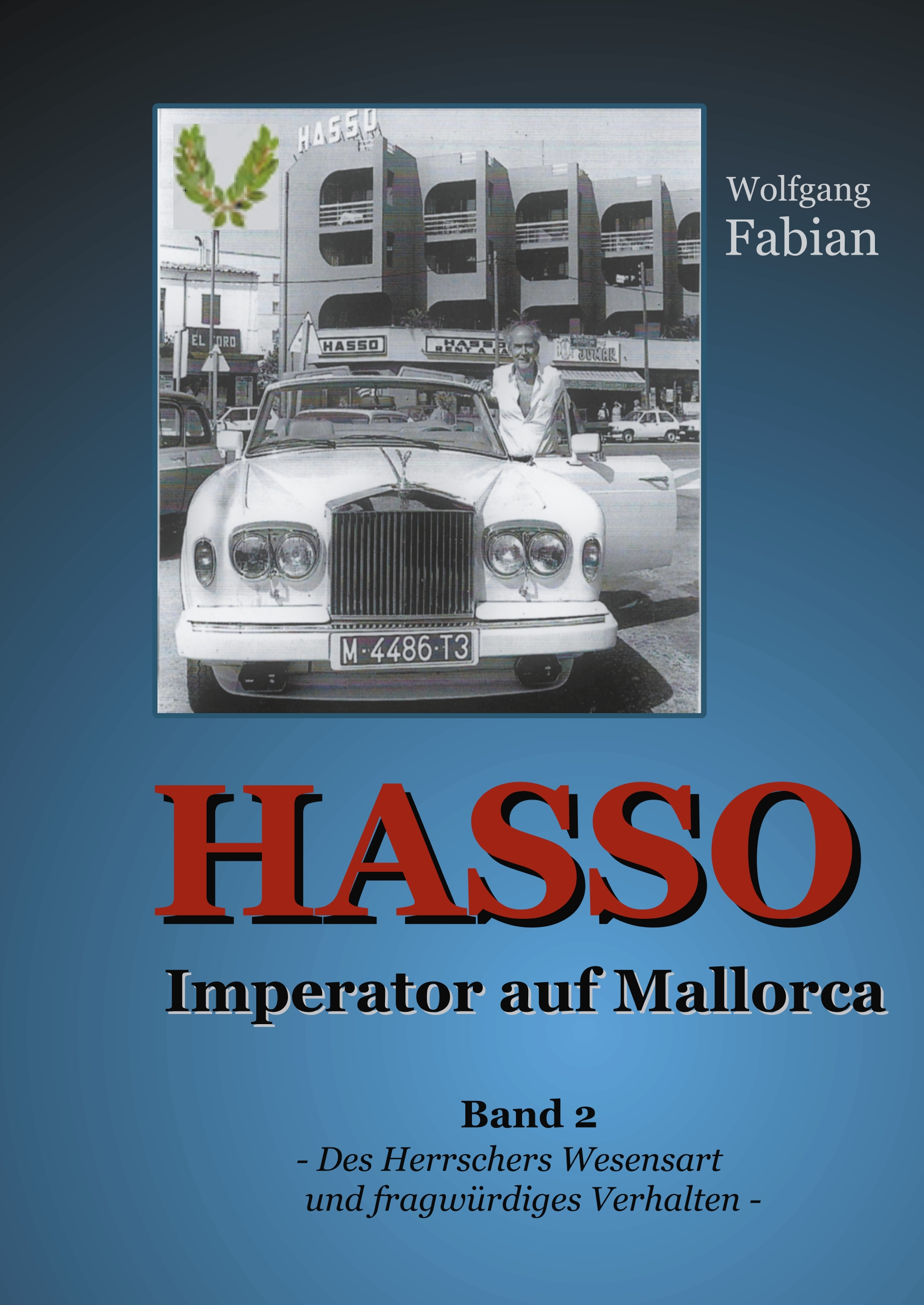Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martin Lusson, 40 J., leitend tätig in einem Dienstleistungskonzern verliert nach einer kurzen Affäre seiner Ehefrau jegliche Kontrolle über sich, verfällt dem Alkohol und büßt seine lukrative Position ein. Er überlebt ein Bootsunglück auf der Nordsee; verübt einen spektakulären Banküberfall, weil er seine Frau versorgt wissen will. Doch bedrängt vom Gewissen und der Empörung seiner Ehefrau schickt er das Geld an die beraubte Bank anonym zurück. Ein Gefängnisaufenthalt bleibt ihm trotzdem nicht erspart, nachdem er seinen Saufkumpan, einen Altpapierhändler, der seinen zahmen Marder Boris tötete, ernsthaft verletzte. Ausgerechnet der Tod dieses Marders löst nachhaltig und in Verbindung mit dem absoluten Niedergang Lussonss außergewöhnliche Ereignisse aus, wie erneuerte Liebe, lukratives Berufsangebot. Doch dann geschieht etwas, womit niemand rechnete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Wahrheit ist jeder an allem schuldig,
nur wissen es die Menschen nicht;
wüssten sie es aber,
so hätten sie das Paradies auf Erden
(Roman Brüder Karamasoff)
Fjodor Michailowitsch Dostojewskij
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Einführungskapitel
Nordwestlich von Hamburg, an der Straße zwischen Wedel und Elmshorn, duckte sich unter dem knorrigen Astwerk mächtiger Eichen das Gasthaus Holsteiner Tor. Auf einem flachen Betonsockel im weiten Eingangsbereich des reetgedeckten Fachwerkgebäudes prunkte der Nachbau einer Postkutsche, erinnernd an die Zeit, als derlei Reisemittel zu den bequemsten zählten; und eine an das Haus geschraubte Holztafel wies denn auch darauf hin, dass hier bis über die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hinaus eine Posthalterei betrieben wurde, mit Herberge, Schankwirtschaft und Stallungen, in denen sich die ausgeschirrten Gespannpferde erholen konnten. Schon damals gab es zwischen der Station und der Straße die breit angelegte Fläche, je nach Witterung staubig oder morastig, nun seit Langem asphaltiert und zur Stunde mit parkenden Autos fast ausgelastet.
Die gegenüberliegende Straßenseite säumten himmelwärts strebende Pappeln, jetzt am Mittag nur kurze Schatten werfend. Es war Anfang Juni und ungewohnt warm, warm wie an einem wolkenlosen Hochsommertag.
Ein halbes Dutzend schwitzender Arbeiter war dabei, die Fahrbahndecke zu erneuern. Eintönig brummend und schneckenhaft langsam rückte ein Kipplaster vor, dessen sich hinter dem Führerhaus langsam hebende Ladefläche ein angedocktes, dumpf tuckerndes und zischendes Monstrum mit Asphalt versorgte, das ihn augenblicklich stark erhitzte und dann gleichmäßig auf den am Tage zuvor grob aufgehobelten Straßengrund verteilte und glättete. Die Erneuerung der Straße erledigte sich fast wie von selbst, und außer den drei Männern an den Maschinen hatten sich die restlichen mit Schaufel und Besen nur noch um die nicht gerade schweren, bei dieser Hitze dennoch schweißtreibenden „Feinarbeiten“ zu kümmern.
Teergeruch wehte gegen das denkmalgeschützte Haus, was die geschlossenen Fenster an der Frontseite erklärte.
Zwei Männer, die in dem Gasthaus zu Mittag gegessen hatten, hielten sich nun an der Kutsche auf und überschauten, die Augen mit der Hand beschattend, den Bereich zur Straße hin. Es schien, als müssten sie sich orientieren.
Fritz Schwindt, Direktor einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Hamburgs Innenstadt, Mitte fünfzig und von untersetztem Wuchs, mit hellblauen Augen in einem fleischigen Gesicht, den Kopf bedeckt mit gelbblonden, schon etwas schütteren Haaren, lockerte den Knoten seiner taubenblauen Krawatte, zog seine Jacke aus und warf sie sich über die Schulter. Dann wandte er sich seinem Begleiter Thomas Felder zu und wiederholte seine vor rund einer Stunde getroffene Aussage, stets in diesem Hause einzukehren, wenn ihn sein Weg in diese Gegend führe.
„Das Menü war reichlich bemessen und sehr schmackhaft“, entgegnete der Angesprochene und setzte hinzu, als müsse er es versprechen: „Ja, dieses Gasthaus werde ich mir merken.“
Thomas Felder, zwanzig Jahre jünger als Schwindt, war ein hochgewachsener, schwarzhaariger Mann, mit kantigem Gesicht und dunkelbraunen Augen. Im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten Schwindt, im leichten, musterlos hellgrauen Anzug, trug er einen marineblauen, korrekt geknöpften Zweireiher.
„Dann wollen wir mal ...“, sagte Schwindt, nachdem er seinen Porsche gefunden hatte. Schwindts Direktoren-Kollegen in Deutschland standen auf schwarz lackierte Mercedeswagen oder BMW; Schwindt war die auffallende Ausnahme: ein Porsche – und dann auch noch weiß!
Felder antwortete forsch mit „Jawohl!“ und „Es ist an der Zeit!“
„Ich bewundere immer wieder Ihren Eifer“, bemerkte Schwindt ironisch. Der von ihm gelegentlich benutzte ironische Tonfall kränkte Felder keineswegs, andrerseits störte dessen dünkelhafte Ausdrucksweise auch keinen.
Die beiden ungleichen Männer hatten den Porsche erreicht. Schwindt entriegelte mit seiner Fernbedienung die Türen, und während er seine Tür aufsperrte, nahm er gleichzeitig die Ausfahrt und die Straße in Augenschein. So beobachtend verharrte er einige Sekunden, setzte dann plötzlich seine Sonnenbrille ab und kniff die Augenlider bis auf einen winzigen Spalt zusammen, setzte die Brille wieder auf, sah kurz zu Felder und dann erneut zur Straße hinüber und machte auch jetzt noch keine Anstalten, einzusteigen. Der hochgewachsene Felder, der sich eben niederbückend auf den Beifahrersitz schwingen wollte, richtete sich wieder auf und schaute nun ebenfalls zur Straße hinüber, entdeckte aber nichts Ungewöhnliches. Doch dann glaubte er, sich Schwindts Verhalten erklären zu können:
„Es ist schon vorteilhaft, zunächst die heiße Luft aus dem Wagen entweichen zu lassen, bevor wir abfahren.“
Dies schien nicht Schwindts Problem zu sein, der dennoch kopfnickend zustimmte und mit leiser Stimme sagte, wie zu sich selbst und anscheinend überrascht: „Der schmächtige Mann dort ... genau gegenüber ... zwischen den Pappeln ... der mit entblößtem Oberkörper ...“
„Ja, ich sehe ihn“, sagte Felder, verwundert, dass ein Straßenarbeiter die Aufmerksamkeit seines Vorgesetzten auf sich zog.
„Wenn ich ihn ebenfalls betrachte“, sprach er nun, sich seines Direktors vermutlich überflüssigen Wahrnehmung anschließen zu müssen, „vermittelt er den Eindruck, nicht gerade geschaffen zu sein für Arbeiten dieser Art.“
„Das ist er auch nicht. Es sind Erinnerungen, die er plötzlich in mir aufkommen lässt.“
„Erinnerungen? Dieser Mann dort auf der Straße weckt in Ihnen Erinnerungen? Nun, dann kennen sie ihn und hatten ihn sicherlich eine Zeit lang aus den Augen verloren, nicht wahr?“
„Ja, so ist es.“
Schwindt warf seine Jacke auf die Rückbank des Wagens und forderte Felder zum Einsteigen auf. „Auf den Mann kann ich auch unterwegs noch zurückkommen“, fügte er an.
Mit sanft blubberndem Geräusch erreichte der Porsche das Ende der Baustelle. Schwindt ließ ihn aufheulen und kam dann gleich auf den Straßenarbeiter zu sprechen.
„Der Mann war Ihr Vorgänger“, sagte er ohne Umschweife. „Wie Sie sahen, hat er sich beruflich kaum verbessert.“
Felder schien das eben Gehörte nicht glauben zu wollen.
„Dieser Mann arbeitet jetzt als Handlanger beim Straßenbau? An sich ist das unbegreiflich. Jedenfalls ist das eine äußerst ungewöhnliche Karriere.“
„Ungewöhnlich? Ja, gewiss, Herr Kollege, dennoch sind derlei rückläufige Karrieren nicht selten. Kenntnis davon erhalten zumeist nur jene, in deren Umfeld sie ablaufen.“
„Vielleicht war etwas vorgefallen, was seinem Abstieg vorausging“, mutmaßte Felder. „Hatte er rechtliche Konsequenzen zu ziehen? Denn es ist kaum vorstellbar, dass jemand eine gehobene Position aufgibt, um als Hilfsarbeiter auf der Straße seine Kräfte zu beweisen.“
„Rechtliche Konsequenzen“, wiederholte Schwindt,„ja, das kann man durchaus sagen“, und nach kurz eingefügtem Schweigen: „Der Mann heißt Martin Lusson, ist, wenn ich mich recht entsinne, vier oder fünf Jahre älter als Sie. Er war von der Konkurrenz zu uns gekommen. Und davor? Bevor er sich entschloss, mit seiner Person die Versicherungsbranche zu bereichern, war er einige Jahre als Offizier bei der Bundeswehr. Zu uns kam er sozusagen als fertige Führungskraft, und seine guten Beurteilungen bewahrheiteten sich.“ Schwindt unterbrach sich kopfschüttelnd und sprach dann weiter: „Seine Geschichte – ich will sie nicht unnötig ausbreiten: Die Mitarbeiter seiner Organisation, jetzt also Ihre, sowie die Kunden schätzten ihn gleichermaßen. Aber dann kam es zur Wandlung. In seinem letzten Tätigkeitsjahr bei uns benahm er sich seinen Leuten gegenüber, ja, wie soll ich sagen, zunehmend kumpelhaft; Termine laut Dispositionsplänen ging er öfter entweder verspätet an oder sagte sie aus fadenscheinigen Gründen ganz ab. Bei internen Besprechungen, aber auch bei Tagungen der Außendienstleiter – Sie kennen das nun schon – benahm er sich oft äußerst auffallend, aber das nicht zu seinen Gunsten. Auf die Gründe seiner dubiosen Verhaltensweisen bin ich ziemlich spät gekommen, nämlich dann, als die Umsätze seiner Organisation immer drastischer zurückgingen.“
Schwindt schwieg einen Augenblick, warf Felder einen kurzen Blick zu und sprach dann weiter:
„Kumpelhaftigkeit, Pflichtvernachlässigung und Labilität ... Wissen Sie, er trank reichlich Alkohol, obwohl er den gar nicht vertrug. Das allein war der Grund seines Verhaltens, zurückzuführen auf private Schwierigkeiten. Vermutlich verschuldete Lusson sich auch, der Alkohol macht‘s sehr schnell möglich. Vor einigen Wochen kam mir zu Ohren, dass er von seiner Familie getrennt lebt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, denn welche Ehefrau nimmt es auf Dauer hin, ihren Mann ständig, zumindest oft alkoholisiert ertragen zu müssen. Doch was ihn auch immer zum Trinken veranlasst haben mochte, Gründe, sich Verpflichtungen zu entziehen und sich stattdessen dem Alkohol zu verschreiben, gibt es nicht. Und Frau Lusson? Sie ist eine intelligente, engagierte Frau, die auch in der Politik eine Rolle spielt oder spielte. Welch sozialer Stand auch immer: Fällt ein Elternteil tief, wird eine Ehe geschieden, sind vorhandene Kinder oftmals die Beklagenswertesten. Lussons haben drei; doch sie sind, wie ich zu wissen meine, schon oder so gut wie erwachsen. Die Lussons heirateten früh, in Hinblick auf das Alter ihrer Kinder unschwer auszurechnen.“
Fritz Schwindt hatte die Absicht geäußert, keine ausführliche Berichterstattung über Felders Vorgänger abzuliefern. Daran hielt er sich.
„Ich war nicht neugierig auf Einzelheiten“, sagte er, „weiß aber, dass sich Lusson betrunken jähzornig benahm – zumindest seiner Frau gegenüber.“
„Wie roh und verwerflich!“, rief Felder empört, als nehme er Anteil an Frau Lussons Schicksal, und er glaubte seiner Überzeugung besonders Ausdruck verleihen zu müssen, dass solch ein problematischer Mann als Vorgesetzter selbstverständlich ungeeignet sei.
„Da bin ich durchaus Ihrer Meinung, Herr Felder“; und Schwindt warf ihm einen kurzen Blick zu, lächelte und sagte überraschend: „Haben Sie Probleme?“ ‒ Der überraschte Felder versicherte, von Schwierigkeiten nicht bedrängt zu werden. „Mich erstaunt“, nahm er das Thema Lusson schnell wieder auf, „von seinem Schicksal noch nichts gehört zu haben. Ich hatte meinen Vorgänger auch nie im Sinn, habe mir demnach auch keine Gedanken über ihn gemacht, denn fast jedermann hatirgendwie einen Vorgänger“; und Schwindt entgegnete, Lussons damalige allgemeine Beliebtheit veranlasse niemand in der Organisation, sich negativ über ihn auszulassen. „Der Höhepunkt war, dass er zwei fingierte Versicherungsanträge einreichte und policieren ließ. Natürlich muss er sich im Klaren gewesen sein, eine nicht unerhebliche strafbare Handlung begangen zu haben. Er wollte mit seinem Handeln seinen unaufhaltbaren Niedergang zu Ende bringen, was ihm ja auch gelang. Sie wissen selbst, dass es immer wieder Charaktere gibt, die bewusst ihren Untergang herbeiführen, wenn sie Ausweglosigkeit erkennen. Der Extremfall ist der Selbstmord. Doch den traute und traue ich Lusson nicht zu. Die Angelegenheit mit den fingierten Anträgen ist übrigens im Sande verlaufen. Unsere Gesellschaft schädigte er nicht direkt, also sahen wir von einer gerichtlichen Klage ab. Er schied aus, und damit genug. Vielleicht geht es mit ihm irgendwann auch wieder aufwärts. Wenn er heute beim Straßenbau arbeitet, dann zeigt das mir, dass er Händearbeit nicht scheut, im Gegensatz zu den vielen Arbeitsunwilligen unter den Dauerkunden der Arbeits- oder Hartz-vier-Agenturen. Der Kunde ist König! Er muss ja nicht arbeiten, der König. Niemand zwingt ihn, und versorgt wird ein König immer.“
Während der Fahrt durch Hamburgs Innenstadt versank das Thema Martin Lusson in die Tiefe der Vergessenheit, und den beiden Männern blieb es vorrangig, sich nochmals über den Auftrag auszutauschen, der sie ins Schleswig-Holsteinische geführt hatte.
1. Kapitel
Das Straßenbauunternehmen, das zwischen Wedel und Elmshorn die Fahrbahndecke erneuerte, hatte für ihre dort eingesetzten Arbeiter Überstunden angeordnet, was aber nicht gleichzusetzen war mit einer dauerhaften Beschäftigung und somit sicherem Arbeitsplatz. Je nach Auftragslage und Terminbewältigung mussten oft Überstunden geleistet werden, dagegen verlangten schlechtere Auftragszeiten Personalabbau. Wurde eingestellt oder entlassen, handelte es sich fast immer um Handlanger, um Hilfsarbeiter, Männer, denen keinerlei fachliche Kompetenzen abzuverlangen waren. Martin Lusson, ehemaliger Außendienstleiter in der Versicherungsbranche, verantwortlich für vierundzwanzig Bezirksleiter in und um Hamburg herum, war solch ein Helfer geworden.
Die Asphaltiermaschine war verstummt, ein kleines Walzenfahrzeug stand still am Straßenrand, und der Kipplastwagen, der den Asphalt herangeschafft und das Monstrum gefüttert hatte, war auf dem Weg zu dem Platz, wo er am anderen Morgen wieder beladen werden sollte. Dort, wo der neue, schwarze Straßenbelag auf der halbseitig gesperrten Fahrbahn noch sehr warm war, kräuselten letzte weiße Wölkchen empor und verwehten flach, hatte sie der Luftzug eines vorbeifahrenden Autos erfasst. Die an der Westseite der Straße stehenden Pappeln warfen lange Schatten über die Fahrbahn, und vom Dorfe Elbenholz her verkündete die Kirchturmglocke die neunzehnte Stunde. Das Blöken einer Kuh drang durch den klaren Abend, andere Kühe antworteten, dann war wieder Ruhe.
Martin Lusson lehnte an der Asphaltiermaschine und blickte versonnen über die Schatten des Frühsommerabends, zwischen die Pappeln hindurch über Apfelbaumwipfel und einem Scheunendach hinweg zum sichtbaren Teil des Kirchturms hinüber, wo unterhalb des Glockenverschlages die Zeiger und Zahlen der Turmuhr golden im Licht der Abendsonne blitzten. Dachte Lusson an Wilhelm Buschs verhinderten Dichter Balduin Bählamm, der sich für ein paar Tage von seiner kinderreichen, lebhaften Familie und seinem Amt in der Stadt beurlauben lassen hatte, um sich in der ländlichen Stille – ... sieh von Ferne des Dörfleins anspruchsloses Bild, in schlichten Sommerstaub gehüllt ... – seinen poetischen Ambitionen hinzugeben, nicht ahnend, dass auf ihn auch in der Abgeschiedenheit und Idylle das Ungemach lauert?
Lusson, von unauffälliger Größe, schmal und feingliedrig, befand sich in seinem einundvierzigsten Lebensjahr. Von seinem früheren ansprechenden Äußeren war nichts mehr geblieben. Wirr und strähnig klebten ihm dunkelbraune Haare auf Ohren und Stirn. Das blasse, verschwitzte Gesicht, die eingefallenen Wangen, die spitze Nase, die braunen, jetzt müden Augen und der schmale, leicht geöffnete Mund, der nackte Oberkörper bedeckt mit vom Schweiß gebundenen Staub, was schmierige Spuren hinterließ, der leicht gekrümmte Rücken und die wie kraftlos herabhängenden Arme, die Hände noch versteckt in fast unterarmlangen Gummihandschuhen, all das prägte das Bild eines körperlich überforderten und anscheinend sogar kranken Mannes. Die Arbeitskollegen indes boten kein angenehmeres Bild, nur waren sie von gröberer Statur, muskulös und sehnig. Ihre breiten, derben Hände und knochigen Finger ließen erkennen, dass sie von jeher hartes Zupacken gewöhnt waren. Ihr Gang war schwerfällig, und ihre vom Körper leicht abgewinkelten Arme bewegten sie während des Gehens kaum.
Was Lussons augenblickliches Bild betraf, so trog der Schein. Lusson war belastbar und zäh. Gewiss, diese Art von Beschäftigung war ihm nach wie vor ungewohnt und zuwider, konnte ihm aber körperlich, auch wenn er inzwischen ein paar Kilo Gewicht eingebüßt hatte, was eher zurückzuführen war auf seine bedenkliche Lebensweise, nicht viel anhaben.
Der Vorarbeiter kam auf ihn zu, entledigte sich seiner Arbeitshandschuhe und schlug sie gegeneinander, was ein klatschendes Geräusch verursachte. „Heh, alter Junge!“, rief er mit sonderbar hoher Stimme, als er herangekommen war, „morgen wird das Wetter ebenso schön sein wie heute.
Ich erkenne das am Himmel und am abflauenden Wind – und ich rieche es auch.“ Er zündete sich eine Zigarette an, und ohne sie von den Lippen zu nehmen, erklärte er weiter: „Die trockenen Tage müssen wir nutzen, was am Ende ja auch mehr Schotter einbringt. Im Winter, ja im Winter, da kannst du dann auch schon tagsüber auf der Gattin liegen.“
Er zog die Zigarette von den Lippen, ließ ein hell meckerndes Lachen ertönen, bis ein Hustenanfall es beendete und sein Gesicht rot anlaufen ließ. Vermutlich war ihm Speichel in die Luftröhre geraten. „Du verstehst: Schlechtwetterpause“, keuchte er, „natürlich mit etwas Schwarzarbeit! Wir haben doch einen tollen Job, was? Du glaubst gar nicht, wie viele Gartenwege, Höfe und Neubaueinfahrten ich schon gepflastert habe. Von Schwarzarbeit darfst du natürlich nicht sprechen. Nachbarschafts-, Freundschafts- oder Verwandtenhilfe, so ist das zu nennen.“ Er verzog sein Gesicht mit einem abschließenden breiten Grinsen und steckte seine Zigarette wieder zwischen die Lippen. Lusson schwieg. Er warf dem Mann nur einen flüchtigen Blick zu, der Zustimmung wie auch Gleichgültigkeit besagen konnte. Der vom Rentenalter nicht mehr weit entfernte stoppelhaarige Vorarbeiter, in seiner Körpergröße Lusson etwas unterlegen, jedoch breit gebaut mit hoher Brust, übergehend auf einen vorgewölbten Bauch, öffnete einen an die Asphaltiermaschine genieteten Blechkasten und entnahm ihm eine Plastikflasche, mit deren Inhalt er sich schwarze Flecken von den Armen rieb. Sein grün-rot kariertes Hemd, Ärmel hoch aufgekrempelt, seit vier Tagen auf dem Leib, schien immer noch nicht durchgeschwitzt zu sein.
Der Mann reichte Lusson die Flasche. Dann inspizierte er flüchtig Teile der Asphaltiermaschine, indes Lusson die Flasche vorerst abstellte und letzte Aufräumarbeiten erledigte. Währenddessen dachte er erneut an den Porsche vom Mittag. Den Mann hinter dem Lenkrad hatte er natürlich sofort erkannt, und beide, Fritz Schwindt wie auch er, hatten sich absichtlich übersehen. Bei einer direkten Begegnung an einem anderen Ort hätte Schwindt nicht gezögert, seinen ehemaligen Mitarbeiter anzusprechen. ‒ Schwindts Auftauchen sorgte dafür, wieder einmal Vergangenes in
Lusson aufzuwühlen, nur ein Teil von Vergangenem, eine von etlichen unauslöschlichen Erinnerungen. Ihn bedrückten von ihm selbst gerufene Geister, die ihn verfolgten, ihn mit Unsäglichkeiten und Ängsten quälten. Jetzt war es das Erinnern an eine seiner Hauptrollen in einem Drama, das heute zum zweiten Mal traumartig sekundenschnell vor seinem geistigen Auge ablief. Er sah sich im Gerichtssaal, nicht lange nach seiner Entlassung bei der Versicherungsgesellschaft. Die Sache mit seinen fingierten Versicherungsanträgen ist, wie in der Einführung erwähnt, nicht geahndet worden; das Thema war ein anderer von ihm ausgeführter Betrugsfall, mit dem er sich bei der Hamburger Kripo selbst angezeigt hatte, als er sich bereits in einer ausweglosen Lage glaubte:
Kopf und Blick gesenkt, steht er wie teilnahmslos vor dem Richter und sieht durch dessen wahrheitssuchende Augen hindurch, so als gehe ihn dieser Prozess nichts an. In Wirklichkeit jedoch bremst ein innerer Sturm seine Gedankentätigkeit und lähmt seine Versuche nach Formulie-rungen, wenn er auf Fragen antworten soll. Es ist ihm, als stehe er nicht selbst hier, sondern jemand Fremdes, ein zufällig aufgegriffener Mensch, der hier steht, weil hier jemand stehen und verurteilt werden muss. Er fühlt sich wie ein Mensch, der sich im Schlaf von einem Albtraum befreien will, weil ihm auf dem Höhepunkt vermeintlich unabwendbarer Bedrohung in einer völlig anderen Welt plötzlich sein Bewusstsein aktiv wird und ihm befiehlt, sich aus dieser zweiten Welt zu lösen. Es war so, antwortet er schließlich nach einigem Hin und Her, mit der Fälschung der Unterschrift seiner ahnungslosen Frau einen seit Langem laufenden Kredit abzulösen und gleichzeitig sich mit einem neuen Kredit ein paar Wochen über Wasser halten zu wollen, also um Zeit zu gewinnen.
„Zeit gewinnen? Wofür denn Zeit gewinnen?“, hört er, den Blick gesenkt, den Richter fragen. Hierauf entgegnet er, mit dem baldigen Verlust seines Arbeitsplatzes gerechnet zu haben.
„Aber dann hätten Sie sich doch sagen müssen“, wirft ihm der Richter vor, „mit dem Arbeitslosengeld erst recht Rückzahlungsschwierigkeiten zu bekommen; das alles reimt sich doch gar nicht.“
Es folgen nur noch wenige Richterfragen, und mit Lussons Antworten vermögen Richter und Beisitzer nichts anzufangen. Insgeheim zweifeln sie an des Angeklagten Verstand und Vernunftfähigkeit. Natürlich können sie ihn nicht eine mildernde, augenblickliche Verständnislosigkeit attestieren. Für sie ist er jemand, der sich schuldig gemacht hat und mit oder ohne Selbstanzeige verurteilt werden muss. Am Ende erfährt das Gericht nur noch die Schuldenhöhe des Selbstanklägers, sie beträgt zwölftausend Euro. Das Urteil des Gerichts: zweitausend Euro Strafe. Dann entlässt der Richter Lusson mit dem tröstenden Hinweis: „Einen Rechtsanwalt müssen Sie ja nicht bezahlen. Und die Gerichtskosten sind auch nicht sehr hoch.“
Als geraume Zeit später Lussons Ehefrau Anna alle Kosten aus der Strafsache bezahlt hat, bewegt ihn seine Situation besonders schmerzhaft.
Martin Lusson wurde von seinen Arbeitskollegen Oberleutnant gerufen. Sie wussten um seine Bundeswehrzeit. Aber dass er als Offizier seinen Dienst quittiert hatte, was nun schon eine ziemliche Zeit zurücklag, bezweifelten sie anfangs, heute gehörte Lussons Spitzname zu ihrem Arbeitsalltag. Der Vorarbeiter hingegen, der seine Wehrpflicht in grauer Vorzeit absolviert hatte, kam die Bundeswehr wieder öfter in den Sinn. Ein ehemaliger Offizier heute ein Aufräumer, Eimerschlepper und Straßenfeger? Das war denn doch zu merkwürdig, irgendwie passte das nicht zusammen.
Lusson würdigte im Nachhinein seine damalige Offenbarung als ausgesprochen dumm; denn warum hatte er auf Fragen ehrliche Antworten gegeben? Er hätte sich schnell etwas ausdenken können, sich klein machen sollen. Ständig wird gelogen, überwiegend Lügen, die nichts nach sich ziehen. Nein, es war das Bier, sein Einstandsbier im Kollegenkreis, dessen alkoholische Wirkung ihn veranlasste, sich mit dem „Oberleutnant“ abheben zu können von Handlangern, von Hilfsarbeitern der vermeintlich unteren Schichten. Immerhin machte ihm sein Spitzname jetzt nichts mehr aus, und über dessen Ursprung sann auch niemand mehr nach, bis eben auf den Vorarbeiter. Dass sich Lusson nach seinem Offiziersdasein dann als angehende und dann aktive Führungskraft der Versicherungswirtschaft verschrieben hatte und dort auch bis vor gar nicht langer Zeit tätig gewesen war, hatte niemanden berührt, weil sich niemand Lussons Position hätte vorstellen können. Der Vorarbeiter war der Einzige, der sich auch darüber Gedanken gemacht hatte und sie gelegentlich wieder aufkommen ließ, sie aber für sich behielt. Und wenn schon die Vergangenheit eines Arbeiters seinem Vorgesetzten, dem Bauleiter, gleichgültig sei, dann gehe ihn das erst recht nichts an. Das Unternehmen benötigte bei Bedarf Männer, die, ohne ihr Gehirn anstrengen zu müssen, zupacken konnten, die, mit oder ohne Schulbildung, mit oder ohne weiße Weste, nur zu begreifen hatten, was von ihnen abverlangt wurde.
Lusson zog sich nun ebenfalls die Handschuhe aus. Zu seinen schmutzig braunen Armen standen seine weißen Hände in einem sonderbaren Kontrast, was den wieder herangetretenen Vorarbeiter zu der Bemerkung veranlasste: „Deine Hände brauchst du nicht zu waschen, hell und sauber wie bei einem Schreibtischhocker.“
Lusson nahm die Flasche auf und schlurfte zu dem Sanitärwagen, der mitsamt einem transportablen Toilettenhäuschen nur wenige Schritte vom Asphaltiermonstrum entfernt vor dem Straßengrabenrand aufgestellt worden war. Männer, die ihre Reinigung erledigt hatten, verabschiedeten sich durch Zurufe und machten sich davon.
Der Vorarbeiter hing sich eben sein Handtuch über die Schulter, als gegenüber zwischen zwei Pappeln eine VW-Limousine stoppte. Gelbbrauner Staub wirbelte auf und stob davon. Dem Wagen entstieg der Bauleiter und wartete, wie jeden Abend, auf seinen Vorarbeiter. Der schaute nach links und rechts und überquerte dann die Straße.
Lusson verstand nicht, über welche Dinge sich die beiden Männer unterhielten. Gewiss besprachen sie das heutige Arbeitsergebnis und das morgige Vorgehen. Lusson interessierte das nicht im Geringsten. Dem Bauleiter stand er nur einmal gegenüber, als er sich um diese Arbeitsstelle beworben hatte. Er war einer Empfehlung der Agentur für Arbeit nachgekommen, der er versichert hatte, jede Verdienstmöglichkeit wahrnehmen zu wollen. Außer Lusson sollten sich noch rund anderthalb Dutzend Arbeitslose bei dem Tiefbauunternehmen vorstellen, doch nur sechs waren der Aufforderung nachgekommen. Nach ihrer Vorstellung musste dann vier von ihnen nachträglich das Grauen überkommen sein. So blieb neben Lusson nur noch einer übrig, ein junger Tiefbauarbeiter aus einem Dorf bei Schwerin. Es war wie so oft unverkennbar: Für ein geruhsames Leben mit Bier und Zigaretten reicht für manchen Beschäftigungslosen die staatliche Stütze aus. Lusson wurde vor der Einstellungszusage nach keinerlei Unterlagen gefragt, die bei einer Bewerbung für eine anspruchsvollere Tätigkeit unabdingbar sind: Zeugnisse, Beurteilungen, Referenzen, zusätzlich Auskünfte aller Art, wozu auch ein polizeiliches Führungszeugnis gehört.
Natürlich ist Lusson schon vor Arbeitsbeginn alles andere als wohl zumute gewesen. Er hatte Peinlichkeit vor sich selbst empfunden, sich zutiefst seiner Lage und der Tätigkeit, die er bereits am nächsten Tag aufgenommen hatte, geschämt. In seinem Leben hatte er drei Bewerbungen, Bewerbungsgespräche und Einstellungen hinter sich gebracht – begonnen mit der Bundeswehr –, und alle drei waren in einer gewissen positiven Spannung verlaufen, die Gespräche auf höherem Niveau geführt worden, und die Dienstantritte hatte er ausnahmslos als ein besonderes, erwartungsfrohes Ereignis gewertet, Anna ebenso. Martin Lusson war jemand, er war eine Persönlichkeit für gehobene Aufgaben. Vor dem Bauleiter und hier auf der Straße war er ein Geringer unter Geringen, einer, der eine Zeit lang gebraucht wurde, aber unternehmerisch, konstruktiv, kreativ und innovativ nichts zu bewegen hatte. Arbeitsmäßig war er jemand geworden, der während seiner Tätigkeiten an alles Mögliche denken konnte, nur nicht an das, was er gerade tat. Nein, auf der untersten Stufe der bürgerlichen Gesellschaft stand er noch nicht. Er hatte sich mit dem Gedanken zu tröten versucht, dass die Wirtschaft Hilfsarbeiter benötige wie Vorstände und Aufsichtsräte. Doch dieser billige Trost fand bei ihm keinen Eingang.
Gebeugt über einem Eimer mit kaltem Wasser entledigte er sich so gut es ging des Schmutzes. Er stand abgewandt von den beiden Männern und rubbelte sich mit seinem Handtuch den Rücken trocken. Er hörte eine Autotür ins Schloss fallen, und gleich darauf das Anspringen eines Motors. Ihm wurde auf die Schulter getippt, und als er sich umdrehte, stand der Vorarbeiter wieder vor ihm, nun alles andere als gut gelaunt. Der Mann betrachtete seine Stiefelspitzen und sagte:
„Tut mir leid, Oberleutnant, du bist entlassen.“
Er war schon oft Übermittler gleichlautender Botschaften gewesen, aber nie war ihm das leicht gefallen. Seine Worte kamen stockend über seine Lippen, als er nun zu erklären versuchte, dass die zukünftige Auftragslage zu personellem Abbau führe. Lusson überfiel ein Gefühl, als werde ihm der Brustkorb eingeschnürt. Er öffnete den Mund, atmete tief durch und faltete sein Handtuch, das er mit nach Hause nehmen wollte. Noch vor wenigen Monaten hatte ihn seine neue, anfangs für ihn unwürdige Tätigkeit regelrecht schockiert. Jetzt war es die Entlassung aus diesem Verhältnis.
„Zu wann ...?", fragte er mit rauer, brüchiger Stimme.
„Zum Monatsletzten. Mir ist das nicht einerlei, kannst es mir glauben. Aber du findest bestimmt eine bessere, leichtere und sauberere Arbeit – bist ja nicht auf den Kopf ...“
„Und warum gerade ich?“, fiel Lusson ihm ins Wort, „warum nicht der Kollege aus Mecklenburg, der mit mir am selben Tag eingestellt worden und wesentlich jünger ist? Und die vielen Ausländer ...? Dieses Unternehmen beschäftigt doch Ausländer. Wir überfluten auch nicht andere Länder, um uns von deren Sozialeinrichtungen versorgen zu lassen. Die würden uns was husten. Nein, das gelobte Land ist Deutschland. Hier rollt der Euro. Und die restlichen Milliarden? Die schaufelt die Bundesregierung nach Griechenland und nach und nach auch in andere Südländer – oder sie führt Kriege in Sand- und Steinwüsten.“
Der Vorarbeiter schüttelte den Kopf. „Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Das alles sind doch keine Vergleiche. Das alles hat doch mit deiner Situation hier nichts zu tun.“
„Ich finde schon! Ausländer kommen in unser Land, um sich hier versorgen zu lassen, in jeder Hinsicht! Was die hier in einem Monat an Kohle kriegen, bekamen sie in ihren Hoch-, Flach- und Wüstenländer das ganze Jahr nicht. Ihre Heimatregierungen lachen sich ins Fäustchen, sind froh, diese Leute los zu sein.“ Heftiger Zorn staute die Luft in Lussons Brust. Er musste an sich halten, um nicht noch ausfallender, sinnlos ausschweifender zu werden. Schließlich presste er hervor: „Ach, lassen wir das!“
„Das ist auch besser so, Oberleutnant. Du redest dich in Rage, regst dich völlig unnötig auf.“
Der Vorarbeiter, an sich für längere Diskussionen nicht zu haben, antwortete dann auf Lussons angefügten Protest, Wessis würden entlassen, damit billigere Ossis oder Ausländer ihren Arbeitsplatz übernehmen könnten: „Das sollte für dich doch kein Thema sein. Du strapazierst nur deine Nerven, wo du für diese Firma spätestens seit heute nicht mehr existierst. Der Buchungsvorgang ist bereits abgeschlossen, ob du nun bis zum Monatsende hier auf der Straße bleibst oder nicht. Ein Entlassener, begreife das, ist für die gestorben! Kannst du dir das nicht selbst sagen? Und dem Unternehmer ist es völlig egal, ob die Leute Wessis, Ossis oder Afrikaner sind. Der Mann aus Mecklenburg ist im Übrigen Tiefbaufacharbeiter.“
Einige kurze, aber friedlich geführte Wortwechsel noch, dann beendete Lusson den widersinnigen Dialog mit den Worten: „Naja, recht hast du. Wie rede ich nur daher ...“
Der Vorarbeiter nickte bedächtig, er verstand die Aufwallung Lussons, er hatte ja hinreichend Erfahrung mit Entlassungssituationen gesammelt. Jede Entlassung war meistens der Beginn einer Tragödie, und für entlassene Hilfskräfte gibt es keine lukrativen Abfindungen. Nein, an eine hohe Abfindung denkt nicht der sogenannte einfache Arbeiter, der seine Arbeitsstelle von heute auf morgen verlassen muss, gleichgültig, wie lange er seinem Betrieb zur Verfügung gestanden hat; nein, an eine hohe Abfindung denkt nicht der Handlanger, der Ungelernte, der Nichtqualifizierte; nein, an eine Abfindung für eine mögliche Übergangszeit denkt nicht der Mann, dem kein geistiges Licht in seiner Wiege angezündet worden ist, das ihn stets die entsprechende Erleuchtung sichert. Bank- und andere Konzerngrößen hingegen können ihre Unternehmen in den Niedergang getrieben haben. Sie nehmen dann ihren Hut, natürlich mit einem Sack voll Euros an Abfindung, und die Sache gehört für sie der Vergangenheit an. Und es stört sie keineswegs, nicht nur von dem Autor Günter Ogger als Nieten in Nadelstreifen genannt zu werden.
Der Vorarbeiter kratzte sich mit den Fingern über seine braun-rötliche, mit feinen blauen Äderchen durchzogene Wange, blickte Lusson mit aufhellenden Augen ins Gesicht und sagte dann mit schnellen Worten, weil ihm spontan eine vermutliche Problemlösung in den Sinn gekommen war:
„Aber sag mal, du warst doch auch mal bei einer Versicherung. Und wenn du dorthin zurückgehst? Mann, da hätte ich doch diesen Dreck hier längst an den Nagel gehängt und mir ein weißes Hemd und eine Krawatte angezogen. Da verstehe dich einer! Und deine Familie? Will deine Frau dich nicht auch lieber im weißen Hemd und Schlips sehen? Du hast doch eine Frau, was?“
„Ich habe eine Frau und auch Kinder; und wenn du dies auch noch wissen willst ...“ Er stockte einen Moment, war sich nicht schlüssig, ob er dem Vorarbeiter tatsächlich die beruflichen Belange seiner Frau unter die Nase reiben sollte. Dann aber ergänzte er: „Meine Frau ist angestellt im Öffentlichen Dienst.“
„Dann ist deine Situation ja gar nicht so dramatisch, da gibt es Arbeitslose, die stehen wesentlich miserabler da.“
„Ja, nämlich dann, wenn sie sich etwas aufgebürdet haben, was sie finanziell dann nicht mehr bewältigen können, jene, die eventuelle Arbeitslosigkeit nicht einkalkuliert hatten. Ansonst ist die Grundversorgung immer gewährleistet. Es gibt zig Tausende, die gar nichts anderes wollen, die mit Hartz-vier und Schwarzarbeit wesentlich besser dastehen als mit gemeldeter, ordentlicher Beschäftigung. Soll ich dir Beispiele nennen?“
„Musst du nicht. Da kenne ich mich auch aus. Dann mach es doch ebenso. Arbeitslosengeld einstreichen und sofort einen guten Nebenjob suchen – ähnlich wie ich oft im Winterhalbjahr. Man kann da viel Geld nebenbei machen. Leider wirkt sich das nicht auf die spätere Rente aus, hast aber auch keine Sozialabgaben. Glücklicherweise haben meine Frau und ich noch unser Häuschen ...“
„Von handwerklichen und anderen Dingen habe ich keine Ahnung“, unterbrach Lusson den Vorarbeiter hektisch laut, als sei er ungehalten darüber, keinen handwerklichen Beruf erlernt zu haben. „Und das Versicherungsgeschäft...? Kundenwerbung von Haus zu Haus, manche sagen Klinkenputzen, liegt mir nicht. Bei meinen damaligen Aufgaben war ich für die Schulung meiner Organisation verantwortlich, für das Theoretische, also für den Wissensstand meiner Vertreter. Klinkenputzer waren sie allerdings nicht, sie betreuten einen festen Bezirk, aus dem ihr Neugeschäft kam und für das sie Provision erhielten.“ Dass er dennoch für die Umsätze seiner Gruppe verantwortlich war und täglich Hilfestellung leisten musste, verschwieg er. „Und natürlich saß ich auch mit beim Kunden“, schwächte er seine kurze Erläuterung ab, „wenn bestimmte fachliche Beratungen gefragt waren“, und lügend ergänzte er, nämlich im Hinblick darauf, dass seines Gesprächspartners nächste Frage lauten werde, warum er denn solch eine Position verlassen habe: „Die gesamte Organisation wurden neu gegliedert. Ich sollte nach Süddeutschland versetzt werden, aber ich lehnte ab. Das war‘s. Und warum sollte ich nicht mal vorübergehend zum Straßenbau gehen? Es ärgert mich nur, weil mir die Kündigung zu früh kommt, in der Zukunft hab‘ ich nämlich etwas ganz Bestimmtes vor“, log er weiter, „nur, die Zeit ist noch nicht reif. Und was ich machen will“, kam er dem Vorarbeiter vermutlich wiederum zuvor, „darüber will ich noch nicht sprechen, da ich mir selbst noch nicht ganz im Klaren bin. Ich sehe also noch nicht klar – verstehst du ...?“
Der Vorarbeiter verstand das nicht, sagte aber: „Natürlich verstehe ich das.“ Er wollte nicht weiter in Lusson eindringen, er spürte, dass es dem Mann unangenehm war, von seiner Vergangenheit, seinen Verhältnissen zu sprechen. Er spürte aber auch, dass bei Lusson einige Dinge höchstwahrscheinlich im Argen liegen mussten. Schließlich gab es nicht nur die Versicherungsgesellschaft, von der sich Lusson getrennt hatte. Wenn er dort mit dem einen oder anderen nicht einverstanden war, wäre es für ihn gewiss ein Leichtes gewesen, eine entsprechende Position bei einer anderen Gesellschaft zu bekleiden. Also beendete der Vorarbeiter das Thema mit dem Angebot: „Wollen wir noch auf ein Bier ins Dorf? Ich gebe einen aus.“
„Ich bin verabredet“, log Lusson erneut und tippte auf das Glas seiner Armbanduhr, die er eben aus seiner Hosentasche gefingert und angelegt hatte. Außerdem wusste er sehr genau, dass es bei einem Bier nicht bliebe, und drei und mehr Gläser würden ihn nicht vom Autofahren abhalten.
Auf der Heimfahrt in seinem alten Opel waren seine Gedanken zwiespältig. Einerseits benötigte er weiterhin verdientes Geld, andrerseits war er froh, diese Tätigkeit Vergangenheit werden zu lassen.
2. Kapitel
Martin und Anna Lussons Ehe gestaltete sich, wie es allgemein üblich ist: Die auf Jahre hinaus ungebrochene Liebe zweier Menschen zueinander wiegt die Sorgen des Alltags oft auf. Dem jungen, aber bereits verheirateten Offiziersanwärter Lusson und seiner absehbar größer werdenden Familie war von der Sozialeinrichtung der Bundeswehr eine Dienstwohnung zugewiesen worden. Das war etwa achtzehn Monate nach Lussons Rekrutierung. Zu diesem Zeitpunkt war Alexander schon über ein Jahr auf der Welt und Corinna unterwegs; an Matthias, geboren zwei Jahre nach Corinna, dachte noch niemand. Nach etlichen Jahren wechselte die Familie dann wieder in eine Privatwohnung. Lusson hatte seinen Dienst im Range eines Oberleutnants quittiert, glaubte, in der Versicherungsbranche böten sich ihm lukrativere Möglichkeiten. Eine Fehleinschätzung. Um sich beruflich zu profilieren – erst recht in der freien Wirtschaft –, mit hervorragendem Fachwissen und dem Ehrgeiz, weiterzukommen, Mitbewerbern bald überlegen zu sein und sich somit bei Vorgesetzten für höhere Aufgaben zu empfehlen, war etwas mehr erforderlich als gutes Aussehen und geistige Beweglichkeit. Werden alle angesprochenen Merkmale auch von einem ausgleichenden, harmonisch ausgerichteten Privatleben unterstützt, dann sind Aufstiegsmöglichkeiten immer gegeben. Erweist sich die private Seite allerdings als quälend, stellt sich ein zuvor eingeredeter eiserner Wille als brüchig heraus, dann sind das auf dem Weg nach oben nicht zu umgehende Hindernisse. Ein mental schwacher Mensch verliert dann sein einmal ins Auge gefasstes Ziel, weicht vom Wege ab, verfällt leicht in Labilität und lässt sich seine Tage von ihr diktieren. Martin Lusson geriet in diese Situation nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr. So erwog er seine Rückkehr, was durchaus möglich gewesen wäre. Sein Einkommen war auch als Führungskraft in der Versicherungswirtschaft erfolgsabhängig, und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Doch er hatte keine Änderung anstreben können, weil er sich für keine anderen, gut dotierten Aufgaben bewerben konnte. Er war sozusagen für nichts qualifiziert. Seinen Durchbruch zur anerkannten und erfolgreichen Führungskraft schaffte er erst im zweiten Anlauf, als er sich bei einem in Europa und der Welt mächtigen Versicherungskonzern als Führungskraft im Außendienst bewarb – in einer Hamburger Filialdirektion.
Als Lusson und Anna in dem Ort in der Nordheide heirateten, waren sie gerade mal zwanzig Jahre alt gewesen. Auch wenn sie sich seit Kindertagen kannten und sich sehr liebten, war eine Heirat in solch jungen Jahren natürlich nicht geplant. „Die haben heiraten müssen“, hieß es damals in ländlicher Gegend oft noch schadenfroh, wenn sich ein blutjunges Paar ungewollt in die Elternschaft geliebt hatte und heiratete. Die farblose Hochzeit, nur mit Eltern und Geschwistern, hatte gewissermaßen in aller Stille stattgefunden. Das war nicht lange nach Lussons abgelegter Reifeprüfung in der nahe gelegenen Kreisstadt und wenige Monate vor seinem Dienstantritt bei der Bundeswehr in Hamburg. Während Anna ihre Aufgaben als Mutter und Hausfrau unter schwierigen Verhältnissen in zwei winzigen ihr von nahen Verwandten überlassenen Zimmern mit gestandener Verantwortung und großer Anstrengung bewältigte, sah Martin Lusson seine Ehe und die daraus entstandenen neuen Aufgaben eher von der unbekümmerten Seite. Von Annas Alltag bekam er nichts mit, er war nur an den Wochenenden zu Hause, und auch das nicht immer. Dienstlich kam er weiter, wuchs aber nicht in seiner Rolle als Ehemann und Familienvater. Seine Ehe empfand er als Vergnügen. Er liebte seine Frau über alle Maßen, und nie wäre ihm in den Sinn gekommen, jemand könnte sich an seinem Eigentum vergreifen. Ja, er sah seine Frau als sein Eigentum an, wenngleich auch nur im Unterbewusstsein. Vertrauliche, intime Gespräche scheuten beide. Sowohl Anna als auch ihm war schon der Gedanke daran peinlich. Derlei Gespräche, geschweige Verbundenheit demonstrierende, spontane Umarmungen kannten sie auch von ihren Eltern nicht. In den Kreisen war jeder darauf bedacht, im Beisein von Zeugen keine Liebenswürdigkeiten, gesprochene, spür- oder fühlbare auszutauschen.
Die Entwicklung seiner Kinder sah Lusson mehr von Ferne. Die Last der Erziehung trug Anna. Das hieß jedoch nicht, dass für Lusson die Kinder ein Klotz am Bein waren, sie waren für ihn Wesen, über die er seit Alexanders Geburt oft intensive Überlegungen in puncto Menschwerdung anstellte. Nein, er hatte sich über seine Kinder gefreut. Für ihn waren sie das Ergebnis einer ehrlichen, sauberen, dauerhaften Liebe, und die wiederholt hämischen Bemerkungen einiger seiner Kameraden hinsichtlich seiner verlorenen Freiheit in jungen Jahren versuchte er zu ignorieren.
So vergingen die Jahre, glückliche wie auch weniger glückliche, wie meistens üblich, sie kamen und gingen wie Sommer und Winter.
Nach über neunzehnzehn Jahren drohte der Lusson-Ehe dann das plötzliche Aus.
Was war der Grund? Was hatte ihn, den Mann, den Oberleutnant der Reserve, den Außendienstleiter, die Führungskraft, den Vorgesetzten, plötzlich von seinem sicheren Weg gedrängt? Warum hatte er sein gutbürgerliches Niveau verlassen? Es war eine Begebenheit, die schon länger zurücklag, ein grundlegendes Ereignis, das in Lusson eine bis dahin schlummernde, dann explosionsartige Eifersucht geweckt hatte. Die Folge: Nach bislang schon reichlichem Alkoholkonsum folgte der Missbrauch sowie drastische Erhöhung seiner Schulden in kürzester Zeit – überwiegend Trinkschulden; dazu niederträchtiges Verhalten seiner Familie gegenüber; Dienstvernachlässigung. Und immer folgten reuige und seine Seele zermürbende nüchterne Tage. Und damit alles zusammenpasste: Entlassung aus seinem Vertrag als Außendienstleiter.
Für einen Außenstehenden war Annas geduldiges Ertragen der zerstörerischen Verhaltensweise ihres Mannes gewiss nicht begreifbar. Sie wendete das Blatt, aber erst, nachdem sie sich in nur wenigen Monaten und mithilfe einer sich wohlüberlegten angeeigneten Trotzreaktion in eine noch ansprechendere berufliche wie gesellschaftlich gehobene Position emporgearbeitet hatte und dadurch finanziell unabhängig geworden war. Ihre Kinder konnten als erwachsen gelten, sodass sie sich um deren Zukunft nicht mehr allzu große Sorgen machen musste. Sie war zur Geschäftsführerin des Stadtverbandes ihrer Partei aufgestiegen, fungierte dazu als Vorsitzende dieser Partei im Hamburger Stadtbezirk Eppendorf. Außerdem war ihr beschieden worden, bei der nächsten Senatswahl als Kandidatin aufgestellt zu werden. Als es Anna mit ihrem Mann dann doch zu bunt wurde, erwirkte sie mithilfe einer einstweiligen Verfügung den sofortigen Auszug ihres Mannes aus der gemeinsamen Wohnung, einem geschmackvoll eingerichteten Zuhause in einem Zweifamilienhaus in Eppendorf. Es war die Wohnung, die die Lussons nach der Bundeswehrzeit bezogen hatten. Nun, das Gericht hatte Annas Antrag umgehend zugestimmt und als Begründung anerkannt: übermäßiger Alkoholkonsum des Ehemannes und ein daraus resultierendes, für Ehefrau und Kinder nicht zumutbares Verhalten. Das Gericht erlaubte Lusson nur so lange wohnen bleiben zu dürfen – allerdings nicht unbefristet, bis ihm eigener Wohnraum zur Verfügung stand. Für Anna war die gerichtliche Verfügung notwendig gewesen, weil ihr das Zusammenleben mit ihrem Mann unerträglich geworden war. Die Brutalität eines Betrunkenen, die weinerliche Labilität eines zum Feigling abgerutschten Mannes, wollte sich Anna und den Kindern nicht mehr zumuten. Martin Lusson indes sah das alles in einem anderen Licht, aber immer nur dann, wenn er wieder mal betrunken war. Er schrieb seine unwürdige Entwicklung einem angeblich schwerwiegenden Fehltritt seiner Frau zu. Doch dieser Fehltritt hätte, auch ohne Großmut an den Tag zu legen, längst vergessen sein können. Was war geschehen? Gehen wir vorerst kurz auf die Freundschaften der Lussons ein. Martin ist in seinem bisherigen Leben mit wahrhaftigen Freunden nicht gesegnet gewesen, im Grunde genommen waren es nur zwei. Er verlor sie, als er sich zur Bundeswehr einberufen ließ. Dort, im Kreise seiner Kameraden, entwickelte sich ein neues freundschaftliches Verhältnis erst zum Ende seiner Dienstzeit: mit einem anderen Offizier, damals ebenfalls Oberleutnant, sowie mit dem Arzt Dr. Ernst Lüders, den er bereits aus dessen Studienzeit kannte. Die Freundschaft zu dem Arzt vernachlässigte er, weil er es auch nach seinem Weggang von der Bundeswehr angenehmer fand, seine freie Zeit mit seinem Offiziersfreund und anderen ehemaligen Kameraden im Kasino seiner früheren Kaserne zu verbringen. Freie Zeit ...? Er nahm sie sich, wann immer es ihn von seinen Mitarbeitern, von seinen Aufgaben forttrieb, und das war sehr oft. So war es nicht verwunderlich, dass die so genannte Chemie zwischen ihm und dem heutigen Hauptmann scheinbar stimmte. Bald verkehrten sogar beide Familien miteinander, wenngleich sich die Ehefrauen verständigungsmäßig ziemlich zurückhielten. Bildungsmäßig, weltanschaulich, auf politischer Ebene ohnehin, war Frau Lusson der Gattin des Hauptmanns ein erhebliches Stück voraus. Im Gegensatz zu ihren Männern konnte von einer engeren Bindung, von einem Gleichklang aber keine Rede sein. Sie gingen miteinander um wie langjährige Bekannte, gingen nur dann etwas mehr aus sich heraus, wenn gemeinsames geselliges Beisammensein angesagt war, aber auch dann nur bis zu einer bestimmten Grenze, kurz: Es stellte sich deutlich heraus, dass Anna und die weit jüngere Ehefrau Dr. Lüders' wesentlich besser miteinander harmonierten. Doch aus zeitlichen Gründen entwickelte sich auch zwischen diesen beiden Frauen kein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis. Seit Annas Engagement im Beruf und in der Politik waren die gegenseitigen Besuche selten geworden. Veronika Lüders indes litt auch nicht unter Langeweile. Sie musste sich um ihren Säugling kümmern und ging hin und wieder noch ihrem Mann in dessen Praxis in Wedel, wenige hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt, zur Hand. Und Lussons Offiziersfreund? Irgendwann nach langer Oberleutnantszeit zum Hauptmann befördert, war ihm nie in den Sinn gekommen, die Uniform an den Nagel zu hängen. Er fürchtete den Wind, der ihm außerhalb der schützenden Kaserne eventuell um die Nase wehen würde. Er war nicht der Mann, der beruflich etwas riskieren wollte, schon gar nicht seine Sicherheit aufs Spiel setzen. Also wägte er gar nicht erst ab, welche Aussichten ihm als Zivilist geboten werden könnten und vor allem, auf welchem Gebiet er eventuell was zu leisten imstande wäre. Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, beide in der Berufsausbildung, bewohnte er am östlichen Stadtrand Hamburgs ein kleines ererbtes Haus, dessen hohes Alter man im Innern riechen konnte. Der Mann hatte es bis heute zwar nur zum Hauptmann gebracht, kassierte aber aufgrund seiner langen Dienstjahre ein ordentliches Gehalt, von dem die Familie, Mietkosten fielen nicht an, finanziell sorgenfrei lebte. Als sogenannter Innendienstfunktioner bekleidete er im Bereich eines Brigadestabes eine Position, die ihm in keiner Weise viel abverlangte, und es war ihm durchaus recht, seinen höchsten Dienstgrad bis zur Pensionierung erreicht zu haben. In derselben Kasernenanlage hatte Lusson gedient, allerdings als Mitglied im Stab eines Bataillons.
Lussons Freund war kein Macher, kein Mann mit Vorwärtsdrang, er war ein Mann gemütlichen Sinnes, vorsichtig mit seinen Weltanschauungen und Reden und legte sich mit niemandem an: „Es könnte so sein, aber auch so ...“ Er war von stabiler Statur, neigte zur Fülle, war breit in den Schultern, bewegte sich aufrecht und federnd und hatte dazu auch ein markantes, sehr männliches Gesicht. Er war also ein schöner Mann, nordisch blond, mit buschigen Brauen über strahlend blauen Augen, mit sinnlichen Lippen, aber ständig leicht verbrämtem Zug um den Mund. Nein, von einem Frauenheld war er weit entfernt, denn dazu fehlte ihm der Elan, der Wille, der Drang, etwas aufzureißen. Da musste eine Frau schon auf ihn zukommen.
Lussons Statur ist bereits an anderer Stelle beschrieben worden. Als eher schmächtige Erscheinung fühlte er sich seit frühester Jugend minderbemittelt, was sein Selbstvertrauen nicht gerade stärkte. Wenn es galt, sich körperlich hervortun zu müssen, wie beispielsweise bei Sportwettkämpfen in der Schule, dann meldete er sich meistens krank. Er gehörte zu den wenigen Schülern, die nie einen Lorbeerzweig nach Hause getragen haben. Manchmal ging ihm der bettelarme, aber in der Holzschnitzkunst hoch talentierte Jüngling Muckerl in Anzengrubers Roman Der Sternsteinhof durch den Kopf. Dann tröstete er sich damit, körperlich nicht behindert und obendrein auch nicht lungenkrank wie der Muckerl zu sein. Muckerl, der mit seinem vertrauensvollen Wesen und ehrlichen Gesicht zwar das hübscheste, aber ebenso ärmste Mädchen der ganzen Gegend zur Frau bekam, sie aber bald an einen reichen Großbauern verlor. Das ist eben manchmal der normale Lauf derlei Beziehungen, nur merkt es ein armer Schlucker, liebesblind, erst dann, wenn er unsanft auf den Boden der Realität zurückkehren muss.
Rücken wir nun die Ereignisse an jenem Abend in der Wohnung der Lussons ins Licht, zu Annas sogenanntem Fehltritt, dem Martin die Schuld an seinem Absturz ins gesellschaftliche Abseits gab:
Zu Gast waren mal wieder der Hauptmann und dessen Frau. Im Verlauf des Abends hatte Lusson den Hauptmann und Anna umarmt in einem dämmrigen, fast dunklen Nebenzimmer überrascht. Anscheinend küssten sie sich leidenschaftlich, denn sie wurden erst auf den Hinzugetretenen aufmerksam, als der bereits seine Fassung verlor. Zunächst stand Lusson wie versteinert da, mit sich überschlagenden Gedanken, wobei sich schnell einer herauskristallisierte, dass es sich hier um eine Sache handele, der schon länger nachgegangen wurde, vielleicht schon seit Jahren. Wäre es nun von Lusson nicht klüger und somit für ihn aufschlussreicher gewesen, hätte er sich, nachdem er bemerkt worden war, lächelnd zurückgezogen? Nein, ein Tobsuchtsanfall war die Folge, unwürdig und fatal seine Auswirkungen. Lusson schien seinen Verstand verloren zu haben, er vergriff sich an Anna und prügelte wie ein Berserker auf sie ein. Der Hauptmann indes stürmte zurück ins Wohnzimmer, zog seine völlig überraschte, aber schnell ahnungsschwer gewordene Frau aus ihrem Sessel, riss im Flur ihre beider Jacken von den Bügeln und verließ mit allem eilig Wohnung und Haus.
Glücklicherweise hatte Anna ihres Mannes wilde, unkontrolliert geführte Attacke einigermaßen abwehren können, sodass sie keine Verletzung davontragen musste. Und glücklich war zu werten, dass Corinna noch nicht zu Hause war und Matthias sich bei einem seiner Schulfreunde aufhielt und bei ihm übernachten durfte. Somit blieb ihnen der Anblick unwürdiger Auftritte erspart. Und der Älteste? Alexander? Er wohnte, das sei vorerst gesagt, nicht mehr bei seiner Familie. Nach seinem Abitur hatte er sich bei der Bundesmarine beworben.
In dieser Nacht betrank sich der bis zu seiner Gewaltanwendung längst nicht mehr nüchterne Lusson fast bis zur Bewusstlosigkeit. Er fand sein Bett nicht mehr, dafür das von Matthias und schlief bis zum nächsten Mittag.
In der Folgezeit sprachen Lusson und Anna nur noch über das Notwendigste. Gedanklich beschäftigte sich Lusson immer wieder mit dem mutmaßlichen Verhältnis seiner Frau mit dem Hauptmann. Ein klärendes Gespräch mit Anna und seinem ehemaligen Freund kam für ihn nicht infrage, nein, er dachte gar nicht daran, weil er den Mut dazu nicht aufbrachte. Er befand sich in einer sehr prekären Dauersituation, einer Mischung aus tiefer Trauer und lähmender Verzweiflung, die ihn nicht schlafen ließ, ihn regelrecht handlungsunfähig machte, sodass er seiner beruflichen Aufgabe natürlich auch nicht mehr weisungsgemäß nachgehen konnte. Die Tagesereignisse liefen an ihm vorbei, er vernachlässigte alles und jeden, nur nicht den Alkohol. Der ermöglichte es ihm dann überhaupt nicht mehr, sich irrsinnigen Eingebungen entgegen zu stemmen. Immer wieder stieß es in ihm auf, Anna und der Hauptmann hätten ihn bereits zum Ende seiner Dienstzeit und vor allem danach, wenn er als Führungskraft bei der Versicherungsgesellschaft seine Termine wahrnahm und auch dann und wann mehrtägige Tagungen außerhalb Hamburgs besuchen musste, betrogen. Der Hauptmann habe Anna oft und gefahrlos aufsuchen können. Seine Dienststellung ließ das ohne Weiteres zu, war er es doch, der über seine An- und Abwesenheit entschied. Von den Liebestreffen war er überzeugt, auch dann noch, als Anna in der Absicht, das unwürdige Verhältnis in ein erträglicheres umzuwandeln, ihrem Mann klarzumachen versuchte, dem Hauptmann nie sehr nahe gewesen zu sein; mehr sei dazu nicht zu sagen. Doch Lusson blieb stur, mehr noch, er erhob Moralansprüche. Dabei wäre für ihn das Wort Moral mit Sicherheit ein Fremdwort, böte sich ihm die Gelegenheit eines außerehelichen Abenteuers. In dieser Hinsicht war er nicht moralischer als andere Männer. Nein, er wollte, in verändertem alkoholisiertem Geist, nach allen Regeln des Unsinns und der Unvernunft seelisches Leid produzieren, es ausschütten und es auch selbst mit sich herumtragen. Er wurde immer unfähiger, gegen Alkohol und Eifersucht – ein enges Interessenpaar – anzugehen. Nicht nur Anna litt unter seinem Verhalten, wenn sie von ihrer aufreibenden, verantwortungsvollen Tätigkeit und der zusätzlichen Hausarbeit ein wenig Ruhe und Entspannung suchte. Auch Matthias, der fast sechzehnjährige Gymnasiast, und Corinna, noch nicht achtzehn und Auszubildende, der er es missgönnte, abends auszugehen und womöglich einen Freund zu haben.
Das ehedem gemeinsame Schlafzimmer nutzte er seit dem besagten Abend allein. Anna hatte es vorgezogen, die Couch im Wohnzimmer als Schlafstätte zu benutzen. In den Monaten zuvor, wo vor allem ihr politisches Wirken sie in Anspruch nahm, hatte sie das manchen freien Abend gekostet. Da waren die Begehrlichkeiten für die nächtliche Liebe abgeflaut. Lusson indes wertete das ganz anders, verband Annas Zurückhaltung mit ihrer angeblichen Beziehung zu dem Hauptmann. Er scheute sich nicht, Annas Vernachlässigung mit scharfer Zunge anzuprangern, aber nur in angetrunkenem Zustand und wenn Corinna und Matthias nicht anwesend waren. Verständlich, dass Anna dann umgehend den Raum verließ, um seinen unflätigen Anschuldigungen zu entgehen.
Die Kinder waren schon früh selbstständig, eine große Entlastung für ihre Mutter, die dadurch wesentlich beruhigter ihren beruflichen Aufgaben nachgehen konnte. Und sie war froh, in der Lage zu sein, ein ordentliches Einkommen zu erzielen. Matthias, der nach der Reifeprüfung studieren wollte, würde noch eine Reihe von Jahren finanzielle Unterstützung benötigen. Corinna und Alexander standen jetzt so gut wie auf eigenen Füßen. Corinna war in der Ausbildung zur Laborantin; Alexander, im einundzwanzigsten Lebensjahr, war als angehender Offizier bei der Bundesmarine vor Kurzem zum Seekadett ernannt worden und selten zu Hause. Von den elterlichen Problemen hatte er noch nichts mitbekommen. Während seiner Besuche ließen sich Anna und seine Geschwister nichts anmerken. Sie benahmen sich wie eh und je, mussten sich nicht verstellen wie Lusson.
Bereits kurze Zeit nach der Gerichtsverfügung tauschte Lusson, dem nicht daran gelegen war, sein ihm noch gewährtes Wohnrecht bei seiner Frau unangebracht lange in Anspruch zu nehmen, gediegenes Ambiente gegen zwei schlichte Zimmer unter der Dachschräge eines sechsstöckigen Mehrfamilienhauses aus der Jugendstilzeit. Eine bessere Möglichkeit konnte er sich nicht leisten. Es war auch nicht sein Ehrgeiz, in seiner Situation sich vornehm etablieren zu wollen. Das Haus stand im Stadtteil Eimsbüttel, eingepresst in eine lange Reihe gleichartiger Wohnhäuser. Lusson war hier ein Fremder, er wohnte sozusagen anonym, was ihm sehr recht war. Er empfand es als äußerst angenehm, sich als ein gewisser Herr Niemand in den Dachgeschosszimmern ehemaliger Dienstmädchen verstecken zu können. Hier oben in der Einsamkeit, wo selbst der Straßenlärm kaum oder gar nicht zu hören war, fühlte er sich weit ab vom Treiben in der Welt. Die Wohnung war sehr klein, dafür umso teurer. Lusson hatte das nach seinem schnellen Einzug nicht sonderlich gestört, er verdiente Geld, wenngleich nur einen geringen Teil von dem, was er einst als Außendienstleiter überwiesen bekam. Als Kunde der Arbeitsagentur sah die Sache freilich etwas anders aus. Für seine Familie konnte er nichts abzweigen, er musste nebenher seine Schulden abbezahlen. Es beruhigte ihn die Vorstellung, dass Anna genug verdiene, um sich und Matthias ordentlich durch den Monat zu bringen. Und Corinna schien sich auf einem guten Weg zu befinden, denn auch als Auszubildende erhielt sie ein gewisses Entgelt. Natürlich ginge es ihm besser, wenn er über ein ausgeglichenes Konto verfügen und sich mit seinem Alkoholkonsum zurückhalten würde. Seine Bankschuld wurde nicht geringer, erhöhte sich sogar sehr stark, wenn er mit der monatlichen Abzahlung nicht nachkam. Blieb er nur eine oder einen Teil der festgeschriebenen Rate schuldig, erhöhte ihm die Bank die Zinsen ins Unermessliche. Für seine tägliche Nahrung benötigte er nur wenig Geld, für alkoholische Getränke und Zigaretten hingegen erheblich mehr.
Sehen wir uns bei ihm einmal um. Sein rund fünfzehn Quadratmeter großes Wohnzimmer engte eine Küchennische ein, in der er nach seinem Einzug alles vorgefunden hatte, was in einer Küche eben benötigt wird: vom kleinen Löffel bis hin zu dem Tischgerät mit zwei Elektroplatten, das auf einem Nachkriegskühlschrank stand. Dessen hämmernder Motor mühte sich gelegentlich, den Inhalt zu kühlen. Dem Kühlschrank schloss sich eine dickwandige Steinspüle aus ebenfalls grauer Vorzeit an. Wollte Lusson den unansehnlichen Wasserstein darin beseitigen, hätte er Hammer und Meißel zur Hand nehmen müssen, was allerdings wegen der Besonderheit des Beckenmaterials nicht zu verantworten gewesen wäre. Das Gleiche galt für den Urinstein in der Toilettenschüssel draußen in einem Dachbodenverschlag, in dem auch ein Waschbecken installiert war, mit einem Spiegel darüber. Den restlichen Platz der Küchennische füllte ein mit drei Zwischenböden versehenes Bretterregal aus, davor gezogen ein verwaschener Leinenvorhang, auf dem in verblasstem Blau die gestickten, anheimelnden Worte Trautes Heim, Glück allein zu lesen waren. Ein einfacher Schrank, nussbaumfurniert, mit einer Glastür in der Mitte, eine Couch, dazu passend ein Armlehnsessel, ein Couch- und ein Beistelltisch, sämtlich aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, sowie eine Messingstehlampe mit drei Leuchtelementen in Tütenform waren das Mobiliar des Zimmers. Und fast alles stand auf einem schon ziemlich abgenutzten Teppich, einer Perserimitation, die Farbigkeit und so etwas wie Behaglichkeit vermitteln sollte. Zu Lussons Zufriedenheit wiesen die kaffeebraunen Polstermöbel keine durchgesessenen und fleckigen Stellen auf. Das zweite Zimmer, in dem nur ein zweitüriger Kleiderschrank, ein Bett und ein Stuhl Platz gefunden hatten, grenzte an den Wohnraum. In der Dachschräge beider Zimmer befand sich jeweils ein Klappfenster. Wenn darauf der Regen prasselte, und Lusson sich nicht gar zu sehr mit Bier und Schnaps befasst hatte, dann griff er zur Schlafenszeit auf Ohropax zurück. Er konnte aber auch, je nach Wetterlage und Interesse, den Wolkenzug, den Krähenflug und – ja, tatsächlich – den Großen Wagen beobachten, und er konnte verfolgen, wie der Mond zu- und abnahm; und strahlte der voll in seiner silbernen Pracht – je nachdem, wie es die Atmosphäre über Hamburg zuließ –, dann war Lussons Schlafgemach ein Hauch von Romantik nicht abzusprechen. Heulte hingegen der Wind über die Dächer, und die Wolken schlugen stakkatoartig ihr Wasser auf Dachpfannen und Fensterglas, dann hörte sich das sehr bedrohlich an. Wenigstens blieb Lussons Bett trocken, und er musste nicht, wie Spitzwegs armer Poet einen Regenschirm über sich aufhängen. Vom Waschraum mit dem Toilettenbecken war schon die Rede. Eine Dusche oder eine Wanne fehlten. Den Platz dafür gab der Raum nicht her. Lusson war dennoch nicht unglücklich. Zum Duschen und sogar zum Schwimmen suchte er ein nicht allzu weit vom Haus entferntes Hallenbad auf, geöffnet das ganze Jahr über. Allerdings kostete ihn sein Bestreben nach körperlicher Reinlichkeit jedes Mal Eintritt. Das betrübte ihn. Für das Eintrittsgeld hätte er sich auch einige Flaschen Bier kaufen können. Der größte Teil der Dachbodenfläche war angehäuft mit demolierten und ausrangierten Möbelstücken und anderem Gerümpel. Dem Anschein nach war hier noch nie ausgemistet worden: Möbelteile aus den zwanziger Jahren, ein leicht zerbeulter Wehrmachtstahlhelm, ein Gasmaskenbehälter und eine deckellose Feldflasche deuteten darauf hin. Und mitten aus dem Durcheinander ragte bis unter die höchste Dachstelle ein eisernes Rohr empor, über vier Meter hoch, an dem die Hausgemeinschaftsantennen für UHF und VHF angeschraubt waren. Aber seit Einrichtung des Kabelfernsehens benötigten die Hausbewohner die Antennen nicht mehr. Lussons altes tragbares Fernsehgerät, mit Zimmerantenne, brachte nicht gerade ansprechende Bilder hervor. Ein Kabelanschluss in der Dachwohnung war nicht vorhanden, was ihn zu der Überlegung brachte, die alten Antennen einfach anzuzapfen; doch letztlich scheute er den Aufwand. Zwei in das Dachziegelwerk eingelassene kleine schmutztrübe Fenster, an die niemand ohne Leiter würde herankommen, ergossen nur wenig Tageslicht auf den Gerümpelboden.
Nachstehende Eindrücke oder Situationen sind vornehmlich der Zeit Lussons zuzuschreiben, als er seine Straßenbauarbeit längst hinter sich gelassen hatte:
Stets beschlich ihn ein beklemmendes Gefühl, wenn vor allem nach Einbruch der Dunkelheit das diffuse Licht einer unter dem Gebälk hängenden und ständig zitternden Glühlampe gespenstisch seinen verwundenen Weg zum Verschlag beleuchtete. Dann trieben die Bodenkobolde lautlos ihre neckischen, ihm aber Angst einflößenden Streiche, zuckend und flimmernd, wobei hundert rote Augenpaare jeden seiner ängstlichen Schritte verfolgten. Dann wieder machten sich die leisen, torkelnden Gesellen unsichtbar und ließen nur ihre Schatten tanzen, ließen sie zusammenkollern, erneut auffächern, ließen sie zurück- und dann wieder auf Lusson zutanzen; der glaubte, sie jeden Moment auf der Haut zu spüren. Das Grauen im Nacken, beeilte er sich dann, sein Vorhaben in dem Toilettenraum zu erledigen. Wieder in seinem Zimmer angekommen, war ihm dann zumute, als sei er unglaublich lange von den Geistern gelähmt gewesen, und doch waren es nur wenige Minuten seiner Abwesenheit, in denen aufgrund äußerlich wirrer und lichtbedingter Verhältnisse ihn seine Vernunft im Stich gelassen hatte – naheliegender allerdings die Nachwirkungen des Alkohols. Lusson empfand dieses sonderbare, geheimnisvolle, schauerliche Spektakel nur dann, wenn er einen Tag mal keinen Alkohol konsumiert hatte. Denn angetrunken befassten sich seine Sinne nicht mit Spukereien, nein, da verhielt er sich gleichgültig, teilnahmslos, fantasielos und über den Dingen stehend. Schon längst war er nicht mehr imstande, seine vom Alkohol vernichtete Selbstsicherheit wieder in richtige, gesundere Bahnen zu lenken. Er achtete peinlichst darauf, fast allen Menschen aus dem Weg zu gehen. Es wurde bereits von seiner Reue gesprochen, wenn ihm nüchtern nicht nur die Bodengeister zu schaffen machten, sondern das Gewissen die Leviten las, unterstützt von einem, man konnte schon sagen, dauerhaften Unwohlsein. Dieser Zustand der nur schwer zu ertragenen Reue und des sich körperlich Elendfühlens hielt dann solange an, bis er abends zwischen seinen vier Wänden, hauptsächlich aber in der Kneipe erneut auf sein angebliches Unglück trank. Mit der Zeit verflog jedoch dieses Reue- oder Schuldgefühl und machte einem nicht minder zermürbenden Selbstmitleid Platz. Im Kreise seiner Zechgenossen, von denen er nur die Vornamen kannte, sie aber als Freunde ansah, brach er, sein Schicksal bejammernd, gelegentlich in Tränen aus; ein regelrechter Anfall, der nach nur zwei Minuten so plötzlich verschwand, wie er aufgetreten war. Dieses kurzzeitliche Ereignis trug dann sehr zur Belustigung der Gäste bei.
3. Kapitel
Es war reiner Zufall, dass Lusson und Dr. Ernst Lüders sich begegneten. An einem Sonnabendnachmittag war es auf dem Parkplatz eines Supermarkts, gerade, als jeder den Kofferraum seines Autos belud. Lüders, ohne seine Frau, hatte eine Menge zu verstauen gehabt, Lusson erheblich weniger. Gewicht brachten für ihn hauptsächlich vier Sechserpacks mit Bier, die Dr. Lüders aber nicht mehr zu Gesicht bekam.
Dr. Lüders maß einen halben Kopf größer als Lusson. Sein goldblonder, leicht gewellter Haarschopf, seine wasserhellen Augen in einem glatten Gesicht, ließen ihn auch mit Brille jünger erscheinen. Auffallend war die etwas schlurfende Gangart des Dreiundvierzigjährigen.
Das plötzliche Zusammentreffen mit dem Arzt war Lusson äußerst peinlich. Doch änderte sich das schnell, als beide in der Cafeteria des Supermarktes ihren Wiedersehenskaffee tranken. Hier hatte sich Lusson dann mitteilungsbedürftig gegeben und die schon lange zurückliegende Sache mit seiner angeblich treulosen Anna erwähnt. Seinen Auszug nach einer einstweiligen Verfügung verschwieg er wohlweislich. Er überraschte den Freund – er ging davon aus, dass er es noch war – mit der Behauptung, viele verheiratete Frauen könne man als Hexe bezeichnen. Vor wenigen Hundert Jahren hätte man sie verbrannt. Heute sei das anders, heute könne sich eine verheiratete Frau anderen Männern hingeben, ohne dass ihr etwas passiere, schlimmstenfalls sich ein Kind einfangen. Lüders folgte nur halbherzig den sonderbaren Auswürfen Lussons, der schon in früheren Zeiten, wenn sie unter sich in vergnügter Stimmung waren, nicht damit sparte. Dem Arzt war das Lächeln, das Lachen mit in die Wiege gelegt worden. Er hieß mit Vornamen Ernst, doch ernst war er höchst selten. Auch jetzt lächelte er, als er Freund Lussons abartige Vorstellungen mit einem scheltenden „Na, na, mein Freund!“ quittierte. Dann aber erkannte er am verbissenen Gesichtsausdruck seines Gegenüber, dass dessen sonderbares Reden wohl
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: