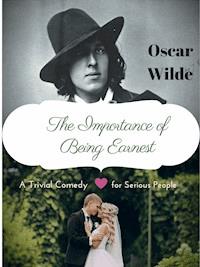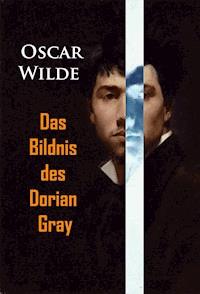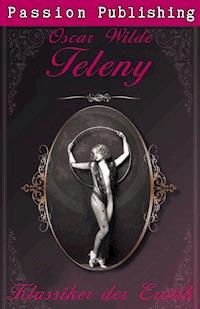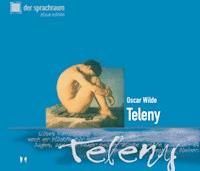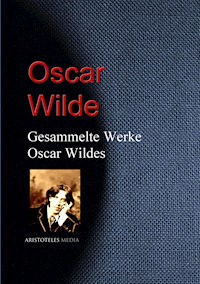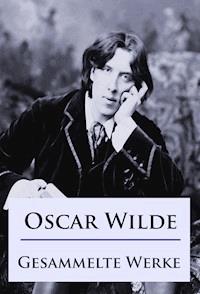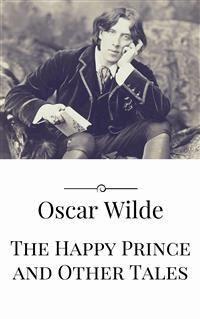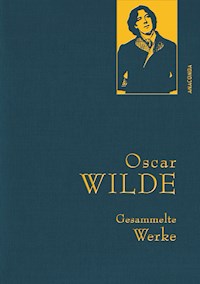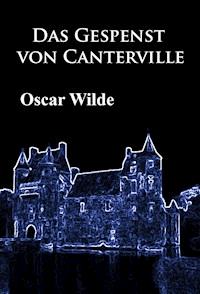Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Taschenbuch-Literatur-Klassiker
- Sprache: Deutsch
De Profundis Aus der Tiefe (nach Psalm 130) Oscar Wilde schreibt über sein Leben am Tiefpunkt desselben einen Brief 'Epistel in Gefangenschaft und Fesseln' 'Epistola: In Carcere et Vinculis' . Er sitzt eine zweijährige Zuchthausstrafe ab, zu der er wegen Unzucht verurteilt wurde. In seinem Brief schildert er die Umstände seiner Verurteilung und seine Haftbedingungen sowie die Erwartung einer schweren Zeit, die im erst noch bevorsteht. Inhalt: Einleitung Epistola In Carcere et Vinculis Vier Briefe aus dem Zuchthaus Reading an Robert Ross Anmerkungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Epistola: in carcere et vinculus
Vier Briefe aus dem Zuchthaus Reading an Robert Ross
I
II
III
IV
Anmerkungen
Einleitung
Seit langem war es mein Wunsch, »De Profundis« in neuer deutscher Fassung darzubieten; ich wollte nur die englische Gesamtausgabe der Werke Oscar Wildes abwarten, weil ich von ihr beträchtliche Vermehrungen und, vor allem, den endgültigen Text erhoffte.
Meine (zuerst im Februar 1905 erschienene) Übersetzung, der eine mit der Schreibmaschine hergestellte Kopie zugrunde lag, wich von der (ursprünglich nicht geplanten, dann aber bald darauf veröffentlichten) englischen Ausgabe, besonders in der Gliederung und gelegentlich auch im Wortlaut, recht erheblich ab. Zwei unbestreitbare Vorzüge hatte sie vor dem Text des englischen Buches: sie gab vielfach – darüber konnte kein Zweifel sein – das Original getreuer wieder, und sie war vollständiger.
Robert Ross, der literarische Testamentsvollstrecker des Dichters, mußte im Jahre 1905 auf die in England herrschende Stimmung Rücksicht nehmen. Noch immer war Oscar Wildes Name verpönt, und es ließ sich schwer voraussagen, welchen Empfang ein britisches Publikum diesem persönlichsten Werke des Verfemten bereiten werde. Daher empfahl es sich, heikle Stellen zu streichen oder im Ausdruck zu mildern. Nur wer die Empfindlichkeit der angelsächsischen Lesewelt nicht kennt, wird Ross daraus einen Vorwurf machen. Und der die kühnsten Erwartungen übertreffende Erfolg hat seinem Verfahren Recht gegeben: »De Profundis« wurde so einmütig in England begrüßt, wie kein Werk des Autors bei seinen Lebzeiten, und ist seitdem wohl in alle europäischen Kultursprachen übersetzt worden.
Daraufhin konnte Ross es wagen, dem unter seiner Leitung herausgegebenen Oeuvre Oscar Wildes (im Verlage von Methuen & Co. in London) ein vermehrtes »De Profundis« einzuverleiben. Nicht nur die früher für Mrs. Grundy unterdrückten, in Deutschland publizierten Abschnitte sind hinzugekommen, sondern auch einige bis dahin unbekannte, so daß der nun vorliegende Text als letzte Fassung seiner Hand zu betrachten ist. Da Ross das alleinige Verfügungsrecht über die Werke seines Freundes besitzt, muß er als oberste Instanz gelten.
Vollständiger ist also »De Profundis« geworden, aber noch weit, weit entfernt von Vollständigkeit.
Wir dürften jetzt etwas mehr als ein Drittel des Ganzen haben. Die erste Hälfte fehlt nach wie vor, weil sie sich auf »geschäftliche und Privatangelegenheiten von gar keinem Interesse« beschränken soll; das andre Sechstel verteilt sich auf die veröffentlichten Partien: wo jetzt drei Punkte stehn, ist eine Lücke angedeutet.
Wie die Dinge in England liegen, konnten wir das Ganze nicht erhalten, werden es auch in absehbarer Zeit nicht erhalten. Kein Brite braucht seinen Namen in einem für ihn unerfreulichen Zusammenhang drucken zu lassen; er kann, wenn er über die nötigen Mittel verfügt, eine Beleidigungsklage gegen den Urheber des Dokuments oder seinen Bevollmächtigten anstrengen. Es wäre pekuniärer Selbstmord gewesen, hätte sich Ross solcher Gefahr ausgesetzt. Er war einfach gezwungen, eine Auswahl zu treffen, bei der sein Taktgefühl das entscheidende Wort zu sprechen hatte. So bedauerlich eine derartige Kürzung vom psychologischen Standpunkt aus sein mag, so begreiflich, ja notwendig ist sie vom praktischen. Noch leben die meisten dramatis personae. Es lebt Lord Alfred Douglas; es leben die beiden Söhne Wildes; es leben die Freunde; es leben die mit Namen angeführten englischen Schriftsteller. Da war Vorsicht geboten, hieß es Rücksichten nehmen, nach den verschiedensten Seiten hin. Mag Ross dem Ideal eines philologischen Herausgebers nicht entsprechen, die Beteiligten werden ihn als das Ideal eines taktvollen Menschen rühmen.
In Deutschland denkt man zum Glück über solche Fragen etwas freier. Ich konnte mich ungehemmter bewegen und habe deshalb keine Bedenken getragen, überall da, wo ich Striche aufmachen und Anfangsbuchstaben erraten konnte, den vollen Namen hinzusetzen. Die Engländer werden es mir schwerlich danken; trotzdem hielt ich es für meine Pflicht, nichts zu verschweigen.
Auch dem Text der englischen Gesamtausgabe vermochte ich nicht durchgehends zu folgen, so sehr ich im allgemeinen bemüht war, mich ihm anzuschließen. Bei genauer Vergleichung des Buches und meiner Vorlage kam ich häufig zu dem Schluß, daß in ihr das steht, was Wilde wirklich geschrieben hat, während Robert Ross, sicher von den besten Absichten geleitet, im Buche mitunter kleine Retuschen vornehmen zu müssen glaubte. Es sind nicht allzuviele Stellen, und die Stellen sind nicht allzuwichtig; immerhin scheint es mir wichtig genug, im Interesse eines phantasielosen englischen Dramatikers und seines phantasieloseren deutschen Verhunzers darauf hinzuweisen.
Erst jetzt rückt das Werk in die rechte Beleuchtung, wo es als Brief kenntlich wird. »De Profundis« oder das, was wir »De Profundis« zu nennen pflegen, ist ein Brief, so gut wie die hier mitgeteilten Briefe an Robert Ross: ein Brief Oscar Wildes aus dem Zuchthaus in Reading an seinen Freund Lord Alfred Douglas; ein sehr langer Brief allerdings von achtzig eng beschriebenen Seiten, aber doch seinem ganzen Charakter nach ein Brief. Und daß sein Verfasser ihn als solchen empfunden, zeigt der von ihm vorgeschlagene Titel »Epistola: in Carcere et Vinculis«. Da ihn Wilde selbst gewählt hat, entschloß ich mich, ihn beizubehalten, obwohl sich »De Profundis« schon eingebürgert hat. Für den ganzen Band habe ich den Rossschen Titel akzeptiert, während ich für das sogenannte »De Profundis« zu dem rechtmäßigen, Wildeschen Titel »Epistola« zurückgekehrt bin.
Als Oscar Wilde den Brief zu schreiben begann, dachte er nicht an eine Veröffentlichung. Es war ein Privatbrief mit »wechselvollen, unsicheren Stimmungen«. Erst allmählich, da er wieder Freude am Darstellen gewann, kam ein Plan hinein, während der Anfang noch ganz unzusammenhängend ist. Und indem die alte Kunst des Gestaltens wieder erwachte, tauchte auch wohl der Gedanke auf, den Brief nicht nur als intime Aussprache mit dem Adressaten gelten zu lassen, sondern wenige erlesene Freunde in einen Teil seines Inhalts einzuweihn. So viel aber steht fest: von vornherein vorgesehn war eine Publikation nicht.
Dies sollte man bei der Beurteilung des Werkes nie außer acht lassen. Etliche Kritiker haben innere Widersprüche festgestellt und den Schreiber, im Hinblick auf sein späteres Leben, der Unaufrichtigkeit geziehn. Wilde hat einen solchen Standpunkt im »Dorian Gray« als typisch englisch bezeichnet (was deutsche Rezensenten nicht hinderte, in das gleiche Horn zu blasen); dort sagt er durch den Mund seines Lord Henry: »Der Wert einer Idee hat nicht das Geringste mit der Aufrichtigkeit dessen zu tun, der sie äußert«. Und was von einer Idee gilt, läßt sich auch von einem Buche behaupten. Gleichwohl braucht man sich diesen Satz nicht anzueignen, um den, der ihn ausgesprochen, gegen den Vorwurf der Unaufrichtigkeit zu schützen. Es versteht sich von selbst, daß die Stimmung des Gefangnen heftigen Schwankungen unterworfen war. Hoffnung und Verzweiflung lösten sich beständig bei ihm ab. Heute schien er zu wissen, wie er sein künftiges Leben gestalten solle, morgen erfaßte ihn wieder Mutlosigkeit. Der Brief ist eben im Gefängnis geschrieben, wo – außer Sokrates – nicht allzuviele Philosophen den Gleichmut der Seele bewahren dürften, ist vor allem in größeren Zwischenräumen geschrieben. Wilde hatte zu Empörendes durchgemacht und litt noch zu sehr, um das stoische Gut der αταραξια zu besitzen; und fortwährend stürmten neue Unannehmlichkeiten von der Außenwelt auf ihn ein. Er hätte mit Shakespeares Leonato den Einwänden seiner Kritiker entgegenhalten können:
»Nein! Nein! Stets war's der Brauch, Geduld zu rühmen
Dem Armen, den die Last des Kummers beugt:
Doch keines Menschen Kraft noch Willensstärke
Genügte solcher Weisheit, wenn er selbst
Das gleiche duldete ....
Denn noch bis jetzt gab's keinen Philosophen,
Der mit Geduld das Zahnweh könnt' ertragen.«
Im Gefängnis hörte der Selbstbetrug auf.
Da starrte den Elenden meist nur das Elend an. Wenn Wilde einmal das, was er schrieb, glaubte, so war es hier. Eine andre Frage ist freilich, ob er es noch glaubte, als ihm die Freiheit wiedergeschenkt wurde, als ihn das Leben wieder in seinen Strudel gezogen hatte. »Das Denken ist für die, die allein, stumm und in Fesseln dasitzen, kein ›geflügeltes, lebendiges Wesen‹, wie Plato es sich vorstellte«, schrieb er, als er noch ein halbes Jahr Kerkerhaft vor sich hatte. Ganz anders schon klingt es, wenn er zwei Monate vor seiner Entlassung nicht mehr daran erinnern zu müssen glaubte, »was für ein flüssiger Körper das Denken bei mir – bei uns allen – ist«. Wär' es anders gewesen, er hätte vielleicht Talent zum »Kirchendiener«, aber nicht zum Dichter gehabt.
Gewiß, sein beklagenswertes Leben nach Reading scheint die »Epistola: in Carcere et Vinculis« Lügen zu strafen; scheint es, denn was ist uns eigentlich bis jetzt von diesem späteren Leben bekannt, abgesehn von ein paar kahlen Tatsachen? Und diese beweisen nicht die Unaufrichtigkeit der Epistel, sondern zeigen nur, daß das Leben eine irrationale Zahl ist, die noch kein Mensch zu berechnen vermochte, daß es mit seiner furchtbaren Wirklichkeit alles, was ein armes Menschenhirn ersinnt, im Nu hinwegbläst. So hat es auch in einem Augenblick all das zertrümmert, was Oscar Wilde in langen Monaten aufgebaut hatte. Gerade darin besteht aber der Reiz des Werkes. Wäre es Wilde vergönnt gewesen, seine guten Vorsätze zu verwirklichen, nach Reading Kunstwerke zu schaffen und zur alten Höhe hinanzusteigen: »In Carcere et Vinculis« wäre nur eine traurige, aber keine tragische Schrift.
Und man darf ferner nicht vergessen, daß die Epistel an einen feingebildeten Menschen, selbst einen Dichter von außerordentlicher Begabung, gerichtet ist. Das erklärt ihren »artistischen« Ton. Oscar Wilde, der Schüler und Verehrer Walter Paters, kann sich nicht einmal im Gefängnis so weit verleugnen, daß er die Welt der Schatten, will sagen: die Kunst, die er so geliebt, verleugnet. Er ist bemüht, »auch dieser Existenz in Elend und Schande einen Stil zu geben, sie aus der blöden Zufälligkeit der Schicksalstücke durch vertiefende Deutung herauszuheben, daß selbst sie sinnvoll werde und eine Vollendung für das Gesamtkunstwerk seines Seins«. Darum langweilt er den Freund nicht mit seinen schaurigen Erlebnissen im Zuchthaus, sondern er sucht sie
Epistola: in carcere et vinculus
....... und mein Platz wäre zwischen Gilles de Retz und dem Marquis de Sade.
So ist es wohl am besten. Ich will mich nicht darüber beklagen. Eine der vielen Lehren, die man dem Gefängnis verdankt, ist die: daß die Dinge sind, was sie sind, und es in alle Zukunft bleiben werden. Ich zweifle auch nicht im geringsten daran, daß der mittelalterliche Wüstling und der Verfasser der »Justine« bessere Gesellschafter sind als Sandford und Merton...
All das hat sich in der ersten Novemberhälfte des vorletzten Jahres zugetragen. Ein breiter Lebensstrom fließt zwischen mir und einem so entfernten Zeitpunkt. Kaum, wenn überhaupt, kannst Du einen so weiten Zwischenraum überblicken. Mir aber kommt es vor, als wär' es mir, ich will nicht sagen: gestern, nein, heute zugestoßen. Leiden ist ein sehr langer Augenblick. Es läßt sich nicht nach Jahreszeiten abteilen. Wir können nur seine Stimmungen aufzeichnen und ihre Wiederkehr buchen. Für uns schreitet die Zeit selbst nicht fort. Sie dreht sich. Sie scheint um einen Mittelpunkt zu kreisen: den Schmerz. Die lähmende Unbeweglichkeit eines Lebens, das in allem und jedem nach einer unverrückbaren Schablone geregelt ist, so daß wir essen und trinken und spazieren gehn und uns hinlegen und beten oder wenigstens zum Gebet niederknien nach den unabänderlichen Satzungen einer eisernen Vorschrift: diese Unbeweglichkeit, die jeden Tag mit seinen Schrecken bis auf die kleinste Einzelheit seinem Bruder gleichen läßt, scheint sich den äußern Gewalten mitzuteilen, deren ureignes Wesen der beständige Wechsel ist. Von Saat und Ernte, von den Schnittern, die sich über das Getreide neigen, von den Winzern, die sich durch die Rebstöcke schlängeln, von dem Gras im Garten, über das sich die weiße Decke der abgefallenen Blüten breitet oder die reifen Früchte ausgestreut sind: davon wissen wir nichts und können nichts wissen.
Für uns gibt es nur eine Jahreszeit: die Jahreszeit des Grams. Die Sonne selbst und der Mond scheinen uns genommen. Draußen mag der Tag in blauen und goldnen Farben leuchten – das Licht, das zu uns hereinkriecht durch das dicht beschlagene Glas des kleinen, mit Eisenstäben vergitterten Fensters, unter dem wir sitzen, ist grau und karg. In unsrer Zelle herrscht stets Zwielicht, in unserm Herzen Mitternacht. Und im Bereich des Denkens stockt, ebenso wie im Kreislauf der Zeit, alle Bewegung. Was Du persönlich längst vergessen hast oder leicht vergessen kannst, trifft mich heut und wird mich morgen wiederum treffen. Das bedenke, und Du vermagst ein wenig zu verstehn, warum ich schreibe und so schreibe...
Eine Woche später schafft man mich hierher. Drei Monate verstreichen, da stirbt meine Mutter. Du weißt, niemand weiß es besser, wie sehr ich sie geliebt und verehrt habe. Ihr Tod war mir furchtbar; aber ich, einst der Sprache Meister, finde nicht Worte, meinen Kummer und meine Beschämung auszudrücken. Niemals, nicht einmal in den glücklichsten Tagen meiner künstlerischen Entwicklung, wär' ich imstande gewesen, Worte zu finden, die eine so erhabene Last hätten tragen oder wohllautend und hoheitsvoll genug im purpurnen Zuge meines unaussprechlichen Wehs hätten einherschreiten können. Von ihr und meinem Vater hatte ich einen Namen geerbt, dem sie Ruhm und Ehre verschafft, nicht nur in der Literatur, Kunst, Archäologie und Naturwissenschaft, sondern auch in der politischen Geschichte meines Vaterlands, in seiner nationalen Entwicklung. Ich hatte diesen Namen für ewig geschändet. Zu einem gemeinen Schimpfworte bei gemeinen Menschen gemacht. In den Schlamm gezerrt. Rohen Gesellen ausgeliefert, daß sie ihn verrohen lassen durften, Verrückten, daß er ihnen gleichbedeutend mit Verrücktheit werden durfte. Was ich damals gelitten habe und noch leide, kann keine Feder schreiben, kein Buch künden. Meine Frau, die in jenen Tagen sehr gütig und liebenswert gegen mich war, wollte es mir ersparen, daß ich die Nachricht von gleichgültigen Menschen, von fremden Lippen hörte, und kam trotz ihrem Kranksein den ganzen Weg von Genua nach England gereist, um mir die Botschaft eines so unersetzlichen, so unermeßlichen Verlustes selbst zu überbringen. Von allen, die mir noch zugetan waren, erreichten mich Beileidskundgebungen. Sogar Leute, die mich nicht persönlich gekannt hatten, ließen mir, als sie hörten, daß ein neuer Schmerz in mein Leben getreten sei, den Ausdruck ihrer Teilnahme übermitteln...
Drei Monate verstreichen. Der tägliche Ausweis über meine Führung und Arbeit, der draußen an der Tür meiner Zelle hängt, – auch mein Name und mein Urteil stehn darauf – sagt mir, es ist Mai...
Glück, Wohlleben und Erfolg mögen von rauher Oberfläche und aus gemeinem Stoffe sein: das Leid ist das Zarteste in aller Schöpfung. Es gibt nichts in der ganzen geistigen Welt, an das der Schmerz mit seinem schrecklichen, überaus feinen Pulsschlag nicht heranreicht. Das dünne, ausgehämmerte Zittergold-Blättchen, das die Richtung der dem Auge nicht wahrnehmbaren Kräfte anzeigt, ist im Vergleich damit grob. Das Leid ist eine Wunde, die zu bluten anfängt, wenn eine andre Hand als die der Liebe daran rührt, und selbst dann von neuem bluten muß, wenn auch nicht vor Schmerz.