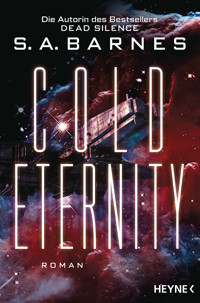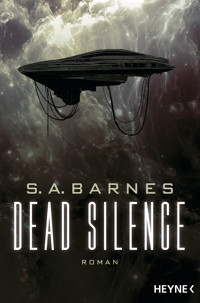
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kovalik gefeuert. Sie und ihre Crew reparieren Relaisstationen im Sonnensystem, doch eine neue Kommunikationstechnik macht diese bald obsolet. Bei ihrem letzten Einsatz fangen sie ein Notsignal auf, das von weit jenseits der Plutobahn kommt. Was sie dort entdecken, raubt ihnen den Atem: Es ist die Aurora, das größte Luxus-Raumschiff aller Zeiten, das vor über zwanzig Jahren auf seinem Jungfernflug verschwand. Wenn Claire und ihre Crew das Wrack bergen können, haben sie ausgesorgt. Doch im Inneren der Aurora bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: verstümmelte Leichen, in Blut geschriebene Botschaften, ein Flüstern im Dunkel. Was immer die Aurora angegriffen hat – es ist noch an Bord …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kovalik gefeuert. Sie und ihre Crew reparieren Relaisstationen im Sonnensystem, doch eine neue Kommunikationstechnik macht diese bald obsolet. Bei ihrem letzten Einsatz tief draußen im All fangen sie auf einer alten Frequenz ein Notsignal auf, das von weit jenseits der Plutobahn kommt. Schnell wird Claire und ihrer Crew klar, dass es nur ein Schiff gibt, von dem das Signal ausgehen kann: Die Aurora, das größte Luxus-Raumschiff aller Zeiten. Vor zwanzig Jahren brach sie mit zahllosen Prominenten an Bord zu ihrem Jungfernflug auf – und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Für Claire und ihre Crew ist das ihre Eintrittskarte in ein neues Leben: Wenn sie die Aurora aufbringen können, haben sie ausgesorgt. Doch an Bord des Geisterschiffs bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Alle Passagiere sind tot, ihre Leichen grausam verstümmelt. Wer – oder was – hat ihnen das angetan? Und ist es noch an Bord? Für Claire und ihre Crew beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit …
Die Autorin
S. A. Barnes arbeitet tagsüber als Bibliothekarin und schreibt nachts Romane, die sie bisher unter Pseudonym veröffentlicht hat. Dead Silence ist ihr Horror-SF-Debüt, für das sie 2022 mit dem Goodreads Choice Award in der Kategorie Science-Fiction ausgezeichnet wurde. S. A. Barnes lebt mit zu vielen Büchern, zu vielen Hunden und einem sehr geduldigen Partner in Illinois.
Mehr über S. A. Barnes und ihre Werke erfahren Sie auf:
diezukunft.de
S. A. BARNES
DEAD SILENCE
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Michael Pfingstl
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
DEAD SILENCE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Taschenbuchausgabe 01/2024
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2022 by S. A. Barnes
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com(Vo Thi Thao Lan, Deviney Designs, Pattern image)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-30603-8V001
www.diezukunft.de
Für Mum und Dad, die mir immer erlaubt haben, alles zu lesen, was ich wollte, solange ich sie nicht wegen meiner Albträume aufweckte.
Ich habe euch ja gesagt, dass sich das eines Tages auszahlen würde.
Ach ja, darf ich bitte das Nachtlicht anlassen?
1
JETZT
Verux-Tower für Frieden und Rehabilitation, Erde, 2149
Es pocht wieder in meinem Schädel, ein weißglühender Schmerz fährt vom Hinterkopf bis in die rechte Seite meines Kiefers, während vom anderen Ende des Raums ein Toter in meine Richtung gestikuliert. Er winkt mich verzweifelt zu sich, die Augen in Panik weit aufgerissen.
Ich wende den Blick entschlossen von der Halluzination ab und versuche, mich auf meine lebenden Besucher zu konzentrieren, die mir an dem verkratzten Plastiktisch gegenübersitzen.
»Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt?« Meine Zunge fühlt sich schwer und ungelenk an. Das kommt von den Medikamenten. Zu viel und gleichzeitig zu wenig.
»Ich sagte, Sie haben uns belogen.« Reed Darrow beugt sich ungeduldig vor. Hinter ihm geht ein älterer Mann – schwarzer Anzug, Vintage-Uhr, Typ Führungskraft – ruhelos auf und ab und verfolgt unser Gespräch mit einem nachdenklichen Stirnrunzeln. Auch er wirkt skeptisch.
»Worüber?« Ich bin verwirrt. Im Moment ist das zwar mehr oder weniger mein Normalzustand, aber bei Reed, einem Junior-Inspekteur der Verux-Qualitätssicherung, weiß ich normalerweise, was er meint. Er ist alle paar Tage vorbeigekommen, seit mich das Rettungsteam der Raleigh vor drei Wochen hier abgeliefert hat.
Max Donovan, mein anderer Besucher, räuspert sich laut. »Verux möchte Ihnen helfen, aber dazu müssen Sie auch uns helfen.« Er nickt mir aufmunternd zu. Sein vertrautes Gesicht ist in tiefere Falten gelegt als sonst. Bei unserer letzten Begegnung war er lediglich Inspekteur. Inzwischen scheint er zum Chef des gesamten Qualitätssicherungs-Departments aufgestiegen zu sein.
»Ich habe Ihnen alles gesagt, woran ich mich erinnere.« Laut den Ärztinnen und Ärzten ist meine Schädelfraktur verheilt, und während meiner einmonatigen Rückreise zur Erde hat das medizinische Personal der Raleigh mich auf jedes erdenkliche Bakterium, jeden Virus und jeden Parasiten getestet. Ganz zu schweigen von all den Untersuchungen in den letzten drei Wochen hier im Tower. Das Ergebnis war immer das gleiche: die Visionen, die Schmerzen und der Gedächtnisverlust haben mit größter Wahrscheinlichkeit eine psychologische Ursache, keine körperliche.
Reed ignoriert mich. »Sie wissen, dass einige Leute denken, Sie hätten Ihre Crew ermordet, bevor Sie in die Rettungskapsel gestiegen sind, damit Ihnen ein größerer Anteil bleibt.«
Meine Schultern verkrampfen sich, und ich muss mich beherrschen, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen.
»Dann haben Sie sich von der Raleigh abholen lassen und darauf vertraut, dass wir Ihnen die ganze Geschichte über Gedächtnisverlust und psychischen Zusammenbruch abkaufen, während Sie sich« – er deutet auf den Aufenthaltsraum – »hier im Tower verschanzen können.«
Der Verux-Tower für Frieden und Rehabilitation ist praktisch die Müllhalde für all die Gebrochenen und Kaputten. Wie mich. Verux hat mehr Schiffe und Besatzungen im All als jeder andere Konzern, und manchmal wollen sich die Andockklammern einfach nicht lösen. Manchmal kommen Menschen mit der jahrelangen Isolation im Weltraum nicht zurecht. Manchmal werden die Kühlmittelleitungen undicht und kontaminieren die Atemluft, und bis das Leck behoben ist, sind schon zu viele Hirnzellen über den Jordan. So was passiert. Sogar wenn man sich nicht daran erinnern kann.
Ich schlucke. Meine Kehle ist staubtrocken. »Meine Crew … sie ist tot, aber ich habe sie nicht umgebracht.«
»Sie bleiben also partout bei Ihrer Version?« Reed lächelt dünn und hält ein in der Mitte gefaltetes Stück Papier in die Höhe. Echtes Papier, was bedeutet, dass das Schreiben von ganz oben kommt. »Wir haben K147 während der letzten drei Wochen beobachtet.«
Allein der Name des Sektors lässt mich zusammenzucken. Ich habe dort alles verloren.
»Und?«, frage ich.
»Es gibt Bewegung dort, Claire«, sagt Max sanft.
Ausgeschlossen. Meine Lippen werden taub, meine Ohren beginnen zu pfeifen. »Die Aurora?«, flüstere ich.
Max nickt.
»Ihr Geisterschiff hat sich selbstständig gemacht, Kovalik«, meldet Reed sich mit einem selbstgefälligen Grinsen wieder zu Wort.
Max kommt an den Tisch und sieht mir in die Augen. »Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sie uns alles noch einmal erzählen. Von Anfang an.«
2
DAMALS
Sektor K147, zwei Monate zuvor
Bei mir ist irgendwo eine Schraube locker.
Eigentlich erstaunlich. Wir leben seit hundert Jahren auf anderen Planeten und Monden und sind sogar noch länger im Weltraum unterwegs, und trotzdem kann ein kleines Stück fehlerhaftes Metall alles kaputtmachen.
»Wie läuft’s da draußen, Kovalik?« Vollers Stimme übertönt das beruhigende Rauschen des Sauerstoffs und zerreißt die Stille in meinem Helm. Irgendwie klingt er hier draußen lauter als in Wirklichkeit.
Ich ignoriere ihn.
»Kovaaalik«, singt er. »Hallohoo?«
»Ist ja gut. Es wäre besser, wenn Sie die Klappe halten würden, damit ich mich konzentrieren kann.« Ich greife nach dem Schraubenzieher, der an einer Werkzeugleine an meinem Anzug baumelt.
Er seufzt, das Geräusch grenzt an ein wütendes Schnauben. »Lourdes sagt, das Signal ist immer noch instabil, TL. Wir verpassen das Rendezvous, wenn wir nicht bald aufbrechen.«
Als ob ich das als Teamleiterin nicht wüsste. Voller ist ein Meister darin, andere mit dem Offensichtlichen zu nerven. Nach sechsundzwanzig Monaten auf engstem Raum bin ich so weit, ihn dafür ebenso zu ermorden wie für sein Schnarchen, das durch die Lüftungsschächte bis in meine Kabine dringt und mich wachhält. Leider ist er außerdem ein guter Pilot.
Ich ignoriere ihn weiter und konzentriere mich darauf, die Hardware der Funkboje zu überprüfen. Vor allem dort, wo wir Neu und Alt zusammengelegt haben. Software-Updates kann man einfach aufspielen, aber bei Hardware muss man selbst Hand anlegen. Und auch mit jahrelanger Übung und Handschuhen, die extra für diffizile Arbeiten entwickelt wurden, braucht es Konzentration. Wenn ich ein Teil abbreche oder zu viele Schrauben verliere, sieht es hier draußen, am Rand des Sonnensystems, mit Ersatz schlecht aus.
Es gibt schlicht keinen, denn das hier ist die letzte Funkboje. Nicht nur auf dieser Tour oder in diesem Sektor, sondern überhaupt. Für uns zumindest. Das nächste Mal, wenn das Commweb – ein das gesamte Sonnensystem umspannendes Netz aus solchen Bojen, das Kommunikation zwischen den Schiffen und Kolonien praktisch in Echtzeit ermöglicht – ein Upgrade bekommt, wird eine Verux-SmarTech-Maschine das erledigen.
Maschinen verlieren weniger Schrauben.
Und wer keine Commweb-Wartungsteams mehr braucht, braucht auch keine Wartungsteam-Leiterinnen mehr. Ich werde überflüssig.
Das war’s. Mein letztes Mal hier draußen. Nicht nur als TL, sondern für immer. Kein Frieden mehr in der großen Leere, umgeben von der Unendlichkeit der funkelnden Sterne. Kein Schiff mehr, dessen Lichter mich aus der Dunkelheit zurückwinken.
Ich schiebe den Gedanken beiseite, soweit es überhaupt geht.
Vielleicht liegt es am Empfänger. Ich lasse meine Hand an der Reling entlanggleiten und ziehe mich auf die andere Seite der Boje, immer sorgsam darauf bedacht, mich nicht zu verheddern. Die Leinen, die mich mit der Boje und unserem Reparaturschiff verbinden, der L1N4 – LINA –, sorgen zwar dafür, dass ich nicht davonschwebe, sind aber auch lästig.
Ich ziehe jede Schraube fest, die ich finden kann. Schließlich knistert es in meinem Helmlautsprecher.
»Sie haben es repariert, TL.« Das ist Lourdes, meine Kommunikationsoffizierin. Ihre rauchige Stimme klingt weit angenehmer als Vollers. »Wir holen Sie jetzt rein. Willkommen zurück aus der Kälte.«
Das sanfte Ziehen an der mit roter Farbe gekennzeichneten Leine verrät mir, dass jemand an der Seilwinde der LINA bereitsteht, um mich auf mein Signal hin einzuholen. Wahrscheinlich Kane, mein Schiffstechniker und stellvertretender Teamleiter. Er mag es nicht, wenn andere Leute die Mechanik der LINA anfassen, selbst etwas so Einfaches wie eine Winde. Alles kann kaputtgehen, sagt er. Und hier draußen sind die Reparaturmöglichkeiten begrenzt.
Nicht, dass das jetzt wichtig wäre. Ich bin ziemlich sicher, dass die LINA nach unserer Rückkehr sowieso verschrottet wird. Sie war schon alt, als sie mir mit dem Auftrag für diesen Sektor zugeteilt wurde. Sie ist ramponiert, riecht nach überhitztem Metall und hat beschissene Luftschleusendichtungen, die wir ständig mit Hartschaum reparieren müssen, obwohl Verux sie nach jedem Einsatz gegen ebenso beschissene Ersatzdichtungen austauscht.
Aber die LINA ist mein Zuhause.
Ich löse die blaue Leine von der Reling der Boje und befestige das nun lose Ende an meinem Anzug. Dabei streifen meine Finger den Karabiner, der mich mit dem roten Seil verbindet – mit der LINA und der Zukunft, die ich nicht mehr habe.
Mein ganzes Leben lang habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als hier draußen zu sein. Weit weg von allen. Das ist das Schöne am Weltraum: Hier draußen gibt es nichts. Sicher, Sterne, Planeten und Funkbojen, aber keine Menschen.
Und jetzt … ist all das vorbei.
Meine Hand schwebt über dem Karabiner. Es wäre so einfach: den Sicherungshebel umlegen, mich von der Leine lösen und dann … abstoßen. Wegschweben. Irgendwann würde ich mich entscheiden müssen, ob ich erfrieren oder ersticken möchte, wenn meinem Anzug der Saft ausgeht, aber es wäre wenigstens meine Entscheidung. Meine Wahl hier draußen zwischen den Sternen, den weit weg schimmernden Planeten und der absoluten Stille des Weltraums.
»Kovalik?«, fragt Kane. »Sind Sie bereit?«
Nein, bin ich nicht. Ich habe auf der Erde nichts verloren. Nicht für lange und schon gar nicht für immer. Ohne ein Schiff ist man gefangen. Und wenn man keine Fluchtmöglichkeit hat, passieren schlimme Dinge. Allein der Gedanke, dauerhaft von so vielen Menschen umgeben und an die Schwerkraft gebunden zu sein, lässt meinen Atem schneller gehen.
Das heißt dann wohl Erstickungstod.
»Teamleiterin Kovalik, hören Sie mich?«, wiederholt Kane; seine Stimme wird immer dringlicher.
»Claire?«, meldet sich nun auch Lourdes zu Wort.
»Kommen Sie schon, Kovalik.« Voller klingt gereizt. »Auf der Ginsburg warten eine Rothaarige und eine ganze Kiste Scotch auf mich. Nur weil Sie nicht damit umgehen können …«
»Halten Sie die Klappe, Voller«, wirft Kane ein.
Meine Finger legen sich um den Sicherungshebel.
»Kovalik. Nicht bewegen. Bin auf dem Weg«, fügt er hinzu.
Meine Sicht verschwimmt, und meine Tränen verwandeln die funkelnden Sterne ringsum in einen nebligen Schleier. Kane würde mich niemals gehen lassen. Er würde mich zurückholen wie eine Gummiente aus einer Badewanne. Er ist gut in solchen Dingen. Dass eine Ente, ob aus Gummi oder nicht, außerhalb des Wassers nichts zu suchen hat, ist ihm egal.
Es würde eine Viertelstunde dauern, bis er angezogen und bei mir wäre, und in der Zwischenzeit würde das Logbuch unseres Schiffes protokollgemäß alles aufzeichnen und an Verux übermitteln.
Es gibt etwas, das noch schlimmer wäre, als nie wieder hier oben zu sein, nämlich auf der Erde im Verux-Tower für Frieden und Rehabilitation eingesperrt zu werden. In Florida – oder dem, was davon übrig ist. Dorthin schickt der Konzern alle Kaputten. Ich habe gehört, dass man, wenn man einmal drin ist, nie wieder rauskommt. Nicht einmal für einen Blick in den Sternenhimmel.
Ich atme tief ein und blinzle meine Tränen weg. »Negativ«, sage ich und zwinge mich, die Hand vom Karabiner zu nehmen. »Ich habe verstanden. Alles gut. Es gab nur eine kurze Störung.«
»Ja, bestimmt«, murmelt Voller.
Ich ignoriere ihn. »Bereit, wenn Sie es sind, Behrens.«
Kane betätigt die Winde und holt mich zurück in die Sicherheit an Bord der LINA, auch wenn es sich wie das exakte Gegenteil anfühlt.
»Was war da draußen los?«, fragt Kane, als ich aus der Luftschleuse raus bin und mich aus meinem Raumanzug schäle. Ich hänge ihn zusammen mit meinem Helm an den Haken, an dem auf einem Stück Magnetklebeband, das sich an den Rändern bereits löst, mein Name steht. Es fällt mir schwer, das zerfledderte Klebeband – und alles andere an Bord – nicht mit sentimentaler Zuneigung zu betrachten. Einfach weil es bald nicht mehr da sein wird.
Ich weiche Kanes Blick aus, während ich meinen Overall über mein T-Shirt und die Kompressionsshorts ziehe. Solche hellen blauen Augen sind selten heutzutage. Man sieht sie eigentlich nur noch in alten Filmen, und ich habe das Gefühl, dass Kane mich mit seinen durchschaut wie ein Röntgenscanner.
»Nichts.« Ich fahre mir mit den Fingern durch die Haare, die schweißnassen blonden Strähnen kleben mir an der Stirn und hängen mir in die Augen. Jetzt, wo ich wieder drinnen bin, kommt mir meine kurze Flucht in die Selbstmordfantasie dumm und erbärmlich vor. Ich hätte meine gesamte Mannschaft zu einem Rettungsversuch gezwungen und in Gefahr gebracht. Wir mögen uns nicht immer verstehen, aber es ist mein Job, für ihre Sicherheit zu sorgen. Ein Job, den ich so sehr wollte, dass ich darüber nachgedacht habe, mich umzubringen, wenn ich ihn verliere.
Mit heißem Gesicht schiebe ich mich an Kane vorbei und strecke den Kopf über das Geländer an der Rampe, die zum Unterdeck führt.
»Nysus«, rufe ich.
Keine Antwort.
»Nysus!«
Eine Sekunde später lehnt er sich aus seinem Lieblingsversteck, dem »Server-Wartungsraum«, der aus kaum mehr als einer Wandnische mit einer Tür davor besteht.
»Was?« Er blinzelt zu mir hoch, sein stacheliges schwarzes Haar ist zerzaust, sein Blick verträumt und ungeduldig. Er scheint immer noch auf das konzentriert, womit er gerade beschäftigt war, bevor ich ihn aufgestört habe. Wahrscheinlich irgendwas im Forum.
»Alles bereit?«, frage ich.
Er nickt. »Klar doch.«
Ich ignoriere Kane, der immer noch neben mir steht, gehe die Rampe zum Hauptdeck hinauf und von dort durch den schmalen Korridor und die kleine Kombüse zur Brücke. Kane folgt mir, allerdings weit langsamer, weil er immer aufpassen muss, sich nicht irgendwo den Kopf zu stoßen. Wie alle Reparaturschiffe ist die LINA vor allem eines: klein. Wir sind ein Kurzstreckenschiff. Die Schlepper bringen uns raus, versorgen uns mit Nachschub, und irgendwann bringen sie uns wieder zurück. An Bord ist gerade einmal genug Platz für die benötigte Ausrüstung und fünf Besatzungsmitglieder: Pilot, Kommunikationsoffizierin, Techniker, Mechaniker und Teamleiterin.
Die Brücke selbst ist kaum größer als die altmodischen Raumkapseln, die Verux im Konzernmuseum ausgestellt hat. Das heißt, sie bietet Platz für drei Leute, maximal vier – wenn jemand bereit ist, die ganze Zeit im Durchgang zu stehen. Sitze gibt es nur für die Funkerin, den Piloten und die Teamleiterin, also mich. Aber ich stehe sowieso die meiste Zeit.
»Status?«, frage ich Lourdes, die vor dem Kommunikationsterminal kauert und sich ihren Kopfhörer ans Ohr presst. Das dunkle, krause Haar an ihren kahlrasierten Schläfen ist längst wieder nachgewachsen. Sie hat es zu strammen Zöpfchen geflochten und diese wiederum von ihrem bevorzugten Ohr weg auf die andere Seite gebunden.
Lourdes dreht sich um und sieht mich mit vorsichtigem Blick an. Ein goldenes Halskettchen schimmert auf ihrer braunen Haut, die kleine Kapsel daran enthält ein fest zusammengerolltes Stück Pergament – ein Bibelvers, der ihr von ihrer Kirche zugewiesen wurde. »Ich teste jetzt die Ausrichtung und die Verbindung. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gutgeht?«
»Ja«, sage ich schärfer, als ich es beabsichtigt hatte.
Lourdes zieht überrascht die Brauen nach oben.
Ich sehe den Schmerz in ihren Augen und gebe nach. »Mir ist nur ein bisschen … schwindelig geworden.«
Voller hat sich in seinem Stuhl hinter den Kontrollen ausgestreckt, die Schließen seines Sicherheitsgurts baumeln am Boden. Er dreht sich halb herum, damit ich sehe, wie er mit den Augen rollt.
Lourdes will etwas sagen, aber dann wandert ihr Blick in die Ferne und sie presst ihre Hand wieder auf den Kopfhörer.
»Wir sollten reden«, erklärt Kane, sobald er aus dem Korridor auftaucht, als wären Lourdes und Voller gar nicht da. Aber selbst wenn sie nicht hier wären, würde ich dieses Gespräch nicht führen.
Ich ignoriere ihn und sehe Voller an. »Sind wir startklar?«
»Sie brauchen nur den Befehl zu geben«, erwidert Voller und lässt seine Fingerknöchel knacken. Das ist sein Tick beim Poker. Ich spiele selbst nicht, aber ich habe es oft genug beobachtet. Er macht das immer, wenn er ein gutes Blatt hat. Voller Ungeduld und Eifer.
Kane kommt noch näher. »Kovalik …«
»Es war nichts«, erwidere ich und versuche, es wie die Wahrheit klingen zu lassen. »Haben Sie alle Checks durchgeführt?«
»Hey Leute«, sagt Lourdes. »Ich glaube, ich habe was gefunden.«
»Ja, Kane, es war nichts«, höhnt Voller. »Wenn Kovalik ihren Aufenthalt in K-mitten-im-Nirgendwo-147 unbedingt unbegrenzt verlängern will …«
»Wollte ich nicht«, fahre ich ihm über den Mund.
»Halten Sie den Mund, Voller«, sagt Kane im selben Moment. »Ich bin der Bordarzt und …«
»Jetzt will er der Verrückten auch noch an die Wäsche«, legt Voller nach.
Ich werde stocksteif vor Schreck.
»Reißen Sie sich gefälligst zusammen«, erwidert Kane scharf.
»Warum verteidigen Sie sie ständig?«, fragt Voller. »Wir sind nicht mal ein richtiges Team, sondern haben nur das Pech gehabt, einen Scheißauftrag zu bekommen.« Er wirft mir einen angewiderten Blick zu. Für ihn bin ich ein Teil von besagter Scheiße. »Wer zum Teufel lässt sich freiwillig dauerhaft hier einsetzen?«
Voller hat nicht unrecht. Ein Einsatz hier bedeutet achtzehn Monate Aufenthalt oder mehr. Ohne Pausen, ohne nahe gelegene Kolonien, die man besuchen könnte, oder die Möglichkeit, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Niemand möchte L52 bis K147 zugewiesen werden, dem entlegensten Abschnitt des Commweb.
Das heißt natürlich: niemand außer mir.
Ich hatte ausdrücklich darum gebeten, als ich vor acht Jahren Teamleiterin wurde. Bei Verux waren sie überglücklich, den Sektor an jemanden loszuwerden, denn trotz der Zusatzzahlungen melden sich nur selten Leute freiwillig für L52 bis K147. Das hat mir anscheinend einen gewissen Ruf eingebracht. Aber hier draußen, wo niemand zusieht, hat man mehr Freiheiten und in der Regel bei jedem Einsatz ein neues Team, was mir lieber ist.
Dieses Mal ganz besonders. Weil es das letzte Mal ist, dauert die Tour noch länger als sonst. Sechsundzwanzig Monate, vielleicht mehr, in denen wir letzte Checks und Feinabstimmungen vornehmen. Das letzte Mal, dass die Funkbojen von Menschenhänden angefasst werden, bevor die Maschinen übernehmen.
Kane hat den Auftrag nur angenommen, weil er das zusätzliche Geld braucht. Voller ist hier draußen gelandet, weil alle besseren Sektoren von Piloten besetzt sind, die kein Dauergrinsen im Gesicht und keine Persönlichkeitsstörung haben. Lourdes ist noch neu. Sie kommt gerade erst von der Ausbildung und muss gehen, wohin der Konzern sie schickt. Und Nysus, nun ja, Nysus ist Nysus. Ihm ist es egal, wo er ist, solange er Zugang zum Forum hat.
Kane drängt sich an mir vorbei und baut sich vor Voller auf. »Zeigen Sie etwas mehr Respekt. Sie haben hier nicht das Kommando.«
»Vielleicht sollte ich«, erwidert Voller trotzig. Sein Blick wandert zu mir und fordert mich zu einer Reaktion heraus.
Ich müsste einschreiten und die Sache beenden, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt. Kane hat recht: Ich habe hier das Kommando. Zumindest noch eine Weile. Aber ich scheine mich nicht dazu durchringen zu können, etwas zu sagen. Es ist, als hätte es mich meine letzte Energie gekostet, den Sicherungskarabiner nicht zu lösen, und jetzt bin ich vollkommen kraftlos. Außerdem, was sollte das bringen?
»Hey!«, ruft Lourdes und zieht unser aller Aufmerksamkeit auf sich. »Ich sagte gerade, ich glaube, ich habe da etwas.«
Nach kurzem Zögern kommt Kane zurück und stellt sich neben mich, aber seine Wangen sind immer noch rot vor Wut. Wenn er involviert ist, setzt sich meist der kühlere Kopf durch – seiner.
Allerdings nicht immer. Meiner Erfahrung nach sind die Spannungen gegen Ende einer Tour stets am größten, doch er und Voller sind sich schon an die Gurgel gegangen, kaum dass wir an Bord waren. Kane mag für Antrieb und Funktionstüchtigkeit der LINA zuständig sein, aber Voller ist derjenige, der sie steuert. Die beiden stehen in einem ständigen Konflikt – der eine ist für den Körper zuständig, der andere für das Gehirn.
»Ah, gut«, meint Voller und streicht sein zerknittertes T-Shirt glatt. Auf dem heutigen steht »Fuck me«, darüber ein Smiley, der die Zunge rausstreckt. Ob das als Aufforderung oder als Beleidigung gemeint ist, kann ich nicht sagen. So wie ich Voller kenne, wahrscheinlich beides. »Die Funkboje funktioniert also wieder. Können wir jetzt von hier verschwinden?«
Lourdes ignoriert ihn. »Es ist ein automatisches Notsignal, glaube ich. Eine dieser R-5-Bojen mit Wiederholfunktion.«
Überraschenderweise weckt das ein vages Interesse in mir.
»Hier draußen?«, frage ich. Hier gibt es nichts. Die Erkundungsschiffe von Verux müssten alle außer Reichweite sein, es sei denn, eines davon ist früher zurückgekommen.
»Aber das Signal ist seltsam. Kein Schiffsname, keine Nachricht, keinerlei weitere Daten. Nur die Koordinaten und das vorprogrammierte SOS. Und es wird nicht über den Notfallkanal gesendet.« Lourdes hält inne. »Zumindest nicht auf dem, den wir jetzt benutzen.« Sie greift mit gerunzelter Stirn nach ihrem Tablet und lässt die Finger über das Display fliegen.
»Ein Echo oder irgendein alter Funkspruch«, erklärt Voller gelangweilt. »Hat wahrscheinlich mit der neuen Hardware zu tun.«
»Nysus?«, frage ich. »Hören Sie zu?« Wie ich schon nach wenigen Tagen an Bord feststellen konnte, hat mein brillanter, aber leicht asozialer Techniker die Kommunikationskanäle auf der Brücke und in den Gemeinschaftsbereichen so verdrahtet, dass sie permanent offen bleiben. Er kann immer mithören, ohne sich selbst beteiligen zu müssen.
»Das ist … möglich«, antwortet Nysus nach ein paar Sekunden. Wie immer klingt er distanziert und abgelenkt. Als wäre er gerade ganz woanders und von uns zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt gestört worden. »Dank dem Upgrade kann das Commweb jetzt auch deutlich schwächere Signale empfangen. Es könnte sein, dass es eine Art Überschneidung ist, nur eine Interferenz.«
»Sehen Sie? Habe ich doch gesagt. Ein Geistersignal.« Voller dreht sich herum und tippt die Koordinaten ein. Der Schiffsantrieb fährt mit einem Rumpeln hoch, das ich selbst durch meine Stiefel hindurch spüre. »Los geht’s. Bessere Dinge warten auf uns. Sogar auf Sie, Kane.«
Kane lehnt am Schott und zeigt ihm den Mittelfinger.
»Oder wir empfangen ein Signal von einem Schiff in weit größerer Entfernung, als es bisher möglich war«, merkt Nysus an. »Die neue Hardware ist einhundertzwanzig Prozent effizienter als die alte.«
Voller stöhnt.
Eine verzweifelte Hoffnung keimt in mir auf. »Wenn es sich um einen Notfall handelt, sind wir verpflichtet, Hilfe zu leisten«, sage ich nach einem Moment und versuche, normal zu klingen – als wäre dies nicht der Hinrichtungsaufschub, mit dem ich nicht mehr gerechnet habe.
»Nein, nein, müssen wir nicht.« Voller dreht seinen Sitz herum und deutet mit spitzem Finger in meine Richtung. »Ich weiß, was Sie denken. Wenn wir das Rendezvous mit der Ginsburg verpassen, sitzen wir einen weiteren Monat hier fest. Ohne zusätzliche Bezahlung. Nur weil Sie nirgendwo hinkönnen, Ihre Beförderung abgelehnt wurde und Sie als Möchtegern-Kommandantin für den Rest Ihres Lebens in einem Schreibtischjob festsitzen werden, müssen Sie uns nicht alle mit reinziehen.«
Seine Worte hallen erschreckend laut durch den kleinen Raum. Es ist nichts, was Kane, Lourdes und Nysus nicht schon wüssten. Aber es laut auszusprechen, ist eine neue Stufe der Demütigung für mich.
Schamesröte steigt mir ins Gesicht. Ich kann Kane nicht in die Augen sehen. Falls es noch eines Beweises bedurft hätte, was ich bei meinem letzten Weltraumspaziergang am liebsten getan hätte …
Voller hebt die Hand. »Ich sage, wenn das Signal nicht auf dem Notfallkanal ist, handelt es sich auch nicht um einen Notfall. Wer steht auf meiner Seite?«
»Voller …«, erwidert Kane mit angewidertem Kopfschütteln.
»Abgesehen davon, dass das hier keine gottverdammte Demokratie ist«, falle ich ihm ins Wort und erschrecke selbst über die Heftigkeit in meiner Stimme. Ich bin nicht der Typ, der anderen seine Autorität aufzwingt. Teamleiterin zu werden, war nie mein Ziel, sondern nur ein Nebeneffekt meines Wunsches, so viel Zeit wie möglich hier draußen zu verbringen.
Kanes Kopf ruckt hoch, sein Kiefer klappt vor Überraschung nach unten.
»Was das angeht«, meldet Lourdes sich zu Wort, »glaube ich, dass es wohl doch ein Notfallkanal ist.«
»Aber Sie sagten doch gerade …«, beginnt Kane.
»Es ist nur nicht der, den wir aktuell benutzen«, fährt Lourdes fort. »Sondern der alte.« Sie hält ihr Tablet hoch. »Ich habe es nachgeschlagen. Als Verux das letzte große Upgrade durchgeführt hat, nachdem sie CitiFutura aufgekauft hatten, haben sie die Bezeichnung des Notfallkanals geändert. Das war vor fünfzehn, vielleicht zwanzig Jahren. Vor unserer Zeit.«
Vor ihrer Zeit, aber nicht vor meiner. Wahrscheinlich auch nicht vor der von Kane, der nur ein paar Jahre jünger ist als ich, glaube ich. Ich war damals achtzehn, kam direkt aus einem von Verux gesponserten Heim und ging an Bord eines Verux-Reparaturschiffes auf meinen ersten Trainingseinsatz.
»Ich erinnere mich«, sage ich. »Die Fusion.« Das war sogar im Heim eine Riesenneuigkeit.
Nysus meldet sich zu Wort. »Sie hat recht.«
»Warum sollte jemand einen alten Kanal benutzen?«, fragt Kane.
Lourdes zuckt die Achseln. »Ich bin nicht sicher, ob es wirklich Absicht war. Wir haben es in der Ausbildung gelernt: Automatisierte Funkbojen sind … automatisiert. Wenn sie losgehen, senden sie so, wie sie programmiert wurden, auf dem neuen Kanal oder eben auf dem alten. Es bedeutet lediglich, dass jemand ziemlich weit draußen mit einer ziemlich alten Hardware sendet.«
Damit scheidet ein Verux-Erkundungsschiff schon mal aus. Die waren alle topmodern, als sie vor ein paar Jahren losgeflogen sind.
»Wie weit?«, frage ich.
»Anhand der Koordinaten? Irgendwo im Kuipergürtel«, antwortet Lourdes. »Etwa neunzig Stunden von unserer derzeitigen Position.«
»Nein«, sagt Voller kopfschüttelnd. »Auf keinen Fall. Das liegt in entgegengesetzter Richtung zu unserem Rendezvous mit der Ginsburg und außerdem weit außerhalb unseres Auftragsgebiets.«
»Das ist auch kein Auftrag«, rufe ich ihm ins Gedächtnis. Die letzten Commweb-Funkbojen befinden sich noch weit innerhalb des Asteroidengürtels. Wir parken hier sozusagen am Ende der Straße. Dahinter gibt es nur noch Felsen, Eis und Zwergplaneten, die zu klein sind, um von Interesse zu sein. Milliarden von Kilometern entfernt von allem. Was sich für mich im Moment gar nicht so schlecht anhört.
»Genau«, bellt Voller. »Das ist mitten im verdammten Nirgendwo und außerdem gefährlich. Wir befänden uns außerhalb des kartografierten Raums, und da draußen fliegt jede Menge Müll rum. Verux will nicht, dass sich seine Commweb-Wartungsteams dort rumtreiben. Wenn Sie so besorgt sind, kontaktieren Sie die Zentrale und bitten sie, ein anderes Schiff hinzuschicken.«
»Ein anderes Schiff zu schicken, dauert Monate«, gibt Lourdes zu bedenken. »Sie müssen erst ein geeignetes ausstatten und …«
»Sie werden gar nichts ausstatten«, unterbricht Voller. »Ich sage Ihnen doch, es ist ein Geistersignal.«
Der laut ausgetragene Streit zwischen den beiden macht das ständige Klingeln in meinem linken Ohr noch schlimmer. Ich hatte als Kind eine schwere Mittelohrentzündung, seitdem höre ich auf dieser Seite kaum noch was. Das Einzige, was immer da ist, ist das Summen meines Tinnitus. Die Ärztinnen und Ärzte bei Verux haben damals versucht, das Problem zu beheben, doch alles, was sie erreicht haben, war, dass der Tinnitus noch lauter wurde. Sie wollten es weiter versuchen, aber ich hatte genug.
Lourdes streicht sich die Zöpfchen aus dem Gesicht und strafft die Schultern. »Sind Sie jetzt der Kommunikationsexperte, Voller, oder ich?«
»Ach, kommen Sie, Sie sind doch nur eine verdammte Praktikantin, die …«
»Genug«, sage ich schroff.
Alle drei sehen mich an, und ich kann die erwartungsvolle Stille auf Nysus’ offenem Kanal regelrecht spüren.
»Jemand steckt in Schwierigkeiten, und wir sind verpflichtet zu helfen. Kapitel fünf, Vorschrift dreiunddreißig.« Natürlich empfehlen dieselben Vorschriften auch, zuerst Verux zu kontaktieren, sofern das möglich ist. Aber das wäre nicht die erste Vorschrift, die wir hier draußen ignorieren – weit weg von den Anzugträgern, die diese Regeln gemacht haben, ohne jemals das Schwerefeld der Erde verlassen zu haben. Eigentlich müssten wir auch immer angeschnallt sein und unsere Verux-Uniform tragen. Als ob uns hier draußen jemand sehen würde. Und als ob es hier irgendetwas gäbe, mit dem wir aus heiterem Himmel zusammenstoßen könnten. Und falls der Mikrograv-Generator ausfallen sollte, haben wir weit mehr Ärger, als ein Sicherheitsgurt lösen kann.
Wenn wir die Zentrale kontaktieren, werden sie uns nur hinhalten, um die Erlaubnis der übergeordneten Managementebene einzuholen, die den Schwarzen Peter weiterreichen wird, bis sie jemanden erwischen, der tatsächlich bereit ist, eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn ein Schiff wirklich in Schwierigkeiten steckt, zählt jede Minute.
»Voller, setzen Sie Kurs zu den Koordinaten, die Lourdes Ihnen gibt«, sage ich.
Voller öffnet den Mund zu einem Protest, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Kanes Kiefermuskeln zucken, doch ich habe die Situation im Griff.
»Ich mag eine abgehalfterte Möchtegern-Kommandantin sein«, beginne ich. »Aber wenn Sie Ihren tollen neuen Job behalten wollen, tun Sie, was ich sage. Wie ich in dieser Angelegenheit denke, mag Ihnen ja egal sein, aber ich wette, der Kommandant der Ginsburg – vor allem, wenn es ein echter ist – wird das anders sehen.«
Voller schließt den Mund mit einem hörbaren Klacken und dreht sich mürrisch zurück zur Steuerkonsole.
Lourdes wirft mir ein Grinsen zu. Sie ist ein gutes Mädchen mit einer besseren Zukunft als wir alle, und ich bin froh, dass ich bei meinem letzten Einsatz Teil dieser Zukunft sein durfte. Wenn schon sonst nichts.
»Okay, dann geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie so weit sind«, sagt sie übertrieben langsam zu Voller.
Ich warte seine Antwort ab. Nur für den Fall, dass er irgendwas versuchen sollte.
»Kleine, ich war schon zu allem bereit, als ich aus dem Schoß meiner Mutter gekrochen bin«, erwidert er verdrossen, aber seine Hände wandern brav zur Tastatur.
Lourdes verdreht die Augen und sagt die Koordinaten auf.
Ich wende mich ab und mache mich auf den Weg zu meiner Kabine. Es fühlt sich zu … eng an hier drinnen. Zu viele Menschen, zu viele Emotionen. Ganz zu schweigen von dem Gefühl, dem Tod gerade noch einmal entkommen zu sein.
Voller hatte recht: Ich könnte mir einen weiteren Monat hier draußen eingehandelt haben. Aber am Ende dieses Monats wird es keine Fortsetzung geben, keine mysteriösen Signale mehr, denen ich auf den Grund gehen kann.
Verux ist fertig mit mir. Danach gibt es keine Schiffe mehr für mich, keine glitzernden kleinen Punkte vor einem ewig schwarzen Hintergrund, keine Kontrolle.
Dafür überall Menschen.
Der Gedanke lässt die Panik wieder in mir aufsteigen.
Ich werde mir eine Wohnung suchen müssen. Und danach erwartet mich ein winziges Büroabteil, in dem ich die nächsten dreißig Jahre das Husten meines Nachbarn höre, sobald mich die überfüllte Nahverkehrsbahn von meinem »Zuhause« zu meinem Schreibtisch gebracht hat, an dem ich unendlich viele Seiten todlangweiliger Schulungsbücher mit meiner »jahrelangen wertvollen Erfahrung« abgleichen muss. Ich bin noch nicht mal vierunddreißig, und es fühlt sich an, als wäre mein Leben bereits vorbei.
Kane folgt mir. Ich spüre seine Präsenz, spüre seine Frage, bevor er sie ausspricht. Vor dem Schott zur winzigen Kombüse bleibe ich stehen. Ich kann immer noch den Duft von Lourdes’ Orangentee in der Luft riechen.
»Ich sagte, es geht mir gut«, brumme ich.
Wenn ich mich jetzt umdrehe, steht Kane nur ein paar Schritte hinter mir, die Arme vor der Brust verschränkt und die Stirn in tiefe Sorgenfalten gelegt. In fünfzehn Jahren habe ich mit acht verschiedenen Crews gearbeitet, mit sechsunddreißig verschiedenen Teammitgliedern. Manche davon waren besser als die anderen, manche … anspruchsvoller. Aber ausgerechnet in meinem letzten Team, auf meinem letzten Flug, befindet sich die einzige Person, die einen besseren Riecher für Lügen hat als ich und die moralische Verpflichtung verspürt, ihn auch einzusetzen.
»Das glaube ich Ihnen nicht«, antwortet er leise. »Reden Sie mit mir.«
Aufgrund seiner Zusatzaufgabe als Bordarzt weiß Kane mehr über mich als jedes andere Crewmitglied. Eigentlich müsste das den Umgang mit ihm deutlich schwieriger gestalten. Denn Menschen, die meine Geschichte kennen, können meist nicht anders, als mich mit Abscheu oder einer Mischung aus Mitleid und Neugier anzustarren, die einfach nur beleidigend ist. Doch Kane ist anders.
Ich bin hin- und hergerissen zwischen dem Impuls, meine gut befestigten Grenzen zu verteidigen und ihn abzuweisen, und dem Wunsch, mich ihm zu stellen und die Worte einfach aus mir heraussprudeln zu lassen. Letzteres fühlt sich an wie eine physische Kraft, die gegen mein Inneres drückt. Kane würde zuhören, das weiß ich, seinen aufmerksamen Blick stets auf mich gerichtet.
Allein der Gedanke daran lässt meine Brust eng werden vor lauter Gefühlen.
Und das darf nicht passieren.
Ich könnte es auf die Länge dieses letzten Auftrags schieben oder auf die beschissene Verletzlichkeit, die entsteht, wenn man aus dem einzigen Job rausgeschmissen wird, den man je geliebt hat. Vielleicht würde ich diese Verbindung zu jedem spüren, der ein freundliches Gesicht und ein offenes Ohr für mich hat und im schlimmsten Moment meines Lebens zufällig in der Nähe ist.
Aber es ist mehr als das. Ich habe Kane in den letzten zwei Jahren ein paarmal mit seiner Tochter beim Videochat gehört. Die Wärme und Zuneigung in seiner Stimme hat einen starken und gefährlichen Schmerz in mir ausgelöst.
Kane gibt mir das Gefühl, jemand zu sein. Er gibt mir Gefühl.
Mein Gott. Gibt es etwas Mächtigeres und Gefährlicheres als das?
Ich balle meine zitternden Hände zu Fäusten und versuche, den Schweiß an den Innenseiten zu ignorieren. »Ich habe nichts zu sagen, und wir beide haben zu arbeiten.«
Dass es Kanes ausdrückliche Aufgabe ist, die Psyche aller Crewmitglieder im Auge zu behalten, kümmert mich nicht. Vor allem von einem, das sich gerade ins Nichts verabschieden wollte.
Er seufzt. »Claire. Manchmal jagen Sie mir eine Heidenangst ein, wissen Sie das?«
Ich drehe mich um und sehe ihn erschrocken an. »Warum?«
Er mustert mich aufmerksam, und ich zwinge mich, nicht nervös zu werden. »Es ist normal, wenn man vor einer großen Veränderung aufgewühlt ist und sich Sorgen macht, wie es jetzt weitergehen soll, was die Zukunft bringen mag und so. Aber Sie?« Er schüttelt den Kopf. »Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so entschlossen zu zeigen versucht, wie scheißegal ihm alles ist. Erschreckend.«
Seine Worte treffen einen verletzlichen Punkt in mir, schnell und schmerzhaft wie ein präzis geführter Schlag. Ich zucke so heftig zurück, dass ich mir auf die Zungenspitze beiße und mir Tränen in die Augen steigen.
Aber ich straffe die Schultern, hebe mein Kinn und sehe ihm direkt in die Augen. »Umso besser, dass Sie sich nicht mehr lange damit rumschlagen müssen.«
»Claire …«, beginnt er. »So habe ich das nicht …«
»Es ist mir egal, wie Sie das gemeint haben«, unterbreche ich. »Sie hatten recht. Zufrieden?«
Sein Kiefer klappt zu, und seine Wangen färben sich rötlich.
»Sehen Sie nach Nysus, und sorgen Sie dafür, dass er Lourdes bei der Suche nach dem Ursprung des Signals hilft.« Ein schwachsinniger Befehl, denn selbst ein Rudel tollwütiger Wölfe könnte Nysus nicht davon abhalten, ein derart geheimnisvolles Signal zurückzuverfolgen, aber ein Befehl ist es trotzdem.
Ich wende mich ab und versuche, Kane und diese seltsame Mischung aus Stolz und Schmerz in mir zu ignorieren. Stolz, weil es mir gelungen ist, ihn in die Schranken zu verweisen, und Schmerz, weil ich trotz allem irgendwie erwartet hatte, dass er das Spiel nicht mitmacht.
3
»Wir sind da, TL«, sagt Voller vierundneunzig Stunden später über die Sprechanlage in meiner Kabine. »Mitten im leeren Weltraum.« In seinem Ton liegt mehr als nur ein bisschen Schadenfreude.
Das Gefühl von Enttäuschung kommt schnell, aber nicht unerwartet. Wir werden die Signalquelle überprüfen, als Phantom kennzeichnen und uns dann auf den Weg zu unserem Treffpunkt mit der Ginsburg machen. Vielleicht warten sie sogar und nehmen uns mit.
Mit ins Nichts.
Die offene Aufbewahrungskiste am Fußende meines Betts nimmt den gesamten freien Platz auf dem Boden ein. Ich steige darüber hinweg und drücke den Sprechknopf an der Wand. »Okay. Bin auf dem Weg.«
Ich habe fast alles gepackt. Es wäre unsinnig, damit zu warten, bis wir die Ginsburg erreichen, und mich dann beeilen zu müssen. Ich falte meine ausgefranste Decke und verstaue sie sorgfältig in der Kiste. Die roten Flecken darauf gehen nicht mehr ab, wie oft ich sie auch wasche, und sie sieht zugegebenermaßen ein wenig eklig aus. Aber sie ist eines der wenigen Dinge, die ich noch besitze, die tatsächlich mir gehören – die mir von jemandem geschenkt wurden, der mich gekannt und geliebt hat, nicht von einem Fremden mit guten Absichten. In einer Ecke sind mein Name und meine Geburtsnummer gestochen scharf aufgestickt. Meine Mutter war Ärztin bei Verux, eine der wenigen auf dem Ferris-Außenposten, und daher im Nähen sehr geübt.
Der Außenposten war ein rauer Ort, nicht einmal eine richtige Kolonie, sondern nur eine Ansammlung miteinander verbundener Verux-Wohnmodule, bewohnt von Menschen, die verzweifelt versuchten, sich mit wenig bis gar keiner Hilfe vom sponsernden Konzern durchzuschlagen. Aber wenn sie die Zehn-Jahres-Marke geknackt hätten, wenn sie es geschafft hätten, tatsächlich auf dem Mars zu leben, hätte Verux sofort Besitzanspruch auf die neue Kolonie erhoben.
»Du wirst deine Sachen gut in Ordnung halten müssen«, sagte meine Mutter zu mir, als wir nach Ferris zogen. Ich war fünf und mein Vater ein Jahr zuvor gestorben. Meine Mutter hatte den gefährlichen, aber sehr gut bezahlten Job aus purer Verzweiflung angenommen. Ich hatte den Tod meines Vaters offenbar nicht gut verkraftet. Außerdem waren Menschen mit medizinischer Ausbildung zu diesem Zeitpunkt auf der Erde bereits von den MedBots verdrängt worden. Sie waren billiger und begingen weniger Fehler, wie ein paar schwammige Statistiken belegten. (Wenn sie allerdings mal danebenlagen, dann richtig. Ungefähr so wie ein Batter beim Baseball, der den Ball verfehlt und dann vom Schwung seines eigenen Schlages von den Beinen gerissen wird. Ihnen fehlte die Vorstellungskraft, die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung ihrer menschlichen Vorgänger.) »Im Wohnmodul ist nicht genug Platz, dass jeder seine Sachen einfach herumliegen lassen kann. Hier gelten strikte Regeln.«
Sie versuchte, mich zu warnen, aber ich war kein Kolonie-Kind, sondern immer noch eine verwöhnte Erdenbewohnerin, die an den Luxus gewöhnt war, dass es überall atembare Luft gab und ich einfach nach draußen gehen konnte. Und sei es nur auf den überfüllten Bürgersteig.
Meine Mutter hat damals ihre letzten Atemzüge auf meine Pflege verwendet und mich gerettet. Sie versuchte auch, alle anderen zu retten, und hätte es wahrscheinlich sogar geschafft, wenn ihr mehr Zeit geblieben wäre. Immerhin konnte Verux dank ihrer Vorarbeit ein neues (und teures) Virostatikum entwickeln.
Aber ich habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ich laufe barfuß den Korridor entlang, die Erde aus dem Gewächshaus noch zwischen meinen Zehen und den Fingern. Beim Anblick des glänzenden blau-weißen Absperrbandes vor der Schleuse zum benachbarten Wohnmodul, das sanft in der Brise des Luftrecyclers flattert, halte ich inne. Das WortQUARANTÄNEzittert, als wäre es lebendig.
Ich schüttele den Kopf und schließe den Deckel – über der Erinnerung und auch den der Aufbewahrungskiste mit der Decke darin. Als das Rettungsteam mich fand, nahmen sie mich so mit, wie ich war, ohne zu packen und ohne Koffer. Ich hielt mich an meiner fleckigen Schmusedecke fest, obwohl ich mit elf Jahren eigentlich schon viel zu alt dafür war.
Und das tue ich bis heute, auch wenn die Decke mich weit mehr an all meine Fehler als an meine Mutter erinnert.
Bevor ich mich auf den Weg zur Brücke mache, werfe ich einen Blick auf meine Kabine. Die Wände sind kahl, jedes Geräusch hallt von nacktem Metall wider. In meiner Koje liegen nur noch Kissen, Bettzeug und genug Verux-Overalls, um es damit bis zur Ginsburg zu schaffen. Es sieht überhaupt nicht wie das Zuhause von jemandem aus, trotzdem war es das für mich. Trotzdem ist es immer noch besser, der harten Realität direkt ins Auge zu blicken. So zu tun, als ob ich dieses Zuhause nicht eher früher als später verlieren würde, war nichts als ein billiger Trick gewesen. Wie viele Tage mir hier auch noch bleiben mögen, jetzt stelle ich mich wenigstens der Realität, anstatt mich verzweifelt an eine Illusion zu klammern.
Es mag andere Meinungen geben, aber so sehe ich es.
Auf dem Korridor stoße ich mit Kane zusammen – meine Schulter gegen seine Brust –, der gerade aus seiner Kabine kommt. Entweder hat der triumphierende Voller ihn ebenfalls aufgescheucht, oder er hat gemerkt, dass das Schiff langsamer wird, weil wir die Zielkoordinaten erreicht haben.
»Nach Ihnen«, sagt er, ohne mir in die Augen zu sehen, und tritt zurück. Sein lockiges Haar ist zerzaust, und seine linke Schläfe ziert ein Schmierfleck. Sein abgenutzter Overall ist bis zur Taille offen, die Ärmel hat er um seine Hüfte gebunden, sodass ich das Baumwoll-T-Shirt sehen kann, das er darunter trägt. Es sieht abgenutzt aus, weich. Die Fantasie, wie ich meine Wange an diese Brust, an diesen Stoff presse, lässt mich einen Moment lang erstarren.
Aber nur einen Moment.
Ich gehe wortlos an ihm vorbei, auch wenn meine Schulter immer noch warm kribbelt von dem unerwarteten Kontakt.
Nein, Claire. Tu das nicht.
Ich bin noch nicht mal ganz durch das Schott zur Brücke, als Voller verkündet: »Sehen Sie, ich hab’s doch gesagt!« Er deutet auf das Sichtfenster an der Vorderseite, das den weiten, leeren Weltraum zeigt. »Nichts.«
»Und das Notsignal?«, frage ich Lourdes.
Sie dreht ihren Sitz zu mir herum. »Hier draußen ist es schwächer. Aber die Koordinaten stimmen.« Ihre glatte Stirn legt sich in Falten. »Ich verstehe nicht …«
»Weil das Commweb das Notsignal verstärkt hat«, wirft Nysus über die Bordsprechanlage ein. »Wir sind jetzt näher an der Quelle, und das bedeutet, dass wir das Signal direkt vom Sender empfangen, und das hat weniger Saft. Außerdem befinden wir uns außerhalb der Reichweite des Commweb.«
Außerhalb der Reichweite des Commweb. Ich war noch nie so weit draußen. Keiner von uns war das. Unser Job ist buchstäblich das Commweb: Wir leben und arbeiten darin wie eine Spinne, die unablässig an ihrem Netz knüpft, alle Knotenpunkte überprüft und wieder überprüft.
Es ist schwer, ein leichtes Schwindelgefühl zu unterdrücken, wenn ich aus dem Sichtfenster blicke. Als würde ich aus extremer Höhe nach unten schauen oder in ein endloses schwarzes Meer, das uns jeden Moment verschlingen wird, ohne dass eine Spur von uns zurückbliebe.
»Wie steht’s um unsere Batterien?«, frage ich Voller. Wenn jemand so weit draußen in Schwierigkeiten gerät, wären ironischerweise wir das einzige Schiff, das zu Hilfe kommen oder wenigstens den Notruf weiterleiten könnte. Das heißt, wenn wir uns in Reichweite des Commweb befänden, was offensichtlich nicht mehr der Fall ist.
»Sind randvoll«, sagt Voller und winkt ab, um meine Bedenken zu zerstreuen. »Können wir jetzt endlich von hier verschwinden?« Er beugt sich vor und blickt durch das Sichtfenster nach oben. »Wir befinden uns weit außerhalb des bekannten Raums, und ich würde es vorziehen, nicht von einem Scheißasteroiden oder was auch immer getroffen zu werden.«
Voller klingt zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, tatsächlich ein wenig beunruhigt.
»Zur Kenntnis genommen«, antworte ich. »Sobald wir den Sender gefunden haben.«
Er stöhnt.
»Also, Nysus, Sie sagen, das Signal, das wir empfangen, stammt von dem Schiff selbst«, spreche ich weiter.
»Ganz genau«, bestätigt Nysus.
Voller wischt sich mit den Händen übers Gesicht. »Es gibt kein Schiff!«
Lourdes starrt ihn an. »Doch, da draußen ist etwas. Es gibt kein Echo, wie es bei einem Geistersignal der Fall wäre. Und es müsste genau hier sein. Aber ich bekomme keine Kollisionswarnung, und weder durch die Sichtfenster noch auf den Kameras ist irgendwas zu sehen.« Sie gestikuliert in Richtung der sechs Monitore, die links und rechts von den dicken Sichtfenstern aufgereiht sind.
Sie klingt frustriert, und das ist auch verständlich. Die Außenkameras decken fast jeden erdenklichen Winkel der Umgebung unseres Schiffes ab. Allerdings haben wir keine Langstreckenscanner wie die großen Transport-, Militär- und Erkundungsschiffe. Reparaturschiffe, die nur von einer Funkboje zur nächsten fliegen wie wir, brauchen sie nicht. Wir machen kurze Sprünge in wohlbekanntem Raum, zwischen Punkten, die seit Jahren kartiert sind und regelmäßig angeflogen werden. Außerdem liegen sie weitab der von den schweren Jungs benutzten Routen, weshalb die Gefahr, dort mit irgendetwas zusammenzustoßen, denkbar gering ist.
Aber hier draußen ist alles ein wenig unscharf, ein bisschen weniger klar definiert. Als würden wir durch einen dunklen Wald tappen, statt die bestens in Schuss gehaltene Magnetschwebetrasse zu benutzen.
Und was jetzt?
»Schalten Sie die Arbeitsscheinwerfer am Heck ein«, sagt Kane hinter mir.
Ich drehe mich um und sehe ihn am Schott lehnen, die Arme vor der Brust verschränkt.
Voller wirft ihm einen verächtlichen Blick zu. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir aufgefallen wäre, wenn wir an irgendwas vorbeigeflogen wären, Chief.«
Kane ignoriert ihn und stellt sich neben mich. In der Mitte der Brücke ist es zu zweit so eng, dass er meinen Arm streift. »Drehen Sie das Schiff auf minus neunzig Grad.«
Plötzlich wird mir klar, worauf er hinauswill. »Tun Sie es«, sage ich zu Voller. Wir alle haben unsere blinden Flecken. Vor allem, wenn man auf einem Planeten geboren wurde und dort auch aufgewachsen ist.
Voller schüttelt den Kopf, gehorcht aber, auch wenn er dabei die ganze Zeit vor sich hin murmelt.
»Holen Sie die Bilder der rückwärtigen Kameras auf die Monitore, Lourdes.«
Die gleißenden Strahler, mit denen wir die Funkbojen beleuchten, während wir an ihnen arbeiten – all die winzigen Schrauben festziehen oder austauschen –, leuchten auf. Die Monitore zeigen einen einzigen weißen Schleier, bis die Kameras die Belichtung angepasst haben, und dann …
»Heilige Scheiße«, keucht Voller.
Auf den Bildschirmen ist ein Schiff zu sehen. Es steht senkrecht zu unserem und treibt in der Leere wie ein Zitronenschnitz in einer unendlich großen Tasse Schwarztee.
»Ich verstehe ni… wie haben Sie …« Lourdes starrt auf die Bildschirme. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie ein Zaubertrick an. Sehen Sie her, liebes Publikum: Tadaa!
Kane grinst mich an. »Im Weltraum gibt es kein Unten.« Diesen Satz bekommen die Verux-Commweb-Teams während ihrer Ausbildung so oft gesagt, dass er zu einer Art Running Gag geworden ist. Gerta, ein Teammitglied bei einer meiner früheren Touren, hat ein Schild über der Toilette aufgehängt: »Im Weltraum mag es kein Unten geben, hier drinnen aber schon. Also bitte gut zielen.«
Die Vorstellung, dass etwas genauso gut unter einem sein kann wie darüber, ist für alle, die mit der Erde unter den Füßen und dem Himmel über dem Kopf aufgewachsen sind, nur schwer zu verinnerlichen.
Der Drang, Kane anzulächeln, ist zu stark, um ihm zu widerstehen. Ich gebe ihm widerwillig nach, und als er meinen Blick eine Sekunde zu lange festhält, durchfährt mich ein Gefühl der Verbundenheit wie ein angenehmes elektrisches Kribbeln.
»Warten Sie«, sagt Lourdes und blinzelt die Monitore an. Schließlich steht sie auf und späht Voller über die Schulter, bis der sie wie eine lästige Fliege verscheucht. »Wir sind noch mindestens zwanzig Kilometer entfernt. Das bedeutet …«
»Das Ding ist riesig«, beendet Voller den Satz, nicht gerade erfreut darüber, dass er offensichtlich doch etwas übersehen hat. Noch dazu etwas so Großes. »Und was sollen wir jetzt machen, TL? Wir können auf keinen Fall Passagiere von einem Schiff aufnehmen, das …«
»Warum sieht es so … merkwürdig aus?« Lourdes fährt die Umrisse des Schiffes auf dem Monitor nach. Den rundlichen Bauch, den an Bug und Heck spitz zulaufenden Rumpf, die winzigen Bullaugen an der Seite.
Eine Alarmglocke läutet in mir, plötzlich und unangenehm.
Nein. Das kann nicht sein.
»So ein Schiff habe ich noch nie gesehen«, sagt Lourdes. »Sind das Schornsteine, da auf der Oberseite? Wozu? Und die Decks an Bug und Heck sehen aus, als wären sie offen. Das würde riesige Glaskuppeln erfordern. So etwas macht niemand, viel zu riskant.«
Ein Schauer läuft mir über den Rücken, mein linkes Ohr beginnt wieder zu pfeifen. Lourdes hat recht. Niemand macht so was, oder nicht mehr. Soweit ich weiß, wurde es auch nur ein einziges Mal getan.
Neben mir wird Kane ganz still. »Sieht das für Sie auch aus wie …«
»Ja«, sage ich, aber es kommt nur ein ehrfürchtiges Flüstern aus meinem Mund. Ich räuspere mich und versuche es noch einmal. »Ja, genauso sieht es aus.«
Voller hebt sich ein Stückchen aus seinem Sitz und betrachtet das Schiff eindringlicher. »Nein«, sagt er schließlich und wirft uns einen ungläubigen Blick zu. »Ausgeschlossen.«
»Was?«, fragt Lourdes.
Kane räuspert sich, aber seine Stimme klingt trotzdem rau. »Man wollte, dass es möglichst nostalgisch aussieht, damit die Passagiere an etwas Vertrautes erinnert werden und sich wohler fühlen. Das Design ist den Ozeandampfern der Erde nachempfunden. Aus der Zeit, als man noch Kreuzfahrten unternehmen konnte.« Er hält inne. »Mein Vater und mein Onkel … sie haben damals bei CitiFutura gearbeitet, bevor Verux das Unternehmen übernommen hat. Sie haben einen Teil der Klempnerarbeiten auf diesem Schiff durchgeführt. Und das andere, das Schwesterschiff, ich weiß nicht mehr, wie es hieß …«
»Cassiopeia«, sage ich leise.
Kane nickt. »Ja, richtig. Es wurde außer Dienst gestellt. Danach, meine ich.«
»Aber was …«, beginnt Lourdes.
»Das Schiff ist damals in die Luft geflogen!«, ruft Voller dazwischen, als wollte er die Existenz des Kolosses vor uns nach wie vor bestreiten. Er deutet auf einen der Monitore. »Ein katastrophaler Unfall mit den Triebwerken. CitiFutura wollte unbedingt den Starttermin einhalten, und dann ist unterwegs was schiefgegangen. Die Sache hat ihnen damals das Genick gebrochen.«
»Chatroom-Gerüchte und haltlose Spekulationen«, wirft Nysus über das Intercom ein. Sein Tonfall legt nahe, dass er bereits in den heruntergeladenen Forum-Threads nach weiteren Informationen sucht. »Nachdem das Schiff verschwunden war, haben die Such- und Rettungskommandos Metallfragmente gefunden, die Teil des Rumpfes gewesen sein könnten oder auch nicht. CitiFutura hat der Versicherung einen Totalverlust gemeldet, aber es gab keinerlei Beweise, sondern nur Dutzende von Theorien. Und dann begannen die Klagen.«
»Was für Klagen?« Lourdes schreit fast. »Wovon reden Sie alle überhaupt?«
Ich reiße meinen Blick von der grausigen Realität auf den Monitoren los und sehe zu Lourdes hinüber.
Sie hebt verärgert die Hände und fordert eine Erklärung. Es scheint mir ausgeschlossen, dass sie es nicht weiß. Doch dann begreife ich, dass sie wahrscheinlich noch ein Kleinkind war, als all das passierte.
»Das«, sage ich und zeige auf den Bildschirm, »ist die Aurora. Das erste und einzige Luxus-Weltraumkreuzfahrtschiff. Mit allen Annehmlichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Goldene Wasserhähne und so weiter.« Aus irgendeinem Grund fallen mir die jedes Mal als Erstes ein, wenn ich an das Schiff denke.
»Böden aus echtem Holz, Kaffee aus echten Bohnen und Fleisch, das einmal lebendig war«, fügt Voller hinzu und klingt dabei genauso ehrfürchtig wie verbittert.
»Vor zwanzig Jahren brach die Aurora mit fünfhundert Passagieren und einhundertfünfzig Besatzungsmitgliedern zu ihrem Jungfernflug durch das Sonnensystem auf«, führe ich weiter aus. »Die Reise sollte ein Jahr dauern, aber nach sechs Monaten ist das Schiff spurlos verschwunden. Alle an Bord galten als tot.«
»Eine der größten Weltraumkatastrophen in der Geschichte der Menschheit und ganz oben auf der Liste der ungelösten Rätsel«, fügt Nysus fast schon begeistert hinzu. Manchmal erleiden eben auch Nerds Gefühlsausbrüche.
Lourdes’ Blick springt zwischen der Aurora und mir hin und her. »Bis jetzt«, murmelt sie.
»Ja. Bis jetzt.«
»Heilige Scheiße«, flüstert sie und verwendet, ob bewusst oder unbewusst, genau die gleichen Worte wie Voller. »Wo war es dann die ganze Zeit?«, fügt sie mit normaler Stimme hinzu.
»Keine Ahnung«, erwidere ich und verschränke die Arme vor der Brust, als könnte ich damit mein rasendes Herz beruhigen. Die Aurora. Direkt vor unserer Nase. »Wir sind unfassbar weit von ihrem letzten bekannten Standort entfernt. Ich glaube nicht, dass sie sich derart weit rauswagen wollten.«
»Niemand glaubt das«, murmelt Voller, allerdings nicht mehr ganz so schlecht gelaunt wie zuvor.
Lourdes’ Finger fliegen über die Konsole. Die Bilder auf den Monitoren flimmern kurz und werden dann wieder scharf, etwas größer als zuvor. »Tut mir leid, aber unsere Kameras sind nicht dafür gemacht, so weit zu zoomen. Besser bekomme ich das Bild nicht hin«, erläutert sie. »Trotzdem sind definitiv keine Hinweise auf eine Explosion zu erkennen. Zumindest nicht aus dieser Perspektive.«
Lourdes hat recht. Die Steuerbordseite sieht genauso glänzend und makellos aus wie auf den Videos, die die Nachrichtensender nach dem Start der Aurora immer wieder gezeigt haben – und dann wieder nach ihrem Verschwinden.
Ich war wie gefesselt, als wir uns die Videos in der Wohngruppe ansahen, und plante bereits meinen eigenen Weg zu den Sternen. Wäre ich ein paar Jahre älter gewesen, hätte ich CitiFutura angefleht, wenn nötig auch erpresst, um mit dabei zu sein, an Bord dieses Schiffes. Wochenlang träumte ich von zukünftigen Kreuzfahrten, von zukünftigen Chancen.
»Das Schiff treibt«, kommentiert Voller. »Kein Antrieb.«
»Auch kein Funkverkehr«, fügt Lourdes stockend hinzu. »Ich habe auf ihren Notruf geantwortet, aber es kam … nichts.« Sie zögert. »Glauben Sie, dass an Bord … noch jemand am Leben ist?«
Sechshundertfünfzig Menschen. Sechshundertfünfzig Leichen.
Die Brücke scheint vollkommen tot. Das ganze Schiff ist kalt und still, eine Frostschicht glitzert auf dem Rumpf. Nicht einmal ein Flackern in einem der winzigen Bullaugen deutet auf Leben hin.
»Den Aufzeichnungen zufolge hatte die Aurora ein System zur Trinkwassererzeugung an Bord. Damals der neueste Stand der Technik«, sagt Nysus über die Sprechanlage. »Aber nur Lebensmittel für achtzehn Monate. Ich schätze, sie dachten, das würde ausreichen, damit jemand sie erreicht, falls sie unterwegs in Schwierigkeiten geraten sollten.«
Und dann kam alles ganz anders, aus welchem Grund auch immer.
»O mein Gott«, murmelt Lourdes und befühlt die kleine Kapsel an ihrer Halskette. »Diese armen Menschen. Sie verhungern hier draußen, ganz allein und …«
»Das wissen wir nicht«, sagt Kane beschwichtigend. »Vielleicht haben sie die Fluchtkapseln genommen. Das können wir von hier aus nicht sehen.« Er wirft mir einen scharfen Blick zu, aber ich sehe keinen Grund, Lourdes anzulügen.
Wäre das möglich? Sicher. Aber wenn es so war, wurden die Rettungskapseln nie gefunden. Und selbst wenn, bei der Entfernung wäre ihnen längst die Atemluft ausgegangen, bevor jemand sie retten konnte. Ein anderer, genauso furchtbarer Tod.
Aber dazu sage ich lieber nichts. Ich stehe in dem Ruf, eine »unbekümmerte Einstellung zur Sterblichkeit« zu pflegen. Der Psychologe, den Verux nach der Ferris-Katastrophe hinzugezogen hat, um meinen Zustand zu evaluieren, hat damals dieses Urteil gefällt, und seitdem verfolgt es mich. Aufgrund dieser einen Beurteilung aus meiner Kindheit wurde ich von den Verux-Erkundungsmissionen ausgeschlossen, und ich vermute, dass sie ebenfalls eine Rolle dabei gespielt hat, dass ich als Kommandantin eines Transporters abgelehnt wurde. Offenbar wird »unbekümmert« manchmal auch als »rücksichtslos« ausgelegt.
Was nicht stimmt. Ich bin gegen niemanden rücksichtslos außer mir selbst, und ich habe noch nie ein Teammitglied verloren. Aber ich sage Ihnen eines: Wenn man miterlebt hat, wie jeder um einen herum stirbt, wie das Licht in seinen Augen langsam erlischt und er sich von einer reizenden Mischung aus Ticks, Gewohnheiten, Vorlieben und Träumen in einen Haufen aus zerfallendem Fleisch und Knochen verwandelt, dann wird einem nicht nur klar, wie kostbar das Leben ist, sondern auch, dass der Tod unausweichlich ist. Ganz gleich, was man tut. Eines Tages sterben die Menschen, die man liebt, und manche davon früher und schrecklicher, als man es sich je vorgestellt hätte. Manchmal ist man sogar selbst dafür verantwortlich.
Ich ziehe es vor, mich dieser Realität zu stellen, anstatt so zu tun, als gäbe es sie nicht. Genauso wie ich mich nicht gerne binde. An niemanden. Warum sollte ich mir diesen Schmerz antun? Doch anscheinend macht mich diese Einstellung auch »distanziert«, »kalt« und, wie ich einmal durch Zufall mitgehört habe, »irgendwie unheimlich«.
»Wir müssen zurück«, erklärt Kane. »Nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale auf. Sie werden jemanden schicken. Ein Rettungsteam.«
Ich schätze Kanes Optimismus – die unerschütterliche Hoffnung, die ihm zugrunde liegt. Das ist etwas, das mir fehlt.
Aber hier gibt es nichts mehr zu retten. Es geht nur noch um Bergung, nichts sonst. Und das bedeutet …
Ich mustere die Aurora, die dunklen Fenster, die stillen Triebwerke, stelle mir den Luxus – und die Schrecken – in ihrem Inneren vor. Allein die Baukosten müssen zig Milliarden betragen haben. Und das war vor zwanzig Jahren.
Eine hässliche Idee blitzt in mir auf und weigert sich hartnäckig, wieder zu verschwinden. Unsere Vorschriften basieren auf den alten Seefahrtgesetzen. Selbst in Dingen, die hier draußen deutlich seltener vorkommen als im Zeitalter von Sextanten und spanischen Galeonen.
Und auf dieses Wrack hat bislang niemand Anspruch erhoben.
»Worauf warten Sie noch?«, fragt Lourdes an Voller gewandt, dessen Hände regungslos auf der Konsole verharren. »Lassen Sie uns von hier verschwinden und den Fund melden.« Sie erschauert. »Es ist, als würde man vor einem Massengrab stehen.«
Sie hat nicht unrecht. Und doch … ein Dutzend goldener Wasserhähne von der sagenumwobenen Aurora wäre mehr als genug, um mein eigenes Transportunternehmen zu gründen. Selbst wenn sie auf dem offiziellen Markt nicht genug einbringen sollten, auf dem Schwarzmarkt für Kuriositäten und Souvenirs tun sie es ganz bestimmt. Wenn man selbst der Boss ist, muss man weder »sozialkompatibel« noch ein »Menschenfreund« sein.
Voller wippt nervös mit dem Bein, nur seine Hände bleiben ruhig.
Ist es möglich, dass er und ich ausnahmsweise mal einer Meinung sind?
Lourdes sieht mich verunsichert an. »TL?«
»Claire«, sagt Kane, und in seiner Stimme liegt eine Warnung.
Als ich nichts erwidere, dreht Voller sich in meine Richtung, den Kopf leicht geneigt. Was auch immer er in meinem Blick zu erkennen glaubt, es scheint zu bestätigen, was er denkt, denn auf sein schmales Gesicht tritt ein breites Grinsen.
»Genau das habe ich vorhin mit verrückt gemeint«, sagt er und deutet auf mich. »Scheiß auf die Ginsburg. Wir werden reich, Baby!«
Damit wendet er sich der Tastatur zu und tippt die Koordinaten ein, woraufhin die LINA in Richtung der Aurora beschleunigt. Ich gerate leicht ins Schwanken von dem Richtungswechsel, bis der Mikrograv-Generator aufgeholt und unser Schwerefeld auf »abwärts« umgestellt hat. Mir wird kurzzeitig übel, allerdings bin ich nicht sicher, ob das an der abrupten Bewegung liegt oder an der Entscheidung, die ich soeben getroffen habe.
»Wir haben keine Ahnung, was dort drüben passiert ist«, sagt Kane und macht einen halben Schritt zurück, damit er mir in die Augen sehen kann. »Wir wissen nicht einmal, ob es sicher ist …«
»Dann kann es ja nicht schaden, es zu überprüfen«, entgegne ich und verschränke die Arme vor der Brust.
»Kann nicht schaden?«, wiederholt Kane ungläubig. »Soll das ein Witz sein?«
»Was ist los? Was machen Sie da?«, fragt Lourdes unseren Piloten, wobei ihre Stimme immer höher wird.
»Das Findergesetz, Baby«, krakeelt Voller.
Ich verziehe das Gesicht. Er hat ja recht, aber ein bisschen mehr Pietät wäre trotzdem angebracht.
»Was soll das bedeuten?« Lourdes blickt zwischen mir und Kane hin und her.
Doch Kane hebt nur wortlos die Hände – ob als Zeichen der Kapitulation oder aus Verärgerung, kann ich nicht sagen – und verlässt die Brücke.
»Es bedeutet, dass wir ein verlassenes Schiff gefunden haben«, antworte ich. Oder zumindest mit niemandem mehr an Bord, der Anspruch darauf erheben könnte. »Und das wiederum bedeutet …«
»Dass die Aurora uns gehört«, fällt Voller mir ins Wort.
4
Aus der Nähe ist die Aurora beunruhigend groß. In der LINA komme ich mir vor wie eine Zecke, die auf einem silbernen Monstrum herumkrabbelt, das mich nur nicht abgeschüttelt hat, weil es entweder meine Anwesenheit noch nicht bemerkt hat oder noch nicht ausreichend genervt von mir ist.