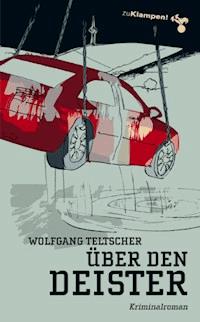Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
In einem kleinen See in Barsinghausen am Rande des Deisters findet man die Leiche des Kommissars i. R. Alfred Matuschek. Kommissar Marder aus Stade wird beauftragt, den mysteriösen Tod seines ehemaligen Kollegen zu untersuchen. Er spricht mit der Familie und den Freunden und Bekannten des Toten. Vordergründig scheint es, als ob alle Menschen in Matuscheks Umfeld in harmonischer Beziehung zu dem Toten gelebt hätten. Erst als Marder Zweifel kommen und er diese Harmonie in Frage stellt, kann er das überraschende Geheimnis um den Tod von Alfred Matuschek lösen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.zuklampen.de
Informationen zum Buch
In einem kleinen See in Barsinghausen am Rande des Deisters findet man die Leiche des Kommissars i. R. Alfred Matuschek. Kommissar Marder aus Stade wird beauftragt, den mysteriösen Tod seines ehemaligen Kollegen zu untersuchen. Er spricht mit der Familie und den Freunden und Bekannten des Toten. Vordergründig scheint es, als ob alle Menschen in Matuscheks Umfeld in harmonischer Beziehung zu dem Toten gelebt hätten. Erst als Marder Zweifel kommen und er diese Harmonie in Frage stellt, kann er das überraschende Geheimnis um den Tod von Alfred Matuschek lösen.
Informationen zum Autor
Wolfgang Teltscher, Jahrgang 1941, hat sein Arbeitsleben für eine deutsche Fluggesellschaft als Fachmann für Marketing und Verkauf in einigen zentralen Städten der Welt verbracht. Nun, im Ruhestand, lebt er mit seiner Frau in Barsinghausen am Deister und schreibt.
Wolfgang Teltscher
DeisterKreisel
Kriminalroman
Impressum
©2010 zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe [email protected] www.zuklampen.de 2. Digitale Auflage 2012 Zeilenwert GmbH Herausgegeben von Susanne Mischke
Titelgestaltung: Angelika Konietzny (www.izwd.de), Hannover Konvertierung: Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN 978-3-86674-078-5
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vorwort
Barsinghausen am Deister gibt es tatsächlich. Ich lebe dort gern und kann den Lesern dieses Romans einen Besuch in unserer Stadt empfehlen. Bei der Beschreibung des Ortes habe ich mir alle Freiheiten genommen, die mir für Ablauf der Handlung nötig erschienen. Sollten Sie auch in Barsinghausen leben, können Sie versichert sein, dass keine einzelne Person als Vorbild für die Menschen in dieser Geschichte gedient hat. Alle Akteure sind vollständig meiner Fantasie entsprungen. Als Leser haben Sie trotzdem die Freiheit, sich über mich oder den Roman zu ärgern.
Wolfgang Teltscher
1
Er warf die Zeit ins Wasser. Sie versank zwischen den Enten, gefangen in der Uhr, die er von seinem Arm genommen hatte. Die digitale Anzeige hatte ihm mitgeteilt, dass es 9.53 Uhr am ersten Tag im November war – aber Zeit bedeutete ihm nichts mehr, sie war eine Last geworden. Er würde die Uhr nicht vermissen. Seine Kollegen hatten sie ihm zum Abschied geschenkt, das war gestern gewesen, der letzte Tag, an dem Zeit eine Rolle spielte. Zuerst hatte er sie nicht annehmen wollen, aber Brenner und die anderen sahen ihn mit fordernden Blicken an und er hatte nicht die Energie, dieses Geschenk abzulehnen. Als er die Uhr um sein Handgelenk gebunden hatte, um eine unnötige Diskussion zu vermeiden, dachte er: So müssen sich die Täter gefühlt haben, wenn ich ihnen Handschellen angelegt habe.
Alfred Matuschek, der ehemalige Leiter der Kriminalpolizei in Barsinghausen, saß auf einer Bank am Teich im Stadtpark. Die Bäume trugen ihre Herbstblätter. Sie wirkten müde und schienen sich mit letzter Kraft an die Zweige zu klammern. Matuschek kam in den Sinn, dass jetzt der Moment für die zweite Tasse Kaffee des Vormittags war, die ihm normalerweise, jedenfalls bis gestern, seine Sekretärin, Fräulein Heinsen, Hildegard, lächelnd ins Zimmer brachte, mit Tadel im Blick, weil er zu viel und zu starken Kaffee trank. Fräulein Heinsen trank nie Kaffee, gelegentlich eine heiße Schokolade, die sie im »Dritte-Welt-Laden« kaufte, weil sie etwas für die Menschen in den unterentwickelten Ländern tun wollte.
Matuschek starrte vor sich hin. An diesem Morgen war er wie an jedem Tag seit vierzig Jahren kurz vor sieben aufgewacht, war ins Badezimmer geschlurft, hatte sich den Schlaf aus den Augen gewaschen, sich mit Gesichtswasser eingerieben, seine Zähne geputzt, horizontal und senkrecht, wie es sein Zahnarzt empfahl, dann hatte er sich die Zunge im Spiegel entgegengestreckt und festgestellt, dass nichts daran auf eine kommende Erkältung hinwies. Wenn das der Fall gewesen wäre, es hätte ihn nicht beunruhigt. Er zog danach seinen dunklen Anzug an und machte sich auf den Weg ins Büro, sogar seine Aktentasche nahm er wie gewöhnlich mit.
Unterwegs war ihm eingefallen, dass er kein Ziel hatte. Niemand erwartete ihn im Büro, sein Schreibtisch war nicht mehr sein Schreibtisch. Seine Frau hatte ihn nicht aufgehalten, als er die Wohnung verließ – wahrscheinlich hatte sie gar nicht mitbekommen, dass es in seinem Leben keine sinnvollen Tage mehr gab. Vermutlich war sie froh über einen letzten Tag, an dem sie das Haus für sich allein hatte. Vera und er hatten gestern kaum miteinander gesprochen, das unterschied den Tag nicht von anderen. Sie fragte abends nicht nach seinem Abschied im Büro, und er hatte nichts davon erzählt.
Alfred Matuschek registrierte die Tauben, die zu seinen Füßen hin und her trippelten und aufgeregt gurrten, als missbilligten sie, dass er auf der Bank saß, ohne ihnen etwas mitgebracht zu haben. Er öffnete seine Aktentasche und fand das Mittagsbrot vom Tag zuvor, seinem letzten Arbeitstag. Er selbst hatte es mit den Resten einer Leberwurst belegt, in Folie gewickelt und in die Tasche gesteckt, war aber nicht dazu gekommen, es zu essen. Seine Kollegen lauerten ihm mittags mit ein paar Schnittchen und der Rentneruhr auf. »Die Henkersmahlzeit«, dachte er, ohne es auszusprechen. Das Brot in der Tasche hatte er darüber vergessen. Er zerriss es in kleine Stücke und warf es zwischen die Vögel. Ihm fiel auf, dass es selbst unter Tauben eine Hackordnung gab. Egal, wo die Häppchen auf die Erde fielen, es waren stets die feistesten Tiere, die als Erste darauf einpickten – die niedrigeren Ränge warteten, ob etwas übrig blieb, bevor sie sich zögernd bedienten.
Er dachte noch einmal an die Uhr. Die Kollegen hatten augenzwinkernd gescherzt, sie solle ihm helfen, seine Zeit einzuteilen – es sei ja bekannt, dass Ruheständler stets unter Zeitnot litten. Sie wiederholten diese ewig gleiche alberne Bemerkung über den »Unruhestand« der Pensionäre und Rentner. Keiner von ihnen machte sich die Mühe, sich etwas Originelles einfallen zu lassen. Keiner von ihnen würde ihm nachtrauern. Er selbst erkannte in der Uhr ihre Erleichterung darüber, dass seine Zeit als Polizist im Dezernat abgelaufen war.
Matuschek wurde sich bewusst, dass er in seinem förmlichen Anzug und der Aktentasche auf den Knien für andere Besucher des Parks wie eine verlorene, lächerliche Figur wirken musste. Die Tasche aus schwarzem Leder passte nicht zu einem alten Mann im Park, der Tauben füttert und zusieht, ob die Zeit vergeht, langsam, ohne dass etwas passiert, was das Warten lohnt. Niemand außer ihm war zu dieser trostlosen Jahreszeit auf die Idee gekommen, den Vormittag an dem Teich zu verbringen.
Mehr als zwanzig Jahre hatte er in dieser Aktentasche seine Fälle, zuweilen auch Morde, mit sich herumgetragen, manchmal auch die Täter, die noch nicht wussten, dass er sie aufgespürt hatte und er lediglich noch die Beweise suchte, mit denen er sie vor Gericht und ins Gefängnis bringen würde.
Mörder, die ihre Tat kaltblütig planen, tun es in der Überzeugung, den perfekten Mord begehen zu können. Solche Fälle waren ihm am liebsten gewesen. Wenn er die Täter zur Strecke gebracht hatte und in seiner Tasche spazieren trug, hatte er große Befriedigung empfunden. Er hielt es für ein Zeichen von Dummheit, wenn Menschen glaubten, einen perfekten Mord begehen zu können. Die waren zu aufgeregt, um Fehler zu vermeiden, auch wenn sie das Verbrechen bis ins kleinste Detail vorausgeplant hatten. Als Kommissar hatte er die Geduld gehabt, Spuren solange nachzugehen, bis sie ihn zu dem Schuldigen führten.
Bei Verbrechen, die aus Leidenschaft – Liebe, Hass, Eifersucht – geschahen, waren die Täter am schnellsten aufzuspüren. Sie waren gleichzeitig Täter und Opfer, sie hatten meistens weder den Willen, sich zu verstecken, noch die Kraft dazu.
Er hatte bei seinen Ermittlungen in viele Seelen geblickt, ohne dabei etwas von seiner eigenen preiszugeben. Darin sah er seine Stärke und seinen Vorteil. Einen perfekten Mord zu begehen, wäre nur für jemanden möglich, der genau wusste, wie die Kriminalpolizei arbeitete, ihre Schwächen und Stärken kannte. Er war fest überzeugt, dass er selbst dazu in der Lage wäre. Dieser Gedanke kam ihm heute zum ersten Mal, vielleicht weil er nun nicht mehr zur Polizei gehörte.
Matuschek war stolz darauf, im Dienst keiner von den hektischen Beamten gewesen zu sein, die mit Blaulicht und Tatütata durch das Land rasen, wahllos Zeugen vernehmen und in den Sackgassen von Lügen und Misstrauen landen. Er zog es vor, an seinem Schreibtisch über seine Fälle und die Motive der Verdächtigen nachzudenken. Oft löste sich ein Verbrechen dabei fast von allein. Das war kein spektakulärer Arbeitsstil, aber er passte zu ihm, weil er kein spektakulärer Typ war. Es reichte ihm, dass die Ergebnisse seiner Untersuchungen von der Presse gelegentlich als »spektakulär« bezeichnet wurden. Einigen Kollegen passte diese Art der Ermittlungen nicht, weil Matuschek sie damit in ihrer Aufgeregtheit lächerlich machte. Sie meinten, es sei oft nur das Glück, das ihm bei der Lösung eines Verbrechens half, und sagten das auch laut, sogar dann, wenn er es hören konnte.
Matuschek hatte ein halbes Jahr vor seinem Ruhestand einen Antrag auf Verlängerung seiner Dienstzeit gestellt. Der Antrag war abgelehnt worden, ohne dass er einen Grund dafür erkennen konnte. Zwei oder drei Jahre zusätzlicher Dienst wären bei gutem Willen seiner Vorgesetzten und wohlwollender Auslegung der Regeln möglich gewesen; vor allem bei dem Mangel an Personal in der Dienststelle, über den unter den Kollegen ständig geklagt wurde. Er vermutete, dass man froh war, ihn loszuwerden, und ihm war klar, dass es sinnlos war, gegen diese Entscheidung anzugehen.
Er hatte den geheuchelten Worten zum Abschied entgehen wollen, hatte ausdrücklich auf eine Verabschiedungsfeier verzichtet und alle Anfragen wegen eines Geschenks abgewimmelt. Er beabsichtigte, den letzten Tag im Büro wie jeden Tag zu beenden. Er wollte die noch nicht abgeschlossenen Fälle in der Aktentasche an seinen Nachfolger übergeben und zum Feierabend still nach Hause gehen. Die belegten Brote, welche die Kollegen als Abschiedsimbiss hingestellt hatten, empfand er als Hohn. Die Armbanduhr, die man ihm aufgedrängt hatte, würde den Rest seines Lebens nicht bereichern.
Fast vier Wochen später, am 27. November, ließ sich Sabine Engelmann auf der Bank am Teich, auf der Alfred Matuschek am Anfang des Monats gesessen hatte, zum ersten Mal von ihrem neuen Freund küssen. Es war nicht so aufregend wie sie gehofft hatte, aber sie versuchte trotzdem, sich darauf zu konzentrieren. Als sie zufällig über die Schulter des jungen Mannes blickte, sah sie ein Krokodil im Wasser treiben. Das kam ihr für einen Teich am Rande des Deisters ungewöhnlich vor, und sie schaute genauer hin. Sie stellte fest, dass sie sich geirrt hatte. Es war der Körper eines Menschen, der im Wasser lag.
2
»Die Augen auf den Ball halten und beim Schlagen in die Knie gehen«, sagte Vera zwischen den Ballwechseln immer wieder zu sich selbst. Jedes Mal, wenn der kleine gelbe Ball über das Netz auf sie zuflog, ergriff sie eine innere Erregung und Freude. Dann hieb sie überhastet auf ihn ein. Wieder hatte sie ihn wegen mangelhafter Hand-Augen-Koordination unsauber getroffen. Vera konnte nicht verhindern, dass ihre Blicke zu früh auf die andere Seite des Platzes wanderten und dem Gegner verrieten, wohin sie den Ball spielen würde.
Vera war ehrgeizig. Sie war eine gute Spielerin, besser als die meisten Frauen, mit denen sie sich auf dem Tennisplatz maß. Für Vera war jedes Spiel ein Kampf. Ihr Ziel war immer der Sieg, und sie lächelte während des Spieles nur wenig, das hätte ihre Konzentration gestört. Vera fiel es schwer, ein Spiel nicht ernst zu nehmen, bei dem es Sieger und Verlierer gab.
Heute war Vera die Ersatzspielerin in einem Quartett, das normalerweise nur aus Herren bestand. Einer von ihnen hatte kurzfristig abgesagt. Mit Männern zu spielen, gab ihr große Genugtuung, sie zog Männer als Partner oder Gegner weiblichen Spielern vor. Sie merkte, dass Männer ebenfalls gern mit ihr spielten, weil sie keine Rücksicht darauf nehmen mussten, dass sie »nur« eine Frau war. Sogar am Netz, wo Männer die Bälle mit Potenz und Überheblichkeit ins gegnerische Feld schmettern, stand sie ihre Frau. Ihre Volleys waren ebenso dynamisch und entschlossen wie die ihrer männlichen Mitspieler.
Außer ihrem kraftvollen Spiel hatte Vera nichts Männliches an sich. Sie legte Wert darauf, dass die Partner ihre Weiblichkeit bemerkten. Dennoch hatte sie nichts für die extrem kurzen Röckchen übrig, mit denen manche Frauen auf dem Platz erschienen, obwohl deren füllige Beine nach dem Sichtschutz einer Trainingshose geradezu bettelten. Vera kleidete sich nach dem letzten Chic der Saison, der ihren Körper zur Geltung brachte, ohne aufdringlich zu wirken.
Vera steckte ihre Ziele grundsätzlich hoch, nicht nur auf dem Tennisplatz. Das Verlangen nach Perfektion, das ein wesentlicher Teil ihres Charakters war, erwartete sie auch von den Menschen, mit denen sie zusammenlebte.
Ein wichtiger Aspekt in Veras Leben war ihre Ehe mit Alfred – er gab ihr finanzielle Sicherheit, wenn auch nicht den Luxus, den sie sich immer gewünscht hatte. Am Anfang suchten sie Bekanntschaften mit anderen Ehepaaren, die jedoch oft nicht länger als ein paar gemeinsame Abende gedauert hatten. Sie versuchte, zu ergründen, woran das liegen konnte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Sie fand bei sich selbst keine Schuld. Als ihre Gefühle für Alfred schwächer geworden waren, lernte Vera im Tennisverein oder auf Reisen andere Männer kennen. Zu einigen der Männer, die sich für sie interessierten, fühlte sie sich anfangs hingezogen, aber beim dritten Hinschauen war keiner dabei, den sie im Schlafanzug und beim Frühstücks-Müsli neben sich haben wollte.
Vera und Alfred hatten sich trotz ihrer schwindenden Liebe füreinander bemüht, ihren Kindern gute Eltern zu sein. Solange Bertram und Anja klein waren, war das nicht besonders schwierig gewesen. Ihre gemeinsame Absicht, den Kindern ein normales Familienleben zu bieten, hatte sie diszipliniert und war Motivation genug, miteinander ohne ständigen Streit auszukommen. Gelegentlich hatten Bekannte sie sogar als Vorbild für andere Eltern hingestellt.
Den Mangel an Ehrgeiz ihrer Kinder hätte Vera besser ertragen, wenn ihr Mann auf der Karriereleiter höher geklettert wäre. In den ersten Jahren bei der Polizei war er in akzeptablen Abständen von Rang zu Rang aufgestiegen, bis er Hauptkommissar geworden war. Weiter wollte er nicht, denn er war der Meinung, dies sei die letzte Position, in der er sich konkret mit der Lösung einzelner Fälle beschäftigen könne. Alles was danach käme, verpflichte in erster Linie zu Papierarbeit und Bürokratie, das läge ihm nicht, das wäre zu weit weg von den Tätern, die er mit Leidenschaft jagte und die er meistens früher oder später zur Strecke brachte.
Alfred hatte nie seine Gleichgültigkeit in Bezug auf seine Kleidung ablegen können. Er trug jahrelang den gleichen dunklen Anzug im Büro, der dem Up-to-date-Stil der Mode um Jahre hinterher hing. Vera hatte am Beginn ihrer Ehe versucht, ihm modischere Kleidung aufzudrängen, damit der optische Unterschied zwischen ihm und seinen Chefs in der Hierarchie der Kriminalpolizei nicht zu deutlich wurde. Sie mochte kaum hinschauen, wenn Alfred an der Seite eines Vorgesetzten auf dem Bildschirm erschien, um den Journalisten der örtlichen Presse und des lokalen Fernsehens den Erfolg bei der Suche nach einem Verbrecher mitzuteilen.
Altmodisch fand sie auch seine Angewohnheit, belegte Brote ins Büro mitzunehmen, anstatt sich mit Kollegen in der Kantine zum Mittagessen zu treffen. Er schlang seine Schnitten am liebsten einsam am Schreibtisch hinunter, während er sich mit Krümeln in den Mundwinkeln mit abscheulichen Verbrechen befasste.
Vera packte ihre Tennistasche zusammen. Sie hatte mit ihrem Partner das Spiel nach drei Sätzen und erbitterter Gegenwehr verloren. Sie musste bis zum nächsten Gefecht gegen Männer unbedingt an ihrem Service arbeiten, vor allem ihr zweiter Aufschlag war nicht hart genug und bot den Gegnern die Chance für einen schnellen Punktgewinn.
Für den Rest des Tages stellte sie sich auf einen ereignislosen Abend zu Hause ein. Dann fiel ihr ein, dass heute eigentlich ein besonderer Tag war. Es war der erste Tag im November und gleichzeitig der erste Tag, an dem Alfred nicht mehr zum Dienst gehen musste. Das hatte sie ganz vergessen.
Vera verspürte im Moment keine Lust, über ihren Mann nachzugrübeln. Ihre Gedanken kreisten um den Tennispartner, mit dem sie gerade das Spiel verloren hatte. Er hatte sich als Christian Neuberger vorgestellt, sah attraktiv aus und hatte anerkennend Beifall geäußert, wenn ihr ein guter Passierball, Lob oder Volley geglückt war. Seinen Namen wollte sie sich auf jeden Fall merken.
Martin Strecker saß am Abend des 27. November vor dem Fernseher in der Notrufzentrale und ärgerte sich über den VfB Stuttgart. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit begingen die Schwaben wieder einmal einen ihrer typischen Fehler, wenn die Abwehr unter Druck geriet. Statt den Ball zielstrebig aus der eigenen Hälfte zu klären, schoben sie ihn vor dem eigenen Strafraum auf der Suche nach dem genialen Steilpass hin und her, bis ein Stürmer des FC Bologna dazwischen gesprintet war und ihnen den Ball wegnahm. Dann schoss er ihn aus kurzer Entfernung am Torwart, aber leider nicht am Tor vorbei. Mit dieser leichtsinnigen Spielweise würden die Stuttgarter nie die Hauptrunde der Champions League erreichen.
Stuttgart war sein Verein und würde es immer bleiben. Als er vierzehn Jahre alt war, war sein Vater nach Hannover versetzt worden, weil die Aufträge für seine Firma von Mercedes immer magerer und die von Volkswagen immer fetter wurden. Vor dem Umzug nach Norddeutschland war Martin gerade in Leidenschaft für den VfB entbrannt und er entschloss sich, diesem Verein niemals untreu zu werden.
Zwei Minuten nach dem Halbzeitpfiff schrillte das Telefon. Ein junger Mann meldete sich aufgeregt von seinem Handy aus. Er und seine Freundin hätten im Ziegenteich einen Körper gefunden, der eine Leiche sei, jedenfalls würde »der Typ nicht mehr atmen«, wie sich der Anrufer ausdrückte. Martin fragte nach ihren Namen und die genaue Stelle, an der sie sich befanden. Dann alarmierte er sofort Polizei, Notarzt und Feuerwehr. Danach wandte er sich wieder dem Fernseher zu, um nicht zu verpassen, was Günther Netzer und Gerhard Delling über die erste Halbzeit zu sagen hatten.
3
Nachdem er zweihundert Meter gelaufen war, atmete er schwer und spürte deutlich, wie sein Herz schneller schlug. Das passierte jedes Mal, wenn er mit dem Joggen anfing, denn die Straße von seinem Haus bis zum Waldrand war der steilste Teil seiner Laufstrecke. Selbst wenn ich jetzt wieder nach Hause zurückgehe, dachte er, hätte ich schon etwas für meine Gesundheit getan. Das sagte er sich immer nach den ersten fünf Minuten, die ihm beim Laufen besonders schwer fielen und während deren er am liebsten wieder umgekehrt wäre. Ihm war bewusst, dass dieser Gedanke Selbstbetrug war, deshalb lief er weiter.
Bertram Matuschek lief in den Waldweg hinein, der am Hang entlang leicht aufwärts führte, bis er sich kurz unterhalb des Kammes des Deisters zwischen den Bäumen auflösen würde. Er überquerte die erste Kuppe des Weges, nun ging es für eine Weile weniger steil bergauf. Links standen junge Birken und Erlen, die vor ein paar Jahren, als er hier zum ersten Mal gejoggt war, gerade neu gepflanzt worden waren. Auf der anderen Seite lag eine freie Fläche. Hier war vor zwei Jahren im Herbst eine Windhose über den Deisterkamm eingefallen und hatte die alten Bäume platt gewalzt. Nun spross das Unterholz und die ersten Bäumchen trauten sich wieder ans Licht. Sie waren jetzt, Anfang November, kaum auszumachen. Ihre dürren Stämme und die blattlosen Äste verloren sich zwischen dem trockenen Gestrüpp. Der Wald hat sich über Jahrhunderte immer wieder mühsam selbst erneuert, dachte er. Heute sorgen wir Forstwirte dafür, dass es schneller geht. Aber kaum jemand dankt es uns, die Leute denken, wir gehen nur zum Zeitvertreib im Wald spazieren.
Der Nadelwald, der nun begann, war düster, ungastlich, beinahe unheimlich. Er war ein Vermächtnis des letzten Weltkrieges und der Nachkriegszeit, als erst die Einheimischen große Teile des Laubwalds zum Heizen abholzten und danach die Engländer den Rest, als Wiedergutmachung für den Schaden, den die deutschen Raketen in ihrem Land angerichtet hatten. Das hatte ihm ein alter Mann erzählt, den er beim Spazierengehen im Wald getroffen hatte. Ob das mit den Engländern wirklich stimmte, wollte er immer schon mal im Archiv des Forstamts nachprüfen, war aber bisher noch nicht dazu gekommen. Als das Wirtschaftswunder in Gang kam, und damit auch die Forstwirtschaft, hatte man große Flächen mit schnell wachsenden Nadelbäumen bepflanzt, doch als sie 40 Jahre später zum Ernten reif waren, gab es für ihr Holz kaum Bedarf. Sie dämmerten nun als trostlose Waldflächen im Halbdunkel vor sich hin. Glücklicherweise standen vereinzelte Laubbäume zwischen den schnurgeraden Reihen der Fichten und Tannen, dort wo Stürme Lücken in die Monokulturen gerissen hatten. Sie waren die fruchtbaren Oasen in der Wüste der Nadelbäume. Den Rest des Waldes würde die Zeit heilen und Forstbeamte wie er selbst, die überall, wo es freie Flächen gab, Laubbäume pflanzten.
Eine junge Frau mit zwei kleinen feisten Hunden an der Leine kam ihm entgegen. Er nickte ihr schwer atmend zu, sie grüßte freundlich zurück. Die Leute im Ort können dankbar dafür sein, fand er, dass sie den Wald direkt vor ihrer Haustür haben. Nicht in vielen Städten können die Hundebesitzer mit ihren Lieblingen gleich um die Ecke im Wald Gassi gehen.
Inzwischen hatte er die letzte Kurve vor dem Ende seiner Laufstrecke erreicht. Vor zwei Tagen lagen hier noch geschälte Holzstämme. Sie mussten gestern abgeholt worden sein. Davon hätte er, entsprechend der Wald-, Holz- und Forstordnung, eigentlich unterrichtet werden müssen, aber wie sooft funktionierte die Kommunikation zwischen dem Forstamt und den Unternehmen der Holzwirtschaft nicht. Nach einem kurzen letzten Anstieg erreichte er den höchsten Punkt der Strecke. Hier war der Wendeplatz für die Fahrzeuge, die das Holz aus dem Wald holten. Mit ihrem Gewicht hatten sie den Waldboden aufgerissen, der Platz wirkte wie eine offene Wunde. Ein paar Opfer sind unvermeidlich, bedauerte Bertram, wenn wir die Natur für uns nutzen wollen. Die Erde kann nicht als ein paradiesischer Garten erhalten werden, wenn sich sechs Milliarden Menschen von ihr ernähren.
Als Bertram sein Studium zum Forstwirt beendet hatte, war er aus dem Haus seiner Eltern ausgezogen und hatte eine eigene Wohnung am Waldrand gemietet. Er hätte es gern früher getan, aber das konnte er sich nicht leisten. Dazu hätte er sich unmittelbar nach dem Abitur eine Arbeitsstelle suchen müssen, und seine Mühen für eine gute Abiturnote wären sinnlos gewesen.
Als er ein kleiner Junge war und noch Wünsche frei hatte, hatte Bertram davon geträumt, Bauer zu werden. Er hätte Weizen, Rüben und Mais angebaut, auf Feldern, die von einem großen Wald umgeben waren – und nebenher noch Rinder und Schweine gezüchtet. Als er das Leben später realistischer betrachtete, musste er feststellen, dass er keine Aussicht hatte, einen Bauernhof zu erben. Da hatte er sich entschlossen, Forstwirtschaft zu studieren. Der Wald hatte ihn immer fasziniert.
Seine Schwester Anja war zwei Jahre jünger als er, auch sie wohnte nicht mehr zu Hause, seit sie mit ihrer Ausbildung fertig war. Sie war Krankenschwester und lebte allein in einer kleinen Wohnung, wenn sie nicht gerade einen festen Freund hatte. Bertram sah sie nicht oft, ihre Gefühle füreinander waren nicht so tief wie bei anderen Geschwisterpaaren, die er kannte. Sie hatten sich nicht viel zu sagen – das war schon früher, als sie noch bei den Eltern lebten, so gewesen.
Bertram war das Familienleben während der letzten Jahre zu Hause manchmal wie ein Bühnenstück vorgekommen. Bei dem tragischen Stück für vier Personen, das sie aufführten, fiel kein Vorhang nach der Vorstellung, sondern die Bühne war ihre Realität, der sie nicht entkommen konnten. Gespräche zwischen den Mitspielern waren oft wie Texte, in denen jeder sagte, was für den Fortgang des Dramas notwendig erschien, und nicht das, was er wirklich dachte. Zu dem Spiel gehörte auch, dass er und seine Schwester nie über ihre Rollen sprachen. Das war wahrscheinlich der Grund, dass er und Anja so wenig Gefühl füreinander entwickelt hatten.
Als Bertram über seine Familie nachdachte, fiel ihm ein, dass sein Vater heute in den Ruhestand gegangen sein müsste. Er überlegte sich, ob er ihn deswegen anrufen sollte, sah jedoch keinen Grund, warum er mit ihm darüber sprechen wollte.
Claus Biederstaedt war gerade dabei, Karin Dor für alle Zeiten aus seinem Herzen zu reißen. Das hatte er gestern bereits in Hameln gemacht, würde es morgen in Wunstorf wieder tun und nächste Woche noch zweimal im Theater am Aegi in Hannover.
Dr. Helmut Schnitzler genoss mit gutem Gewissen die Vorstellung des Tournee-Theaters in der Aula des lokalen Gymnasiums, obwohl er heute Abend der Notarzt im Einsatz für die Rettungsdienste der Stadt Barsinghausen war. Er verstieß damit nicht gegen die Regeln, solange er jederzeit telefonisch zu erreichen war. Handys waren eine tolle Erfindung. Es wäre ihm allerdings peinlich, wenn es gerade jetzt klingelte. Er musste in diesem Fall mit einer witzigen oder abfälligen Bemerkung von den Schauspielern auf der Bühne rechnen. Sie konnten ja nicht wissen, dass er bei einem Anruf vermutlich ein Menschenleben zu retten hatte.
Er konzentrierte sich wieder ganz auf die Probleme der beiden verliebten Stars auf der Bühne, als sich sein Handy mit den ersten Takten einer Symphonie von Beethoven meldete. Hastig sprang Dr. Schnitzler auf und rannte ins Foyer, bevor ein Schauspieler ironisch reagieren konnte.
»Schnitzler hier. Was gibt es?«
»Herr Doktor, wir hatten gerade einen Anruf, dass ein Körper im Teich im Stadtpark gefunden wurde, vermutlich ist der Mann schon tot. Sie müssen sofort dorthin, vielleicht können Sie noch etwas ausrichten.«
Wenige Minuten später kam Helmut Schnitzler am See an. Der Körper eines älteren Mannes lag auf dem Rasen. Ein Sanitäter war über ihn gebeugt und drückte rhythmisch mit seinen Handflächen auf den Brustkorb. Schnitzler suchte den Pulsschlag des Mannes, zog dessen Augenlider nach oben und leuchtete mit einer Taschenlampe in seine Pupillen. Er wusste sofort, dass es für ihn hier nichts mehr zu tun gab. Er untersuchte die Leiche, um zu sehen, ob er eine offensichtliche Todesursache entdecken konnte. Er kam zu dem Schluss, dass der Mann ertrunken war. Wie das geschehen war, musste die Polizei klären.
4
Die Hände der Friseurin wanderten von der Stirn zum Hinterkopf, griffen nach einem Haarbüschel, zogen ihn zwischen Zeigefinger und Mittelfinger nach oben und schnitten die Haarspitzen mit einer Schere ab. Anja empfand den Druck der Hände auf der Kopfhaut angenehm, wie eine Massage. Sie genoss die Stunde auf dem Friseurstuhl, während sie zusah, wie sich ihre Haare von Chaos in Ordnung verwandelten. Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, dann bestimmen das Gesicht und die Frisur den ersten Eindruck, den man voneinander hat, wusste sie. Wenn mir der Kopf eines Menschen nicht gefällt, lässt sich mit dem Rest des Körpers oder mit guten Worten später nicht mehr viel reparieren.
Anja trug ihre Haare am liebsten halblang, locker, wie zufällig um den Kopf drapiert, nicht zu verspielt, nicht zu streng. Sie war überzeugt, dass Frauen mit ganz kurzen Haaren, die nur kunstlose Frisuren zuließen, keinen Wert darauf legten, attraktiv auszusehen. Anja fielen Igel und Kakteen ein, wenn sie solche Frisuren sah. Vielleicht ist es für Frauen nicht mehr zeitgemäß, so zu denken, dachte sie, aber Männer beurteilen Frauen nun einmal zuerst danach, wie sie aussehen. Sie fand, dass schöne Frisuren mehr als Eitelkeit waren, vor allem für Frauen, die noch einen Mann suchten. Haare sind eine wichtige Waffe bei der Jagd nach dem richtigen Mann. Geld, das man für eine gute Frisur ausgibt, macht sich bezahlt.
Sie hatte einmal mit dem Gedanken gespielt, ihre Haare färben zu lassen, aber inzwischen meinte sie, dass das nicht nötig war. Die Natur hatte für sie die Haarfarbe ausgewählt, für die sie sich selbst entschieden hätte: Braun mit einem Schuss ins Rötliche. Sie fand, dieser Ton brauchte nicht verbessert oder verändert zu werden. Wenig Verständnis hatte sie auch für Frauen mit langen Haaren, die strähnig ohne sichtbare Ordnung herunterhingen. Die Idee, sie könnte so ungepflegt herumlaufen, war ihr ein Gräuel. Es leuchtete ihr ein, dass Menschen in früheren Jahrhunderten lieber Perücken trugen, als sich mit schlampiger Haartracht zu zeigen, auch wenn es darunter juckte. Adel verpflichtete eben, damals so wie heute. Sie würde gern in der Gesellschaft von Adligen oder Prominenten leben, das waren Leute nach ihrem Geschmack.
Anja atmete das Aroma von Shampoo und den Dunst von Haarspray ein, dabei betrachtete sie den Friseursalon hinter sich im Spiegel. Der Raum war modern eingerichtet. Von der Welt der gemütlichen Barbiere, die sie in alten Filmen gesehen hatte, war nichts übrig geblieben.
Anja dachte an ihre Eltern, die sich jedes Mal aufregten, wenn sie zum Friseur gingen und die Preise von heute mit denen in ihrer Kindheit verglichen.
Wie war wohl das Leben gewesen, als ihre Eltern so alt waren wie sie heute? Sie glaubte nicht, dass damals alles einfacher und deshalb schöner gewesen war, wie es die alten Leute oft behaupteten. Die Welt hatte sich weitergedreht, und denen, die sich nicht mitbewegen wollten oder konnten, war halt schwindlig geworden.
Vor allem ihr Vater konnte sich dem Fortschritt in der Welt schlecht anpassen. Er verheimlichte seine altmodischen Ansichten nicht und versuchte auch nie, sie zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Es war höchste Zeit, dass er in den Ruhestand ging.
Gestern war sein letzter Arbeitstag gewesen. Das hatte er während ihres letzten Besuchs bei den Eltern, vor ungefähr zwei Wochen, nebenbei erwähnt. Sie bedauerte, dass er keine Feier zu seiner Verabschiedung im Büro erlaubt hatte, zu der dann auch seine Familie eingeladen worden wäre.
Ihre Mutter hatte sich besser auf die heutige Zeit eingestellt als ihr Vater. Anja sah in ihr eine Frau, die man seinen Freunden vorstellen konnte, ohne sich gleich schämen zu müssen. Kein Wunder, dass das Verhältnis zwischen den Eltern angespannt war. Trotzdem war es zu Hause relativ friedlich zugegangen, obwohl die Eltern wenig miteinander sprachen, oder vielleicht gerade deswegen.
Mit ihrem Bruder Bertram hatte sie wenig gemeinsam, er war nicht der Typ von Bruder, den sie sich selbst ausgesucht hätte. Sie wusste nie, worüber Bertram nachgrübelte oder was er fühlte, wenn er sich schweigend durch das Haus bewegte. Anja hatte sich, seit sie ein Teenager war, auf ihr eigenes Leben konzentriert. Nach dem Abitur drängte ihre Mutter sie, Medizin zu studieren, aber Anja hatte sich dagegen gewehrt. Sie wollte nicht jahrelang zur Uni gehen und von Prüfung zu Prüfung büffeln, sie wollte ihr Leben genießen, solange sie jung war. Außerdem wurde im Fernsehen von zu vielen und schlecht bezahlten Ärzten berichtet, die endlose Überstunden leisten mussten. Das wurde in dem Krankenhaus, in dem sie inzwischen als Krankenschwester arbeitete, bestätigt. Sie war mit ihrem Dasein als Krankenschwester zufrieden: Die Arbeitszeiten waren geregelt, die Verantwortung bei weitem nicht so groß wie bei den Ärzten. Der einzige Nachteil war, dass ihre Bezahlung am Monatsende nicht den Gehältern der Doktoren entsprach.
Nach ihrer Ausbildung bekam sie eine Anstellung im Krankenhaus in Gehrden, wo sie in das Wohnheim für Schwestern eingezogen war. Sie hatte dort fast drei Jahre gelebt, es aber immer nur als Notunterkunft für eine begrenzte Zeit betrachtet. Im vorigen Jahr konnte sie es sich endlich leisten, eine kleine Wohnung in einem großen Wohnblock in Barsinghausen zu mieten. Aber dort wollte sie nicht ewig bleiben. Sie hoffte, einen Mann zu finden, der ihr ein Leben bieten konnte, wie sie es sich in ihren Träumen vorstellte. Natürlich wollte sie diesen Mann lieben – was sie bei einigen Männern bereits versucht hatte. Natürlich wollte sie auch von ihm geliebt werden – was bisher noch keinem für längere Zeit gelungen war.
Das Wetter war am 27. November in Barsinghausen nicht besonders freundlich, das wäre zu dieser Jahreszeit auch eher die Ausnahme gewesen. Es hatte nicht geregnet, aber am Himmel hingen statt Geigen graue Wolken, die sich in rascher Folge aus Westen über den Deister schoben. Die Sonne ließ sich nur für kurze Momente blicken, und als sie hinter die Hügel gekrochen war, war es schnell dunkel geworden. Die nächtliche Wolkendecke brach nur selten auf, dann kitzelten dünne Mondstrahlen die Erde. Die Lampen um den Ziegenteich schufen helle Flecken in ihrem unmittelbaren Umkreis, in die meisten Bereiche fiel jedoch kaum Licht.
Der Person, die in einer dunklen Ecke stand, war das recht. Sie konnte sehen, ohne gesehen zu werden. Als sie zu dem kleinen See gekommen war, war hier eine Szene im Gang, die ihr aus den Tatort-Folgen im Fernsehen vertraut war: Blinkende rote und blaue Lichter, Einsatzwagen der Feuerwehr, Polizeiautos, eine Notarzt-Ambulanz. Die Polizei hatte den Bereich, in dem man den Körper gefunden hatte, abgesperrt. Außer den Beamten der verschiedenen Rettungsdienste in ihren Uniformen und einem Arzt krochen ein halbes Dutzend Personen in Schutzanzügen aus weißem Plastik über den Boden. Das waren die Leute von der Spurensicherung. Die Person im Schatten wusste, dass sie nach Spuren suchten, die den Tod des Mannes im Wasser erklären sollten.
Sie sah, wie der Körper auf eine Bahre und in den Leichenwagen geschoben wurde. Die Männer verriegelten sorgfältig die Tür hinter dem Toten, als befürchteten sie, er könnte während der Fahrt verloren gehen. Alles geschah ohne besondere Eile, das ließ den Schluss zu, dass man auf dem Weg in die pathologische Abteilung war. Es ging nur noch darum, festzustellen, wie der Mann gestorben war. Die Person war unsicher, ob sie traurig oder erleichtert sein sollte.
5
So hatte er sich den Friesenmarkt nicht vorgestellt.
Das war er also, seit langem angekündigt, und nun in die Stadt gekommen. Die Atmosphäre von Küste, Schiffen und Watt hinter dem Deich sollte er bringen. Eine frische Brise aus salziger Luft wie an der Nordseeküste würde über die Hügel des Weserberglandes wehen, man würde das Rauschen der Brandung hinter den Bäumen hören, Krabbenpulen und Folklore von der Waterkant würden die Fußgängerzone in eine Hafenmole verwandeln. So jedenfalls war es in den Vorberichten der lokalen Presse beschrieben worden. Burt Brenner war darauf hereingefallen.
Er hatte sich der Fußgängerzone voller Erwartung genähert. Der erste Verkaufsstand war gleich die erste Enttäuschung: Statt Friesischem wurden billige Lederwaren – Gürtel, Handtaschen, Mützen – angeboten, dazu Socken, drei Paar für einen Euro. Nun, dachte er, solche Stände gibt es auf jedem Markt, das muss nichts bedeuten. Auch am nächsten gab es nichts von der Waterkant zu kaufen; dafür Lakritze in zwölf verschieden Formen und Farben, in ebenso vielen Geschmacksrichtungen. Haribo macht eben Friesenkinder froh, dachte er. Der Nachbar pries ein sensationelles Putzmittel für alle Dinge des Haushalts, von der Lese- bis zur Klobrille, zu einem Super-Spezialpreis an: »Nur hier und nur heute und nur solange der Vorrat reicht.«
Brenner fragte sich, warum man diesen Freiluftmarkt auf einen so späten Termin im Jahr – heute war der 31.Oktober – gelegt hatte. Das war eher die Zeit, in der man sich schon allmählich auf Weihnachtsmärkte freute. Die Antwort drängte sich auf: Der Friesenmarkt war eine ausschließlich kommerzielle Veranstaltung, ein »Verkaufs-Event«, der als Wanderzirkus von Ort zu Ort zog. Die attraktiveren, warmen Monate waren für größere Städte reserviert, in der kühleren Nebensaison wurden die Kleinstädte abgegrast. Brenner schlängelte sich durch die Besucher. Es sind erstaunlich viele Leute hier, dachte er. Ob wohl alle so enttäuscht sind wie ich.
Er hatte nicht geplant, sich lange auf dem Markt aufzuhalten. Er war auf dem Weg, zwei Platten mit belegten Broten von einem Feinkostladen am Ende der Fußgängerzone abzuholen. Die Schnittchen waren für den Abschied von Alfred Matuschek gedacht, der heute seinen letzten Arbeitstag hatte.