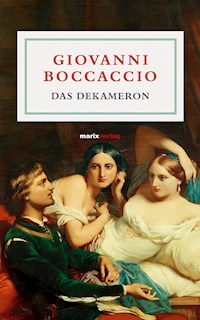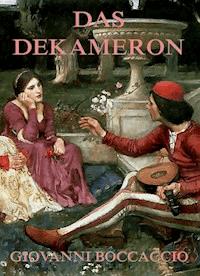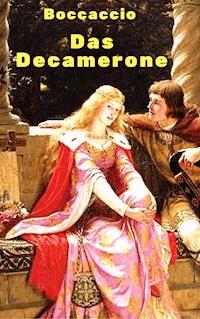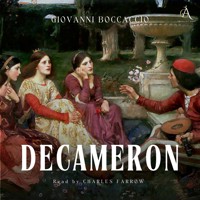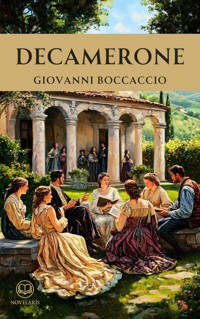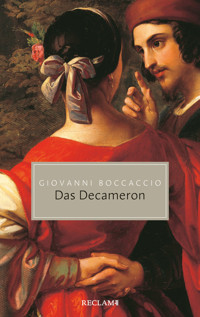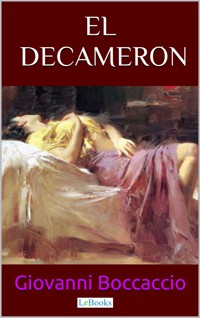Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Taschenbuch-Literatur-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn der 1350er Jahre verfasste Giovanni Boccaccio sein Meisterwerk, das Dekamerone. Zehn Personen, Frauen und Männer, haben sich in ein Haus nahe Florenz geflüchtet und versuchen sich zu unterhalten, so gut es eben geht angesichts der in der Umgebung wütenden Pest. Für jeden Tag bestimmen sie einen König, der ein Thema vorgibt. Zu diesem Thema muss sich dann jede und jeder eine Geschichte ausdenken, die den Anderen vorzutragen ist. Anschließend kehren die Zehn nach Florenz zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1130
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erste Erzählung.
Dritte Erzählung.
Vierte Erzählung.
Fünfte Erzählung.
Sechste Erzählung.
Siebente Erzählung.
Achte Erzählung.
Neunte Erzählung.
Zehnte Erzählung.
Elfte Erzählung.
Zwölfte Erzählung.
Dreizehnte Erzählung.
Vierzehnte Erzählung.
Fünfzehnte Erzählung.
Sechzehnte Erzählung.
Siebzehnte Erzählung.
Achtzehnte Erzählung.
Neunzehnte Erzählung.
Zwanzigste Erzählung.
Einundzwanzigste Erzählung.
Zweiundzwanzigste Erzählung.
Dreiundzwanzigste Erzählung.
Vierundzwanzigste Erzählung.
Fünfundzwanzigste Erzählung.
Sechsundzwanzigste Erzählung.
Siebenundzwanzigste Erzählung.
Achtundzwanzigste Erzählung.
Neunundzwanzigste Erzählung.
Dreißigste Erzählung.
Einunddreißigste Erzählung.
Zweiunddreißigste Erzählung.
Dreiunddreißigste Erzählung.
Vierunddreißigste Erzählung.
Fünfunddreißigste Erzählung.
Sechsunddreißigste Erzählung.
Siebenunddreißigste Erzählung.
Achtunddreißigste Erzählung.
Neununddreißigste Erzählung.
Vierzigste Erzählung.
Einundvierzigste Erzählung.
Zweiundvierzigste Erzählung.
Dreiundvierzigste Erzählung.
Vierundvierzigste Erzählung.
Fünfundvierzigste Erzählung.
Sechsundvierzigste Erzählung.
Siebenundvierzigste Erzählung.
Achtundvierzigste Erzählung.
Neunundvierzigste Erzählung.
Fünfzigste Erzählung.
Einundfünfzigste Erzählung.
Zweiundfünfzigste Erzählung.
Dreiundfünfzigste Erzählung.
Vierundfünfzigste Erzählung.
Fünfundfünfzigste Erzählung.
Sechsundfünfzigste Erzählung.
Siebenundfünfzigste Erzählung.
Achtundfünfzigste Erzählung.
Neunundfünfzigste Erzählung.
Sechzigste Erzählung.
Einundsechzigste Erzählung.
Zweiundsechzigste Erzählung.
Dreiundsechzigste Erzählung.
Vierundsechzigste Erzählung.
Fünfundsechzigste Erzählung.
Sechsundsechzigste Erzählung.
Siebenundsechzigste Erzählung.
Achtundsechzigste Erzählung.
Neunundsechzigste Erzählung.
Siebenzigste Erzählung.
Einundsiebenzigste Erzählung.
Zweiundsiebenzigste Erzählung.
Dreiundsiebenzigste Erzählung.
Vierundsiebenzigste Erzählung.
Fünfundsiebenzigste Erzählung.
Sechsundsiebenzigste Erzählung.
Siebenundsiebenzigste Erzählung.
Achtundsiebenzigste Erzählung.
Neunundsiebenzigste Erzählung.
Achtzigste Erzählung.
Einundachtzigste Erzählung.
Zweiundachtzigste Erzählung.
Dreiundachtzigste Erzählung.
Vierundachtzigste Erzählung.
Fünfundachtzigste Erzählung.
Sechsundachtzigste Erzählung.
Siebenundachtzigste Erzählung.
Achtundachtzigste Erzählung.
Neunundachtzigste Erzählung.
Neunzigste Erzählung.
Einundneunzigste Erzählung.
Zweiundneunzigste Erzählung.
Dreiundneunzigste Erzählung.
Vierundneunzigste Erzählung.
Fünfundneunzigste Erzählung.
Sechsundneunzigste Erzählung.
Siebenundneunzigste Erzählung.
Achtundneunzigste Erzählung.
Neunundneunzigste Erzählung.
Einhundertste Erzählung.
Erste Erzählung.
Man erzählt von einem gewissen Musciatto Francesie, der in Frankreich aus einem reichen und angesehenen Kaufmann ein Edelmann geworden war, und mit Charles Sansterre, dem Bruder des Königs von Frankreich (den der Papst Bonifacius zu sich berufen hatte, und der sich auch willig finden ließ) nach Toscana ziehen sollte, daß er (wie es den Kaufleuten oft zu gehen pflegte) sein Vermögen hie und da versteckt hatte, und weil es sich nicht in der Geschwindigkeit losmachen ließ, den Entschluß faßte, verschiedenen Personen den Auftrag zu geben, mit seinen Schuldnern Abrechnung zu halten! Er fand auch zu allem Rat; nur blieb er in Verlegenheit, wem er es auftragen sollte, mit gewissen Burgundern, die ihm schuldig waren, Richtigkeit zu treffen. Diese Verlegenheit entstand daher, daß er seine Burgunder als hartnäckige, übelgesinnte und betrügerische Leute kannte, und er wußte sich auf keinen Menschen zu besinnen, den er für verschlagen und listig genug gehalten hätte, um sich auf ihn genugsam verlassen und ihn seinen Schuldnern entgegensetzen zu können. Wie er lange genug darüber nachgedacht hatte, erinnerte er sich endlich eines gewissen Ser Ciapperello da Prato, der oft in sein Haus in Paris zu kommen pflegte, und den die Franzosen Ciappelletto zu nennen gewohnt waren; denn weil er klein von Person und sehr zierlich und geschniegelt war, und weil die Franzosen nicht wußten, was Ciapperello bedeuten sollte, sondern glaubten, er hieße vielleicht Cappello (Kranz), welches in ihrer Sprache Chapelet heißt, so nannten sie ihn, weil er so klein war, nicht Capello, sondern Ciappelletto, und unter diesem Namen war er allgemein bekannt, da hingegen wenige seinen rechten Namen Ciapperello wußten. Mit der Lebensart dieses Ser Ciappelletto hatte es folgende Bewandtnis: er war ein Notarius, würde sich aber gewaltig geschämt haben, wenn unter den wenigen Instrumenten, die er ausfertigte, sich ein einziges richtige befunden hätte; aber falsche zu schmieden, war er jeden Augenblick bei der Hand, und machte dergleichen lieber umsonst, als ein echtes für die beste Bezahlung. Falsches Zeugnis legte er ab mit dem größten Vergnügen, gebeten oder ungebeten; und da man zu der Zeit in Frankreich einem Eidschwur großen Glauben beimaß, so wurden alle Prozesse gewonnen, in welchen er zum Zeugen auf seinen Eid gerufen ward, weil es ihm keine Ueberwindung kostete, einen Meineid zu schwören. Er gab sich auch viele Mühe, und fand ein großes Vergnügen daran, Feindschaft und Verdruß in Familien und zwischen Freunden und andern Personen anzustiften, und je größer das Unglück war, das daraus entstand, desto größer war seine Freude. Ward er eingeladen an einem Morde, oder an einem andern Verbrechen Teil zu nehmen, so gab er nie eine abschlägige Antwort, sondern war gerne mit dabei, und hatte mit eigenen Händen manchen Menschen verwundet und erschlagen. Er war der größte Lästerer Gottes und seiner Heiligen, und fluchte und lästerte bei jedem kleinsten Anlaß, weil er mehr als gewöhnlich jähzornig war. In die Kirche ging er nie, und ihre Sakramente verlästerte er als verächtliche Dinge mit den abscheulichsten Ausdrücken. Dagegen war er nirgends lieber als in den Kneipschenken und an andern liederlichen Oertern. Die Weiber liebte er wie der Hund den Knüttel, dem entgegengesetzten Laster aber war er mehr als irgend ein anderer Schandbube ergeben. Raub und Diebstahl beging er mit eben dem Gewissen, womit ein heiliger Mann seine Gabe auf dem Altar darbringen würde. Er war ein Fresser und Säufer bis zum ekelhaftesten Uebermaße, und als falscher Spieler mit Karten und Würfeln war er berüchtigt. Mit einem Worte, er war vielleicht der größte Bösewicht, der jemals geboren ward. Die Macht und der Reichtum des Musciatto dienten ihm lange Zeit zur Stütze, und um seinetwillen fürchteten ihn oft diejenigen Privatpersonen, die er bisweilen beleidigte, und der Hof, der seinen Frevel stets empfand. Wie sich demnach Musciatto dieses Ser Ciapperello erinnerte, dessen Lebenswandel ihm durch und durch bekannt war, so hielt er ihn eben für den rechten Mann, welchen er der Arglist seiner Burgunder entgegensetzen müßte. Er ließ ihn also rufen, und sagte: »Ciappelletto, ich bin, wie Du weißt, im Begriff, mich gänzlich von hier zu entfernen, und da ich unter Andern mit einigen Burgundern in Geschäften stehe, die ausgefeimte Betrüger sind, so weiß ich nicht, wen ich besser schicken kann als Dich, um meine Forderungen von ihnen einzutreiben. Weil Du nun eben jetzt nichts Anderes zu thun hast, so will ich Dir Geleitsbriefe vom Hofe verschaffen, wenn Du Dich dieser Sachen annehmen willst, und will Dir von allem, was Du mir einbringst, einen solchen Teil geben, daß Du mit mir zufrieden sein kannst.«
Ser Ciappelletto, der keine Geschäfte hatte, dessen Umstände schlecht bestellt waren, und der eben denjenigen abreisen sah, welcher lange Zeit sein einziger Stecken und Stab gewesen war, entschloß sich, von der Not gedrungen, kurz und gut, und gab seine Einwilligung. Wie sie beiderseits einig waren, gab ihm Messer Musciatta seine Vollmacht und den Geleitsbrief des Königs, und Ser Ciappelletto ging nach Burgund, wo ihn fast niemand kannte, und fing an, wider seine Gewohnheit, mit Sanftmut und Gelindigkeit die Schulden einzufordern, und die Geschäfte zu verrichten, um derentwillen er gekommen war; gleichsam als wollte er das Gezänk und Streiten bis zuletzt verspüren. Wie er sich zu diesem Endzweck bei zweien Brüdern aus Florenz, die auf Wucher liehen, und die ihn aus Achtung für Musciatto sehr gut aufnahmen, eingemietet hatte, traf es sich, daß er krank ward, weswegen die beiden Brüder sogleich Aerzte und Aufwärter anschafften, die ihn bedienen mußten; allein es half nichts, sondern der Ehrenmann, der nicht mehr jung war, und ausschweifend gelebt hatte, ward nach dem Urteil der Aerzte täglich schwächer, und eilte dem Tode entgegen, welches den beiden Brüdern sehr ungelegen war. Eines Tages unterredeten sie sich miteinander nahe der Kammer, wo Ciappelletto krank lag. »Was machen wir mit dem Menschen?« fragte einer den andern. »Wir sind mit ihm sehr schlimm daran; denn es wäre Sünde und Schande, ihn so krank aus dem Hause zu schaffen, nachdem die Leute gesehen haben, daß wir ihn bei gesunden Tagen gut aufgenommen, und ihn hernach mit aller Sorgfalt haben pflegen lassen; und nun, da er uns keine Ursache zum Mißvergnügen kann gegeben haben, sollten wir ihn plötzlich, und noch dazu todkrank, fortschicken? An der andern Seite aber ist er ein so gottloser Mensch gewesen, daß er jetzt nicht wird beichten oder irgend ein Sakrament gebrauchen wollen, und wenn er ohne Beichte stirbt, so wird man seinen Leichnam in keiner Kirche aufnehmen, sondern ihn wie einen Hund in eine Grube werfen. Ja, wenn er auch beichtete, so sind seine Sünden so groß und abscheulich, daß es ihm nicht besser gehen wird; denn weder Mönch noch Weltpriester werden ihn lossprechen wollen, oder können, um zu verhüten, daß er nicht eben so auf den Anger geworfen werde. Wenn aber dieses geschähe, so würden die Leute in dieser Stadt (die uns nicht nur wegen unseres Gewerbes, das ihnen verhaßt ist, Böses Nachreden, sondern auch die größte Lust haben, uns das Unsrige zu rauben) einen Auflauf erregen, würden über die lombardischen Hunde schreien, welche die Kirche abgewiesen haben, und würden uns nicht länger das Brot gönnen, sondern uns das Haus stürmen und vielleicht nicht nur unsere Güter rauben, sondern auch unsere Personen antasten, so daß es auf alle Weise mißlich mit uns steht, wenn er sterben sollte.«
Ciappelletto, der wie gesagt nicht weit davon lag, wo jene mit einander sprachen, hatte ein feines Gehör, wie es die Kranken oft haben, und verstand alles, was sie von ihm sprachen. Er ließ sie zu sich rufen und sagte zu ihnen: »Ich wünschte nicht, Euch auf irgend eine Weise um meinetwillen in Verlegenheit zu wissen, oder Euch die Besorgnis zu verursachen, daß Ihr meinetwegen in Schanden und Unglück geraten solltet. Ich habe alles gehört, was Ihr von mir gesprochen habt, und Ihr habt freilich Recht, daß es so kommen würde, wie Ihr fürchtet, wenn dasjenige geschähe, was Ihr voraussetzt; allein es soll schon anders gehen. Ich habe in meinem Leben an unserm Herrn Gott so vieles gesündigt, daß eine Sünde mehr oder weniger am Rande des Grabes nichts verschlimmern oder verbessern wird. Laßt mir demnach nur den frömmsten und besten Pater herkommen, den Ihr finden könnt (wenn ein solcher zu haben ist), und laßt mich nur machen, so sollt Ihr sehen, daß ich Eure und meine Angelegenheit in Ordnung bringen will, wie sichs gebührt, und daß Ihr sollt mit mir zufrieden sein.«
Die beiden Brüder bauten zwar nicht viel auf diese Versicherung; nichts desto weniger gingen sie nach einem Kloster und begehrten einen klugen und frommen Mann, um die Beichte eines Lombarden zu hören, der in ihrem Hause krank läge. Man gab ihnen auch einen alten Klosterbruder von sehr erbaulichem frommen Wandel mit, einem in der Schrift wohlgelehrten und sehr ehrwürdigen Mann, der bei allen Bürgern in der Stadt in besonderem Ansehen und Hochachtung stand, und sie führten ihn nach ihrem Hause. Wie er in die Kammer des Ciappelletto kam und sich neben sein Bett gesetzt hatte, fing er zuerst an, ihn mit Sanftmut zu trösten, und fragte ihn dann, wie lange es wäre, seitdem er zum letzten Mal gebeichtet hätte.
Ciappelletto, der nie zur Beichte gegangen war, gab ihm zur Antwort: »Mein Vater, es ist immer meine Gewohnheit gewesen, wöchentlich wenigstens einmal zu beichten, wiewohl ich es auch oft mehrmals gethan habe; aber die Wahrheit zu sagen, seit meiner Krankheit, die nun schon über acht Tage dauert, habe ich noch gar nicht gebeichtet; so sehr hat mir meine Krankheit zugesetzt.«
»Wohl gethan, mein Sohn«, sprach der Pater, »und nur immer so fortgefahren! Ich merke wohl, da Du so oft beichtest, so werde ich wenig Mühe haben, Dich zu vernehmen und zu befragen.«
»Sagt das nicht, lieber Vater«, sprach Ciappelletto. »Ich habe nie so oft und so viel gebeichtet, daß ich nicht jedes Mal wünschen sollte, eine allgemeine Beichte meiner Sünden abzulegen, so weit ich mich ihrer von dem Tage meiner Geburt an bis an den Tag meiner Beichte erinnern kann. Darum bitte ich Euch, bester Pater, mich über alle Dinge so strenge zu befragen, als ob ich noch nie gebeichtet hätte. Und kehrt Euch nur nicht daran, daß ich so krank bin; denn ich will weit lieber mein Fleisch und Blut kreuzigen, als ihnen zu Gefallen etwas thun, das meiner Seele zum Verderben gereichen könnte, die mein Heiland mit seinem teuren Blute erkauft hat.«
Diese Worte gefielen dem frommen Geistlichen sehr wohl, und schienen ihm ein Beweis eines christlich gesammelten Gemüts zu sein; daher er denn, nachdem er ihm darüber sein Wohlgefallen bezeugt hatte, den Anfang damit machte, daß er ihn fragte, ob er sich jemals der Wollust mit dem weiblichen Geschlecht schuldig gemacht hätte?
Ciappelletto antwortete ihm mit einem Seufzer: »Lieber Pater, ich schäme mich, euch über diesen Punkt die Wahrheit zu sagen, weil ich fürchte, in die Sünde der Ruhmredigkeit zu verfallen.«
»Redet frei heraus«, sprach der Pater; »denn wenn man die Wahrheit sagt, so sündigt man nicht, weder in der Beichte noch anderswo.«
»Nun, weil Ihr mich denn darüber beruhigt,« sprach Ciappelletto, »so will ichs Euch sagen: ich bin noch so rein, wie ich von Mutterleibe gekommen bin.«
»Gott segne Dich!« sprach der Pater. »Ach wie wohl hast Du gethan, und wie viel größer war dabei Dein Verdienst als das unsrige, da es in Deiner Willkür stand, anders zu handeln; da es hingegen mir und meinen andern Ordensbrüdern durch unsere Regeln verboten ist!«
Hierauf fragte der Pater, ob er auch wohl durch die Sünde der Schwelgerei dem Himmel mißfällig geworden wäre. »Ach leider, mehr als zu oft!« versetzte Ciappelletto und seufzte abermals sehr stark dabei. »Denn obgleich ich außer den großen Fasten, welche die gottseligen Leute jährlich beobachten, noch wöchentlich wenigstens drei Tage bei Brot und Wasser zu fasten gewohnt bin, so habe ich doch, besonders nach irgend einer mühsamen Arbeit, oder während derselben, oder auf einer Wallfahrt, das Wasser oft mit eben der Wollust getrunken, womit die Trinker den Wein genießen, und nicht selten war ich nach einem leckeren Krautsalat eben so lüstern, wie die Weiber, wenn sie zu Dorfe gehen; auch hat mir bisweilen das Essen nachher weit besser geschmeckt, als es, wie ich glaube, demjenigen schmecken sollte, der aus Bußfertigkeit fastete.«
»Lieber Sohn!« sprach der Pater, »dergleichen Schwachheiten sind so natürlich, und sind so unbedeutend, daß Dich Dein Gewissen deswegen nicht mehr martern muß, als nötig ist. Es begegnet wohl einem jeden Menschen, sei er so heilig wie er wolle, daß ihm nach langem Fasten das Essen, und ein Trank nach schwerer Arbeit herzlich wohlschmecken.«
»Ach mein bester Pater!« antwortete Ciappelletto, »sprecht doch nicht so, um mich zu trösten; bedenkt nur, daß ich wohl wissen muß, eine jede Sache, die man thut, um Gott wohlgefällig zu sein, müsse aus reinem Herzen und ohne Widerwillen geschehen, und daß ein jeder, welcher anders handelt, sündigt.«
Mit Herzlichkeit gab ihm der Pater zur Antwort: »Es freut mich, mein Sohn, daß Du es so betrachtest, und ich bemerke mit großem Wohlgefallen an diesem Stücke die Zartheit und das feine Gefühl Deines Gewissens. Sage mir denn auch, hast Du Dich wohl des Geizes schuldig gemacht und gewünscht, mehr zu besitzen, als Dir beschieden war, oder Dir etwas zugeeignet, das Dir nicht gebührte?«
Ciappelletto versetzte: »Guter Pater! es wäre mir leid, wenn Ihr übel von mir dächtet, weil ich hier bei diesen Wucherern im Hause wohne. Ich habe aber nichts mit ihnen zu schaffen, sondern ich halte mich vielmehr bloß deswegen zu ihnen, damit ich sie warne und ermahne, und sie von dieser abscheulichen Gewinnsucht abwende. Ich glaube auch wirklich, daß es mir würde gelungen sein, wenn mich Gott nicht auf diese Weise heimgesucht hätte. Allein ich muß Euch sagen, daß mein Vater mir einst ansehnliche Reichtümer hinterließ, wovon ich nach seinem Tode den größten Teil den Armen gab, und hernach, um mein eignes Leben zu fristen, und um den Armen meines Heilandes beizustehen, eine kleine Handlung trieb, bei welcher ich freilich nach Gewinnst trachtete, aber immer mit der lieben Armut teilte, so daß ich die eine Hälfte zu meinen Bedürfnissen verwandte, und die andere Hälfte den Armen gab; und dabei hat mich der Beistand meines Schöpfers dergestalt gesegnet, daß meine Umstände sich von Tag zu Tag verbessert haben.«
»Du hast wohl gethan,« sprach der Pater. »Aber hast Du Dich auch wohl oft ereifert?«
»Ach ja,« sprach Ciappelletto; »ich kann Euch versichern, daß mir dies oft genug begegnet ist. Aber wer könnte sich dessen auch enthalten, wenn man sieht, wie die Leute täglich Werke der Finsternis ausüben, die Gebote Gottes nicht halten, und seine Gerichte nicht fürchten? Wie manchen lieben Tag hätte ich mir nicht lieber den Tod gewünscht, als das Leben, wenn ich sehen mußte, wie die Jünglinge dem eitlen Wesen nachlaufen, wie sie fluchen und schwören, wie sie in den Weinhäusern umherschwärmen, und die Kirchen nicht besuchen, und vielmehr den Wegen der Welt, als den Wegen des Herrn folgen!«
»Das ist ein frommer Eifer, mein Sohn,« sprach der Pater, »und ich kann Dir deswegen, meiner Meinung nach, keine Buße auflegen. Aber hat Dich nicht etwa Dein Eifer verführt, irgend einen Totschlag zu begehen, oder jemand durch Scheltworte oder sonst auf irgend eine Weise zu beleidigen?«
»Ach mein Herr, oder Mann Gottes, wofür ich Euch halte!« sprach Ciappelletto, »wie könnt Ihr so reden? Glaubt ihr denn, wenn mir irgend ein Gedanke an dergleichen Handlungen in's Herz gekommen wär, daß ich mir einbilden könnte, Gott würde mich so lange haben leben lassen? Das sind Dinge, deren nur sittenlose und lasterhafte Menschen fähig sind, und wenn mir dergleichen Leute in den Weg kamen, pflegt' ich immer zu sagen: Geh hin, Gott bessere Dich!«
»Daß Dich Gott segne, mein Sohn!« sprach der Pater. »Aber sage mir nun auch, hast Du jemals falsches Zeugnis wider jemand abgelegt, oder Böses von jemand gesprochen, oder Dir fremdes Eigentum angemaßt, wider den Willen dessen, dem es gehörte?«
»Ach freilich, mein Herr,« sagte Ciappelletto, »habe ich Böses von jemand gesprochen; denn ich hatte einmal einen Nachbar, der wider alles Recht und Billigkeit in der Welt nie aufhörte, sein Weib zu prügeln; daher ich einst mit Unglimpf gegen die Verwandten seiner Frau von ihm sprach, weil mir das arme Weib so nahe ging, da er sie, so oft er betrunken war, dermaßen zusammenprügelte, daß es Gott erbarmte.«
»So sage mir denn,« sprach der Geistliche, »da Du ein Kaufmann bist, hast Du nie jemand übervorteilt, wie die Kaufleute wohl zu thun pflegen?«
»Ach freilich ja, lieber Herr,« sprach Ciapelletto; »allein ich erinnere mich nicht mehr, wer es war, der mir einmal Geld brachte, das er mir für verkauftes Tuch schuldig war, und ich legte es ungezählt in meinen Geldkasten, und wie etwa ein Monat vergangen war, fand ich darin vier Groschen zuviel, die ich wohl ein Jahr lang aufhob, um sie ihm wieder zu geben; weil ich ihn aber nicht wieder zu sehen bekam, hab' ich sie zu Almosen verwandt.«
»Das war eine Kleinigkeit«, sprach der Pater, »und Du hast sie gut angelegt.«
Darauf fragte ihn der fromme Pater noch Mancherlei, worauf er ihm auf eben dieselbe Weise antwortete. Wie nun der Pater schon zur Absolution schreiten wollte, sprach Ciappelletto: »Lieber Herr, ich habe noch eine Sünde begangen, die ich Euch nicht gebeichtet habe.«
»Und was für eine?« frug der Pater.
»Ich erinnere mich«, gab Ciappelletto zur Antwort, »daß ich einst meinen Dienern am Sonnabend Abends das Haus fegen ließ, und also den Vorsabbat nicht so heilig hielt, wie ich sollte.«
»Ach mein Sohn, das hat wenig zu bedeuten«, sprach der Pater.
»Oh, sagt das nicht, daß es wenig bedeutet«, sprach Ciappelletto, »der Sonntag ist zu heilig, weil an diesem Tage unser Erlöser vom Tode zum Leben erstand.«
»Hast Du sonst nichts mehr auf dem Herzen?« fragte der Mönch.
»Ja Herr«, sprach Ciappelletto, »einmal habe ich, ohne daran zu denken, in der Kirche ausgespieen.«
Der Pater lächelte und sagte: »Lieber Sohn, daraus mußt Du Dir nichts machen. Wir Geistlichen selbst thun dies alle Tage.«
»Daran thut Ihr sehr übel«, sprach Ciappelletto; »denn nichts sollte sauberer gehalten werden, als die heilige Stätte, wo man Gott sein Opfer bringt.«
Kurz, Ciappelletto brachte noch eine Menge solcher Sachen vor, und am Ende fing er an zu seufzen und bitterlich zu weinen, welches er meisterhaft konnte, so oft er wollte.
»Was hast Du denn noch?« fragte ihn der ehrliche Mönch.
»O weh, mein Herr!« sprach Ciappelletto, »es ist mir noch eine Sünde übrig geblieben, die ich noch nie gebeichtet habe, weil ich mich so sehr schämen muß, sie zu gestehen. So oft ich mich daran erinnere, muß ich bitterlich weinen, wie Ihr jetzt seht, und ich fürchte wahrlich, daß Gott wegen dieser Sünde nimmermehr Erbarmen mit mir haben werde.«
»Behüte, was sagst Du, mein Sohn!« sprach der fromme Mann. »Wenn alle Sünden, die jemals in der Welt begangen wurden, oder noch künftig mögen begangen werden, auf dem Haupte eines einzigen Menschen lägen, und dieser wäre so reuig und bußfertig, wie ich Dich finde, so ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes so groß, daß er sie ihm auf sein Bekenntnis willig vergeben würde. Du kannst also nur freimütig sagen, was es ist.«
Ciappelletto antwortete unter beständigen Thränen: »Ach Vater! meine Sünde ist zu groß, und ich kann kaum glauben, daß mir sie Gott jemals vergeben wird, wenn Ihr mir nicht mit Eurem Gebete beisteht.«
»Sage an, ohne Scheu,« sprach der Pater, »ich verspreche Dir, Gott für Dich zu bitten.«
Ciappelletto fuhr immer fort zu weinen, und wollte nicht mit der Sprache heraus. Der Pater sprach ihm indessen beständig Trost zu, und wie nun Ciappelletto mi seinen Thränen den Geistlichen lange Zeit hingehalten hatte, stieß er endlich einen tiefen Seufzer aus und sagte: »Mein Vater, weil Ihr mir versprecht, Gott für mich zu bitten, so will ich's Euch bekennen. Wisset, daß ich einst, wie ich noch ein kleines Kind war, meine Mutter gescholten habe.« Wie er dies gesagt hatte, hub er an von neuem zu weinen.
»Und scheint Dir denn das eine so schreckliche Sünde zu sein, mein Sohn?« sagte der Geistliche. »Ach die Menschen lästern ja Gott selbst jeden Tag, und doch verzeiht er es gern denen, die es herzlich bereuen, und Du wolltest nicht glauben, daß er Dir dieses verziehe? Weine nicht, sei getrost, denn wahrlich, wenn Du auch einer von denen gewesen wärst, die ihn an's Kreuz schlugen, und Du bewiesest Dich so zerknirscht, wie ich Dich sehe, so würde er's Dir verzeihen.«
Ciappelletto versetzte: »O weh, mein Vater, was sagt Ihr! Meine liebe Mutter, die mich neun Monate Tag und Nacht unter ihrem Herzen getragen und mich tausendmal an ihren Busen gedrückt, wie übel that ich, sie zu schelten! Die Sünde ist gar zu groß, und wenn Ihr nicht Gott für mich bittet, so wird sie nimmer vergeben.«
Wie der Geistliche fand, daß Ciappelletto nichts weiter zu sagen hatte, erteilte er ihm die Absolution und gab ihm seinen Segen, indem er ihn für den heiligsten Menschen hielt, weil er zuversichtlich glaubte, alles wäre wahr, was ihm Ciappelletto gesagt hätte. Und wer würde das nicht auch geglaubt haben, wenn er einen Menschen auf dem Sterbebette so reden hörte? Zuletzt sprach er zu ihm: »Ser Ciappelletto. Ihr werdet mit Gottes Hülfe bald wieder gesund werden. Sollte es aber dennoch geschehen, daß Gott Eure gnadenerfüllte Seele zu sich riefe, so habt Ihr doch hoffentlich nichts dawider, daß man Euren Leichnam in unserer Kirche zur Erde bestatte.«
»Ach nein«, antwortete Ciappelletto! »vielmehr möchte ich nirgends lieber ruhen, da Ihr mir versprochen habt, Gott für mich zu bitten, zumal, da ich überdies immer eine besondere Hochachtung für Euren Orden gehabt habe. Ich bitte Euch deswegen, wenn Ihr wieder in Euer Kloster kommt, daß Ihr alsobald Anstalt machet, daß der wahre Leib Christi zu mir komme, den Ihr des Morgens auf dem Altar eingesegnet habt, weil ich ihn, wiewohl unwürdig, zu genießen, und alsdann die heilige letzte Oelung zu empfangen wünsche, damit ich, wenn ich gleich als ein Sünder gelebt habe, zum wenigsten wie ein Christ sterbe.«
Der gute Geistliche sagte: er sei es sehr zufrieden, und es sei wohl gesprochen, er wollte gleich gehen und Anstalt machen, daß ihm Alles gebracht werde, welches auch geschah.
Die beiden Brüder, denen immer bange gewesen war, Ciappelletto möchte ihnen nicht Wort halten, hatten an einer Bretterwand gehorcht, welche die Kammer des Ciappelletto von einer andern trennte, wo sie in der Stille zuhörten, und alles sehr gut vernahmen, was Ciappelletto mit dem Pater sprach; und erst hatten sie große Mühe gehabt, sich des Lachens zu enthalten über die Dinge, die er beichtete, daß sie fast bersten wollten, und bisweilen dachten: welch ein Mensch ist das, den weder sein Alter, noch die Furcht vor dem nahen Tode und vor Gott selbst, vor dessen Richterstuhle er in wenigen Stunden zu erscheinen gewärtigen muß, von seiner Bosheit abwendig machen und ihn abhalten können, ebenso dahin zu sterben, wie er gelebt hat! Doch wie sie fanden, daß er ihnen Wort gehalten hatte, und daß er in der Kirche sollte begraben werden, bekümmerten sie sich nicht um das Uebrige. Ciappelletto empfing gleich darauf das Abendmahl, und wie es sich immer mehr mit ihm verschlimmerte, auch die letzte Oelung und starb kurz nach der Vesperzeit an demselben Tage, an welchem er seine treffliche Beichte abgelegt hatte. Zufolge seiner eigenen Anordnung, wie er wollte auf eine ehrbare Weise begraben sein, sandten die beiden Wirte Nachricht zu den Mönchen in's Kloster, damit sie noch des Abends kämen, um die gewöhnlichen Vigilien bei der Leiche zu halten, und sie des andern Morgens abzuholen, wozu sie selbst auch die nötigen Anstalten machten. Wie der fromme Pater, der die Beichte des Ciappelletto gehört hatte, vernahm, daß er gestorben wäre, begab er sich zum Prior, ließ die Kapitelglocke läuten und alle Mönche im Kloster versammeln und zeigte ihnen an, daß Ciappelletto ein heiliger Mann gewesen sei, wie er aus seiner Beichte schließen müsse. Da er nun hoffte, daß unser Herr Gott durch ihn viele Wunder thun würde, so ermahnte er sie, seinen Leichnam mit vieler Ehrfurcht und Andacht aufzunehmen. Der Prior und die übrigen Mönche glaubten alles, und stimmten ihm bei, und begaben sich sämtlich des Abends nach dem Hause, wo die Leiche des Ciappelletto lag, bei welcher sie eine große und feierliche Vigilie hielten; und des Morgens kamen sie alle, in ihren Westerhemden und Meßgewändern feierlich gekleidet, mit ihren Büchern in der Hand und mit vorgetragenen Kreuzen, um den Leichnam abzuholen, und brachten ihn mit vielem Gepränge und Feierlichkeit nach ihrem Kloster, wobei fast alle Leute in der Stadt, Männer und Weiber, nachfolgten. Wie man die Leiche im Kloster niedersetzte, bestieg der Pater, dem Ciappelletto gebeichtet hatte, die Kanzel und hielt eine lange Rede, in welcher er von seinem Lebenswandel, von seinem Fasten, von seiner Keuschheit, von seiner Unschuld und Einfalt Wunder erzählte. Wie er unter andern dasjenige anführte, was ihm Ciappelletto als seine größte Sünde gebeichtet hätte, und er ihm kaum habe begreiflich machen können, daß Gott ihm dieses vergeben würde, sagte er mit strafender Miene und Rede zu seinen Zuhörern: »Und Ihr, von Gott verworfenen, lästert Gott und seine Mutter und alle Heiligen im Paradiese um eines jeden Strohhalms willen, der Euch unter die Füße gerät!« So sprach er noch vieles von seiner Aufrichtigkeit und von der Reinigkeit seiner Sitten; kurz, seine Worte, welchen alle Menschen in der Gegend völligen Glauben beimaßen, erfüllten die Köpfe der ganzen Gemeine mit so vieler Ehrfurcht für den Verstorbenen, daß nach dem Gottesdienst alles haufenweise hinzulief, um ihm Hände und Füße zu küssen; alles Gewand ward ihm vom Leibe gerissen und ein jeder schätzte sich glücklich, der einen Fetzen davon erhalten konnte. Man mußte den Sarg den ganzen Tag offen lassen, damit ein jeder ihn besuchen und sehen konnte, und wie der Abend kam, ward er in einer marmornen Lade sehr ehrenvoll in einer Kapelle beigesetzt. Am andern Tage kamen schon Leute, um zu ihm zu wallfahrten und ihn anzubeten, und folglich auch, um Gelübde an ihn zu thun, und wächserne Bilder nach Maßgabe ihrer Gelübde zu opfern. Ja so sehr verbreitete sich der Geruch seiner Heiligkeit und die Andacht seiner Verehrer, daß fast niemand, der sich in irgend einer Widerwärtigkeit befand, sich einem andern Heiligen empfahl, als ihm, und man nannte ihn (und nennt ihn noch diese Stunde) Sankt Ciappelletto, und versichert, daß Gott durch ihn manches Wunderwerk verrichtet habe, und noch jeden Tag an denen wirke, die sich ihm mit Andacht empfehlen!
*
Zweite Erzählung.
Wie man erzählt, wohnte einst in Paris ein reicher Kaufmann, namens Jeannot de Sévigny, ein braver, rechtschaffener Mann, der einen großen Tuchhandel führte und in sehr vertrauter Freundschaft mit einem sehr reichen Juden lebte, welcher Abraham hieß, und auch ein rechtlicher und ehrlicher Kaufmann war. Wenn Jeannot bisweilen die Rechtschaffenheit und Redlichkeit dieses Juden betrachtete, so schmerzte es ihn sehr, daß die Seele eines so guten und weisen Mannes wegen Mangel des Glaubens verloren gehen sollte. Deswegen fing er an, freundschaftlichst in ihn zu dringen, daß er doch die Irrtümer der jüdischen Lehre verlassen und sich zur christlichen Wahrheit bekehren möchte, die, wie er ja selbst sehen könnte, wegen ihrer Heiligkeit und Vortrefflichkeit immer wüchse und zunehme, da hingegen die seinige sichtlich abnähme und sich ihrer Vernichtung näherte. Der Jude gab ihm aber zur Antwort: er hielte keine Lehre außer der jüdischen weder für heilig, noch für gut; in dieser wollte er leben und sterben, und nichts wäre vermögend, ihn jemals davon abwendig zu machen. Jeannot ließ indessen nicht nach, sondern brachte nach einigen Tagen dieselbe Unterredung wieder auf's Tapet und bewies ihm mit solchen einfachen Gründen, dergleichen ein Kaufmann gemeinlich nur fähig ist vorzubringen, aus welchen Ursachen die christliche Religion besser wäre als die jüdische. Und obwohl der Jude in dem mosaischen Gesetze ein großer Meister war, so geschah es doch, entweder weil ihn seine große Freundschaft für Jeannot bewegte, oder weil ihn vielleicht die Worte überredeten, die der heilige Geiste dem ungelehrten Manne in den Mund legte, daß die Beweise des Jeannot anfingen, dem Juden sehr einzuleuchten, wiewohl er noch immer hartnäckig dabei blieb, sich von seinem Glauben nicht abwenden zu lassen. So eigensinnig dieser nur immer blieb, so beharrlich fuhr Jeannot fort, ihm zuzureden, bis endlich der Jude, von dieser Beharrlichkeit überwunden, zu ihm sagte: »Höre Jeannot, Du willst durchaus haben, daß ich ein Christ werden soll, und ich bin nicht abgeneigt, Dir zu willfahren, doch ich will erst nach Rom reisen und will denjenigen sehen, von dem Du sagst, er sei der Statthalter Gottes auf Erden, ich will seinen Wandel und seine Führung kennen lernen, und auch den Lebenswandel seiner Brüder, der Kardinäle; und wenn diese mir so gefallen, daß ich an ihren Werken sowohl, wie aus Deinen Worten merke, daß Eure Religion besser, als die meinige, wie Du Dich bemühest mir zu beweisen, so will ich thun, was Du verlangst; wenn ich es aber anders finde, so bleibe ich ein Jude, wie ich bin.«
Wie Jeannot dies hörte, ward er in seiner Seele betrübt und dachte bei sich selbst: alle meine Mühe ist verloren, die ich glaubte so gut angewandt zu haben, weil ich dachte, ich hätte diesen Mann schon bekehrt. Wenn er aber nach Rom kommt und sieht das Lasterleben der Klerisei, so wird er nicht nur aus einem Juden kein Christ werden, sondern wenn er schon ein Christ wäre, so würd' er unfehlbar wieder zum Juden. Darum sprach er zu Abraham: »Lieber Freund, warum willst Du Dir die viele Mühe und Unkosten machen, die mit einer Reise nach Rom verknüpft sind; zumal da einen reichen Mann wie Dich tausenderlei Gefahren zu Wasser und zu Land bedrohen? Meinst Du denn, Du findest niemand hier, der Dich taufen kann? Und wenn Dir ja gegen den Glauben, den ich Dir erkläre, noch einige Zweifel aufstoßen, wo giebt es denn größere Meister in demselben und weisere Leute als hier, bei denen Du Dich über alles befragen kannst? Darum bin ich der Meinung, daß Deine Reise ganz überflüssig ist. Denke Dir die Prälaten in Rom als eben solche Männer, wie Du sie hier gesehen hast und noch um so viel frömmer, als sie dem obersten Hirten näher wohnen und erspare Dir die Mühe einer Reise auf mein Wort, bis Du dereinst Anlaß findest, nach Ablaß zu wallfahrten, so leiste ich Dir alsdann Gesellschaft.«
Der Jude antwortete: »Ich will zugeben, Jeannot, daß es so sei, wie Du sagst; allein mit einem Worte statt vieler: ich bin fest entschlossen, zu reisen, wofern ich dasjenige thun soll, warum Du mir so sehr angelegen hast, sonst kann nichts daraus werden.«
Da Jeannot ihn so entschlossen fand, blieb ihm nichts Anderes übrig zu sagen, als: »So reise denn glücklich!« Allein er dachte bei sich selbst, er würde nimmermehr ein Christ werden, sobald er den römischen Hof gesehen hätte; doch da er selbst nichts dabei verlor, so gab er sich zufrieden. Der Jude stieg zu Pferde, und zog nach Rom so eilig er konnte, wo ihn seine Glaubensgenossen bei seiner Ankunft mit vielen Ehrenbezeigungen aufnahmen. Während seines Aufenthaltes daselbst beobachtete er, ohne seine Absicht zu verraten, sehr aufmerksam den Lebenswandel des Papstes und seiner Kardinäle, so wie der übrigen Prälaten und aller Herren am Hofe; und nach allem, was er als ein scharfsichtiger Mann selbst bemerkte, und was ihm Andere berichteten, fand er bald, daß sie vom Größten bis zum Kleinsten durchgängig auf die schändlichste Weise der Wollust stöhnten, und sich nicht nur den natürlichen, sondern auch den widernatürlichsten Lüsten ohne Scham und Scheu überließen, so daß man durch den Einfluß der Buhlerinnen und unzüchtigen Knaben bei ihnen die wichtigsten Dinge erlangen und durchsetzen konnte. Ueberdies fand er sie alle dem Fressen und Saufen und der Unmäßigkeit ergeben, und überzeugte sich, daß sie in ihren Begierden, wie unvernünftige Tiere, nur dem Bauche dienten; und wie er noch weiter nachforschte, so fand er, daß die Menschenseelen und christliche oder geistliche Dinge, sie mochten Namen haben, wie sie wollten, und mochten zu Kirchen oder zu Pfründen gehören, für Geld kauften und verkauften, und einen größeren Handel damit trieben, und mehr Mäkler dazu gebrauchten, als in Paris zum Tuchhandel und zu anderen Geschäften angestellt sind; und daß sie die offenbarste Simonie mit dem Namen Bestallungspflege und ihre Gierigkeit mit dem Namen Unterhaltungsgebühren bedeckten, als wenn Gott sich um solche Wortklaubereien bekümmerte, die bösen Absichten verkehrter Gemüter nicht kennte, und sich nach Menschenweise durch Benennung der Dinge hintergehen ließe.
Wie nun dieses Alles und manches Andere, was wir lieber verschweigen, dem Juden als einem ehrbaren und bescheidenen Manne höchst mißfällig war, und wie er glaubte, genug gesehen zu haben, entschloß er sich zur Rückreise und kam wieder nach Paris. Jeannot hatte kaum seine Ankunft erfahren, als er auch schon zu ihm ging und sich mit ihm des Wiedersehens höchlich erfreute; doch fiel es ihm im geringsten nicht ein, daß sein Freund ein Christ werden würde. Wie dieser nun einige Tage ausgeruht hatte, fragte ihn Jeannot, wie er den Papst und die anderen Herren am Hofe gefunden hätte.
Böse habe ich sie gefunden (gab ihm der Jude hastig zur Antwort) und Böses vergelte ihnen Gott! Das ist alles, was ich Dir sagen kann; denn wo ich recht gesehen habe, so giebt es dort weder Frömmigkeit noch Andacht, noch irgend ein gutes Werk oder Beispiel, oder sonst etwas Löbliches, bei irgend einem, der zum geistlichen Stande gehört, sondern eitel Wollust, Geiz, Schwelgerei, Betrug, Neid, Hochmut und mehr dergleichen und noch schlimmere Dinge, wenn man sie noch schlimmer denken kann. Dies alles glaube ich in solchem Maße bei ihnen gefunden zu haben, daß ich Rom eher für eine Werkstatt teuflischer als göttlicher Dinge halte. Und wie es mir scheint, so arbeitet Euer Oberhirte, und folglich auch alle übrigen, mit Gewalt daran, die christliche Religion zu Schanden zu machen, und sie von der Welt zu vertilgen, da sie doch billig der Grundstein und die Stütze derselben sein sollten. Da ihnen nun dieses nicht gelingt, wonach sie streben, sondern da Eure Religion sich täglich mehr und mehr ausbreitet, und immer heller und reiner glänzt, so glaube ich mit Recht zu schließen, daß der heilige Geist selbst der Grund und Pfeiler dieser Religion sein muß, und daß sie alle andern an Wahrheit und Heiligkeit übertrifft. Deswegen, so steif und fest ich mich auch bisher Deinen Ermahnungen widersetzt habe, und kein Christ werden wollte, so will ich Dir frei gestehen, daß mich nunmehr nichts in der Welt länger abhalten kann, die christliche Religion anzunehmen. Komm mit mir in die Kirche, und laß mich daselbst nach der Vorschrift Eurer heiligen Religion taufen.«
Jeannot, der sich eines ganz entgegengesetzten Entschlusses von ihm versehen hatte, war der vergnügteste Mensch von der Welt, wie er ihn so reden hörte. Er eilte mit ihm in die Kirche unserer Frauen in Paris, und bat die Geistlichen, seinen Freund Abraham zu taufen, was sie auch unverzüglich thaten, wie sie hörten, daß er selbst es begehrte. Jeannot ward sein Pate und gab ihm den Namen Jean. Er ließ ihn hernach durch große Schriftgelehrten vollkommen in seiner Religion unterrichten, mit welcher er sich auch in kurzer Zeit bekannt machte, und hernach als ein trefflicher Mann ein erbauliches Leben führte.
*
Dritte Erzählung.
Saladin, der so tapfer war, daß er nicht nur aus einem geringen Manne zum Sultan von Babylon ward, sondern auch außerdem noch manche Siege über die sarazenischen und christlichen Fürsten erfocht, hatte teils in verschiedenen Kriegen, teils durch seinen großen Aufwand und Pracht, einst seinen ganzen Schatz erschöpft, und nun traf es sich eben, daß er plötzlich einer ansehnlichen Summe bedurfte, die er nirgends so schnell aufzutreiben wußte, als er sie nötig hatte. In dieser Verlegenheit erinnerte er sich eines reichen Juden, der Melchisedech hieß und in Alexandrien auf Wucher zu leihen pflegte und er glaubte, dieser könnte ihm helfen, wenn er wollte. Der Jude war aber so geizig, daß er es von freien Stücken nimmer würde gethan haben, und offenbare Gewalt wollte Saladin nicht brauchen. Weil ihn jedoch die Not drang, so sann er auf ein Mittel, den Juden unter einem scheinbaren Vorwande zu zwingen, seinen Beutel aufzuthun. Er ließ ihn demnach zu sich rufen und hieß ihm freundlich sich neben ihn setzen, indem er zu ihm sagte: »Trefflicher Mann, ich habe von verschiedenen Leuten gehört, daß Du weise bist, und in geistlichen Dingen sehr erfahren. Darum möchte ich gern von Dir wissen, welche von den drei Lehren Du für die wahrhafteste hältst, die jüdische, die sarazenische oder die christliche.« Der Jude, der in der That ein kluger Mann war, merkte sehr gut, daß ihn Saladin mit seinen Worten zu fangen suchte, um Händel mit ihm anzufangen, und er glaubte daher, daß er keine von den drei Religionen mehr als die andere loben dürfe, damit Saladin seinen Zweck nicht erreichte, und da es auf eine schnelle Antwort ankam, wodurch er keine Blöße gäbe, so kam ihm auf der Stelle sein Scharfsinn zu rechter Zeit zu statten, und er sagte: »Mein Herr, Ihr habt mir da eine wichtige Frage vorgelegt, um Euch aber zu sagen, wie ich darüber denke, so bitte ich Euch, vorher eine kleine Geschichte von mir anzuhören: Wenn mir recht ist, so hat man mir oft erzählt, daß einst ein reicher, vornehmer Mann war, der unter anderen kostbaren Kleinoden, die sich in seinem Schatze befanden, einen sehr schönen und köstlichen Ring besaß, welchen er wegen seines Werts und seiner Schönheit besonders auszeichnen und ihn deswegen auf immer bei seiner Nachkommenschaft erhalten wollte, und darum befahl er, daß derjenige unter seinen Söhnen, welchem er diesen Ring hinterlassen würde, als sein Erbe angesehen werden sollte, und alle seine andern Brüder sollten ihn als das Haupt der Familie ehren und hochachten. Derjenige, der den Ring erbte, beobachtete gegen seine Nachkommen dasselbe Verfahren und folgte dem Beispiele seines Ahnherrn. So ward der Ring vom Vater auf den Sohn durch viele Geschlechter vererbt, bis ihn endlich einer bekam, der drei liebenswürdige und tugendhafte Söhne hatte, welche dem Vater alle gleich gehorsam waren, und deswegen alle drei von ihm gleich geliebt wurden. Die Jünglinge, welchen das Herkommen mit dem Ringe bekannt war, und welche einer wie der andere wünschten, ein jeder vor den übrigen der Geehrteste zu sein, bestrebten sich um die Wette, den Ring zu bekommen, und ein jeder von ihnen bat den Vater, der schon alt war, ihm denselben nach seinem Tode zu vermachen. Der gute Vater, der seine Söhne gleich lieb hatte und selbst keine Wahl unter ihnen zu treffen wußte, versprach einem jeden, ihm den Ring zu geben, und ersann ein Mittel, sie alle drei zu befriedigen. Er ließ deswegen bei einem geschickten Meister heimlich zwei andere Ringe machen, die dem ersten so völlig ähnlich waren, daß er selbst, der sie hatte verfertigen lassen, kaum im Stande war, den echten von dem unechten zu unterscheiden. Auf seinem Sterbebette gab er jedem seiner Söhne insgeheim einen von den drei Ringen. Nach seinem Tode wollte nun ein jeder von den Söhnen der Erbe sein und den Vorrang vor seinen Brüdern behaupten, und um diesen den andern streitig zu machen, zog ein jeder, dem hergebrachten Gebrauche gemäß, seinen Ring hervor. Da war aber ein Ring dem andern so ähnlich, daß es nicht möglich war, den echten zu erkennen, und die Frage, wer der rechte Erbe des Vaters wäre, blieb unentschieden, und bleibt unentschieden bis auf diesen Tag. Und eben dieses sage ich Euch, mein Herr, von den drei Religionen, die Gott der Vater den drei Völkern gegeben hat, wegen welcher Ihr mich befraget. Ein jedes derselben glaubt, sein Erbteil, seine Lehre und seine Gesetze unmittelbar von ihm empfangen zu haben. Von welchem unter ihnen aber sich dieses mit Wahrheit behaupten lasse, das bleibt (so wie bei den drei Ringen) noch unausgemacht.«
Saladin sah wohl ein. daß der Jude sich gut aus der Schlinge zog, die er ihm gelegt hatte. Er entschloß sich demnach, ihm sein Anliegen geradezu zu eröffnen und zu versuchen, ob er ihm von freien Stücken würde helfen wollen. Er that es, und gestand ihm zugleich, was seine Absicht gewesen wäre zu thun, wenn er nicht so vernünftig geantwortet hätte. Der Jude bediente ihn willig mit der ganzen Summe, die er brauchte, und Saladin bezahlte ihm in der Folge nicht nur seine Schuld, sondern machte ihm noch überdies ansehnliche Geschenke, und behielt ihn als seinen Freund in großen Ehren und Ansehen beständig bei sich.
*
Vierte Erzählung.
In Lunigiana, einem Ländchen nicht weit von Florenz, war ein Kloster, welches einst reicher an Mönchen und an Helligkeit war, als heutigen Tages, und woselbst sich unter anderen ein junger Klosterbruder befand, dessen Kräfte und Gesundheit weder Fasten noch Nachtwachen schwächen konnten. Wie dieser einst nach Mittag, indes die übrigen Mönche alle schliefen, außer den Mauern des Klosters lustwandelte, welches an einem ziemlich einsamen Orte lag, ward er ein sehr hübsches, junges Mädchen gewahr (vielleicht die Tochter eines Landmanns aus der Gegend), welches im Felde ging, um Kräuter zu sammeln. Er hatte sie kaum erblickt, wie ihn auch schon die Fleischeslust mit aller Gewalt bestürmte. Er näherte sich also dem Mädchen und knüpfte ein Gespräch mit ihr an, wobei er seine Worte so gut zu machen wußte, daß er mit ihr einig ward, und sie in seine Zelle führte, ohne von jemand bemerkt zu werden. Indem er hier von gar zu großer Begierde getrieben, ein wenig zu laut mit ihr koste, traf sich's, daß der Abt, der nach geendigtem Mittagsschläfchen aufgestanden war, das Gekicher der beiden Liebenden hörte, indem er mit leisen Tritten vor der Zelle vorbei ging. Um die Stimmen desto besser zu erkennen, schlich er sich an die Thür der Zelle und horchte, wo er denn deutlich vernahm, daß ein Frauenzimmer sich in der Zelle befand. Schon war er willens, sich die Thür öffnen zu lassen, doch bedachte er sich wieder und ging in sein Zimmer, um zu warten, bis der Mönch aus seiner Zelle käme. Diesen hatte jedoch, so sehr ihn auch das Vergnügen mit dem jungen Mädchen beschäftigte, bereits eine kleine Furcht angewandelt, und weil es ihm geschienen, als hätte er jemand im Erholungszimmer gehen gehört, so hatte er durch eine kleine Spalte geguckt und den Abt deutlich wahrgenommen. Er konnte wohl denken, daß dieser das Mädchen in seiner Zelle bemerkt haben müßte, und da er wußte, daß ihm dafür eine schwere Strafe bevorstand, so ward er darüber sehr niedergeschlagen; doch ließ er das Mädchen nichts von seiner Verlegenheit merken, sondern dachte nur geschwinde hin und her, wie er sich heraushelfen wollte, und da besann er sich auf eine ganz neue List, die ihm auch glücklich gelang. Er stellte sich gegen das Mädchen, als ob er glaubte, daß es Zeit wäre, sie wieder zu entfernen, und sagte: »Ich will hinausgehen, und suchen Anstalt zu machen, daß Du wieder ungesehen hinaus kömmst; halte Dich unterdessen hier ganz still, bis ich wiederkomme.« Darauf ging er hinaus, verschloß seine Zelle, und ging gerade zu dem Abt in sein Zimmer, übergab ihm den Schlüssel, wie es bei den Mönchen Sitte war, wenn sie ausgingen, und sagte mit unbefangener Miene: »Hochwürdiger Herr, ich konnte heute früh nicht alles Holz heimfahren lassen, das ich schlagen ließ, und ich gehe jetzt mit Eurer Erlaubnis in den Wald, um das Uebrige herbringen zu lassen.«
Der Abt, welcher nicht glaubte, daß ihn der Klosterbruder bemerkt hätte, und welcher wünschte, sich genauer von seinem Vergehen zu unterrichten, war froh über diese Gelegenheit, und empfing mit Vergnügen den Schlüssel; er gab ihm Urlaub, und wie er weggegangen war, überlegte er, was am besten gethan wäre, ob er in Gegenwart des ganzen Klosters die Zelle des Mönchs öffnen und sein Verbrechen jedermann zeigen sollte, damit man über ihn nicht murren möchte, wenn er den Mönch bestrafte, oder ob er erstlich von dem Mädchen erforschen sollte, wie alles zugegangen wäre. Da er nun zugleich erwog, daß es vielleicht die Tochter oder Verwandte irgend eines solchen Mannes sein könnte, dem er ungern die Schande zufügen möchte, daß er sie allen Mönchen zeigte, so entschloß er sich erstlich zu sehen, wer sie wäre, und dann seine Maßregeln zu nehmen. Er ging demnach in der Stille nach der Zelle, öffnete die Thür, ging hinein, und schloß hinter sich zu. Wie das arme Mädchen den Abt hereintreten sah, ward ihr angst und bange, und zitternd vor Scham fing sie an bitterlich zu weinen. Der Abt, der sie indessen aufmerksam betrachtete, und an ihr ein schönes, frisches Geschöpf fand, fühlte plötzlich, so alt er auch war, den Stachel des Fleisches nicht minder rege werden, als es dem jungen Mönch widerfahren war. Er dachte bei sich: »Ei nun, warum soll ich nicht das Vergnügen genießen, wenn es sich mir darbietet. Verdruß und Unannehmlichkeiten finde ich ja ohnehin immer genug bei der Hand. Hier ist ein hübsches Mädchen, kein Mensch in der Welt weiß etwas davon; wenn ich sie dahin bringen kann, mir zu Willen zu sein, so weiß ich nicht, warum ich es nicht versuchen sollte; wer wird's erfahren? kein Mensch! und heimliche Sünde ist halb vergeben. Es wird mir vielleicht nie wieder so gut geboten, und ich denke, es ist vernünftig gethan, das Gute auch mit zu genießen, wenn es der Himmel anderen bescheret.« Wie der Abt dieses bei sich überlegte, änderte er völlig seinen Vorsatz, womit er gekommen war, und indem er näher zu dein Mädchen trat, fing er an, sie zu beruhigen, und bat sie, nicht zu weinen, und wie nun ein Wort das andere gab, so kam er endlich dahin, ihr sein Begehren zu eröffnen. Das Mädchen, das nicht von Stahl und Stein war, ließ sich auch leicht genug bewegen, sich gefällig gegen den Abt zu beweisen. Das Ruhebettchen des Klosterbruders war Zeuge ihrer Umarmung, und da der gute Abt vermutlich das zarte Alter des Mädchens in Erwägung zog, so war er gutherzig genug, ihr seine eigene Brust zum Pfühl herzugeben, indem er sie herzte. Der Mönch, der sich nur gestellt hatte, als ob er in den Wald ginge, hatte sich im Erholungssaal verborgen, und wie er sah, daß der Abt in seine Zelle ging, schöpfte er gute Hoffnung, daß ihm sein Anschlag gelingen würde, und wie er vollends hinter sich zuschloß, blieb ihm kein Zweifel mehr übrig. Er verließ demnach seinen Schlupfwinkel und schlich sich an ein kleines Loch, wo er alles sehen und hören konnte, was der Abt sagte und that. Wie dieser glaubte, sich lange genug mit dem Mädchen unterhalten zu haben, schloß er sie in der Zelle wieder ein und begab sich zurück in sein Zimmer. Wie er darauf nach einiger Zeit den Klosterbruder hörte und glaubte, daß er aus dem Walde zurückgekommen wäre, nahm er sich vor, ihm eine derbe Strafpredigt zu halten, und ihn einkerkern zu lassen, um die eroberte Beute für sich allein zu behalten. Er ließ ihn demnach rufen, schalt ihn mit finsterem Angesicht, und kündigte ihm sein Gefängnis an. Der Mönch gab ihm geschwind zur Antwort: »Hochwürdiger Herr, ich bin noch nicht so lange im Orden des heiligen Benedikts gewesen, daß ich alle Gebräuche desselben vollkommen inne habe und Ihr hattet mich bisher noch nicht unterwiesen, daß wir Mönche uns der Bürde der Weiber eben so wohl unterwerfen müßten, als der Last der Fasten und Nachtwachen. Jetzt aber, da Ihr mir selbst das Beispiel gegeben habt, verspreche ich Euch, wenn Ihr mir diesmal verzeiht, künftighin in diesem Stücke nicht mehr zu fehlen, sondern immer nach Eurem Vorbilde zu handeln.«
Der Abt, der ein schlauer Mann war, merkte wohl, daß jener mehr wußte als er, und daß er ihm hinter seine Schliche gekommen war. Er schämte sich also, da er sich desselben Vergehens schuldig wußte, den Klosterbruder mit der Strafe zu belegen, die er selbst verdient hatte. Er verzieh ihm demnach und befahl ihm, zu verschweigen, was er gesehen hätte, worauf sie beide das Mädchen ohne Geräusch aus dem Zimmer schafften; doch läßt sich vermuten, daß sie sie bisweilen wieder kommen ließen.
*
Fünfte Erzählung.
Der Marquis von Montferrat, ein sehr tapferer Mann und ein Panierträger der Kirche, war auf einem Kreuzzuge der Christen über's Meer verreist. Wie nun von seiner Tapferkeit am Hofe des Königs von Frankreich, Philipps des Einäugigen, vieles gesprochen ward, welcher sich eben auch zu demselben Kreuzzuge rüstete, so sagte unter andern einer von den anwesenden Rittern, es gebe kein so vortreffliches Paar unter dem weiten Himmel, als den Marquis und seine Gemahlin. Denn so wie der Marquis unter den Männern wegen jeder ritterlichen Tugend der berühmteste sei, so behauptete seine Gemahlin vor allen Weibern in der Welt den Vorzug der Schönheit und Liebenswürdigkeit. Diese Worte machten auf den König solchen Eindruck, daß er, ohne die Marquise jemals gesehen zu haben, auf einmal sterblich in sie verliebt ward. Er nahm sich deswegen vor, sich auf dem vorhabenden Kreuzzuge in Genua einzuschiffen, damit er auf der Reise dahin eine schickliche Gelegenheit hätte, sie zu besuchen; indem er sich schmeichelte, während der Abwesenheit ihres Gemahls vielleicht seinen Endzweck bei ihr zu erreichen. Er schickte demnach alle seine Leute voraus und machte sich selbst mit einigen wenigen Edelleuten auf den Weg, und wie er sich dem Gebiete des Marquis näherte, ließ er der Dame einen Tag vorher melden, daß sie ihn am folgenden Tage zur Mahlzeit erwarten möchte. Als eine kluge und verständige Frau gab sie mit Freundlichkeit zur Antwort: sie schätzte sich's zur großen Ehre, und der König sollte ihr willkommen sein. Und nun sann sie nach, was es doch wohl bedeuten müßte, daß ein solcher König während der Abwesenheit ihres Mannes zum Besuch zu ihr käme, und sie irrte sich nicht, indem sie sich einbildete, daß der Ruf von ihrer Schönheit ihn dahin gezogen hätte. Nichtsdestoweniger machte sie Anstalt ihn zu empfangen, wie es einer verständigen Frau geziemt; sie ließ die ehrsamsten Männer, welche daheim geblieben waren, zu sich berufen, und beratschlagte sich mit ihnen über alle Anstalten, die gemacht werden müßten; doch behielt sie sich vor, das Mittagsmahl und das Essen ganz allein nach ihrem Sinne anzuordnen. Sie ließ hierauf so viele Hühner zusammenbringen. als sie in der Gegend bekommen konnte und befahl ihren Köchen, diese allein auf verschiedene Art für das königliche Mahl zuzurichten. Der König kam zur bestimmten Zeit, und ward von der Marquise sehr festlich empfangen. Indem er sie sah, deuchte sie ihm noch unendlich schöner, sittsamer und liebenswürdiger, als er sie sich nach der Beschreibung des Ritters gedacht hatte; er betrachtete sie mit der höchsten Bewunderung und überhäufte sie mit Lobsprüchen, indes seine Liebe um desto mehr zunahm, je mehr er fand, daß die Marquise seine Erwartung übertraf. Nachdem er eine Zeit lang in Zimmern ausgeruht hatte, welche auf eine seiner würdige Art ausgeschmückt waren, und die Stunde des Mittagsmahls heran kam, setzte sich die Marquise mit ihm an eine besondere Tafel, und die übrigen Herren wurden an andern Tischen bewirtet. Dem Könige wurden herrlich zubereitete Speisen und köstliche Weine vorgesetzt und überdies gewährte ihm der Anblick der liebenswürdigen Wirtin unbeschreibliches Vergnügen. Wie jedoch ein Gericht nach dem andern aufgetragen ward, fing der König endlich an, sich zu verwundern, daß sie zwar auf verschiedene Art zubereitet waren, aber alle aus lauter Hühnerfleisch bestanden. Da er nun wußte, daß es in der Gegend, wo er sich befand, nicht an allerlei Wildbret fehlen konnte, und da die Marquise zeitig genug von seiner Ankunft war unterrichtet gewesen, um etwas aufjagen zu lassen, so nahm ihn das zwar um desto mehr Wunder, doch wollte er von keiner andern Sache Anlaß nehmen, sie zur Sprache zu bringen, als bloß von ihren Hühnern. Er fragte sie demnach mit lachendem Munde, ob in ihrer Gegend lauter Hühner, ohne einen einzigen Hahn geheckt würden. Die Marquise, welche die Meinung seiner Frage erriet, und glaubte, der Himmel schickte ihr die gewünschte Gelegenheit, dem Könige merken zu lassen, wie sie gesinnt wäre, gab ihm mit Freimütigkeit zur Antwort: »Nein, Sire, aber die Weiber sind hier ebenso gemacht, wie anderswo; wenn sie sich gleich durch Rang und Kleidung ein wenig von andern unterscheiden.«
Wie der König diese Worte hörte, erklärte er sich leicht die Absicht mit den Hühnergerichten und den versteckten Sinn der Rede, und ward zugleich inne, daß er bei einer solchen Frau seine Worte nur verlieren würde und daß hier Gewalt nicht statt fände; daher er denn, sowie er sich unbedachtsamer Weise in sie verliebt hatte, es nun für das Weiseste hielt, um seiner eigenen Ehre willen, die unzeitige Flamme wieder zu ersticken; ohne demnach der Dame weiter mit Reden zuzusetzen, weil er sich vor ihren Antworten fürchtete, endigte er seine Mahlzeit, ohne sich weiter Hoffnung zu machen, und damit er durch eine schnelle Entfernung seinen ungeziemenden Besuch wieder gut machte, so dankte er ihr für ihre gute Aufnahme; sie empfahl ihn Gott, und er reiste nach Genua.
*
Sechste Erzählung.
Es war einmal vor nicht gar langer Zeit ein Bruder Minorit in Florenz Inquisitor der ketzerischen Greuel, welcher sich zwar gern das Ansehen der Heiligkeit und des Eifers für die christliche Religion geben mochte (wie sie alle thun), aber sich nicht minder darauf verstand, den vollen Säckeln auf die Spur zu kommen, als den glaubensleeren Herzen; und vermöge dieser Thätigkeit war ihm einmal ein Ehrenmann in die Klauen geraten, der weit größeren Überfluß an Reichtümern besaß, als an Verstand. Dieser hatte nämlich einst, nicht aus Freigeisterei, sondern um ehrlich zu reden, vielleicht vom Weine oder von der Fröhlichkeit ein wenig zu sehr erhöht, zu einem von seiner Tischgesellschaft gesagt: er habe einen Wein, der so gut sei, daß ihn Christus selbst trinken würde. Dies ward dem Inquisitor hinterbracht, welcher wußte, daß der Mann vermögend und seine Börse wohlgefüllt war; daher er cum gladiis et fustibus über ihn herfiel, und ihm einen fürchterlichen Prozeß machte nicht so wohl, um ihm seinen Unglauben auszutreiben, als um seine Goldgülden in seine Hände zu bekommen. Er ließ ihn vorladen, und fragte ihn, ob dasjenige wahr wäre, dessen er beschuldigt würde. Der ehrliche Mann gestand es ein, und erzählte dem Inquisitor, wie er dazu veranlaßt worden. Aber der fromme Inquisitor, als ein würdiger Gelobter des heiligen Johannes mit dem goldenen Barte, fuhr ihn an: »So willst Du Christum zu einem Säufer machen, wie einen Cinciglione, oder einen andern von Euren Schlemmern und Saufgesellen? Und nun meinst Du mit glatten Worten durchzukommen und das Ding auf die leichte Achsel zu nehmen? Aber es ist nicht so leicht, wie Du Dir's einbildest; Du hast den Scheiterhaufen damit verdient, wenn wir Dich so strafen wollten, wie wir wohl sollten.«
Mit dergleichen und andern bittern Vorwürfen setzte er ihm zu, wie einem Epikuräer, der die Unsterblichkeit der Seele geleugnet hätte. In der That erschreckte er ihn so sehr, daß der arme Mann durch gewisse Unterhändler ihm die Hände mit einer guten Gabe von der Salbung des heiligen Johann Goldmunds schmieren ließ (ein treffliches Heilmittel für die pestilenzialische Seuche der Pfaffen, besonders der Minoriten, die kein Geld anrühren dürfen), damit er barmherzig mit ihm verführe. Diese Salbe, die sehr wirksam ist, obgleich Galenus in seinen Schriften nichts davon erwähnt, schlug so gut an, daß der Scheiterhaufen in ein Kreuz verwandelt ward, und zwar gab er ihm ein gelbes im schwarzem Felde, als wollte er ihn zu einer Kreuzfahrt über's Meer mit einem recht schönen Panier versehen. Ueberdies behielt er ihn nach dem Empfang des Geldes noch einige Zeit bei sich, und legte ihm die Buße auf, daß er alle Morgen die Messe zum heiligen Kreuze hören, und sich hernach zur Mittagsstunde bei ihm stellen mußte, wogegen er die übrige Tageszeit über gehen durfte, wohin er wollte. Jener richtete treulich aus, was ihm auferlegt war, und da traf es sich eines Morgens, daß in dem Evangelio die Worte abgelesen wurden: Es wird Euch Alles hundertfältig vergolten werden, und Ihr werdet das ewige Leben haben. Diese Worte schrieb er sich in's Gedächtnis und erschien, dem Befehle gemäß, um die Mittagsstunde vor dem Inquisitor, der schon bei Tische saß. Dieser fragte ihn, ob er des Morgens die Messe gehört habe.
»Ja, Hochwürdiger«, war die Antwort.
»Ist Dir nichts dabei vorgekommen, woran Du einige Zweifel hättest, und Dich darüber befragen möchtest?«
»Nichts«, sprach der gute Mann. »Ich zweifle an Keinem, das ich gehört habe, sondern glaube alles fest und gewiß. Aber eine Sache habe ich gehört, die mir leid ist um Euretwillen, und wegen allen Eurer Mitbrüder, wenn ich an den unglücklichen Zustand denke, der Euch in jener Welt erwartet.«
»Wie lauteten denn die Worte, die Dich so zum Mitleiden mit uns bewegten?« fragte der Minorit.
»Es waren die Worte des Evangelii: »Es wird Euch Alles vergolten werden hundertfältig.«
»Die Worte sind richtig«, sprach der Inquisitor; »aber warum haben Dich diese Worte so sehr bewegt?«
»Ich will's Euch sagen, hochwürdiger Herr! Seitdem ich hier aus- und eingehe, habe ich täglich gesehen, daß eine Menge armer Leute bald einen, bald mehrere große Kessel von Küchenspülicht hier abholen, die als ein überflüssiger Abfall von Eurer Tafel und von der Tafel der übrigen Brüder weggeräumt werden. Wenn Ihr nun für jeden Kessel Spülwasser hundert in jener Welt wieder bekommt, so müßt Ihr ja alle darin ersaufen.«
Hierüber lachten nun zwar Alle, die an des Inquisitors Tafel saßen; er selbst aber, dem diese empfindliche Stichelrede seine heuchlerische Spülichtspende vorwarf, entfärbte sich ganz, und wenn er nicht gefürchtet hätte, daß dieser Vorgang ihm selbst keine Ehre machen würde, so hätte er ihm einen neuen Prozeß an den Hals geworfen, weil er mit seinem scherzhaften Einfall ihn und die anderen faulen Bäuche aufgezogen hatte; und mit übler Laune befahl er ihm zu gehen, wohin er wollte, und ihm nur nicht wieder vor die Augen zu kommen.
*
Siebente Erzählung.
Herr Cane della Scala, ein Mann, den das Glück auf mancherlei Weise begünstigt hatte, war, wie die Sage fast überall geht, einer von den vornehmsten und freigebigsten Herren, die es seit Kaiser Friedrichs II. Zeit in Italien gegeben hat. Wie dieser einst in Verona ein überaus großes und herrliches Fest angesetzt hatte, und schon von allen Orten und Enden, besonders vom Hofe, Gäste von allerlei Stand und Würden sich einstellten, besann er sich plötzlich (man weiß nicht warum) eines andern, sorgte einigermaßen für diejenigen, die gekommen waren, und entließ sie. Nur ein gewisser Bergamino, ein Mann, von dessen fertiger und zierlicher Beredsamkeit man sich, ohne ihn gehört zu haben, keinen Begriff machen konnte, blieb allein zurück, ohne etwas zu bekommen, oder seinen Abschied zu erhalten, doch hoffte er noch