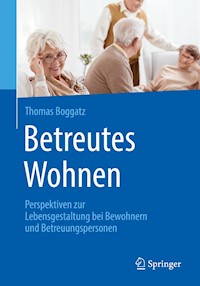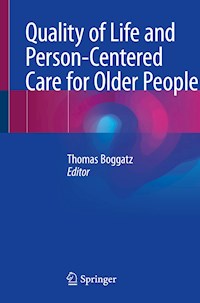Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band befasst sich mit dem gesellschaftlichen Dauerthema Demenz. Das Phänomen hat zu einer kaum noch überschaubaren Anzahl von Publikationen geführt, in denen Erklärungen angeboten und Lösungen für die mit der Zunahme demenzbetroffener Menschen einhergehenden Herausforderungen angeboten werden. Ein Konsens zeichnet sich dabei nicht ab & eher kann von einem Deutungskampf um die Wirklichkeit der Demenz gesprochen werden. Den Autoren dieses Bandes geht es daher um eine kritische Bestandsaufnahme des derzeitigen Stands der Diskurse und Praktiken zum Thema Demenz. Dabei gehen sie der wechselhaften Geschichte der Deutung von Demenz nach, fragen nach der Umsetzbarkeit von person-zentrierten Ansätzen in der Praxis und werfen einen kritischen Blick auf die Settings, in denen die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz stattfindet. Die vertretenen Thesen werden in Expertengesprächen einer kritischen Diskussion unterzogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autoren
Prof. Dr. Thomas Boggatz, Professor für klinische Pflege, Technische Hochschule Deggendorf.
Prof. Dr. Hermann Brandenburg, Professor für Gerontologische Pflege, Vinzenz Pallotti University, Vallendar.
Prof. Dr. Manfred Schnabel, Professor für Gemeindenahe Pflege, Evangelische Hochschule Ludwigsburg.
Thomas Boggatz/Hermann Brandenburg/Manfred Schnabel
Demenz
Ein kritischer Blick auf Deutungen, Pflegekonzepte und Settings
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-039286-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-039287-8
epub: ISBN 978-3-17-039288-5
Inhalt
Einleitung
Thomas Boggatz, Manfred Schnabel, Hermann Brandenburg
Literatur
1 Kritische Ontologie der Demenz
Manfred Schnabel
1.1 Einleitung
1.2 Ontologie der Demenz
1.2.1 Krankheit als naturwissenschaftliches Erkenntnisobjekt
1.2.2 Krankheit als Funktionsstörung
1.2.3 Krankheit, Leid und soziale Unterstützung
Erstes Fazit
1.3 Epistemologie
1.3.1 Gedächtnistests
1.3.2 Bildgebende Verfahren
1.3.3 Neurochemische Biomarker
Zweites Fazit
1.4 Historische Konjunkturen der Alzheimer Demenz
1.4.1 Die Entdeckung
1.4.2 Die Medikalisierung des Alters
1.4.3 Die Medikalisierung der Demenz
1.4.4 Die Demenz als bürgerschaftliches Projekt
Drittes Fazit
1.5 Demenz-Diskurse
1.5.1 Verlust und Korrektur – der »Defizit-Diskurs«
1.5.2 Sorge, Emanzipation und das gute Leben – der »person-zentrierte Diskurs«
1.5.3 Wirklichkeiten der Demenz
Viertes Fazit
Literatur
2 Expertengespräch: Demenzdiskurse – vom Nutzen der Verunsicherung
3 Konzepte zur Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz: Theorie – Methode – Kritik
Thomas Boggatz
3.1 Einleitung
3.2 Validation nach Feil und nach Richard
3.2.1 Theorie
3.2.2 Methode
3.2.3 Kritik
3.3 Das psychobiographische Modell nach Böhm
3.3.1 Theorie
3.3.2 Methode
3.3.3 Kritik
3.4 Person-zentrierte Pflege nach Kitwood
3.4.1 Theorie
3.4.2 Methode
3.4.3 Kritik
3.5 Das mäeutische Pflegemodell nach van der Kooij
3.5.1 Theorie
3.5.2 Methode
3.5.3 Kritik
3.6 Fazit
Literatur
4 Expertengespräch: Pflege- und Betreuungskonzepte für Menschen mit Demenz – Eine Inszenierung von Authentizität?
5 Settings für die Pflege von Menschen mit Demenz
Hermann Brandenburg, Volker Fenchel, Manfred Borutta, Ruth Ketzer
5.1 Einleitung
5.2 Pflegebedürftigkeit und Demenz im Alter – Die aktuelle Situation
5.3 Pflegesettings
5.3.1 Das häusliche Setting
Erstes Zwischenfazit
5.3.2 Das stationäre Setting
Zweites Zwischenfazit
5.4 Theorie und Praxis: Wie und warum funktionieren die Settings?
5.4.1 Settings als »triviale« Systeme
5.4.2 Die Settings als autopoetische Systeme
5.4.3 Interventionen in komplexen Systemen
Drittes Zwischenfazit
5.5 Plädoyer für eine Theoriebildung in der Pflege alter Menschen
5.6 Abschluss
Literatur
6 Expertengespräch: Settings in der Versorgung von Menschen mit Demenz – machen sie einen Unterschied?
Schlusswort
Manfred Schnabel, Thomas Boggatz, Hermann Brandenburg
Einleitung
Thomas Boggatz, Manfred Schnabel, Hermann Brandenburg
Deutungen der Demenz
In dem Fernsehfilm »Die Auslöschung« des österreichischen Regisseurs Nikolaus Leytner (2013) wird die Geschichte eines verwitweten Professors für Kunstgeschichte erzählt, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt. Zunehmend von Vergesslichkeit geplagt, besorgt er sich schließlich Gift, das er zu nehmen gedenkt, wenn sein Zustand nicht länger erträglich ist. Seine Lebensgefährtin muss mit ansehen, wie er zunehmend pflegebedürftig wird, bis dass er vollständig auf fremde Hilfe angewiesen ist und selbst die Fähigkeit zu sprechen verliert. Eines Abends mischt sie das Gift, das sie aufbewahrt hat, in einen Grießbrei, den er ohne zu zögern isst, sodass er stirbt.
Das Motiv für diesen assistierten Suizid ist aus einem Klassiker der Filmgeschichte bekannt. In »Einer flog über das Kuckucksnest« von Milos Forman (1975), der auf dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey (1972) basiert, wird ein straffällig gewordener Häftling in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, da er eine psychiatrische Erkrankung vortäuscht, um dem Arbeitsdienst im Gefängnis zu entgehen. Er erlebt mit, wie die übrigen Patienten durch eine repressive Behandlung hospitalisiert und entmündigt werden und ermutigt diese zum Widerstand gegen das psychiatrische System. Als der Konflikt zwischen Patienten und Personal eskaliert, versucht er die leitende Stationsschwester zu erwürgen, wird jedoch von den übrigen Pflegekräften überwältigt. Um seinen Widerstand endgültig zu brechen, wird er einer Lobotomie1 unterzogen, und sein Körper kehrt als geistlose Hülle auf die Station zurück. In der letzten Szene wird er von einem vermeintlich taubstummen Mitpatienten mit den Worten »Ich gehe nicht ohne Dich, so lasse ich Dich nicht hier!« erstickt, bevor dieser die vergitterten Fenster der Anstalt zerbricht und als einziger Patient entflieht.
Während Geistlosigkeit bzw. Demenz in »Die Auslöschung« die Folge einer degenerativen Erkrankung ist, ist es in »Einer flog über das Kuckucksnest« ein repressives System, das seine Kontrolle über den Patienten durch einen chirurgischen Eingriff gewinnt und auf diese Weise dessen Person auslöscht. In beiden Filmen ist die Rettung der zerstörten Person jedoch die gleiche: die Tötung des Patienten. Der Tod des Körpers scheint dabei ein Weg in die Freiheit zu sein. Der Geist, der im Körper zugrunde ging, wird durch dessen Ende wieder hergestellt. Beide Filme huldigen damit einem platonischen Mythos. Wenn der Körper das Grab der Seele ist (Platon: Gorgias 493a2-3), muss umgekehrt das Begraben des Körpers zu einer Befreiung der Seele führen.
In dem Film »Die Auslöschung« findet der Verlust des Geistes jedoch auf einer fundamentaleren Ebene statt. War es in »Einer flog über das Kuckucksnest« ein repressives System, das nur mit externer Gewalt den Freiheitsdrang der Hauptfigur zu bändigen vermochte, und war deren Tod eine Befreiung von äußerem Zwang, der nur so lange bestand, wie das System Gewalt über den Körper ausüben konnte, so vollzieht sich in »Die Auslöschung« eine Vernichtung der Person von innen heraus. Es ist der Körper selbst, der die Person abstreift, um als eine geistlose Hülle zurückzubleiben. Die Kränkung, die dem Geist auf diese Weise durch den Körper widerfährt, ist dabei umso größer, da es sich hier nicht um einen gewaltbereiten Sträfling handelt, sondern um einen Mann von Geist, einen Träger und Repräsentanten der geistigen Kultur, die durch die Demenz zu einer Fassade wird, hinter der sich kein Geist, sondern nur neurobiologische Prozesse verbergen. Nach Kopernikus, dessen Entdeckung den Menschen aus dem Zentrum des Universums verstieß, nach Darwin, demzufolge die Menschheit von tierischen Vorfahren abstammt, und nach Freud, der den Menschen mit der Einsicht konfrontierte, dass sich ein großer Teil des Seelenlebens der Kontrolle des Bewusstsein entzieht und dass damit »das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus«, scheint Alzheimers Entdeckung der Beta-Amyloid-Plaques in den Zwischenzellräumen des Gehirns die vierte große Kränkung des Selbstbilds der Menschheit zu sein. Geist wäre damit nichts weiter als ein Epiphänomen und seine Befreiung vom Körper ein Mythos, der nur noch im Film weiterlebt.
Das Fatale an dieser Kränkung ist, dass derjenige, der eine Heilung seines Geistes von der Krankheit Alzheimer wünscht, das geistlose Fundament der biochemischen Prozesse als letzte Wirklichkeit anerkennen muss, denn nur unter dieser Annahme kann einer medikamentösen Behandlung ein Effekt zugesprochen werden. Geist ist mithin durch Medikamente nur heilbar, wenn es ihn als solchen gar nicht gibt. Alternativ kann man versuchen, die Existenz des Geistes zu retten und ihm eine eigenständige Wirklichkeit zusprechen, die unabhängig von neurobiologischen Prozessen ist – was angesichts der bislang fehlenden Behandlungserfolge nicht weiter schwierig ist. In diesem Fall ist es – wie im Film »Einer flog über das Kuckucksnest« – das Verhalten der sozialen Umwelt (ihre maligne Sozialpsychologie, wie Tom Kitwood (2016), einer der bekanntesten Vertreter dieser Sichtweise, es bezeichnet), welches das Erscheinungsbild der Demenz erst erzeugt. Eine derartige Rettung des Geistes müsste allerdings konsequenterweise auf die Option einer medikamentösen Behandlung verzichten, was jedoch in der Praxis bei der Versorgung von Menschen mit Demenz nicht der Fall ist.
Es gibt damit mindestens zwei Deutungen der Demenz, die sich zwar widersprechen, in der Praxis jedoch koexistieren. Eine abschließende Antwort auf die Frage, was Demenz eigentlich ist, bieten sie beide nicht und eine Lösung des Problems ist damit nicht in Sicht. Warum aber ist Demenz überhaupt ein Problem? Beide Deutungen gehen davon aus, dass eine Beeinträchtigung des Geistes vorliegt – entweder durch eine Störung neurobiologischer Prozesse oder durch das depersonalisierende Verhalten der sozialen Umwelt. Könnte Demenz nicht aber auch die Lösung eines Problems sein? Könnte sie nicht als eine Befreiung des Körpers vom Geist gesehen werden – eine Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen, denen sich der Geist im Verlaufe seiner Bildung unterworfen hat? Dies wäre eine weitere Deutung des Phänomens Demenz, und in der aktuellen Diskussion wird diese auch tatsächlich angeboten (vgl. Wißmann & Gronemeyer 2008).
Inhalt und Aufbau dieses Buchs
Angesichts dieser ungelösten Fragen ist die Vielzahl an Publikationen, die zum Thema Demenz erschienen sind, nicht weiter verwunderlich. Dabei mag es überflüssig erscheinen, dieser Vielzahl nun eine weitere Publikation hinzuzufügen. Es ist allerdings nicht die Absicht dieses Buches, ein weiteres Deutungsangebot zur Demenz zu unterbreiten oder die vorhandenen Konzepte zum Umgang mit Menschen mit Demenz um weitere Deutungen und Konzepte zu ergänzen. Es geht dem Autorenteam vielmehr darum, einen Schritt zurückzutreten und den Diskurs zur Demenz sowie die damit verbundenen Praktiken distanziert zu betrachten. Ein Abstand zu festgefahrenen Diskursen und Praktiken erlaubt es vielleicht, den Blick für neue Perspektiven zu öffnen.
Da es das Anliegen dieses Buches ist, etablierte Sichtweisen in Frage zu stellen, widmet sich das erste Kapitel den empirischen und normativen Grundlagen des aktuellen Bildes der Demenz. In Anlehnung an eine poststrukturalistische Sichtweise betreibt Manfred Schnabel dabei eine Kritische Ontologie der Demenz ( Kap. 1), »die das scheinbar obligatorisch Gegebene als kontingentes Produkt eines machtindizierten Herstellungsprozesses betrachtet, den es zu entschlüsseln gilt«. Dabei rekonstruiert er die wechselhafte Geschichte des Diskurses zur Demenz, der trotz einer Dominanz des medizinischen Blicks zwischen einer medizinischen und einer psycho-sozialen Erklärungsperspektive schwankt, deren jeweilige Konjunktur von technischen, politischen und zeitgeschichtlichen Entwicklungen abhängig ist. Von Manfred Schnabel wird dabei die antagonistische Logik aufgedeckt, die den sich widersprechenden, diskursiven Konstruktionen zu Grunde liegt: Um im Wahren zu sein, benötigt jede Konstruktion ihr Gegenbild. Konkurrierende Deutungsangebote zur Demenz gewinnen Form und Überzeugungskraft aus der offensiven Abgrenzung gegenüber den jeweils verworfenen Interpretationen. Strebt man in der medizinischen Sichtweise nach einer Heilung der Demenz, kommt das Einnehmen der psycho-sozialen Perspektive einem Verzicht auf medizinischen Fortschritt gleich, strebt man in der psychosozialen Sichtweise nach einer positiven Arbeit an der Person, kann die Medikalisierung der Demenz nichts anderes als maligne Sozialpsychologie sein.
Thomas Boggatz beschäftigt sich mit den Versuchen der Rettung des Person-Seins von Menschen mit Demenz und der Frage ihrer praktischen Umsetzbarkeit ( Kap. 3). Untersucht werden dabei die Validation nach Feil und nach Richard, das psychobiographische Modell von Böhm, die person-zentrierte Pflege nach Kitwood und die Mäeutik von van der Kooij. All diesen Konzepten geht es um den originären Beitrag, den die Pflege beim Umgang mit Demenz leisten kann. Daher beziehen sie explizit oder implizit Position gegen eine rein medizinische Sichtweise, und es wird zum einen zu fragen sein, inwieweit ihnen die Loslösung von der medizinischen Perspektive auf das Problem gelingt, zum anderen wird zu klären sein, inwieweit sie nicht der Utopie einer authentischen, interpersonalen Begegnung im Sinne Martin Bubers (1983) verfallen, die ein quasi bedingungsloses Sich-Einlassen auf den Menschen mit Demenz erforderlich macht. Empirische Befunde zur Implementierung derartiger Konzepte werfen die Frage auf, ob solche Implementierungsversuche nicht zu einer Überforderung der Pflegenden führen, die nur dann zu vermeiden ist, wenn die Empathie, die die Pflegenden den Menschen mit Demenz zeigen sollen, nur vorgetäuscht und die Authentizität in der Begegnung mit ihnen nicht echt ist.
Hermann Brandenburg und Kolleginnen2 untersuchen schließlich die Settings zur Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz, deren Entstehung im Zusammenhang mit den diskursiven Konstruktionen und den mit ihnen verbundenen Praktiken zu sehen ist Kap. 5). Settings können dabei als Materialisierung von Konzepten und als Gehäuse von sozialen Praktiken gesehen werden. Demenz lässt sich damit insgesamt im Sinne eines Dispositivs verstehen. Ein Dispositiv ist nach Foucault ein »heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst« (Foucault, 1978, S. 119). Diese Elemente bestehen dabei nicht unabhängig voneinander, vielmehr ist das Dispositiv »das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann«. Auf diese Weise entsteht »eine Art von Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin besteht, auf einen Notstand zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion« (ebd.). Der Notstand, um den es in diesem Fall geht, ist die Zunahme von Menschen mit Demenz. Da die Formation, die als Antwort auf diesen Notstand entsteht, nicht zentral gesteuert ist, überrascht es auch nicht, dass die Settings, mit denen man versucht, auf Demenz zu reagieren, genau so wenig einheitlich sind wie die Praktiken und Diskurse. Ähnlich wie bei den diskursiven Konstruktionen zur Demenz lassen sich auch hier zwei gegensätzliche Ansätze beobachten: Pflege im primären sozialen Bezugssystem Familie, das auf einer emotionalen Basis beruht, und Pflege in Institutionen, die einer zweckrationalen Ordnung folgen, in der Emotionen keine wesentliche Rolle spielen. Es ist dabei fraglich, ob Diskurse und Settings in einem geradlinigen Verhältnis zueinanderstehen, so dass institutionelle Pflege automatisch zu einer Depersonalisierung der Pflegebedürftigen und einer Medikalisierung von Demenz führt, während familiäre Pflege per se mit einer bedingungslosen Anerkennung des Person-Seins der Betroffenen korrespondiert. Zu fragen wäre vielmehr, ob nicht auch ein depersonalisierender Umgang in Familien zu finden ist, und ob nicht auch eine positive Arbeit an der Person in Pflegeinrichtungen möglich ist. Emotionale Verbundenheit mit zweckrationaler Verrichtungsorientierung im Rahmen der institutionellen Pflege vereinbaren zu wollen, scheint aus einer systemtheoretischen Perspektive zwar einerseits eine unauflösbare Paradoxie zu sein, kann aber andererseits im Sinne der Theorie des professionalisierten Handelns nach Oevermann (1996) als Antinomie gesehen werden, die im Handlungsfeld der Pflege angelegt ist und die – sofern sie nicht in den Raum des Nicht-Besprechbaren verbannt wird – der Pflege erst den Charakter einer Profession verleiht.
Den Autoren der hier versammelten Beiträge kommt es dabei darauf an, die Perspektive, die sie selber zu diesen Fragen einnehmen, wiederum zur Diskussion zu stellen. Daher schließt sich an jedes Kapitel eine Diskussion mit anderen Experten und Expertinnen zum Inhalt des Kapitels an. Die konträren Ansichten, die dabei zur Sprache kommen, können in der Diskussion vielleicht zu einer Synthese finden, die neue Einsichten erlaubt, sie fordern jedoch in jedem Fall den Leser dazu auf, seine eigene Position zu beziehen.
Literatur
Buber M. (1983). Ich und Du. Ditzingen: Reclam
Foucault M (1978). Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve.
Kesey K (1972). Einer flog über das Kuckucksnest. Frankfurt a. M.: März.
Kitwood T (2016). Demenz. 7. Aufl., Bern: Hogrefe.
Oevermann U (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In: Combe A & Helsper W (Hrsg.) Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 70–182.
Wißmann P & Gromeyer R (2008). Demenz und Zivilgesellschaft – eine Streitschrift. Frankfurt am Main: Mabuse.
1 Eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden.
2 Texte sollten lesbar und verständlich sein, dazu muss auch die Sprache beitragen. Allerdings bildet sie auch Aspekte der Wirklichkeit ab bzw. schafft neue »Wirklichkeiten«. Wir werden daher überwiegend – sofern keine neutrale Form möglich ist (oder die männliche Form angemessen ist) – die weibliche Form benutzen. Sie schließt, sofern nicht anders genannt, alle weiteren Geschlechtsformen mit ein.
1 Kritische Ontologie der Demenz
Manfred Schnabel
Zusammenfassung
Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit dem Krankheitskonzept der Demenz. Zunächst werden medizinphilosophische Argumente zur Existenz von Krankheitsentitäten und davon ausgehend zum Krankheitsstatus der Demenz referiert und kritisch besprochen. Im Anschluss werden die wissenschaftlichen Methoden zur Entdeckung und Bestimmung einer Demenz bzgl. ihrer Möglichkeiten und Grenzen einer Analyse unterzogen. Durch einen Blick in die jüngere Geschichte der Demenzforschung werden schließlich die Kontingenz von Demenzdeutungen und ihre Wechselwirkung mit gesamtgesellschaftlichen Relevanzen offengelegt. Dass dieser Deutungsprozess bis heute nicht abgeschlossen ist, wird im letzten Teil durch eine Darstellung der aktuellen Auseinandersetzung um den Status der Demenz in wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Debatten dargelegt. Das Kapitel endet mit einer Darstellung der Wirkungen solcher Demenz-Deutungen auf Betroffene, Angehörige sowie professionelle Helferinnen und Forschende.
1.1 Einleitung
Modelle für die pflegerische Versorgung demenzbetroffener Menschen transportieren Leitideen zum Wesen demenzieller Veränderungen. Ihre Problembeschreibungen und Lösungsvorschläge beziehen ihre Logik aus spezifischen Annahmen zu den Ursachen und Folgen der Demenz. Dabei gilt nach wie vor das biomedizinische Modell3 als Leitbild (vgl. z. B. Panke-Kochinke et al. 2015). Unterstellt man, dass dieses Modell nicht alternativlos ist, muss eine kritische Besprechung demenzbezogener Pflegekonzepte mit der Infragestellung ihrer Prämissen beginnen. Das im westlichen Kulturkreis etablierte Bild der Demenz als Hirnerkrankung ist darum näher zu betrachten, ebenso die Idee, dass den demenzbedingten Herausforderungen vordringlich mit therapeutischen Interventionen zu begegnen ist. Die folgende Analyse folgt damit dem Programm einer »kritischen Ontologie«. Gemeint ist eine kritisch-analytische Haltung, die das scheinbar obligatorisch Gegebene als kontingentes Produkt eines machtindizierten Herstellungsprozesses betrachtet, den es zu entschlüsseln gilt (Foucault 2005a). Ziel ist es, das Wissen und die Praktiken rund um die Demenz nicht auf ihre Evidenz oder Wirksamkeit, sondern auf ihre Funktionalität innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse zu befragen. Diese kritische Betrachtung ist freilich weder Selbstzweck noch erschöpft sie sich in der Diskreditierung des biomedizinischen Modells. Vielmehr soll dargestellt werden, dass die den Modellen zugrundliegenden Prämissen nicht uneingeschränkt gültig und damit für Wissenschaft und Praxis auch nicht alternativlos sind.
Die Untersuchung bedient sich poststrukturalistischer Begriffe und Theorieangebote.4 Sie vollzieht sich in vier Schritten. Zunächst wird grundsätzlich die Frage nach der wissenschaftlichen Validität einer Unterscheidung von Krankheit und Gesundheit sowie nach den damit verbundenen Konsequenzen gestellt. Daran anschließend werden die Methoden kritisch hinterfragt, mit denen in Wissenschaft und medizinischer Praxis Erkenntnisse zur Alzheimer-Demenz gewonnen werden. Nach dieser Relativierung des naturwissenschaftlichen Blicks werden schließlich alternative Deutungen zur Entstehung und Etablierung eines biologischen Demenzbildes angeboten. Zunächst wird die Geschichte der Medikalisierung der Altersdemenz in einer historisch-genealogischen Perspektive erzählt. Ziel ist es, die Interdependenzen biowissenschaftlicher und anderer Erklärungsmodelle mit technischen, politischen und zeitgeschichtlichen Entwicklungen herauszustellen. Abschließend wird anhand einer Reihe aktueller Diskursanalysen dargelegt, wie neue Deutungen der Demenz in gesellschaftlichen Debatten hergestellt und alte verteidigt werden. Dabei wird einerseits die Kontingenz von Leitideen und andererseits ihre politische Dimension offengelegt.
Wenn im Folgenden ohne weitere Konkretisierung von Demenz gesprochen wird, ist damit immer die Demenz im Alter gemeint. Auf eine der offiziellen Nosologie folgende Benennung unterschiedlicher Formen und Varianten von Demenz wird dabei, sofern nicht ausdrücklich die Geschichte oder die Diagnostik der Alzheimer-Demenz besprochen wird, zumeist verzichtet. Die wissenschaftliche Etikettierung von auffälligen Phänomenen ist bereits Teil ihrer Wirklichkeit und daher in einer kritischen Analyse mit Vorsicht zu betrachten.
1.2 Ontologie der Demenz
Die Begriffe Gesundheit und Krankheit sind Schlüsselbegriffe des Gesundheitssystems und in den meisten Kulturkreisen auch Grundlage für das Selbstverständnis und den Handlungsrahmen medizinischer Berufe. Gesundheit als zu erreichendes oder zu erhaltendes Gut gibt medizinischen Handlungen eine Richtung vor, das Vorliegen von Krankheit legitimiert medizinische Eingriffe (Hucklenbroich 2012, Paul 2006a). Nur wenn menschliche Zustände »offiziell« als behandlungswürdig gelten, ist der Einsatz von Ressourcen zu ihrer Behandlung konsensfähig. Somit ist die sichere Unterscheidung zwischen gesunden und pathologischen Zuständen von zentraler Bedeutung für die Medizin und für das sie tragende Gesundheitssystem. Der Umgang mit Demenz bildet hier keine Ausnahme. Plausibilität und Legitimität medizinischer Interventionen im Bereich der Demenz sind an die Prämisse geknüpft, sie sei eine von einer »gesunden« Alterung klar unterscheidbare und somit pathologische Entwicklung.5
Worauf beruht aber nun diese Unterscheidung? Letztlich stellt die Diagnose einer Erkrankung immer die Feststellung einer Abweichung von einem als normal angenommenen Zustand dar. Gesundheit entspricht somit einer Norm, Krankheit ist dagegen eine Normverletzung (Romfeld 2015, Schramme 2012). Mit dieser Aussage wird freilich sofort die Frage relevant, anhand welcher Messlatte ein Zustand zunächst als »normal« identifiziert werden kann. Diese einfach erscheinende und von den Praktikern medizinischer Berufe kaum je gestellte Frage erweist sich allerdings als schwer zu beantworten. Ob Gesundheit und Krankheit überhaupt objektiv fassbare Kategorien darstellen, die mit den Instrumenten der empirischen Wissenschaften gemessen und bewertet werden können oder ob sie im Kern auf einer sozialen Bewertung beruhen und somit einer naturwissenschaftlichen Prüfung enthoben sind, ist z. B. strittig (Schramme).6 Dabei gilt vor allem die Beschreibung und Behandlung psychischer Erkrankungen als anfällig für den Einfluss impliziter Normen und Werthaltungen (Fangerau 2006). Grund ist, dass Ihnen häufig ein organischer Befund fehlt bzw. nicht mit der gleichen Eindeutigkeit wie bei somatischen Erkrankungen auszumachen ist (Frances 2013, Romfeld 2015). Die Alzheimer-Krankheit mag wegen ihrer als charakteristisch geltenden neuropathologischen Krankheitszeichen als Ausnahme gelten; allerdings fehlt auch hier der letzte Beweis für den Zusammenhang von Befunden und dem klinischen Bild der senilen Demenz. Die Ätiologie der Alzheimer-Erkrankung ist nach wie vor nicht abschließend geklärt (Gutzmann & Pantel 2019).
Im Folgenden sollen drei zur Unterscheidung von gesunden und pathologischen Zuständen regelmäßig ins Feld geführte Argumentationslinien kurz erläutert und kritisch besprochen werden. Konkret geht es um die naturwissenschaftliche Evidenz von Krankheitsbeschreibungen, um den Funktionsverlust, den Krankheiten bewirken und schließlich um die soziale Schutzfunktion, die mit einer Diagnose verbunden ist. Die Aussagen verdanken sich der komplexen interdisziplinären Debatte zum Wesen von Krankheit und Gesundheit, erheben aber nicht den Anspruch, diese umfassend abzubilden.7
1.2.1 Krankheit als naturwissenschaftliches Erkenntnisobjekt
Eine erste Argumentationslinie für den Status von Krankheiten als eigenständige Tatbestände gründet sich auf das naturwissenschaftliche Paradigma und sein Postulat einer kausalen Ordnung aller empirisch fassbaren Phänomene. Alle Erscheinungen der dinglichen Welt gelten als rational erklärbar und physikalisch messbar (Slezák 2012). In dieser Perspektive werden die physiologischen Prozesse des Organismus als Ausdruck einer funktionalen Anpassung an eine gegebene Umwelt verstanden. Körperliche und psychische Phänomene sind somit durch ihren Zweck erklärbar. Dabei wird unterstellt, dass die statistisch regelhafte und somit »normale« Ausstattung des Körpers zweckhaft ist und daher als »gesund« gelten kann. Abweichungen vom Standarddesign unterlaufen dagegen seine Funktionalität und können daher als Fehlfunktion bzw. als Krankheiten betrachtet werden. Um gesunde von krankhaften Zuständen zu unterscheiden, ist folglich Wissen über die dem Überleben dienenden und daher physiologischen Funktionen des menschlichen Körpers oder zumindest über die Normalverteilung von Körperformen und -funktionen erforderlich (Nesse 2012). Dieses Wissen ist nach Ansicht der Befürworter dieser als »naturalistisch« bezeichneten Perspektive heute vorhanden. Die Fülle der gewonnenen und in einem mehr als ein Jahrhundert währenden Prozess der wissenschaftlichen Auseinandersetzung validierten Befunde gelten als hinreichend sichere Grundlage für die Unterscheidung von gesunden und kranken Zuständen und als Beleg für die Gültigkeit der biomedizinischen Perspektive (Hucklenbroich 2012). Dass es dennoch nach wie vor Wissenslücken gäbe, sei kein Makel der Biomedizin, sondern Wesensbestandteil aller empirischen Wissenschaften (Hucklenbroich 2018, Lyre 2018).
Normalität bzw. Krankheit gelten folglich als statistische Größen, die anhand der Referenzgrößen biologische Funktionalität und Normalverteilung bestimmt werden können (Boorse 2012). Weil die Ermittlung von Normalität und Abweichung auf messbaren und daher objektiven Tatbeständen beruht, kann sie nach Boorse, einem prominenten Vertreter dieser Perspektive, ohne Bezugnahme auf ein Wertesystem vollzogen werden (ebd.). Dass die individuelle und gesellschaftliche Bewertung von krankhaften Zuständen auch normativen Charakter habe, wird zwar nicht bestritten, der auf wissenschaftlichem Wege gewonnene Begriff der Krankheit dürfe aber nicht mit seiner Bewertung durch den Einzelnen oder die Gesellschaft verwechselt werden (Hucklenbroich 2012, Nesse 2012).
Auch in der Diskussion um den Status der Demenz wird die in Jahrzehnten der Forschung gewonnene Fülle, Qualität und Komplexität wissenschaftlicher Erkenntnisse zu ihrer Pathologie und Ätiologie häufig als Beleg für die Validität ihrer biomedizinischen Einordnung angeführt. Sven Lind, ein bekannter Fürsprecher der naturalistischen Position, weist der Biomedizin sogar die Position der Leitwissenschaft bei allen demenzbezogenen Fragen zu (2004). Aber auch wenn die Fortschritte der Biomedizin evident sind, erscheint der Rekurs auf die Erfolge der naturwissenschaftlichen Methode dennoch als unzureichende Immunisierung gegen Kritik. Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen:
Grenzen der Statistik
Ein erster Einwand richtet sich gegen das Konzept der Normalverteilung von Eigenschaften als objektive Bestimmungsgröße für Gesundheit und Krankheit. Der kritische Punkt ist hier die Festlegung der Grenze, ab der eine Norm als verletzt gelten kann. Statistische Verfahren alleine sind Kritikern zufolge hier nicht hilfreich. Aus einer Fülle an Daten lassen sich zwar Mittelwerte für unterschiedlich ausgeprägte Phänomene wie IQ, Blutwerte, Körpergewicht oder Sexualverhalten errechnen – angesichts der Fülle an individuellen Ausprägungen des Menschlichen wird sich aber kaum ein Individuum zu jeder Zeit seines Lebens genau in dieser Mitte befinden (Frances 2014). Abweichungen sind also normal. Es muss folglich immer noch die Frage geklärt werden, ab welcher Position auf der glockenförmigen Normalverteilungskurve eine Abweichung, z. B. ein unterdurchschnittlicher Intelligenzquotient oder eine überdurchschnittliche Körpergröße, noch tolerabel ist bzw. wann sie als pathologisch gelten kann. Ein Krankheitswert könnte hier Orientierung geben, allerdings fehlt er den Normverletzungen häufig oder ist zumindest umstritten. Dies gilt bereits für die Bestimmung »normaler« Cholesterin- oder Blutdruckwerte und in besonderer Weise für die Festlegung einer »normalen« Sexualität oder einer »normalen« Trauerzeit nach dem Verlust einer nahestehenden Person (ebd., Maio 2017).8 Eine Bestimmung der Grenze zwischen dem Spektrum des Normalen und dem Pathologischen ist somit durch Statistik alleine nicht möglich. Benötigt wird ein externes inhaltliches Kriterium zur Bewertung der festgestellten Abweichungen (Bobbert 2012). Die Entscheidung bleibt somit letztlich eine normative Festlegung und damit offen für Auslegungen.
Tatsächlich ist durch Studien gut belegt, dass die Festlegung oder Verschiebung der Grenzen zwischen den Sphären des Normalen und des Abnormen häufig Ausdruck gesellschaftlicher Konventionen und Normalitätsvorstellungen ist (s. u.). In Zeiten eines zunehmend marktförmig organisierten Gesundheitswesens werden außerdem wirtschaftliche Interessen bei der Verhandlung von Krankheitsbildern bedeutsam9. Hinzu kommen politische Steuerungsinteressen oder die Interessen der von Krankheit Betroffenen bzw. ihrer politisch agierenden Organisationen.10 Krankheiten sind somit (auch) Produkte eines Aushandlungsprozesses zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren und Interessenslagen.
Auch bei der Zuordnung der senilen Demenz zum Morbus Alzheimer spielten soziale Faktoren eine gewichtige Rolle (ausführlich Kap. 1.3). Ob Desorientierung im Alter normal oder krankhaft ist, lässt sich somit auch bei der Demenz nicht nur durch eine objektive Abgrenzung von einem »gesunden« Alter bestimmen. Im Gegenteil, angesichts der Häufigkeit der Demenz im Alter müsste der kognitive Abbau eigentlich als Normalzustand gelten (vgl. dazu Förstl 2012). Die Bestimmung von Mittelwerten und die daran anknüpfende Einordnung von Befunden als normal oder pathologisch sind somit zwei unterschiedliche Dinge. Statistische Verfahren ermöglichen es zwar, aus einer Fülle von Daten eine Verteilungskurve zu ermitteln – eine Aussage über die Bewertung von Abweichungen erlauben sie aber nicht. »Die Glockenkurve offenbart uns viel über die Verteilung von allem Möglichen (…), aber sie gibt uns nicht vor, wo das Normale endet und das Abnormale beginnt.« (Frances 2014, S. 31)
Subjektbezogenheit von Krankheit
Ein weiteres Argument gegen den objektiven Status von Krankheiten ist der Umstand, dass sich jedes Krankheitsgeschehen notwendigerweise in einem Individuum manifestieren muss, um überhaupt sinnvoll als Erkrankungen gefasst werden zu können. Krankheiten haben im Moment des Krankseins somit immer ein »subjektives« Element. Das bedeutet im Umkehrschluss – ein wenig überspitzt formuliert – dass Krankheiten außerhalb des kranken Individuums nicht existieren (Schramme 2012). Arthrose oder Herzinsuffizienz haben keine Existenz aus eigenem Recht; sie bedürfen menschlicher Gelenke oder Herzen, anhand deren Zustand sie als Krankheit beschrieben werden können. Selbst Infektionskrankheiten bilden hier nur bedingt eine Ausnahme, auch wenn die Existenz von pathogenen Keimen außerhalb des menschlichen Organismus kaum bestritten werden kann. Ob ein Mensch aber infiziert wird und im Falle einer Infektion Symptome entwickelt, bleibt von einer Reihe individueller Resilienz- und Risikofaktoren abhängig (ebd.). Neben biologischen Faktoren spielen hier – wie bei Erkrankungen allgemein – auch Persönlichkeit, Einkommensstatus, soziale Position, Bildungsgrad oder Lebensstil eine Rolle. Auch für Covid-19 ist dieser Zusammenhang belegt (Hobel et al. 2021). Wegen der großen Spannbreite der von Menschen mitgebrachten biologischen, sozialen oder biografischen Voraussetzungen fallen Anfälligkeit, Verlauf, Konsequenzen und persönliche Wertung einer Erkrankung höchst unterschiedlich aus (Engelhardt 2012, Maio 2017). Wenn Krankheiten aber als individuelle Phänomene begriffen werden, sind der Verallgemeinerung von Krankheitszeichen Grenzen gesetzt. Das subjektive Element von Krankheit steht daher nach Ansicht einiger Medizintheoretikerinnen einer umfassenden objektiven Fundierung der Begriffe Krankheit und Gesundheit entgegen (Paul 2006b, Schmidt-Wilke 2003).
Aufforderungscharakter des Krankheitsbegriffs
Auch die im Krankheitsbegriff implizite Handlungsaufforderung gilt als Argument gegen die Naturalisierung und Objektivierung von Krankheiten. Sie unterstreicht den oben bereits angeklungenen normativen Charakter des Krankheitsbegriffs. Wie schon erläutert, bedeutet die Feststellung einer Erkrankung, ein gegebenes körperliches oder psychisches Phänomen als Abweichung von einem als physiologisch geltenden und daher normalen Zustand zu definieren. Damit ist zudem implizit die Möglichkeit der Behandlung bzw. Korrektur verbunden. Für die als krank bezeichneten Betroffenen kann man annehmen, dass sie ihr Defizit als negatives Faktum anerkennen und die in Aussicht gestellte Korrektur einfordern. Gleiches gilt für die sie inkludierenden Sozialsysteme. Der Begriff der Krankheit erzeugt folglich Erwartungen und Handlungszwänge (Engelhardt 2012, Kipke 2012). Heilungswünsche müssen befriedigt, Fehlzeiten am Arbeitsplatz entschuldigt und entstandene Kosten gegenüber den Leistungsträgern legitimiert werden (Paul 2006c). Die Diagnose einer Erkrankung ist deshalb in kritischer Perspektive kein objektiver naturwissenschaftlicher Erkenntnisprozess, sondern Teil der gesellschaftlichen Strategie zum Umgang mit normverletzenden oder leidverursachenden Phänomenen. Ziel der Diagnose ist daher auch nicht die Suche nach der »Wahrheit« des Einzelfalls, sondern seine Subsumption in die Liste der bereits als behandlungswürdig anerkannten und entsprechend alimentierten Beeinträchtigungen (ebd.). »… in der Medizin steht die Suche nach Wissen hinter der Therapiebedürftigkeit erst an zweiter Stelle« (Borck 2016, S. 18). Folgt man dieser Argumentation, dann besteht die Funktion von Nosologien folglich auch nicht in der objektiven Beschreibung von »Krankheitsentitäten«. Vielmehr bilden sie einen in Politik und Fachwelt etablierten Rahmen, dem individuelle Fälle zugeordnet und einer als wissenschaftlich begründet geltenden Behandlung zugeführt werden können (ebd., Paul 2006c).
In dieser Perspektive sind Krankheiten folglich keine Naturphänomene, die ähnlich wie Pflanzen oder Planeten unabhängig von menschlichen Interessen existieren und objektiv vermessen werden können. Krankheitsdefinitionen erfüllen vielmehr eine soziale Funktion. Der soziale Charakter des Krankseins geht der biowissenschaftlichen Einordnung von Krankheiten voraus. Anders ausgedrückt ist »Kranksein (…) nicht ein natürliches kulturelles Epiphänomen von Krankheit, sondern Krankheit ist ein kulturelles Epiphänomen von Kranksein« (Schmidt-Wilke 2003, S. 83).
Wissenschaft und Kultur
Ein letzter Einwand soll etwas ausführlicher besprochen werden: Der Rekurs auf wissenschaftliche Befunde als Beleg für die Existenz objektiver Krankheitsentitäten jenseits ihrer gesellschaftlichen Bewertung transportiert die implizite Prämisse, dass der Wissenschaftsbetrieb wertneutral und folglich frei von politischen und wirtschaftlichen Interessen sowie unbeeinflusst von den Werten und Normen in einer gegebenen Gesellschaft sei. Dass die Wissenschaft inklusive der Medizin in Forschung und Praxis aber Teil gesellschaftlicher Machtkonstellationen und Wertesysteme ist und diese durch ihr Tun stabilisiert und reproduziert, ist durch viele Studien belegt (s. u.). Die biowissenschaftliche Klassifizierung pathologischer Phänomene vollzog (und vollzieht) sich stets im Kontext der Problematisierung von Zuständen, Personen oder Gruppen auf der Basis bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse. Wie die folgenden Beispiele zeigen, folgen die wissenschaftlichen Erklärungen für die beanstandeten Störungen zwar wechselnden zeitgenössischen Strömungen und wissenschaftlichen Moden; das grundlegende normative Gerüst bei der Beurteilung von normalen und abweichenden Zuständen und die dahinter wirkende Machtstruktur bleiben aber gleich:
• So galt z. B. Masturbation vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert als schwerwiegende Erkrankung, die unbehandelt zu Verdauungsstörungen, Impotenz, Schwindsucht, »geistiger Zerrüttung« oder »Hirnerweichung« führen kann. Kritisch betrachtet wurde die kirchliche Verurteilung dieser nicht auf Reproduktion zielenden und daher »gottlosen« Sexualpraktik von Medizinern übernommen und naturwissenschaftlich reformuliert. Die pathologische Verschwendung von Samen wurde zunächst humoralpathologisch (als Störung des Säftegleichgewichts), dann neurologisch (als Suchterscheinung) und schließlich eugenisch (als Ausdruck genetischer Degeneration) gedeutet (Ritzmann 2018).
• Psychiatrische Frauenleiden (dazu gehörten auch »wollüstige« Erregung oder sexuelle Phantasien) wurden bis ins frühe 20. Jahrhundert von der noch ausschließlich männlichen Medizin grundsätzlich auf die naturgegebene Unvollkommenheit des weiblichen Körpers zurückgeführt (Shorter 1989). Die naturwissenschaftliche Erklärung der als Fakt angenommenen weiblichen Schwäche folgte dabei den gerade gültigen Leitideen der medizinischen Wissenschaft. Frauenleiden wurden als Irritation der Nervenbahnen durch den Uterus, als Fehlfunktion der Ovarien oder ganz allgemein als Resultat der als anfällig erachteten psychischen Konstitution der Frau erachtet (ebd., Honegger 1989).
• In ähnlicher Weise wurde die Ätiologie von Altersgebrechen parallel zur Verfeinerung naturwissenschaftlicher Messmethoden und Bezugsgrößen erst als Erschöpfung der Organe, später als Verfall der Gewebe und schließlich als Folge der Zellalterung erklärt (von Kondratowitz 1989). Die inhärente Prämisse, dass Alter vor allem Abbau und Funktionsverlust bedeutet, bleibt in den wechselnden Erklärungsmustern konstant.
• Der schlechte Gesundheitsstatus großer Teile des Industrieproletariats zu Zeiten des Frühkapitalismus wurde aus Sicht der dem Bürgertum entstammenden Mediziner auf das unmoralische Verhalten der Arbeiter und ihren zügellosen Lebenswandel zurückgeführt. Den Vorstellungen der Zeit folgend wurde Gesundheit als Effekt eines maßvollen, fleißigen und vor allem moralisch einwandfreien Lebens betrachtet, Krankheit dagegen als Produkt einer moralischen Verfehlung (Labisch 1992).
• Ein letztes, in die Gegenwart reichendes Beispiel für den Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Bewertung menschlicher Phänomene ist die Medikalisierung der Homosexualität und anderer in den Augen früherer Gesellschaften »perverser« Sexualpraktiken. Homosexualität galt lange als todeswürdige Sünde. Im Zeitalter der Wissenschaften wird sie zur Geisteskrankheit. Eine negative Bewertung ist freilich beiden Interpretationen inhärent. Als Ursache wurden von Biowissenschaftlern je nach Profession und Zeitgeschmack eine Hormonstörung vor der Geburt, eine zu starke Bindung an die Mutter oder zuletzt eine genetische Veranlagung angenommen (Sigusch 2010). Keine dieser Theorien ließen sich wissenschaftlich erhärten. Auch die Pathologisierung der Homosexualität kann somit als Ausdruck einer Verstetigung gesellschaftlicher Normen mit Mitteln der Biowissenschaft betrachtet werden.
In den genannten Beispielen sind es die kulturellen Muster einer bürgerlichen Werteordnung, die wissenschaftlichen Beobachtungen eine Form geben – Vorstellungen über die Stellung der Geschlechter, den Wert alter und unproduktiver Menschen oder die moralische Überhöhung von Sauberkeit und Anstand. Wissenschaftliche Erklärungen widerlegen nicht etwa derartige vortheoretische Annahmen, sie verleihen ihnen vielmehr Plausibilität. Wiedersprüche einer sich als modern und aufgeklärt verstehenden Gesellschaft, z. B. konflikthafte Ungleichheitsverhältnisse zwischen Männern und Frauen, Jungen und Alten oder Besitzenden und Abhängigen werden einer säkularen Deutung und rationalen Bearbeitung zugänglich gemacht (Labisch 1989). Wissenschaft wird also nicht in einem wertfreien Raum praktiziert, sondern von gesellschaftlichen Wertmaßstäben gerahmt. Dieser Werterahmen formt die Erklärungsmodelle der Forschenden und damit ihren Blick auf die fokussierten biologischen oder psychischen Phänomene. Er produziert Definitionen von Krankheit, die anschlussfähig an vorherrschende kulturelle Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit sind und deshalb innerhalb und außerhalb der Wissenschaft Akzeptanz finden (Paul 2006a, Ritzmann 2018). Die biomedizinische Wissenschaft ebenso wie die medizinische Praxis ist somit mehrfach vom »Sozialen« affiziert. Biowissenschaftliche Theorien liefern anschlussfähige Erklärungen für störende soziale Phänomene; kulturelle Vorstellungen über behandlungswürdige Zustände prägen das Aufgabenfeld medizinischer Berufe und verschaffen ihren Handlungen Legitimität. Dabei sind, wie die genannten Beispiele zeigen, sowohl die kulturellen Muster zur Bewertung von störenden Phänomenen wie auch die innerhalb der Wissenschaften verwendeten Erklärungsmodelle historisch kontingent.
Einen rein naturalistischen Krankheitsbegriff kann es folglich nicht geben (Maio 2017). Für die Beurteilung der Legitimität medizinischer Interventionen reicht Naturwissenschaft daher auch nicht aus. Die populäre Unterscheidung zwischen disease (Krankheit als Fakt) und illness (Kranksein als subjektives Erleben) ist irreführend, zumindest, wenn Subjektivität nur im Erleben von Erkrankungen, nicht aber in ihrer wissenschaftlichen Beschreibung gesehen wird (Beck 2011, Lanzerath 2008). Die Vermessung und Klassifizierung eines menschlichen Zustandes ist stets in einen kulturellen Kontext eingelassen, der mit den Instrumenten der Naturwissenschaften nicht fassbar ist. Die von den Befürwortern der naturalistischen Perspektive vorgeschlagene Trennung zwischen einer zwar fehlbaren, aber dennoch strikt rationalen und der Wahrheit verpflichteten Wissenschaft und der Gesellschaft, in der sie Anwendung findet, ist daher nicht möglich. Auch die in der Argumentation implizite Annahme einer gradlinigen Entwicklung zu immer profunderen Erkenntnissen erscheint angesichts der historischen Kontingenz von Erkenntnisformen als unterkomplex (vgl. auch Borck 2016).
Natürlich können die oben angesprochenen Krankheitstheorien heute als krude und längst überholt gelten. Die darin zum Ausdruck kommende Vermischung von Medizin, Moral und Machtinteressen erscheint aus der Perspektive der Gegenwart allzu offensichtlich. An der Kontextabhängigkeit jeglicher Wissensproduktion ändert das aber aus der hier gewählten kritisch-ontologischen Perspektive nichts. Die Klassifizierung von Erkrankungen, die als sinnvoll erachteten therapeutischen Ansätze und das zur Plausibilisierung herangezogene Wissen sind – mit Foucault gesprochen – Teil eines Dispositivs, eines Sets aus Praktiken und Diskursen auf der Basis gesamtgesellschaftlich gültiger Narrative (2003a). Das uns heutige Praktiken der Wissensproduktion und -anwendung im Vergleich mit früheren Entgleisungen modern und aufgeklärt erscheinen, liegt demnach nicht (nur) an der Überlegenheit unseres Wissens, sondern auch an einem durch eben dieses Wissen bereits fokussierten Blick. Insofern ist es gewiss nicht ausgeschlossen, dass aktuell gültige (wenn auch bereits umstrittene) Krankheitsbilder wie ADHS, SAD (Social Anxiety Disorder) oder senile Demenz irgendwann als zeittypische Verirrungen erkannt und aufgebeben werden.
1.2.2 Krankheit als Funktionsstörung
Eine andere Argumentationsfigur zur Unterscheidung von normalen und pathologischen Zuständen stellt im weitesten Sinne auf nachteilige Funktionsstörungen ab, die bestimmte Zustände für die betroffenen Personen bedeuten und sie von gesunden und daher auch nicht benachteiligten Personen unterscheiden. Ein solcher Nachteil kann zunächst ganz allgemein in der verringerten Überlebenswahrscheinlichkeit funktionsgestörter Individuen gesehen werden. Wer aufgrund von signifikanten Unterschieden in der körperlichen oder psychischen Ausstattung eine im Vergleich zu nicht beeinträchtigten Personen kürzere Lebensspanne aufweist (bei Nichtbehandlung der Beeinträchtigung), kann demnach als krank gelten (Hucklenbroich 2018). Von einer Krankheit kann auch dann gesprochen werden, wenn ein Mensch seinen im Lebenszusammenhang »üblicherweise« anstehenden Aufgaben wegen des Ausfalls »normalerweise« verfügbarer Körperfunktionen nicht mehr gewachsen ist. Der Funktionsverlust muss für Einzelne oder die »Gattung« außerdem hinreichend relevant sein, um gerechtfertigt als »krank« bezeichnet werden zu können (Wakefield 2012). Nesse betrachtet aus einer evolutionsbiologischen Perspektive argumentierend z. B. solche Zustände als pathologisch, die den Reproduktionserfolg der Betroffenen beeinträchtigen (2012, vgl. auch Hucklenbroich 2018). Weil die Gesetze der Evolution universell sind, so Nesse, sei auch die Feststellung eines krankheitsbedingten Reproduktionsnachteils letztlich wertfrei und unbeeinflusst von sozialen Erwägungen zu treffen (2012). Andere Autoren nennen auch soziale oder persönliche Aspekte als Kriterien für krankheitswerte Verluste. Genannt werden Einschränkungen in der Fähigkeit zum sozialen Zusammenleben (Hucklenbroich 2018) oder die Nichterfüllung essenzieller Bedürfnisse wie Sicherheit, Partizipation oder Selbstverwirklichung (Gelhaus 2012). Einem Vorschlag Nordenfelts zufolge können außerdem solche Funktionsverluste als pathologisch gelten, die die Handlungsfähigkeit beeinträchtigen und so zum Verfehlen wesentlicher Ziele führen (2012a). Dazu zählt er neben dem Erhalt des Lebens auch die Realisierung eines zufriedenstellenden und glücklichen Daseins (ebd., Nordenfelt 2012b). Nicht der Funktionsverlust als solches, sondern seine Auswirkung auf Lebensqualität und Wohlergehen wären demnach ausschlaggebend für die Feststellung einer Erkrankung (ebd.).
Den Krankheitsbegriff an den negativen Konsequenzen einer Abweichung festzumachen, hat Nesse zufolge außerdem den Vorteil, dass massenhaft auftretende und somit eigentlich »normale« Phänomene wie die Altersdemenz als krankhaft betrachten werden können (2012). Zwar ist sie aufgrund ihrer Häufigkeit kaum als Abweichung von der Norm zu fassen; weil sie für die Betroffenen aber eine Funktionseinschränkung darstellt, ist sie dennoch als pathologisches Phänomen zu betrachten (ebd.).
Das der Verlust von Fähigkeiten und Funktionen i. d. R. einen Nachteil bedeutet und von den Betroffenen negativ erlebt wird, ist gewiss unstrittig. Die offizielle Anerkennung eines nachtteiligen »Defektes« ist in der gegebenen sozialstaatlichen Praxis zudem die Voraussetzung für die Freistellung von Pflichten und den Anspruch auf Transferleistungen. Dennoch lassen sich auch hier Einwände formulieren:
Unterstützung vs. Ausgrenzung
Als problematisch kann zunächst gelten, dass sich bei alleiniger Betrachtung von Fähigkeits- und Funktionsverlusten der Krankheitsbegriff enorm ausdehnen lässt. Alle mit Verlusten »normaler« Funktionalität einhergehenden Zustände, vom Alter bis zur Behinderung, wären dann eindeutig als krankhafte Zustände einzusortieren. Befürworter dieser Perspektive sehen darin einen Vorteil, weil sie mit der Anerkennung des Krankheitsstatus eines Leidens auch einen Anspruch auf Unterstützung verbinden, der Kreis der unterstützungsberechtigten Personen also mit jeder Erweiterung des Krankheitsbegriffs steigt (Nordenfelt 2012a). Ob ein Kriterium wie Krankheit oder Funktionsverlust aber geeignet ist, alte oder behinderte Menschen zu vergesellschaften oder ob die darin zum Ausdruck kommende negativ konnotierte Defizitperspektive sie nicht eher von den Gesunden abgrenzt und damit ausgrenzt, ist zu diskutieren.11 Hinzu kommt, dass nicht jedes problemverursachende Phänomen automatisch als unterstützungswürdig gilt. Das lange politische Ringen um die Anerkennung demenztypischer Fähigkeitsverluste in der Pflegeversicherung ist ein Beispiel dafür.
Problematischer Utilitarismus
Wenn Funktionalität als Unterscheidungskriterium zwischen krank und gesund gesetzt wird, muss außerdem geklärt werden, welche Funktionen im Leben eigentlich »normal« sind. Die oben besprochenen Vorschläge beantworten dies durch das implizite Postulat eines Zieles oder Zweckes, den ein Mensch im Verlauf seines Lebens zu erfüllen hat. Normalität und Abweichung werden an der gelungenen oder misslungenen Erreichung dieses Zieles gemessen (Maio 2017, Slezák 2012). Ziel ist je nach Konzept die Erhaltung der Art, das Überleben des Einzelnen oder das Erreichen persönlicher Ziele und persönlichen Glücks. Anzumerken ist hier, dass die genannten Kriterien weder universelle Gültigkeit beanspruchen können noch objektiv begründbar sind. Glück, Wohlergehen und die Verwirklichung von Zielen sind vielmehr typische normative Konzepte einer modernen und individualisierten Gesellschaft. Menschen anderer Epochen oder Kulturkreise würden sie als Kriterien eines sinnhaften und daher gesunden Lebens vermutlich weniger plausibel erscheinen. Selbst die Idee des Arterhalts durch fortgesetzte Reproduktion ist letztlich ein normatives Konzept, zumindest wenn der Erhalt der eigenen Art unreflektiert als wünschenswert betrachtet wird (Engelhardt 2012, Ringkamp 2018).12 Als moralische Wesen können Menschen in Bezug auf ihre eigene Art aber durchaus andere als »naturgegebene« Ziele verfolgen. Als Maßnahme gegen Überbevölkerung und Naturverbrauch können sie z. B. ihre Reproduktion bewusst einschränken (Bobbert 2012).
Funktionalität an positiv konnotierten Zielen festzumachen ist zudem nicht ohne Risiko für »funktionslos« gewordene Personen. Dies zumindest, wenn im Umkehrschluss ein sinnhaftes Leben an die Fähigkeit zur Verfolgung von Zielen geknüpft wird. Eine der zentralen Fragen in der Debatte um den Status von schwer demenzbetroffenen Menschen ist deshalb, ob der Wert einer Person unabhängig von Beeinträchtigungen bedingungslos gilt oder ob er – wie dies von einigen utilitaristischen Ethikern vertreten wird – z. B. an ihre Fähigkeit zu freien Entscheidungen oder zukunftsorientierten Planungen zu binden ist (vgl. Fuchs 2020, Schockenhof & Wetzstein 2013). Versteht man Entscheidungsfähigkeit als Funktion der Person, liefert die Anerkennung eines Funktionsverlustes ggf. die Vorlage zur Aberkennung des Personenstatus.
Technisierung von Gesundheit und Krankheit
Ein Letztes: Krankheit als Funktionsverlust mit Auswirkungen auf menschliche Ziele zu beschreiben leistet in kritischer Perspektive einem techniklastigen Verständnis von Krankheit und Gesundheit Vorschub. Gesundheit wäre dann nicht als umfassendes Wohlbefinden oder Abwesenheit von Krankheit zu betrachten, sondern mit einer prinzipiellen »Reparaturfähigkeit« gleichzusetzen. Umgedreht gerät alles zur Krankheit, was prinzipiell repariert werden könnte, aber nicht repariert wird (Bittner et. al. 2011). Wenn z. B. eine Frau nach der Menopause mithilfe ihrer in jüngeren Jahren entnommenen und konservierten Eizellen wieder »fruchtbar« werden kann (falls Fruchtbarkeit als Ziel gelten kann), müsste der vorangegangene Zustand der Unfruchtbarkeit als krankhaft gewertet werden. Zwar ist er Teil des natürlichen Lebenszyklus, aber dennoch prinzipiell behebbar und somit bei Nichtbehandlung als pathologisch einzuordnen. Die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit wird so zu einer Frage des technisch Machbaren (ebd.).
1.2.3 Krankheit, Leid und soziale Unterstützung
Eine letzte hier zu besprechende Argumentationslinie fokussiert die soziale Unterstützung, die mit dem Konzept der Krankheit verbunden wird. Die Anerkennung eines Zustandes als »krank« bedeutet demnach zugleich die Anerkennung des Leides und der Not der Betroffenen. Daraus kann wiederum ein solider Anspruch auf Hilfe abgeleitet werden. Solide deshalb, weil viele Autorinnen und Autoren in der Bereitschaft zu helfen eine anthropologische Vorbedingung menschlicher Gesellschaften sehen, kranke Menschen deshalb verlässlich auf Unterstützung zählen können. Gelhaus zufolge stellt Krankheit ähnlich wie Hunger und Durst die archaische Form einer Notsituation dar, die weitegehend unbelastet von religiösen und kulturellen Einflüssen Hilfsbereitschaft erzeugen kann (2012). Krankheit wird dabei als Einschränkung von objektiven Grundbedürfnissen verstanden, wozu wiederum das Überleben, ein aktives Leben, geistige Gesundheit und Autonomie gezählt werden (ebd.). Auch Hucklenbroich sieht in Vulnerabilität und Krankheitsanfälligkeit Grundprinzipien des Menschseins, den Wunsch zu heilen wiederum als anthropologische Konstante menschlicher Gesellschaften (2018). Unabhängig vom limitierenden Einfluss des Wissens und der technischen Fähigkeiten einer gegebenen Gesellschaft gilt ihm das ärztliche Handeln als Versuch, der Vulnerabilität der menschlichen Existenz so gut es geht gerecht zu werden (ebd.).
Neben dieser anthropologischen Argumentationslinie lässt sich die Notwendigkeit sozialer Unterstützung im Krankheitsfall auch mit der sozialstaatlichen Verantwortung für die Kompensation anerkannter Beeinträchtigungen begründen. Wenn Krankheiten Handlungsräume und Teilhabechancen der Betroffenen beschränken, stellen sie nach deutschem Recht eine Beschneidung ihrer Grundrechte dar. Daraus entsteht ein Auftrag zur Kompensation ihrer Beeinträchtigungen durch sozialstaatliche Institutionen.
Auch diese Argumentationsfiguren sind in der aktuellen Debatte um den Status der Demenz populär, vor allem bei den Befürwortern einer fortgesetzten Biomedikalisierung der Demenz. Fällt der Krankheitsstatus der Demenz, so das Argument, erlischt auch der Anspruch der Betroffenen auf Unterstützung (z. B. Lützau-Hohlbein & Schönhof 2010). Auch das Recht demenzbetroffener Menschen auf Selbstbestimmung und Teilhabe wird häufig als Argument für eine konsequente Diagnose und Behandlung demenzbedingter Fähigkeitsverluste verwendet. Nur wer im Rahmen des Möglichen geistig intakt ist, so wird angeführt, könne sein Anrecht auf Teilhabe auch wahrnehmen (z. B. Lehr 2010).
Dass Endlichkeit zum Menschen gehört und dass Menschen in Gemeinschaften leben, die mit der Hinfälligkeit ihrer Mitglieder umzugehen haben, soll hier nicht diskutiert werden. Dennoch ist auch dieses im Kern gewiss ernstzunehmende Argument differenziert zu betrachten.
Erlebtes Leid und Kulturen des Helfens
Zunächst erscheint die Annahme einer Direktverbindung von einer naturhaften menschlichen Anfälligkeit auf eine helfende Reaktion durch die Gemeinschaft als zumindest unterkomplex. Selbst wenn Hilfsbereitschaft ein anthropologisches Prinzip sein sollte, bleibt die Anerkennung oder Aberkennung bestimmter Hilfsbedarfe zumindest anteilig sozial bedingt. Dies gilt besonders in Bezug auf eher unscharfe Phänomene wie Krankheiten. Für den Bereich der psychiatrischen Diagnosen ist z. B. gut bekannt, dass diese starken länder- und kulturspezifischen Schwankungen unterliegen. Schizophrenie wird in den USA doppelt so häufig diagnostiziert wie in Europa (Finzen 2018). Innerhalb der USA wird sie wiederum bei Farbigen häufiger diagnostiziert als bei Weißen. Grund dafür sind Frances zufolge keine objektiven Unterschiede in der Biologie schwarzer oder weißer Patientinnen und Patienten, sondern ausschließlich Vorurteile und mangelnde Sensibilität für kulturelle Differenzen im Gesundheitswesen (2014).13
Auch die Aufmerksamkeit für das Problem der Demenz war kein Selbstläufer. Das Interesse wächst erst mit der Erfahrung und Problematisierung einer wachsenden Zahl alterserkrankter Menschen im Zuge des demografischen Wandels ( Kap. 1.4.2). Das Leid der Betroffenen alleine reichte nicht aus, um den Weg für höherrangige medizinische oder soziale Interventionen freizumachen. Das Leid mag engagierten Fachleuten und Laien auch vor dem Bedeutungszuwachs der Demenz nicht gleichgültig gewesen sein; es erscheint aber dennoch als zu einfach, helfendes Handeln als autonom und von der gesellschaftlichen Ebene unabhängig zu betrachten. Eine einfache Verbindung zwischen erlebtem Leid und seiner Diagnose und Behandlung gibt es in kritischer Perspektive nicht. Unterschiedliche Gesellschaften sind unterschiedlich sensibel (bzw. unsensibel) für die körperlichen und psychischen Belange ihrer Bürgerinnen und Bürger. Letztlich ist es neben biologischen Befunden immer auch das gesamtgesellschaftliche Interesse an der Korrektur gesundheitlicher Probleme, das medizinische Interventionen rechtfertigt (Paul 2006b).
Stigmatisierung und Entfremdung
Ein weiterer Einwand: auch wenn die Anerkennung einer Beeinträchtigung erfolgt ist, muss dies nicht automatisch positive Effekte für die Betroffenen nach sich ziehen. Die Anerkennung eines Hilfebedarfs bedeutet gleichzeitig die Anerkennung einer Abweichung. Als krank oder behindert eingestuft zu werden birgt stets das Risiko der Stigmatisierung (Romfeld 2015). Für Beeinträchtigungen, die wie Demenz den Verlust der Selbstbestimmtheit bedeuten können – ein im westlichen Kulturkreis hochgeschätztes Gut – gilt dies in besonderer Weise (Maio 2015). Dass Demenzbetroffene in ihrem Umfeld tatsächlich pauschale Disqualifizierung und soziale Ausgrenzung erfahren, ist durch Studien belegt ( Kap. 1.5.3).
Kritikern zufolge verleitet der durch den Krankheitsstatus der Betroffenen legitimierte biomedizinische Zugriff auf die Altersdemenz zudem zu der Erwartung, eine Lösung der demenzbezogenen Aufgaben müsse auch durch biologische Strategien herbeigeführt werden (z. B. Schockenhof & Wetzstein 2013). Die Anerkennung eines Krankheitsbildes Demenz scheint die Zuständigkeiten ausreichend genug zu klären, um zivilgesellschaftliche Kräfte von ihrer Verantwortung zu entbinden. Dieses Vertrauen in die Erklärungskraft und Lösungskompetenz der Medizin habe zu einer Vernachlässigung alternativer, nicht medizinischer Lösungsansätze beigetragen (ebd.). Auf den Punkt gebracht trägt die Medikalisierung der Demenz demnach dazu bei, die Betroffenen der Gemeinschaft zu entfremden und sie von solidarischen Hilfsbeziehungen in ihrem sozialen Umfeld abzuschneiden. Folgt man dieser Argumentation, würde die Anerkennung der Demenz als Krankheit nicht mehr Hilfe, sondern weniger Hilfe bedeuten – zumal die Reichweite biomedizinischer Interventionen bei Demenz stark limitiert ist.
Erstes Fazit
Viele der hier vorgestellten Argumentationslinien für die valide Unterscheidung von gesunden und krankhaften Zuständen rekurrieren auf die eine oder andere Weise auf als gegeben erachtete und daher implizit als unstrittig betrachtete Tatbestände. Je nach Provenienz sind es die anthropologischen Konstanten menschlicher Gemeinschaften, die Gesetze der Natur oder die objektiven Verfahren der Naturwissenschaften, die als Bezugspunkte dienen. Die Argumente prolongieren damit die Idee einer vom menschlichen Willen unabhängigen Natur, deren Gesetzmäßigkeiten und Sachzwänge eine Realität jenseits der kulturellen und technischen Gegebenheiten einer menschlichen Gemeinschaft darstellen. Entsprechend werden sie als wertneutrale und objektive Ansatzpunkte sowohl für die Biowissenschaften wie auch für die Formen organisierter Unterstützung gewertet. Wie gezeigt wurde, ist aber die Gestalt wissenschaftlicher Konzepte und helfender Praktiken innerhalb historisch-kultureller Rahmungen veränderlich.
Das Herausstellen der historischen Kontingenz von Krankheitsvorstellungen ist freilich nicht mit einem umfassenden kulturellen Relativismus zu verwechseln. Es geht nicht darum, die Existenz von Erkrankungen nur durch den Verweis auf die mit ihrer Definition verbundenen Wertvorstellungen, Machtinteressen und Verdienstmöglichkeiten zu erklären und sie damit letztlich als biologische Phänomene zum Verschwinden zu bringen (auch wenn einige Erkrankungen tatsächlich auf diese Weise verschwunden sind). Dies würde weder dem erlebten Leid der Betroffenen noch den sozialpolitischen Interessen der Gesellschaft gerecht werden. Paul zufolge würde eine weitreichende Ignoranz gegenüber der »Materialität« von Erkrankungen, sei es im Gewebe oder im menschlichen Verhalten, zudem einer unkontrollierten Ausdehnung von Krankheitsdefinitionen Vorschub leisten (2006b). Dennoch – wegen seiner weitreichenden Implikationen muss sich das Etikett »Erkrankung« eine kritische Reflexion seiner Prämissen gefallen lassen. Diagnosen können eine tiefe Zäsur im Leben der Betroffenen darstellen, häufig mit negativen Konsequenzen. Für die Demenz, die mit dem Verlust des Selbst gleichgesetzt wird, gilt dies in besonderem Maße. Darüber hinaus haben Diagnosen gesamtgesellschaftliche Wirkungen. Die Aussagen der Biomedizin hinterlassen einen viel tieferen Eindruck außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft als z. B. solche der Physik oder der Chemie. Grund ist ihr Gegenstand und ihre abgehobene Position.