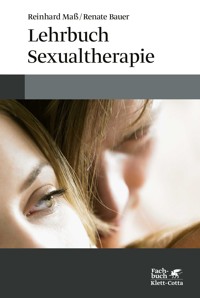21,99 €
Mehr erfahren.
Ihr Weg aus der Depression
In Deutschland werden immer mehr Antidepressiva verschrieben – und das nicht nur bei Depression, sondern auch bei vielen anderen seelischen Störungen. Diese Praxis wird zunehmend von zahlreichen Gesundheitsexperten kritisiert. Denn der Nutzen von Antidepressiva ist fragwürdig und mit Risiken verbunden, während Betroffene oft lange auf einen Psychotherapieplatz warten müssen, obwohl Psychotherapie nachweislich wirksam ist.
Prof. Dr. Reinhard Maß, leitender Psychologe am Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide (ZSGM) am Klinikum Oberberg, rät aufgrund der aktuellen Forschungslage von der Verwendung von Antidepressiva dringend ab. Er behandelt auf seiner Psychotherapiestation seit Jahren schwer depressive Patienten und hat in mehreren Fachveröffentlichungen gezeigt, dass Antidepressiva dabei überflüssig sind. In diesem Buch
- erläutert er, wie Depressionen entstehen,
- klärt kritisch über Antidepressiva auf,
- zeigt, was Sie selbst gegen Ihre Depression tun können,
- stellt die Perspektive der Verhaltenstherapie vor und
- beschreibt das stationäre Therapiekonzept am ZSGM und die hier durchgeführte Langzeitstudie.
Entscheiden Sie selbst, welchen Weg der Heilung Sie gehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Depressionen überwinden ohne Antidepressiva
Was Sie selbst gegen Ihre Depression tun können – und wie Psychotherapie hilft
Prof. Dr. Reinhard Maß
1. Auflage 2025
10 Abbildungen
Liebe Leserin, lieber Leser,
im Laufe der Jahrzehnte habe ich sehr viele Patientinnen und Patienten behandelt, die unter Depression litten. In diesem Buch möchte ich die wichtigsten Erfahrungen zusammenfassen, die ich im Rahmen meiner psychotherapeutischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser psychischen Erkrankung gemacht habe. Ein zentrales Anliegen ist mir dabei, zu erklären, was Depression eigentlich ist.
Das mag merkwürdig erscheinen, weil es bereits so viele Veröffentlichungen zu diesem Thema gibt. Aber leider hat sich dabei eine Sichtweise durchgesetzt, nach der Depression im Kern ein biologisches Problem ist, eine genetisch bedingte Erkrankung, eine Störung von Hirnfunktionen. Das geht einher mit der Vorstellung, eine Depression müsse ebenso mit Medikamenten behandelt werden wie andere körperliche Erkrankungen, vor allem mit Antidepressiva. Die meisten meiner ärztlichen und auch viele meiner psychologischen Kolleginnen und Kollegen denken so.
Diese Sichtweise steht nicht in Einklang mit dem aktuellen Forschungsstand, sondern fußt auf widerlegten Hypothesen, unbewiesenen Spekulationen und methodischen Fehlern in der Forschung. Sie ist schlicht und einfach falsch. Das möchte ich Ihnen in den ersten Kapiteln darstellen und aufzeigen, wie es zu dieser Fehlentwicklung kommen konnte. Die Gründe dafür, depressiv zu werden, sind vielfältig, aber es handelt sich dabei immer um psychologische oder soziale Faktoren, die wiederum wissenschaftlich gut belegt sind. Erst wenn über die wirklichen Ursachen Klarheit besteht, ist es möglich, wirksam gegen Depression vorzugehen. Was dabei getan werden kann und auf welche Weise Psychotherapie hilft, werde ich Ihnen in späteren Kapiteln aufzeigen.
Ich habe das Glück, auf der Station »Aaron T. Beck« im Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide seit vielen Jahren mit klugen, erfahrenen und engagierten Menschen in einem Team zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit hat sich bei uns ein bestimmtes Verständnis der Entstehung und Behandlung von Depression entwickelt. Unser Konzept ist nachgewiesenermaßen erfolgreich.
In diesem Buch fasse ich einen großen Teil unserer Erfahrungen und Erkenntnisse zusammen. Meine Hoffnung ist, dass es Ihnen dabei hilft, Ihren persönlichen Weg aus der Depression finden.
Reinhard Maß
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserin, lieber Leser,
1 Was ist »Depression«?
Die ICD-10
Die ICD-11
Weitere Beeinträchtigungen
2 Zwei Erklärungsansätze für Krankheiten
Die biomedizinische Wende der Psychiatrie
Depression aus biomedizinischer Sicht
3 Biologische Ursachen von Depression
Die Serotonin- bzw. Monoaminhypothese
Tri- oder tetrazyklische Antidepressiva
Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Forschungsergebnisse als Marketingdesaster
Antidepressiva sind nicht harmlos
Verkleinerter Hippocampus
Genetik
Ist Depression eine genetische Störung?
Die Suche nach dem »Depressionsgen«
Der Glaube an biologische Ursachen schadet
4 Wissenswertes über Antidepressiva
Häufigkeit der Verschreibungen
Wirkungsweise
Methodik der Pharmaforschung
Die Macht des Placeboeffekts
Durchbrechung der Doppelblindbedingung
Der Wash-out-Effekt
Die Publikationstendenz
Finanzielle Interessenkonflikte
Pharmakologische Wirkungen von Antidepressiva
Nebenwirkungen
Neuroplastizitätshypothese
Psychotherapie und Antidepressiva
Absetzen von Antidepressiva
Abhängigkeit der Psychiatrie von Antidepressiva
Ärztlicher Druck
5 Soziale Ursachen von Depression
Problem »Positive Psychologie«
Armut
Arbeitslosigkeit und geringe Bildung
Soziale Ungleichheit
Die wahren Ursachen erkennen
6 Psychische Ursachen von Depression
Prägende Erfahrungen in der Kindheit
Die Bindungstheorie
Depressive Eltern – depressive Kinder
Äußere und innere Lebensbedingungen
Das Waagschalenmodell
Risikokonstellationen für Depression
Die Eigendynamik der Depression
Gefühle
Verhalten
Gedanken
Das Denken verändern
7 Selbstverantwortung
Erfassung der Selbstverantwortung
Warum übernimmt nicht jeder Selbstverantwortung?
Selbstverantwortung und Schuld
Selbstverantwortung und Opferhaltung
Selbstverantwortung und sexueller Missbrauch
Selbstverantwortung und soziale Ungleichheit
Selbstverantwortung, Psychotherapie und Antidepressiva
8 Konstruktive Aggression und ihre Hemmung
Aggressionshemmung und Depression
9 Aktiv gegen Depression vorgehen
Verhalten ändern: konstruktive Aktivitäten
Einwand 1: Ich habe keine Lust
Einwand 2: Ich habe keine Kraft
Das Aktivitätsniveau langfristig erhöhen
Alltagsstrukturen einführen
Denken ändern: die ABC-Technik
The Map is not the Territory
Vier Schnäbel und vier Ohren
Denkfehler
Merkmale depressiver Bewertungen
Entwicklung konstruktiven Denkens
10 Anmerkungen zur Psychotherapie
Schädliche Grundüberzeugungen
Der versteckte Nutzen von Symptomen
Die eigene Komfortzone verlassen
Ambulant oder stationär?
11 Unser Therapiekonzept
Medikamente
Der Beginn der Behandlung
Therapieprogramm
Autonomie als übergeordnetes Ziel
Forschung
12 Langzeitstudie auf unserer Station
Das Beck-Depressions-Inventar
Die Ergebnisse
Zur »Antriebssteigerung« durch Antidepressiva
Schädigung der Sexualität durch Antidepressiva
Ausblick
Service
Literatur
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
1 Was ist »Depression«?
Diese scheinbar einfache Frage kann auf ganz unterschiedliche Weise beantwortet werden. Äußerlich betrachtet ist Depression eine seelische Störung, die durch bestimmte Symptome gekennzeichnet ist.
Wenn Fachleute die Diagnose einer Depression stellen, prüfen sie, welche Symptome vorliegen und seit wann dies der Fall ist (z. B. seit mindestens vier Wochen). Bei der Beurteilung müssen sie auf bestimmte Klassifikationssysteme zurückgreifen. Das sind Kataloge von Krankheitsbeschreibungen, die von Expertinnen und Experten der jeweiligen Fachgebiete erstellt wurden und international einheitlicher Standard sind.
Die ICD-10
In Deutschland wird derzeit die sogenannte »ICD-10« verwendet, die 1992 eingeführte 10. Version der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD steht für »International Classification of Diseases«), die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird.
Besonders wichtige Symptome einer Depression (in der ICD-10 wird von »typischen Symptomen« oder »Leitsymptomen« gesprochen):
Gedrückte Stimmung, Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung, manchmal auch der Verlust der Fähigkeit, überhaupt irgendwelche Gefühle zu empfinden;
Verlust von Interessen, Freudlosigkeit, z. B. das Aufgeben von Hobbys;
Störung des Antriebs. Meistens ist das die Beeinträchtigung der Fähigkeit zu zielgerichteten Aktivitäten, erhöhte Ermüdbarkeit, schnelle Erschöpfbarkeit, Kraftlosigkeit. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Antriebssteigerung kommen.
In der ICD-10 aufgezählte »zusätzliche«, ebenfalls auftretende Symptome:
Verminderte Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisstörungen;
Selbstzweifel, Verlust von Selbstvertrauen, Erleben eigener Wertlosigkeit;
Schuldgefühle, manchmal Selbsthass;
pessimistische Zukunftsperspektive;
Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen;
Schlafstörungen; meistens Ein- oder Durchschlafstörungen, gelegentlich auch ein erhöhtes Schlafbedürfnis, ständige Müdigkeit;
Appetitstörungen; meistens Verlust des Appetits, gelegentlich auch erhöhter Appetit (»Frustessen«), oft mit entsprechenden Änderungen des Körpergewichts.
Je mehr Symptome vorliegen, desto schwerer ist die Depression. So wird in der ICD-10 eine leichte depressive Episode als ein Zustand definiert, bei dem mindestens zwei der drei Leitsymptome und mindestens zwei zusätzliche Symptome vorhanden sind. Bei einer mittelgradigen Episode sollen es mindestens zwei Leitsymptome und mindestens drei (besser vier) zusätzliche Symptome sein, bei der schweren Depression müssen alle drei Leitsymptome und mindestens vier zusätzliche Symptome vorhanden sein, von denen einige stark ausgeprägt sein müssen.
Die ICD-11
Die Definitionen psychischer Störungen werden von Zeit zu Zeit geändert. Es liegt bereits die 11. Version der ICD vor, die im deutschen Gesundheitswesen ab 2027 verpflichtend sein soll. Dabei wurden auch Änderungen bei der Definition von Depression vorgenommen. So gilt die Störung des Antriebs in der ICD-11 nicht mehr als Leitsymptom, sondern nur noch als zusätzliches Symptom, sie hat also eine weniger große Bedeutung; Hoffnungslosigkeit wurde als weiteres zusätzliches Symptom aufgenommen. Am Ende des Kapitels ▶ »Soziale Ursachen von Depression« mache ich ein paar Anmerkungen zu den modernen Krankheitskatalogen, an dieser Stelle müssen wir uns darum nicht kümmern.
Weitere Beeinträchtigungen
Häufig finden sich bei Depression auch noch andere Beeinträchtigungen, zum Beispiel ein allgemeiner Rückzug aus dem Leben, die Vermeidung sozialer Kontakte und Aktivitäten (z. B. morgens nicht aufstehen, die Wohnung nicht verlassen), Lebensüberdruss, der Verlust der Fähigkeit, den Tag sinnvoll zu gestalten, die Wohnung in Ordnung zu halten, sich selbst zu versorgen (z. B. Ernährung, Körperpflege), der Verlust des Interesses an Sexualität (sexuelle Lustlosigkeit) sowie diffuse körperliche Beschwerden, z. B. Schwindel, Übelkeit, Schmerzen. Es kann zu weiteren Symptomen kommen, etwa zu massiven Angstzuständen bis hin zu Panikattacken. In seltenen, extrem schweren Fällen zeigen sich sogenannte psychotische Symptome, z. B. die wahnhafte Überzeugung, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden oder zu verarmen (»Verelendungswahn«), obwohl das nicht den Tatsachen entspricht.
Das ist also mit Depression gemeint. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass bei dieser Art der Diagnostik nicht nach den Ursachen gefragt wird. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Bei vielen anderen Diagnosen ist die Benennung der Ursache sogar Teil der Definition der Erkrankung. Beispielweise ist eine Erkältung eine Infektion mit Viren, ein Krebstumor entsteht durch entartete Zellen, Malaria ist eine Infektion mit einem Parasiten. Warum geht man bei Depression anders vor? Damit wollen wir uns im folgenden Kapitel ausführlich befassen.
2 Zwei Erklärungsansätze für Krankheiten
Über die Ursachen einer Depression wird bereits seit langer Zeit diskutiert, um nicht zu sagen gestritten. Um diese Diskussion zu verstehen, ist es zunächst erforderlich, zwei grundsätzlich unterschiedliche Erklärungsmodelle für Krankheiten zu betrachten, nämlich das biologische bzw. biomedizinische Modell einerseits und das psychosoziale Modell andererseits.
Das biomedizinische Erklärungsmodell betrachtet eine Krankheit als eine Abweichung von einem vorherigen Normalzustand (idealerweise ist das der Zustand der Gesundheit). Die Abweichung wird durch einen schädlichen biologischen, chemischen oder physikalischen Einfluss ausgelöst. Dabei kann es sich um eine Verletzung, eine Infektion, eine Vergiftung, einen Gendefekt o. Ä. handeln. Das Ziel einer biomedizinischen Behandlung (z. B. Operation, Medikamente) ist daher immer klar, sowohl für die Behandelnden als auch für die Kranken: Der vorherige Zustand soll so weit wie möglich wiederhergestellt werden, indem die Ursachen der Krankheit behoben oder zumindest deren Folgen gemindert werden.
Das psychosoziale Erklärungsmodell betrachtet die Krankheit als Folge von belastenden innerpsychischen und/oder äußeren (sozialen) Lebensbedingungen, meistens ist es eine Kombination verschiedener innerer oder äußerer Bedingungen. Ziel der psychosozialen Behandlung (z. B. Psychotherapie) ist daher nicht, den Ausgangszustand wiederherzustellen – denn genau hier liegen ja die Ursachen der Erkrankung –, sondern die krank machenden Bedingungen so zu verändern, dass die Symptome verschwinden können. Bei einer Psychotherapie geht es also grundsätzlich um Veränderung. Herauszufinden, was die psychosozialen Ursachen einer Störung sind, ist bereits Teil der Behandlung. Es sind immer die Patientinnen und Patienten, die das Ziel festlegen, und sie wissen am Anfang der Behandlung oft selbst noch nicht, was das Ziel ist oder welche Änderungen notwendig sind, um es zu erreichen.
Biomedizinische Krankheitsmodelle sind nicht besser oder schlechter als psychosoziale Krankheitsmodelle. (Beide Modelle können auch kombiniert werden. So ein »biopsychosoziales Erklärungsmodell« passt z. B. für Magengeschwüre, bei denen Stress, Rauchen, genetische Veranlagung und eine Bakterieninfektion als Ursachen angenommen werden. An dieser Stelle ist das aber nicht von Belang.) Entscheidend ist, welches Modell bei welcher Krankheit angewendet wird. So ergibt es wenig Sinn, nach psychosozialen Ursachen für einen Knochenbruch zu suchen oder diesen mit Psychotherapie behandeln zu wollen.
Die Frage, um die es hier geht, lautet: Welches Erklärungsmodell passt für Depression? Ist die Depression als seelische oder als körperliche Erkrankung zu betrachten? Die Antwort der Psychiatrie hängt eng mit ihrer Geschichte zusammen. Daher müssen wir einen Blick auf die wissenschaftshistorische Entwicklung dieses Faches werfen.
Die biomedizinische Wende der Psychiatrie
Man kann sich das heute nur noch schwer vorstellen, aber bis in die 1950er-Jahre hinein war die Psychiatrie ein ausgesprochen psychotherapeutisch ausgerichtetes Fach, dabei war die Psychoanalyse dominierend. In der Psychoanalyse werden seelische Störungen psychologisch erklärt und z. B. als Folge von unbewussten Konflikten und Angstabwehr betrachtet. Solche Prozesse sind mit wissenschaftlichen Methoden kaum nachweisbar.
Ohnehin stand die Psychoanalyse der empirischen Forschung traditionell eher fern. Hierbei werden wissenschaftliche Erkenntnisse durch Formulierung und Prüfung von Hypothesen mittels systematischer Beobachtungen, Messungen oder Experimenten gewonnen. Zugleich zeigte sich, dass die Anwendung psychoanalytischer Konzepte bei der Behandlung psychischer Störungen oft wenig erfolgreich war.
Daher wuchs bei der nachrückenden Generation von Psychiaterinnen und Psychiatern die Unzufriedenheit mit der einseitig psychoanalytischen Ausrichtung, und es entwickelte sich eine starke Gegenbewegung. Dabei hatten die 1972 veröffentlichten sogenannten »Feighner-Kriterien« ▶ [1] großen Einfluss, in denen unter anderem gefordert wurde, dass die Psychiatrie wieder zu einer im engeren Sinne ärztlichen Fachrichtung werden und sich auf die biologischen Ursachen seelischer Störungen konzentrieren sollte. Dieser Artikel hatte erheblichen Anteil an der biomedizinischen Neuausrichtung der Psychiatrie. Seelische Störungen sollten als körperliche Erkrankungen betrachtet und mit biomedizinischen Methoden behandelt werden.
Durch diesen grundlegenden Richtungswechsel ist die Psychiatrie heute überwiegend eine Biopsychiatrie geworden. Ab den 1950er-Jahren wurden Psychopharmaka entwickelt und auf den Markt gebracht, z. B. Chlorpromazin (für psychotische Erkrankungen), Benzodiazepine (bei Ängsten), Lithium (bei bipolaren Störungen). Die Beschreibungen erster, teilweise spektakulärer Behandlungserfolge gaben der »biomedizinischen Wende« in der Psychiatrie starken Auftrieb, und Psychopharmaka rückten in das Zentrum psychiatrischer Behandlungen.
Jedoch wurde damit auch eine fatale Fehlentwicklung eingeleitet. Der Einfluss der Pharmaindustrie wuchs im Laufe der Jahre, und spätestens seit den 1980er-Jahren ist die Psychiatrie, soweit es um den Einsatz von Psychopharmaka geht, weitgehend an den Profitinteressen der Pharmaindustrie ausgerichtet (siehe auch Kapitel ▶ »Wissenswertes über Antidepressiva«).
Depression aus biomedizinischer Sicht
Kommen wir nach diesem Exkurs zurück zur Depression. Aus biomedizinischer Sicht wird Depression ebenfalls als ein körperliches Problem betrachtet, das mit biomedizinischen Mitteln, vor allem mit Antidepressiva, zu behandeln ist. Die Pharmaindustrie hat daher ein großes Interesse an dem biomedizinischen Modell der Depression.
Das hat erhebliche Konsequenzen (siehe Kapitel ▶ »Wissenswertes über Antidepressiva«). Vor der biomedizinischen Wende wurde zwischen der »reaktiven Depression« und der »endogenen Depression« unterschieden. Während bei der reaktiven Depression innerpsychische oder soziale Ursachen angenommen wurden, betrachtete man die endogene Depression als körperliche Krankheit, die durch vermutete genetische Faktoren oder Hirnstoffwechselstörungen verursacht wird. Man nahm an, dass reaktive Depressionen viel häufiger als endogene Depressionen vorkommen.
Mit der biomedizinischen Wende in der Psychiatrie wurde diese Unterscheidung fallen gelassen. In der ICD-10 und anderen Klassifikationssystemen wird die Diskussion über die Ursachen umgangen, indem bei der Definition von Depression nur Symptome aufgelistet werden. Psychosoziale oder biomedizinische Ursachen werden weder gefordert noch ausgeschlossen. In der psychiatrischen Praxis führte das allerdings dazu, dass man heutzutage – meistens unausgesprochen – jede Depression als vollständig oder wenigstens teilweise endogen betrachtet, als eine Gehirnerkrankung. Folglich werden in der psychiatrischen Versorgung biomedizinische Behandlungsmethoden eingesetzt, vorzugsweise Antidepressiva; etwa so, wie Antihistaminika bei Juckreiz oder Antibiotika bei bakteriellen Infektionen verschrieben werden.
Aber wie stichhaltig sind die Argumente, Depression als endogen bzw. körperlich verursacht zu betrachten? Damit setzen wir uns in den anschließenden Kapiteln auseinander.
Zur Definition von Krankheiten
Krankheitskataloge wie die in ▶ Kapitel 1 erwähnte ICD sind in Psychiatrie und Psychotherapie von erheblicher Bedeutung. Neben der ICD hat das von der American Psychiatric Association herausgegebene Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) international großen Einfluss. In ICD und DSM werden Krankheiten allgemeingültig definiert.
Diese Definitionen sind keine Naturgesetze und können sich im Laufe der Zeit ändern. Änderungen in der Definition psychischer Störungen sind jedoch nur selten ein Ausdruck neuer Forschungsergebnisse. In der Psychiatrie werden Diagnosen sehr oft einfach per Abstimmung festgelegt. Es gibt Trends und »Modediagnosen«, die kaum wissenschaftliche Grundlagen haben. Häufig setzen sich Fachleute, die gerade viel Einfluss haben, mit ihrem speziellen Arbeitsthema durch.
Krankheiten werden immer neu katalogisiert
Zu Änderungen in den Krankheitskatalogen kommt es, wenn genügend Leute das so wollen. Eine wichtige Rolle für die Frage, was als »normal« bzw. »gesund« oder »abweichend« bzw. »krankhaft« betrachtet wird, spielen auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Homosexualität etwa galt in der bis 1992 gültigen ICD-9 noch als psychische Störung. Der Grund für den Wegfall der Homosexualität in der ICD-10 ist, dass es seit den 1960er-Jahren in den westlichen Industrienationen zu einer Liberalisierung sexueller Normen gekommen ist. Die Einordnung der Homosexualität in der ICD-9 ist dadurch »aus der Mode gekommen«. Man wollte Homosexualität einfach nicht länger als Krankheit betrachteten (und das ist gut so).
Insgesamt gibt es jedoch eine starke Tendenz, dass die Anzahl der beschriebenen Krankheiten in jeder Auflage größer wird. ▶ [2] Dahinter stecken keine neuen Entdeckungen wie z. B. in der Zoologie, wenn eine neue Tierart gefunden und beschrieben wird. Großen Einfluss bei der Überarbeitung der Krankheitskataloge hat die Pharmaindustrie. Manchmal werden Krankheiten regelrecht erfunden und von den Marketingabteilungen mit Kampagnen und Lobbyarbeit ins Gespräch gebracht. Es geht natürlich darum, dadurch Absatzmärkte für neue Medikamente zu schaffen. ▶ [3] Bei Bedarf wird auch massiver Druck auf die Zulassungsbehörden ausgeübt.
Ein Beispiel dafür ist das Vorgehen, mit dem der US-amerikanische Pharmakonzern Sprout Druck auf die Food and Drug Administration (FDA) ausübte, die in den USA für die Zulassung neuer Medikamente zuständig ist. Es ging um den Wirkstoff Flibanserin, dessen Zulassung als Antidepressivum zuvor gescheitert war und das nun zur Behandlung von mangelndem sexuellem Verlangen bei Frauen zugelassen werden sollte. Über viele Monate wurde eine landesweite pseudofeministische Kampagne durchgeführt, um »das Recht der Frauen auf Flibanserin« durchzusetzen. ▶ [4] Leonore Tiefer und ihre Kolleginnen beschrieben, wie Sprout bei einer vorentscheidenden FDA-Sitzung alle Möglichkeiten der Manipulation nutzte. ▶ [5] Der so aufgebaute Druck verfehlte seine Wirkung nicht, Flibanserin wurde zugelassen.
Die Medikalisierung der Gesellschaft
Eine andere Methode, mehr »Kranke« zu erzeugen, besteht darin, die Grenzen zwischen »gesund« und »krank« so zu verschieben, dass die Anzahl der als krank und behandlungsbedürftig geltenden Personen immer größer wird. Dafür wurde der Begriff »Medikalisierung« geprägt. Die Medikalisierung der westlichen Industrienationen ist ein Phänomen, das sich zunehmend auf alle Lebensbereiche auswirkt. Viele psychotherapeutisch und medizinisch Tätige sind daran beteiligt (oft ohne dass es ihnen bewusst ist).
Mit der Medikalisierung der Gesellschaft hat sich der US-amerikanische Sozialwissenschaftler Peter Conrad befasst. ▶ [6] Ein Beispiel ist die neue ICD-11-Diagnose der »anhaltenden Trauerstörung«. Das ist ein Zustand, der nach dem Tod einer nahestehenden Person auftritt und gekennzeichnet ist durch ein starkes Verlangen nach bzw. eine starke Beschäftigung mit der verstorbenen Person, begleitet von starkem emotionalen Schmerz. Wenn die Trauer länger als sechs Monate dauert, gilt sie als Krankheit. Warum? Weil eine Trauer, die länger als sechs Monate dauert, von den Verfechterinnen und Verfechtern dieser neuen Diagnose als unnormal betrachtet wird. Das ist eine willkürlich gesetzte Grenze, mehr nicht.
3 Biologische Ursachen von Depression
Ziel der biopsychiatrischen Forschung ist, biologische Ursachen von Depression aufzudecken und auf dieser Grundlage biomedizinische Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Betrachten wir einmal einige wesentliche biopsychiatrische Forschungsfelder, bei denen es um Hirnstoffwechsel, Hirnstruktur und Genetik geht.
Die Serotonin- bzw. Monoaminhypothese
Es geht hier um die sogenannten Botenstoffe oder Neurotransmitter. Das sind Substanzen, mit denen Nervenzellen miteinander kommunizieren. Sie werden an den Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen ausgeschüttet, den sogenannten Synapsen, und dienen der Signalübertragung. Serotonin und Noradrenalin gehören zur Gruppe der sogenannten Monoamine.
Tri- oder tetrazyklische Antidepressiva
Imipramin war das erste Antidepressivum, es kam 1958 in den Handel. Aufgrund seiner chemischen Struktur wird es zur Gruppe der tri- oder tetrazyklischen Antidepressiva (TZA) gezählt. Es folgten viele weitere Antidepressiva dieser Art wie Amitriptylin oder Trimipramin. Da Imipramin und andere Antidepressiva zu einer Erhöhung der Konzentration der oben genannten Botenstoffe führen, kam in den 1960er-Jahren die Vermutung auf, Depression sei die Folge eines Mangels dieser Botenstoffe. ▶ [7] Als mögliche Ursache von Depression wurde zunächst ein Mangel des Neurotransmitters Serotonin angenommen, weshalb der Begriff »Serotoninhypothese« geprägt wurde. Kurz darauf wurde diese Hypothese auf das Noradrenalin ausgedehnt, deswegen wird oft auch der Begriff »Monoaminhypothese« verwendet.
Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
Später wurden weitere Gruppen von Antidepressiva entwickelt, allen voran die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRIs). »Selektiv« bedeutet, dass ein SSRI im Unterschied zu den TZA vorwiegend auf das Serotonin wirken, kaum oder gar nicht auf andere Neurotransmitter. Eines der ersten SSRIs im Handel war Fluoxetin (1975), auch hier folgten zahlreiche weitere Substanzen (z. B. Paroxetin, Citalopram). Es gibt noch weitere Gruppen von Antidepressiva (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, Monoaminooxidase-Hemmer etc.), auf die ich hier aus Platzgründen nicht eingehen kann. Nahezu alle Antidepressiva erhöhen die Konzentration von Serotonin bzw. Noradrenalin an den Synapsen, mit dem Ziel, den vermuteten Mangel an diesen Botenstoffen im Gehirn zu beheben.
Allerdings wurden schon in 1970er-Jahren erste Zweifel an der Hypothese geäußert, dass die Depression etwas mit einem Mangel an Neurotransmittern zu tun hat, und inzwischen gilt diese Vermutung längst als widerlegt. Die britische Psychiaterin Joanna Moncrieff befasst sich seit vielen Jahren kritisch mit Antidepressiva. Sie veröffentlichte kürzlich mit einigen Kolleginnen und Kollegen eine sorgfältige Übersichtsarbeit, in der alle bekannten Fakten zur Serotoninhypothese zusammengefasst werden. ▶ [8] Es fanden sich keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Serotonin und Depression oder eine Wechselwirkung zwischen Genen, Stress und Depression. Mit anderen Worten: Die Serotoninhypothese wird wissenschaftlich nicht unterstützt und ist damit unhaltbar.
Depression ist nicht die Folge eines chemischen Ungleichgewichts oder einer Stoffwechselstörung im Gehirn. Das ist einer der Gründe dafür, dass es trotz größter Bemühungen auch nicht gelungen ist, einen Biomarker ist für Depression zu finden.
Biomarker sind messbare Indikatoren für das Vorhandensein oder die Schwere eines Krankheitszustands, z. B. in Form bestimmter Laborwerte oder Vitalzeichen. Bekannte Biomarker sind etwa der erhöhte Blutzuckerwert (Hinweis auf Diabetes mellitus) oder Fieber (Hinweis auf eine Entzündung). Während der Covid-19-Pandemie wurden mit den Antigen-Schnelltests millionenfach Biomarker untersucht, um eine Infektion zu bestimmen. Hätte die Depression biologische Ursachen, müsste es auch dafür einen Biomarker geben. Aber die Suche war vergeblich.
Forschungsergebnisse als Marketingdesaster
Das alles ist ein echtes Problem für die Hersteller von Antidepressiva, die dringend eine Begründung für die Verschreibung von Antidepressiva brauchen. Die Marketingabteilungen der Pharmafirmen haben darum den Mythos des Serotoninmangels gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis am Leben gehalten. 2005 verglichen Jeffrey R. Lacasse und Jonathan Leo die Darstellungen der Serotoninhypothese in der wissenschaftlichen Fachliteratur mit den Beschreibungen in den Werbetexten der Pharmaindustrie. ▶ [9] Sie zeigten, dass in der Pharmawerbung systematisch Falschinformationen verbreitet wurden. Die Serotoninhypothese wurde als wissenschaftlich abgesicherte Tatsache dargestellt, die umfangreiche Kritik wurde einfach unterschlagen.
Diese Kampagne hat einen bemerkenswerten, bis heute anhaltenden Erfolg. Nicht nur viele Laien, sondern auch zahlreiche medizinische und psychologische Fachleute glauben und verbreiten bis heute, dass die Depression eine Folge des Mangels an Neurotransmittern ist. Ich vermute, Ihnen wurde das auch irgendwann erklärt oder Sie haben es irgendwo gelesen. Bitte betrachten Sie das als einen durch die Wissenschaft widerlegten Mythos, vergleichbar mit der Vermutung, die Erde sei eine Scheibe oder die Sonne drehe sich um die Erde.
Eine schöne Pointe ist ein Medikament namens Tianeptin, das in Deutschland seit 2011 als Antidepressivum im Handel ist. Anders als die meisten anderen Antidepressiva verstärkt Tianeptin die Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt, es reduziert also die Serotoninkonzentration. Das passt wirklich schlecht zur Serotoninhypothese.
Antidepressiva sind nicht harmlos
Die Widerlegung der Serotoninhypothese bedeutet allerdings keineswegs, dass Antidepressiva chemisch wirkungslos sind. Fast alle erhöhen tatsächlich die Konzentration von Neurotransmittern wie Serotonin oder Noradrenalin. Und zwar nicht nur im Gehirn, sondern im ganzen Körper: Synapsen, die mit Serotonin oder Noradrenalin funktionieren, gibt es nicht nur im Gehirn, sondern unter anderem auch im Herz-Kreislauf-System, im Urogenitalsystem oder im Magen-Darm-System. Das ist ein Grund für die zahlreichen Nebenwirkungen von Antidepressiva und für viele Entzugssymptome, die auftreten können, wenn Antidepressiva abgesetzt werden.
Antidepressiva können die Konzentration von Neurotransmittern wie Serotonin oder Noradrenalin erhöhen. Aber da Depression nichts mit einem Mangel an Neurotransmittern zu tun hat, hilft das nicht gegen die Depression.