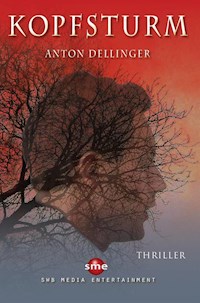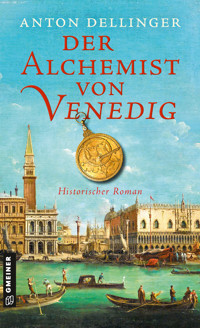
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baumeister Fabrizio Mansani
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Anno 1689. Baumeister Fabrizio Mansani rettet seinen aufgrund falscher Anklage zum Tode verurteilten Bruder und will Venedig verlassen. Aber seine Tat blieb nicht unbeobachtet und so wird er von dem wegen leerer Staatskasse verzweifelten Kämmerer Ducatini gezwungen, ihm bei einem Täuschungsmanöver zu helfen. Offiziell sollen sich Leibniz und Newton dem Bau einer Sternwarte widmen - größer als die des Vatikans. Doch Newton soll vor allem Gold für Venedig herstellen und der Kämmerer droht, ihn bei Weigerung als Hexer nach Rom auszuliefern …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anton Dellinger
Der Alchemist von Venedig
Historischer Roman
Zum Buch
Die venezianische Sternwarte Anno 1689 rettet Baumeister Fabrizio Mansani seinen aufgrund falscher Anklage zum Tode verurteilten Bruder und will Venedig verlassen. Aber die Tat blieb nicht unbeobachtet. So kann Ducatini, wegen leerer Kassen verzweifelter Kämmerer Venedigs, Mansani dazu zwingen, ihm bei einem Täuschungsmanöver zu helfen. Er soll – unterstützt von Newton und Leibniz – eine Sternwarte mit modernstem Teleskop bauen, welche die des Papstes übertrumpft. Doch Newton – gerüchtehalber erfolgreicher Alchemist – soll vor allem Gold für Venedig herstellen. Ducatini will ihn bei Weigerung als Hexer nach Rom ausliefern. Newton macht sich gezwungenermaßen an die Arbeit, und Ducatini gibt auf das Gold eine geheime Anleihe heraus. Doch die Schöpfung von Gold droht Newton zu misslingen. Der Kämmerer sieht seine Anleihe platzen und hat eine verhängnisvolle Idee.
Anton Dellinger, Jahrgang 1948, hat an der TU München Informatik studiert. Nach 20 Jahren bei der Bundeswehr wechselte er in die Wirtschaft und war dort bis 2008 als IT-Manager tätig. Im Ruhestand studierte er Geschichte und begann danach zu schreiben. Nach drei Thrillern und einem Kurzgeschichtenbändchen ist „Der Alchemist von Venedig“ sein erster historischer Roman. Dellinger hat vier Kinder und lebt mit seiner Lebensgefährtin in Vallendar bei Koblenz.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Bernardino_Bison_-_The_Bucintoro_at_the_Molo,_Venice,_on_Ascension_Day.jpg;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrolabe_en_cuivre._Georgius_Hartman_f._-_btv1b52505768s_(1_of_2).jpg
ISBN 978-3-8392-7734-8
Vorbemerkung
Bis auf Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton (erst 1705 geadelt) sind die Personen im Roman fiktiv. Real existierende Orte, Gebäude und Institutionen sowie Handlungen historischer Persönlichkeiten sind teilweise künstlerisch verändert.
Widmung
Für Heidi und die Kinder
1 Der Plan
Meine Maurer und Zimmerleute hatten mich gedrängt, heute Abend einen Becher Wein mit ihnen zu leeren, und ich mochte nicht Nein sagen. Sie arbeiteten schnell und gut. Ich brüllte sie nicht betrunken an wie Beretto. Beretto – seit über 20 JahrenProto, oberster Baumeister der Stadt Venedig – hatte mit 63 den Zenit seiner Leistungen überschritten. Als zweiter Mann hinter ihm leistete ich das mit meinen Leuten, wofür er das Lob der Räte, des Senats und des Dogen einheimste.
Ich hatte nach Einbruch der Dämmerung die Baustelle des neuen Palazzo für die älteste Tochter des Dogen an der Calle Bande verlassen und mich auf den Weg in die verabredete Taverne gemacht. Meine Männer hatte ich vorgeschickt. Ich musste eine Liste des verbrauchten Materials für den Kämmerer abschließen und war ihnen dann gefolgt. Nicht in die Gegend, in der ich gerne unterwegs war. Es war kühl für einen Aprilabend. Ich raffte den Tabaroenger und zog meine Kappe tiefer in die Stirn, als ich in das dunkle Gässchen nicht weit weg von der Kirche Santa Maria dei Miracoli einbog. In der windschiefen Tür der Taverne hielt ich kurz die Luft an. Verbrauchter Dunst schlug mir entgegen. Das und der Lärm von Rufen, Gesängen und Scheppern von Bechern und Gläsern hätten mich um ein Haar wieder umdrehen lassen. Aber meine Männer erkannten mich trotz des spärlichen Lichts aus flackernden Lampen, die Öl schlechtester Qualität verbrannten. Sie saßen nahe am Eingang um einen Tisch mit einer Schüssel mit venezianischen Moèche, kleinen gebratenen Lagunenkrebsen ohne Panzer, die man mit sämtlichen Innereien isst.
»Messer Mansani, willkommen!«, riefen sie durcheinander. »Einen Becher und einen Teller für Proto Fabrizio Mansani«, schrie einer nach hinten zur Wirtin.
»Ich bin nicht euer Proto«, wehrte ich ab.
»Du bist der wahre Proto der Stadt. Du bist nicht wie Beretto«, sagte der angesäuselte Maurer, neben den ich mich auf die Bank an den Tisch zwängte, und spießte einen der kleineren Moèche auf sein Messer. Er stand auf, zeigte auf den öltriefenden Krebs und sagte:
»Fett, klein, ohne Haare, mit kurzen Beinchen und …«, er bewegte das Messer in Richtung Mund, »… bald am Ende seiner Zeit!« Er schob sich den Leckerbissen zwischen die Zähne und konnte vor Lachen kaum kauen. Alle prusteten los und prosteten mir zu. Die Männer hatten hart gearbeitet, und es duftete nach Mensch. Ich roch sicher nicht anders, denn ich hatte schweißgebadet beim Abladen eines Holzschiffes mitgeholfen, das spät gekommen war und eine weitere Fuhre vor sich hatte.
»Danke, Männer, aber seid vorsichtig mit solchen Reden«, sagte ich, nahm den Becher, den man mir hinhielt, und trank auf die Tischrunde.
Nicht mein Wein. Zu dünn.
Alle redeten gleichzeitig auf mich ein, wollten mit mir anstoßen und nötigten mich, in die Schüssel zu greifen. Mirela, meine Frau, machte mir die Moèche mit Polenta. Hier, mit der undefinierbaren Tunke der Wirtin, mochte ich sie nicht. Doch mit jedem Schluck Wein schmeckten sie besser. Ich merkte, wie ich auftaute und das sonstige Treiben in der Taverne wahrnahm. Überwiegend Arsenalotti, die Arbeiter aus der Schiffsfabrik Venedigs, dem Arsenal. Leicht an ihren zu Zöpfen gebundenen Haaren zu erkennen, verprassten sie hier ihren Tageslohn. Dazu eine GruppeAgenti mit ihrem schon schwer angeschlagenen Capo am Nebentisch. Ihren Uniformen nach zu urteilen, gehörten sie zu den untersten Rängen im Dienste der Signori di Notte al criminal, der Herren der Nacht, die vom Abend bis in den Morgen für die allgemeine Sicherheit in der Stadt sorgten. Den Capo erkannte ich an dem kurzen Degen an der Hüfte und einem breitkrempigen schwarzen Hut, den er neben seinem Becher liegen hatte. Die Männer hingen an seinen Lippen. Zu ihren Füßen achtlos hingeworfen die Laternen, mit denen sie sich in den dunkleren Gassen Venedigs orientierten.
»Wisst ihr, was uns morgen erwartet? Ich verrate euch ein Geheimnis«, lallte er in grauenvollem Dialekt.
»Sag an, Capo, was für ein Geheimnis?«, drängten die Agenti.
»Ihr wisst, unser Capitano vertraut mir. So …«, er machte eine Pause, schaute bedeutungsvoll in die Runde und hob seinen Becher, »… wie ich euch vertraue. Salute!«
Alle nickten eifrig und prosteten ihm zu.
Der Capo stellte seinen Becher ab und senkte die Stimme: »Er hat mir verraten, wen wir morgen versenken.«
Versenken? Ein Hinrichtungstrupp?
Ich spitzte die Ohren. Mehr aus kribbelndem Interesse. Diese heimlichen Hinrichtungen in der Nacht, das Werk der gefürchteten drei Inquisitoren aus dem Rat der Zehn, erfüllten jeden Venezianer mit dem wohligen Schauer, nicht betroffen zu sein.
»Oh! Sag, Capo. Mach es nicht so spannend!«, grölten die Agenti durcheinander.
»Nicht so laut, Männer.« Er sah sich kurz um, winkte ihre Köpfe näher zu sich. »Darf ich euch gar nicht sagen. Aber …«, er rülpste und lachte, »ihr werdet ja dabei sein.«
Die Runde stimmte mit ein.
»Morgen Nacht versenken wir einen Aurifex, hat der Capitano gesagt.«
»Aurifex, was ist das?«, fragten die Agenti nach.
Mein älterer Bruder Marcello übte den Beruf des Orafo, des Goldschmieds, aus. Die Adligen der Stadt, die Nobili, sagten vornehm Aurifex. Aber Marcello konnte nicht gemeint sein.
Das Geheimgericht verurteilt einen Handwerker? Keinen Spion wie üblich?
»Ein Goldschmied«, lallte der Capo.
»Was hat er gemacht?«
»Hat er dem Dogen einen Bleiring für die Heirat mit dem Meer angefertigt?«, fragten die Männer des Capo durcheinander und prusteten vor Lachen.
»Schlimmer.« Der Capo flüsterte, dass ich ihn kaum mehr verstand. »Er hat das jüngste Töchterchen des Dogen geschwängert und ihr vorher Gewalt angetan.«
Fast fiel mir der Becher aus der Hand.
Was hatte Marcello mir vor Monaten erzählt? Er habe mit einer Tochter des Dogen angebändelt. Sie war ihm vor die Mietgondel gefallen, als sie ihr ausgebüxtes Hündchen verfolgte und in eine schlüpfrige Nebengasse geraten und ausgerutscht war. Marcello hatte sie aus dem Wasser gezogen und sie samt Hündchen in seine Wohnung verfrachtet. Dort hatte sie ihre Kleider getrocknet und er ihre Schürfwunden versorgt. Sie verliebten sich ineinander und trafen sich weiter heimlich.
»Du bist verrückt«, hatte ich ihm gesagt. »Der Doge bringt dich um, wenn er das erfährt.«
»Sie liebt mich, wir werden gemeinsam fliehen«, antwortete Marcello keck. Allzu ernst hatte ich das nicht genommen.
Sie ist schwanger von meinem Bruder, und der Doge ist dahintergekommen! Vergewaltigt? Unmöglich. Nicht mein Bruder! Das hat er nie und nimmer getan!
Ein anonymer Hinweis in einem der Briefkästen mit Schlitz in Form eines Löwenmauls, den Bocce di Leone, für die allgegenwärtigen Denunzianten hatte vermutlich eine Rolle gespielt. Niemand war vor ihnen sicher in dieser Stadt. »Lügt der Briefschreiber, frisst der Löwe seine Finger, schreibt er die Wahrheit, geht der Brief zum Dogen«, flüsterte der Volksmund.
Ich muss ihn retten!
Meine Gedanken rasten, ich hörte nicht mehr, was meine Maurer, Steinmetze und Zimmerleute schwatzten. Ich war nüchtern von einem Moment zum anderen. Abwesend und wie im Nebel wartete ich darauf, dass der Capo aufbrach. Er stand auf, ich wollte ihm schon folgen, aber er schwankte nur zur Latrine und kehrte zurück zu seinen lärmenden Agenti.
Eine lange Weile später, in der ich kaum gesprochen, etwas getrunken oder gegessen hatte, stemmte er sich endgültig hoch und torkelte zum Ausgang. Die Handwerker störte mein hingemurmelter unvermittelter Abschied nicht, sie waren mit sich und ihrem Wein beschäftigt genug. Ich staunte jeden Morgen, wie sie es schafften, sich nicht auf die Finger zu schlagen oder vom Gerüst zu fallen.
Ich folgte dem Anführer der Agenti bis um die Ecke und fasste ihm von hinten an die Schulter. Blitzschnell, wie ich es ihm nach der Menge genossenen Weins nicht zugetraut hatte, schnellte er herum und hielt mir den Degen vor die Brust. Wir waren gleich groß.
»Was willst du?«, lallte er.
Ich öffnete meine Arme und sagte: »Ich bin nicht bewaffnet. Ich … ich will ein Geschäft vorschlagen.«
Er ließ die Hand sinken. »Ein Geschäft?«
Ich nickte. In der Zeit des Wartens hatte ich mir den Kopf zerbrochen, ab welcher Summe der Capo mitspielen würde. Gut bezahlt wurden die Agenti nicht, hörte man.
»50 Dukaten, wenn der Verurteilte morgen Nacht nicht gefesselt in den Kanal geworfen wird.«
Der Capo lehnte sich an die Wand, durch ein Fenster fiel spärliches Licht. Er hob die Hand mit dem Degen. Seine Stimme klang unerwartet klar.
»Komm her, Bürschchen, zeig dich. Wer bist du?«
»Der Bruder des Verurteilten«, stammelte ich.
»Hmm, ich verliere eine Hand, nein – den Kopf, wenn das rauskommt. 100 Dukaten!«
Mein halber Jahresverdienst! Das überstieg meine Möglichkeiten völlig. Aber ich nickte kurz entschlossen und presste ein Ja heraus.
»Gut«, sagte er, »Canale dei Maranni. Du weißt, wo das ist?«
Ich nickte erneut. Den Ort, an dem von den Inquisitoren Verurteilte heimlich ertränkt wurden, kannte jeder Venezianer und mied ihn möglichst.
»Wir sehen uns morgen um Mitternacht«, sagte der Capo, lallte wieder und wankte davon.
*
Massimo Ducatini hatte seine zweite Amtszeit als Camerario comunis, Kämmerer des Senats, vor drei Monaten angetreten. Seinen Aufgabenbereich, die Finanzen und die Aufsicht über die öffentlichen Bauten, hatte er schnell durchdrungen. Als Seitenspross der Datinis, die die ersten venezianischen Banken im Ausland eröffnet hatten, hatte er Erfahrung in London und Paris sammeln dürfen und sprach Englisch und Französisch. Das erleichterte internationale Geldgeschäfte für die Republik. Doge Agostino Poggione und – wichtiger – der Rat der Zehn und der Senat waren mit ihm so zufrieden, dass die unübliche Wiederwahl zum Kämmerer Venedigs reibungslos und ohne Aufsehen über die Bühne ging.
Poggione hatte ihn zu sich gerufen. In sein Arbeitszimmer, die Sala Erizzo im Dogenpalast. Zu später Stunde und allein! Die Republik Venedig kontrollierte ihren Dogen überall und zu jeder Zeit. Ein Gespräch mit ihm unter vier Augen hatte deshalb etwas Ungewöhnliches. Doch in der Sala Erizzo konnte man wenigstens sicher sein, dass nicht – wie so häufig in Venedig – im Nebenzimmer ein bezahlter Spion oder bestochener Bediensteter mithörte, manchmal durch ein eigens dafür gebohrtes Loch in der Wand. Poggione war alt, 71. Trotz der angehäuften Lebensjahre zeichnete er sich durch energische Aktivität aus, wenn es um Festivitäten ging. Die nicht lange zurückliegende Hochzeit seiner älteren Tochter beschäftigte die Wirte der Stadt über Monate. Die Maurer bauten einen Triumphbogen vor der Hochzeitskirche wie nie zuvor gesehen. Die Maurerzunft lag in der Zuständigkeit von Ducatini, sodass die Kosten für den Dogen im Rahmen blieben, was er dem Camerario dankte. Ansonsten sagte man Poggione nach, unter dem Pantoffel seiner Gemahlin, der Dogaressa Angelina, zu stehen.
Er will sicher wieder Geld für ein großes Vergnügen, dachte Ducatini, als er sich von der Porta della Carta, dem Eingang des Palazzo Ducale, des Dogenpalasts, von der Wache bis zum Arbeitszimmer Poggiones führen ließ. Für Ducatini war es das zweite Mal um diese Zeit. Der Soldat trug eine Uniform aus feinem Stoff, feiner und dadurch teurer, als Ducatini es für nötig hielt.
Verschwendung. Da muss ich nachhaken.
Der Soldat blieb stehen und wartete auf die persönliche Wache des Dogen neben einer Statue des Adonis, die Ducatini zuvor nicht gesehen hatte.
Hoffentlich ein Geschenk und nicht aus der Kasse der Republik.
Er verglich sich insgeheim mit der Skulptur. Schlank war er, aber ein so fein geschnittenes Gesicht wie das des Traumbilds eines Jünglings hatte Ducatini nicht mehr zu bieten. Immerhin gefielen den Damen seine dunklen Augen und hochstehenden Wangenknochen. »Du blickst wie eine zahme Raubkatze«, hatte eine einmal zu ihm gesagt. Das »zahme« hatte er ihr später ausgetrieben. Die Wache unterbrach seine Gedanken und öffnete die mit schwarzem Leder bespannte Tür. Der Soldat hatte geklopft, Zustimmung von innen abgewartet und hielt jetzt die Tür auf. Ducatini trat mit einer Verbeugung ein. Die tannengrünen Wandbehänge und massiven Deckenbalken mit Schnitzereien beeindruckten ihn wie beim ersten Mal. Die blassgrünen Vorhänge vor drei schmalen Fenstern waren bis auf eine Handbreit zugezogen. Der helle Marmorfußboden mit erhabenem doppeltem Rautenmuster reflektierte das Licht zweier Öllampen an der Wand. Poggione empfing ihn breit lächelnd vor seinem Schreibtisch aus dunkel glänzendem Mahagoni sitzend. Hinter sich ein monumentales Gemälde von Tintoretto, das den Camerario Jacopo Soranzo zeigte. Der Doge erklärte niemandem, auch dem jetzigen Amtsinhaber nicht, was ihn mit der Familie Soranzo verband. Ein dünner Mantel aus Seide umhüllte den ausgemergelten Körper Poggiones. Sein Schlafzimmer grenzte an das Arbeitszimmer, und er hatte es sich schon bequem gemacht. »Sei gegrüßt, mein lieber Ducatini. Wir möchten … ach, lassen wir die Förmlichkeiten, wir sind unter uns – ich will mit guten Gedanken einschlafen. Deshalb habe ich dich so spät herbestellt. Ein Glas Wein?« Er griff zu einer dunkelroten Karaffe aus Murano und einem fein geschliffenen Kristallglas, das im Licht von einem Dutzend Kerzen glitzerte, die auf dem Schreibtisch verteilt standen.
Zu viele Kerzen. Er denkt nie an die Brandgefahr …
»Gern«, antwortete Ducatini. »Was kann ich für Euch tun, Exzellenz?«
»Trink erst einmal.« Der Doge hielt ihm das Glas hin. Beide nahmen einen Schluck.
»Setz dich, Ducatini. Ich habe etwas mit dir zu besprechen.« Er griff hinter sich nach einem Papier auf dem Schreibtisch. »Hier die vorläufige Kostenaufstellung für unsere Pestkirche Santa Maria della Salute.« Er bekreuzigte sich. »Du kennst sie sicher.«
»Ich habe sie erstellt, Exzellenz.«
»420.000 Dukaten, unglaublich.«
»420.136 Dukaten genau. Die heilige Jungfrau hat ihren Preis für die Hilfe gegen die Pest, Exzellenz.«
»Lass die Scherze, Senatore!«
»Verzeiht, Exzellenz.«
»Die 100 Dukaten machen unsere Kasse nicht leerer, als sie ist. Habe ich recht?«
Ducatini senkte den Kopf. »Leerer geht kaum.«
»Ich plane ein großes Fest anlässlich des Beginns meines vierten Amtsjahres. Wie bezahlen wir das?«
Am besten aus deiner Privatschatulle …
»Eine Finanzierung aus dem Nichts ist schwierig. Wir müssen moderne Wege …«
»Hast du eine Idee?«
Ducatini lächelte breit.
»Eine nie da gewesene, Exzellenz.«
Der Doge sah den Kämmerer durchdringend an. »Ich höre.«
»Alchemie, Exzellenz. Wir machen uns das Gold, das wir benötigen, selbst.«
Poggione setzte sein Glas hart auf den Tisch.
»Welch Narretei, willst du mich foppen?«
»Mit Verlaub – keine Narretei, Exzellenz.«
Poggione hob sein Glas wieder hoch und schaute Ducatini ungläubig an.
»Du … du kannst das?«
»Nein – nein, aber ich weiß, wer es kann.«
»Wer?«
»Isaac Newton.«
»Der englische Astronom?«
»Genau der.«
»Ein Wissenschaftler mit ungewöhnlichen Ideen, Ducatini. Ich habe von ihm gehört. Er ist Theologe und Astronom, soweit mir bekannt ist. Und Alchemist?«
»Ihr seid bestens im Bilde, Exzellenz. Ich habe darüber hinaus Informationen zu Newtons Leidenschaft. Er betreibt in aller Heimlichkeit Alchemie.«
»Hmm … erfolgreich?«
»Unsere Bankiers in London berichten, dass sie von ihm hergestelltes Gold gesehen haben, nicht in großen Mengen, aber …«
»England, London … hier wird das Gold gebraucht. Und ausreichend viel.«
»Alchemisten werden in England wegen … Hexerei verfolgt.«
»Wie bei uns, Ducatini.«
»Ich weiß, aber es ist ein Verbot des Papstes. Dessen Verbote gelten hier nicht unbedingt …«
»Hmm … stimmt. Du hast recht, der Zweck würde die Mittel heiligen.«
»Die Menge schafft er mit der Zeit …«
»Mein viertes Amtsjahr beginnt in neun Monaten.«
»In drei Monaten könnte er anfangen, Exzellenz.«
»Aber, jetzt spann mich nicht auf die Folter, wie willst du Newton hierherlocken?«
»Wir bieten ihm – fürstlich entlohnt – ungestörtes Arbeiten an. Vom Goldmachen überzeugen wir ihn, sobald er hier ist. Englands Arm reicht nicht so weit, und wir schützen ihn vor dem Papst.«
»Hmm.«
»Ich weiß, dass Newton ständig in Geldnot ist, und habe schon bei ihm vorsichtig anfragen lassen …«
»Und?«
»Bisher keine Antwort, Exzellenz. Briefe aus England brauchen mit den schnellsten Boten drei bis vier Wochen.«
»Gut, dann gib Nachricht, sobald du etwas weißt.«
Der Doge lächelte breit.
»Nimm noch ein Glas, Ducatini. Ich glaube, ich werde heute mit besseren Gedanken einschlafen als am gestrigen Abend.«
Ducatini verbeugte sich.
»Allzeit zu Diensten, Exzellenz.«
*
Ich hatte vor, mich in aller Frühe aus unserem Haus in der Calle Nicoletto in San Polo zu schleichen. Wortlos wollte ich samt Mappe mit Zeichnungen weggehen und öffnete leise die Tür. Mirela stand auf einmal neben mir, ordnete ihr dichtes schwarzes Haar, zog ihren Schlafrock zusammen und fragte:
»Ist dir nicht gut? Du hast schlecht geschlafen, dauernd gestöhnt und jetzt willst du ohne einen Ton aus dem Haus? Ohne Kuss?«
Ich schloss die Tür wieder, nahm sie in den Arm und sagte: »Es ist nichts, Liebste. Ich habe ein Riesenproblem mit Beretto und der Baustelle. Heute muss ich vor allen anderen da sein, um etwas zu überprüfen. Sonst kriege ich meinen Anteil am vereinbarten Lohn nicht.«
Das wird sie verstehen …
Sie verstand, küsste mich und sagte:
»Dann beeil dich. Du weißt, wir brauchen das Geld unbedingt. Sonst wird das nichts mit dem Häuschen auf der Terraferma.«
Und wie ich das wusste. Unser Traum, aufs Festland, raus aus der Stadt. Weg von Berettos Knute und selbstständiger Baumeister – vielleicht in Padua oder Vicenza?
60 Dukaten hatten wir gespart, ein kleiner Anfang. Für den Palazzo der Dogentochter standen 60 Dukaten allein für die Zeichnung an, von denen zehn an mich gehen sollten. Ich hatte den gesamten Plan erstellt. Beretto ging damit bei den Nobili hausieren und strich 50 Dukaten dafür ein. Er konnte nicht einmal ohne Hilfe eine gerade Linie ziehen, ich schaffte freihändig einen nahezu perfekten Kreis. Diese zehn Dukaten hatte ich noch nicht. Sie und unsere gesparten 60 reichten nicht für die 100, die der Capo verlangt hatte. Für die Mitarbeit an der Pestkirche standen weitere 60 Dukaten aus, aber die Stadt zahlte schleppend.
Zehn Dukaten muss ich Mirela lassen … Ich brauche 50 Dukaten bis Mitternacht.
Eine frühe Gondel reagierte auf mein Winken. Zum Glück nicht Tonio, der mich ansonsten fuhr. Musste nicht jeder wissen, wohin ich so früh wollte.
»Zum Getto«, flüsterte ich.
Auf dem Weg ging mir durch den Kopf, warum ich das alles riskierte:
Die Mauer maß knapp 15 Fuß in der Höhe und ragte in die Brenta. Die Jungen in unserem Dorf sprangen mit Begeisterung von dort in das Wasser des Flusses. Ich erinnere mich an mein erstes Mal. Nach oben gelangte man über eine Treppe. Sie war seitlich an die etwa zwei Fuß breite Mauer gebaut, einen Fuß schmal und hatte kein Geländer. Ich fühlte mich sofort unwohl, als ich aus unerfindlichem Grund spontan einem Spielkameraden – an die Mauer gepresst – gefolgt war. Auf halbem Wege wollte ich umkehren, die Höhe machte mir doch zu schaffen. Der hinter mir war älter als ich. Er lachte, als ich mich – starr nach vorn blickend – vorsichtig hinauftastete. »Na, Schiss?«, frotzelte er und gab mir einen Schubs vorwärts. Fast wäre ich abgerutscht. Oben angekommen, wollte ich gleich wieder umkehren. Aber ein anhaltender Strom von Jungen hinderte mich daran. Marcello stand unten und schaute mir zu – Besorgnis im Gesicht. »Geh nicht rauf, wenn du nicht sicher bist«, hatte er gesagt. Ich hätte auf ihn hören sollen.
Immer stand ich abseits, wenn die anderen ins Wasser sprangen und anschließend vor Freude johlend und prustend an Land liefen, um gleich wieder nach oben zu rennen und noch einmal zu springen. Ich wollte das können wie sie. Mir wurde aber schon schlecht, wenn ich vor unserem Kirchturm stand und hochschaute. Mein Magen krampfte sich zusammen, und die Knie wurden weich bei dem Gedanken an die Höhe. Mir kann nichts passieren, hämmerte ich mir ein, als ich jetzt oben auf der Mauer stand und versuchte, nicht zu schwanken und den Druck von hinten abzuwehren. »Du fällst ins Wasser wie jeder andere. Wasser ist nicht weich, aber die Mauer ist nicht so hoch, dass du dir wehtust«, hatte Marcello vor ein paar Tagen gesagt und es mir gleich vorgemacht. Er war allein oben und nahm Anlauf, um im weiten Bogen und mit einem »Juuuhuuu« ins Nass zu platschen. Triefend kam er zu mir und lachte. »Siehst du, ganz einfach.«
Jetzt gab es keinen Platz mehr auf der Mauer. Es allein und unbeobachtet von anderen zu versuchen, hatte sich erledigt.
»Was ist los da vorne, warum geht es nicht weiter?«, rief einer von der Treppe. »Na los, spring endlich, du Angsthase«, tönte der dicke Nachbarsjunge hinter mir ungeduldig. Ich machte einen vorsichtigen Schritt – zu langsam für meinen Hintermann. Er gab mir einen Stoß, und ich fiel ins Bodenlose, griff ins Leere, fühlte dann einen Schlag und verlor die Besinnung.
Marcello erzählte mir später, ich hätte um mich geschlagen und laut geschrien. Die auf der Mauer hätten nur gelacht. Mein Bruder hatte gemerkt, dass ich nicht sofort wieder auftauchte, war hinterhergesprungen und hatte mich aus dem Wasser gezogen. Ich war nur kurz ohne Besinnung und flüsterte: »Nie wieder. Das mach ich nie wieder! Ich will nach Hause.«
Ich war damals zehn Jahre alt, und mein Berufswunsch stand fest. Vater war Zimmermann, das wollte ich werden – oder Baumeister. Wenn ich ihn begleiten durfte und er auf Gerüsten arbeitete, stand ich unten und bewunderte ihn. Hoch traute ich mich nicht. »Das wird noch, Fabrizio«, sagte er, klopfte mir auf die Schulter und lachte aufmunternd. Marcello hatte mit seinen 14 Jahren eine Lehre bei einem Goldschmied in der Stadt angefangen. Er lebte bei der Familie seines Meisters in Padua und kam nicht mehr oft nach Hause.
Diesen Sommer jedoch wollte er fast zwei Monate bei uns im Dorf bleiben. Der Meister war verreist und hatte seine Lehrlinge solang zu ihren Eltern geschickt.
»Willst du immer noch Zimmermann werden oder Baumeister?«, fragte er mich.
Der Wunsch hatte sich nicht verflüchtigt, aber seit dem ungewollten Sturz in die Brenta sprach ich nicht mehr gern darüber.
»Warum fragst du?«
»Ich habe mit einem Kunden meines Meisters gesprochen, der sich mit der Angst vor Höhe auskennt. Ein arabischer Arzt. Sie hat ihn früher auch gequält.«
»Die Höhe? Früher? Das heißt, er hat sie nicht mehr?«
Marcello nickte.
»Wie das? Was hat er gemacht?«
»Dagegen angekämpft, geübt und geübt. Man muss seine Ängste herausfordern, um sich ihnen stellen zu können, sagt er. Schritt für Schritt, nicht übertreiben und nicht aufgeben.«
Ich überlegte kurz. »Meinst du – ich kann das auch?«
Marcello nickte noch einmal. »Acht Wochen haben wir Zeit. Entweder springst du danach von jeder Mauer und kletterst auf jedes Gerüst oder du solltest dir einen anderen Beruf wünschen.«
Ich holte tief Luft und sagte: »Ich will diese Angst los sein.«
Marcello fing damit an, dass er mich jeden Tag zwei- oder dreimal zu unserem Kirchturm führte. Ich musste den Kopf in den Nacken legen und hochschauen. Das tat ich, und sofort wurde mir flau im Magen. Ich senkte den Kopf, und er sagte: »Gib mir die Hand und schau nach oben, Fabi. Sag mir, ob dir etwas passiert. Fällt dir die Kirche auf den Kopf? Versinkst du im Boden? Schau …«
Ich ergriff seine Hand und sagte leise zu mir: »Es geschieht nichts, es geschieht nichts.« Und so war es. Am vierten Tag konnte ich ohne Marcellos Hand eine Weile stehen und nach oben schauen. In der zweiten Woche blieb der Magen ruhig, und die Knie schwammen kaum spürbar. Zu Anfang der dritten Woche fragte Marcello: »Fühlst du dich stark genug für die nächste Übung?«
»Ja«, sagte ich, ohne zu zögern.
Mein Bruder machte weiter mit der Treppe an der Mauer. Frühmorgens unbeobachtet, wenn noch kein Junge aus dem Dorf seinen Sprungkünsten frönte.
Stufe für Stufe musste ich hochsteigen und dort verharren. Nach oben, nach unten und zur Seite sollte ich meinen Kopf drehen und schauen, bis ich mir im Innersten sagte, dass mir dort nichts passierte und auch nicht passieren könne. Am Schluss verlangte er, dass ich mich umdrehte und Schritt für Schritt zurück nach unten ging, ohne mich an der Mauer abzustützen. Ich schaffte das tatsächlich jedes Mal von weiter oben, und Marcello freute sich mit mir. Nach fünf Wochen lief ich die Treppe rauf und runter, ohne an die Mauer zu fassen, und stand mit breiter Brust oben auf der Krone. Ich machte zum ersten Mal zwei bewusste Schritte bis zum Rand, und die Angst packte mich mit Gewalt. Alles war wieder da, der Krampf im Magen, die weichen Knie, die Unfähigkeit, in irgendeine Richtung zu blicken.
»Was … was tue ich hier?«, stammelte ich.
»Deine Angst besiegen«, flüsterte mein Bruder und fasste mich an der Hand. »Dir passiert nichts und du weißt das, Fabi. Denk ganz fest daran. Ich bin bei dir.«
Er zog mich sanft an der Hand. Ich ließ es zu, und wir sprangen beide in die Brenta.
Ich verlor weder die Besinnung noch schrie ich. Ich staunte nur über mich selbst. Nach drei weiteren Sprüngen an der Hand von Marcello wagte ich es das erste Mal allein. Bis auf ein kurzes Zögern und Zittern meiner Knie … passierte nichts. Unbändiger Stolz erfüllte mich und unendliche Dankbarkeit meinem Bruder gegenüber.
Nach ein paar weiteren Tagen mit und ohne Marcello auf der Mauer war die Angst vor Höhe oder Tiefe verschwunden. Marcello hatte recht behalten.
Kurz darauf, als mein Vater im Ort arbeitete, fragte ich ihn, ob ich ihn begleiten dürfe. Er sah mich erstaunt an und nickte. Später stand er weit oben auf dem Gerüst und ich unten, wie er es gewohnt war. Als er nicht mehr auf mich achtete, huschte ich hoch, stellte mich neben ihn. Fast fiel ihm der Hammer aus der Hand.
Ohne Marcello wäre ich kein Baumeister geworden.
Jetzt musste ich das Geld beschaffen, mit dem ich ihn retten wollte. Dem Arzt und Bruder von Salomon Sem, einem Geldverleiher, hatte ich ein Haus im Getto ausgebaut. Ein heimlicher Nebenverdienst. Leicht verdientes Geld. Mit zwei Maurern und einem Zimmermann hatten wir dem berühmten Arzt ein siebtes Stockwerk auf sein Wohnhaus gesetzt. Juden war es verboten, Immobilien zu besitzen. Doch der angesehene Doktor versorgte Patrizier und ihre Familien zu deren vollster Zufriedenheit. Er hatte sogar schon heimlich dem päpstlichen Nuntius geholfen, der an einer anhaltenden Krankheit litt, wie man sagte. Deshalb genehmigte der Hausbesitzer den Ausbau, den der Arzt bezahlte und für den anschließend Miete floss. Salomon kannte mich durch die Arbeit für seinen Bruder. Er würde mir das Geld leihen, hoffte ich.
»Ah, Messer Mansani«, begrüßte er mich verschlafen. »Mein Bruder ist nicht da, schon unterwegs …«
»Guten Morgen, Messer Sem, ich will nicht zu Eurem Bruder, sondern zu Euch.«
»Oh, was kann ich für Euch tun?«
»Ich … ich brauche einen Kredit. Jetzt … genauer … bis heute Abend. 50 Dukaten.«
Er verbeugte sich und machte die Tür weit auf. Drinnen bot er mir einen Stuhl an.
»Viel Geld. Darf ich fragen, für welchen Zweck?«
»Eine … unaufschiebbare Familienangelegenheit.«
Salomon wiegte seinen Kopf hin und her.
»Welche Sicherheiten bietet Ihr mir?«
Mit der Frage hatte ich gerechnet.
»Für die Restarbeiten an der Pestkirche schuldet mir die Stadt 60 Dukaten. Ihr wisst, der Magistrat arbeitet wie eine Schnecke …«
»Ich weiß, Messer Mansani, ich weiß.«
Salomon schaute mich nachdenklich an.
»Gut, 15 Prozent Zinsen, wenn Ihr den Kredit in einem Jahr zurückzahlt. Die Zinsen jeweils zum Quartal.«
Das ist ein guter Zins, üblich sind 20 …
»Ich mache Euch den Kredit so billig, weil mein Bruder Eure Arbeit schätzt. Kommt gegen Mittag, dann habe ich das Geld bereit.«
Mit einem Seufzer der Erleichterung sagte ich: »Einverstanden. Ich bin mittags wieder da.«
*
Ducatini empfing diesen lästigen deutschen Gelehrten in seinem Arbeitszimmer im Palazzo dei Camerlenghi neben der Rialtobrücke. Rot gefärbtes Leder mit goldener Malerei bespannte die Wände, dazwischen fanden sich reiche Stuckverzierungen. Kunstvoll geschnitzte dunkle Balken teilten die Decke. Blüten und Blätter der Ornamente fanden sich wieder auf den bemalten und vergoldeten Wandbespannungen. Ausgesuchtes Mobiliar sollte den Besucher beeindrucken. Sorgfältig arrangiert, ohne protzig zu wirken. Protz war einem Senator per Gesetz verboten, aber Ducatini hatte das Zimmer von seinem Vorgänger übernommen und nicht verändert. Er empfing Gottfried Wilhelm Leibniz, weil der Doge ihn dazu angewiesen hatte. Der Herzog von Hannover hatte den Hofrat Leibniz nach Venedig geschickt, um mögliche italienische Wurzeln der herzoglichen Familie erkunden zu lassen. Der Herzog selbst hatte zuvor aus dem Anlass ein Jahr in Venedig verbracht und dazu angesichts ständiger Ablenkung durch Einladungen und Feste keine Zeit für die Spurensuche gefunden. Doge Poggione hatte Ducatini den Brief eines hochgelehrten Freundes gezeigt, der schrieb: »Leibniz ist der führende Kopf unseres Jahrhunderts, er korrespondiert mit den Gelehrten der Welt. Es ist mir bislang kein Mensch begegnet, der gelehrter und mit allen Gebieten der Wissenschaften so vertraut ist wie er und der so gründliche Kenntnisse besitzt.« Beeindruckt genehmigte der Doge Leibniz die erbetene Suche nach Spuren der herzoglichen Vorfahren und hatte Ducatini dennoch angewiesen, ihn am langen Arm im Auge zu behalten – wie jeden ausländischen Besucher in der Stadt.
Wie die Venedig besuchenden deutschen Kaufleute logierte Leibniz im Fondaco dei Tedeschi. Ducatini hatte diese sparsame Unterbringung für ihn organisiert und den Dogen nicht mit der Nase darauf gestoßen. Aus Wissenschaft machte der Kämmerer sich herzlich wenig.
Dieser stark parfümierte, mittelgroße dürre Mann mit den seidenen Strümpfen, silbernen Schnallen auf den Schuhen, der schwarzen Perücke, Dreispitz und dem silberdurchwirkten Rock, der in Paris Mode war, sollte der führende Kopf des Jahrhunderts sein? Er blinzelte mit den Augen, als wäre er kurzsichtig.
Ducatini sprach kein Deutsch, aber in Französisch oder Englisch würde er sich mit Leibniz ohne Helfer verständigen können.
»Seid Ihr mit Eurer Unterbringung zufrieden, Messer Leibniz?«, fragte Ducatini nach der Begrüßung mit einem Händedruck.
Uhhh, hat der kalte Hände, dachte er.
Leibniz verbeugte sich und antwortete in fehlerfreiem Italienisch: »Habt ausgezeichneten Dank, hochwohlgeborener Signore Senatore, ich bin über die Maßen zufrieden.«
Erstaunt antwortete Ducatini in der Sprache, die jeder Venezianer beherrschte, aber im Alltag vermied:
»Das höre ich gern. Wollt Ihr Euch nicht setzen? Was kann ich für Euch tun?«
So weit reichten die Italienisch-Kenntnisse von Leibniz offenbar nicht. Er blieb höflich lächelnd stehen. Ducatini wiederholte auf Französisch.
»Oh, gern«, sagte Leibniz und nahm in einem der hohen Stühle mit filigran geschnitzten Lehnen aus Elfenbein Platz. Er sagte:
»Ihro Gnaden könnten mir assistieren, ein passend Archiv zu finden, in dem ich für meinen Herzog laborieren kann.« Er befingerte gleichzeitig die geschwungene Lehne, beugte sich kurz zur Seite, besah sich die Schnecke und den eingelegten Edelstein und befühlte ihn. »Elfenbein und Rubine? Trefflich, fürwahr!«
Schmeichler … Aber richtig, er sucht ja etwas für diese Familiengeschichte … warum spricht er so gestelzt?
Mit wenigen Worten erklärte Ducatini den Weg zum Archiv im Dogenpalast. Leibniz bedankte sich, machte aber keine Anstalten zu gehen. Vielmehr stand er auf und betrachtete die Verzierungen an den Deckenbalken eingehend. »Verzeihet, meine Augen sind schwach …«
Komischer Kauz …
»… doch ich bewundere die vollkommene Baukunst in dieser Stadt, Signore Senatore. Es hat bis nach Braunschweig gelautet, Ihr habet im Arsenal eine Vielzahl nützlicher Bauten, trefflich Gerät, um große Teile zu bewegen …«
Ein Spion?
»… Bitte interpretieret mich nicht falsch, ich weiß um die große Bedeutung der Schiffswerft für die Republik. Ihr müsset wissen, ich bin zu Hause in Hannover kein Stubengelehrter. Nein, ich konstruiere Vorrichtungen und Maschinen für die Bergbaukunst und suche derethalben überall in der Welt Anregungen. Könnt Ihr mir behülflich sein, den Dogen um die Occasio eines Besuchs zu bitten?«
Was will er denn noch? … Könnte er mir nützlich sein?
»Messer Leibniz, das versuche ich gern, aber Ihr könntet mir im Gegenzug bei einer kniffligen Angelegenheit helfen.«
Leibniz verbeugte sich.
»Wie könnten meine bescheidenen Fähigkeiten Euch nützen?«
»Ihr steht doch im Briefwechsel mit Gelehrten in vielen Ländern. Mit Isaac Newton im Königreich England auch?«
»Ich stehe in trefflichem Diskurs, gar wohl Disput mit ihm über einen neuen Calculus.«
Calculus?
»Hmm. Eine Frage, womit könnte man Newton bewegen, eine Weile hier in Venedig zu … arbeiten?«
Leibniz überlegte nicht lange und antwortete:
»Mich deucht, neben Theologie und Mathematik interessieret ihn die Optik im Übermaß. Er laborieret in einem Observatorium nahe London an der Kunst neuer Teleskope. Er sucht gleich mir nach einem verbesserten Wege zur Funktion so wie ich bei Rechenmaschinen. Seine neuartige Teleskopkunst allhier in einer modernen Sternwarte erproben, das wäre ihm sicher gefällig.«
Wie der spricht …
»Eine ausgezeichnete Idee, Messer Leibniz. Ich denke, ich werde Euch einen Besuch im Arsenal vermitteln können.«
»Danke, Signore Senatore. Und falls Hülfe bei der Constructio der Sternwarte vonnöten sei, ich habe eine Idee für die Kuppel. Cupola auf Italienisch, richtig? Mein Fürst hält mir das Geld für Neuerungen knapp, aber Ihr?«
Ducatini nickte.
Eins nach dem anderen, mein Freund …
»Zu freundlich, Messer Leibniz. Ich komme womöglich darauf zurück.«
*
Ruhelos lief ich den ganzen Tag auf der Baustelle herum. Ich vertat mich bei meinen Anweisungen, sodass ich gezwungen war, eine halbe Wand wieder einreißen zu lassen. In der Mittagszeit huschte ich zu Salomon, der das Geld für mich bereithielt. Fahrig unterschrieb ich den Kreditvertrag, nahm den Beutel mit den Dukaten und vergaß um ein Haar, mich zu verabschieden. Meine Gedanken kreisten um das Leben Marcellos, dann darum, wie ich denn in zwölf Monaten das Geld für die Rückzahlung auftreiben sollte – am besten, ohne dass meine Frau es mitbekam.
Zäh verrann die Zeit, bis es dunkel wurde. Mirela hatte ich gesagt, dass ich unaufschiebbare Arbeiten der Stuckateure zu beaufsichtigen hatte. So saß ich bei den Männern, die bei Lampenlicht feine Muster aus Gips formten, und lauschte den Glockenschlägen der nahen Kirche bis eine Stunde vor Mitternacht. Die Handwerker waren weit in Verzug und hörten nicht auf, als ich mich verabschiedete. Ich musste mich sputen, lagen doch fast eineinhalb Meilen durch enge Gassen vor mir.
Mit zügigen, aber vorsichtigen Schritten und nah an den Hauswänden schlich ich mich im spärlichen Licht der Laternen in Richtung Lagune zum Canale dei Maranni gegenüber der Insel San Pietro di Castello.
Ich zitterte – nicht wegen der Nachtkühle – und hielt den Beutel mit den Dukaten krampfhaft fest, bis ich Schritte hörte. Eine Gruppe näherte sich. Vorneweg ein Mann, der mit gefesselten Händen einen Sack vor sich hertrug. Ich erkannte entsetzt meinen Bruder Marcello. Die Fessel lief durch einen Ring an dem Sack voller – wie ich wusste – Steine, die ihn in die Tiefe ziehen sollten. Trotz des trüben Lichts sah ich seine vor Angst geweiteten Augen. Der Capo stapfte seinen Helfern hinterher. Den üblicherweise den Todeskandidaten begleitenden Priester suchte ich – zum Glück – vergeblich. Das hatte der Capo vermutlich arrangiert. Dass Geistliche der niederen Ränge käuflich für alles und jedes sein sollten, flüsterte man sich überall in den Kirchenbänken zu. Zum Glück.