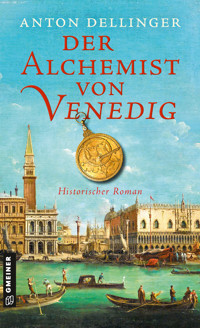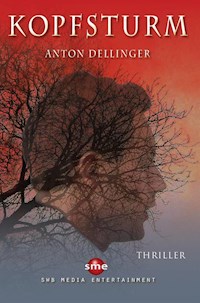
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gottfrieds Vater kämpft auf der Intensivstation um sein Leben – leider vergeblich. Für Epilepsie, die als Todesursache auf dem Totenschein steht, gab es nie Anzeichen. Gottfried besteht auf ein MRT, das dies klären soll, doch dann verschwindet der Kopf des Toten. Der Sohn findet im Kalender seines Vaters als letzten Termin „Trauerdinner“ und eine mysteriöse Zeitungsanzeige. Gottfried beginnt zu recherchieren, ohne zu ahnen, welcher Strudel aus Wahn, Gier und Schuld ihn bald zu verschlingen droht. Anton Dellinger (geboren 1948) ist Informatiker und Historiker. Er war lange als IT-Manager tätig, ehe er zu schreiben begann. Der Vater von vier erwachsenen Kindern lebt mit seiner Lebensgefährtin in Vallendar bei Koblenz und freut sich über den persönlichen Kontakt mit seinen Lesern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anton Dellinger
Kopfsturm
Anton Dellinger
Kopfsturm
Roman
swb media entertainment
Die Handlung und die handelnden
Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder bereitsverstorbenen Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2022
ISBN 978-3-96438-040-1
Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzesist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzungen,Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbareVerfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.
© 2022 Südwestbuch Verlag
SWB Media Entertainment, Sommenhardter Weg 7, 75365 Calw
Printed in EU
Umschlaggestaltung: Gerd Schweikert
Lektorat: Johanna Ziwich
Satz: Julia Karl / www.juka-satzschmie.de
Druck und Bindung: Custom Printing PL
Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.
www.suedwestbuch.de
Für Heidi
DER VERDACHT
22. April 2025
»Machst du Witze, Roland? Ich bin dafür nicht in Stimmung, kein bisschen! Wo, zum Teufel, sind die verdammten MRT-Bilder?«
Roland schwieg und wich mit hochgezogenen Schultern meinem Blick aus.
»Sieh mich an und antworte!« Ich rutschte auf dem Stuhl nach vorn, stützte mich auf die Schreibtischkante und rang mir ein Grinsen ab. »Komm, Roland, sag mir, dass das ein Scherz ist, wenn auch ein misslungener.«
Meine Frau Eliza saß neben mir, fasste nach meiner Hand und sagte zu Roland:
»Eine Privatklinik mitten in Hamburg und der … Kopf eines kurz zuvor verstorbenen Patienten löst sich in Luft auf?«
Roland antwortete kaum hörbar: »Es stimmt. Sein Kopf ist verschwunden. Wir können uns das nicht erklären. So etwas hat … es … noch nie gegeben. Das könnt ihr mir glauben.«
Mein Magen krampfte. Nacheinander zog ich an den Fingern meiner linken Hand, bis die Gelenke knackten, und atmete tief durch. Ich wollte schlucken, wollte etwas sagen und konnte es nicht.
»Komm, Gottfried, du bist ja ganz weiß im Gesicht. Wir gehen an die frische Luft.« Eliza klopfte mir auf den Rücken und zog mich vom Stuhl hoch.
Kraftlos ließ ich mich hinausführen. Kurz vor der Treppe zur U-Bahn-Station blieb ich stehen und ballte die Fäuste. Rasende Wut stieg in mir auf.
»Kann nicht wahr sein! Vaters Kopf ist weg. Weg!« Ruckartig drehte ich mich um. »Was sind das für Gangster? Verdammt noch mal! Was wird hier vertuscht?« Ich stürmte zurück in Rolands Zimmer. Der saß hinter seinem Schreibtisch und putzte seine Brille. Ich schoss um das Möbelstück herum und blieb erst eine Armlänge vor ihm stehen. Abwehrend hob er die Hände. Mühsam dämpfte ich meine Stimme:
»Erst schafft ihr den Toten weg und wir kriegen dich kaum dazu, ihn für die Untersuchung zurückzuholen …«
»Wir … wir haben hier im Haus kaum Platz für Verstorbene und müssen sie schnellstmöglich …«
»… dann ist das stationäre MRT kaputt. Wir werden hingehalten …«
Roland schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nicht defekt. Eine langwierige Wartung … das mobile MRT war im Einsatz …«
»… und keine Nachricht, bis wir herkommen, um zu erfahren, dass in der Privatklinik Papen am helllichten Tag der Kopf … der Kopf eines Patienten – nicht sein Handy, nicht sein Rasierapparat – nein, sein KOPF verschwindet. Nicht mehr da, futschikato.«
»Ein … ein Schabernack von … von Studenten«, winselte Roland.
Eliza war mir gefolgt und fasste mich an der Schulter. Ich schüttelte ihre Hand ab und beugte mich zu ihm. Sein Atem ging stoßweise und er wich vor mir zurück, soweit er konnte. Ich berührte beinahe sein Gesicht und roch seinen Mittagswein. »Schabernack? Ein Student mit Clownsmaske und blutigem Fuchsschwanz trägt am 22. April 2025 vor sich hin pfeifend einen Menschenkopf am Klinikpförtner vorbei durch die Drehtür zur nächsten U-Bahn-Station. Muss ich mir das so vorstellen, Herr Chefarzt?«
Roland grinste gequält und antwortete leise: »Es ist schon einmal vorgekommen. Ein Arm und ein Fuß, kein Fuchsschwanz. Medizinstudenten. Der Kopf, er wurde säuberlich abgetrennt.«
Ich schlug mit der Faust auf den Schreibtisch, dass eine Tasse klirrte.
»Mir reicht’s! SCHABERNACK? Was vertuscht ihr hier? In einer gut geführten Klinik wäre so was nie passiert! Nie! Das hat ein Nachspiel! Glaub mir! Ich gehe zur Polizei! Komm, Eliza.«
Ich stapfte ich aus dem Zimmer und hätte um ein Haar meiner Frau die Tür vor der Nase zugeschlagen.
Roland rief hinter uns her: »Die Polizei habe ich schon informiert.«
***
Drei Tage zuvor.
Dieses Geräusch!
Vor fünfunddreißig Jahren, als meine Mutter im Sterben lag, da hatte ich es das letzte Mal gehört. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten. Mein Vater – an Armen und Beinen in einem Klinikbett festgeschnallt und unter Schläuchen zuckend – röchelte wie sie damals. Seine Augen quollen aus ihren Höhlen. Aus einem Mundwinkel rann ein Speichelfaden auf das Laken.
Ich schluckte und griff nach seiner Hand. »Vater, ich bin’s, Gottfried.« Er riss an den Bändern, mit denen man ihn fixiert hatte. Die Monitore über ihm warfen grünliche Schatten auf sein Gesicht.
Mein Gott! Die Augen! Wie dieser Gollum aus »Herr der Ringe« …
»Wir mussten ihn vor sich schützen. Die üblichen Beruhigungsmittel wirken nicht«, sagte der behandelnde Arzt und deutete auf die Bänder. Eliza schluchzte.
»Haben Sie eine Erklärung?«, fragte ich den Arzt.
Er schüttelte den Kopf. »Wir suchen noch.«
»Wie ist er hierhergekommen?«
»Die Polizei hat ihn aus dem Stadtpark hergebracht. Er lag auf einer Bank. Man hat ihn zuerst für betrunken gehalten.«
»Wie ist er dort hingelangt?«, fragte Eliza.
»Was hat er vorher gemacht?«, fragte ich.
Der Arzt zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Die Polizei wusste nichts.«
»Was können wir tun?«
»Abwarten«, meinte der Arzt. »Entschuldigen Sie, mein Pager, der nächste Notfall.«
Wir blieben eine Weile neben Vaters Bett stehen.
»Was ist das bloß?«, fragte Eliza. »Er war bis gestern, nein vorgestern, völlig gesund.«
»Ich habe auch nichts bemerkt.«
»Ein Virus, ein Gift?«
»Lassen wir die Ärzte ihren Job tun. Du bist Psychotherapeutin, ich bin Physiker. Wir verstehen zu wenig davon.«
»Hör mal, ich habe das Medizinstudium einer Allgemeinmedizinerin!«
»Natürlich. Beruhige dich, entschuldige«, sagte ich und tätschelte ihre Hand. »Die hier haben jedenfalls mehr praktische Erfahrung als wir.«
»Du hast ja recht, Liebling, tut mir leid«, entgegnete Eliza und drückte sich an mich. »Es ist fürchterlich, deinen Vater in dem Zustand zu sehen und ihm nicht helfen zu können.«
»Wir müssen rauskriegen, wo er war und was er gemacht hat.«
Eliza warf den Kopf hoch. »Warum ist Marija nicht an seiner Seite?«
»Stimmt. Er hängt neuerdings Tag und Nacht mit seiner Freundin zusammen. Sie kleben seit Wochen aneinander wie verliebte Teenies. Hast du die Telefonnummer?«
Wir waren aus dem Zimmer auf den Gang getreten. Meine Frau fischte ihr Handy aus der Handtasche und suchte.
»Ich finde sie nicht.«
»Sie hat einen englischen Allerweltsnamen, Milton oder Wil…«, warf ich ein.
Es fiel mir ein. »Wilson, Marija Wilson.«
»Da, ich hab sie«, sagte Eliza und tippte hastig in ihr Handy.
»Wen rufst du an?«
»Ihre Nummer. Es tutet.«
Es dauerte, dann sagte sie: »Geht keiner ran. Aber ich habe die Festnetznummer ihrer Wohnung seit dem Frauennachmittag im Vier Jahreszeiten letzten Monat.« Sie tippte wieder. »Der Ruf geht raus, ich hoffe, sie ist – Eliza Leibner hier, guten Tag. Mit wem spreche ich? … Ah, ja. Das ist gut. … Ja, richtig, mein Schwiegervater ist der Freund Ihrer Schwester. Wir haben uns leider noch nicht kennengelernt. … Genau … Er liegt im Krankenhaus und wir hätten sie gern gesprochen.«
»Was?«, stieß Eliza hervor und horchte angestrengt ins Telefon.
»Danke, wir … wir melden uns«, sagte sie dann und legte auf – grau im Gesicht.
»Die Schwester sucht nach einem Anruf der Klinik in Marijas Wohnung persönliche Unterlagen. Marija ist gemeinsam mit deinem Vater gefunden worden. Man hat beide in lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert. Marija ist kurz darauf gestorben.«
***
»Was machen wir jetzt?«, fragte Eliza tonlos und knetete ihre Hände.
Ich wusste es nicht, wollte nichts Unüberlegtes von mir geben, fasste ihre Hände und hielt sie fest.
»Lass die Ärzte ihre Arbeit machen.«
»Vorige Woche waren Marija und Vater quicklebendig und gesund, jetzt ist sie tot und dein Vater …«
Sie zog an ihren Händen. Ich wollte sie nicht loslassen. Seit einer in der Kindheit fehlgeschlagenen Sehnenoperation war mein linker Daumen steif und ich konnte nicht fest greifen. Es reichte aber, um ihre beiden Hände nicht loszulassen.
Es freute mich, dass sich Vater nach vielen Jahren allein noch einmal verliebt hatte, mit zweiundsiebzig. Wunderbar, dass er trotz der Besessenheit, die er als Leiter des Hamburger Leibniz-Museums für seine Arbeit zeigte, am richtigen Leben teilnahm. Einmal hatte ich ihn mit einer Leibniz-Perücke in der Hand Tanzschritte für einen Kurs mit der lebenslustigen Deutschen mit pakistanischen Wurzeln üben sehen. Und jetzt in diesem Bett …
»Epilepsie, die Arme.«
Ruckartig löste Eliza doch ihre Hände. »Man stirbt nicht abrupt an Epilepsie.«
»Könnte das bei Vater auch …?«
Sie schüttelte heftig den Kopf.
»Unmöglich! Ich will das nicht glauben. Dein Vater ist kein Epileptiker und Marija war für mich völlig gesund.«
Sie hatte recht. Mir war nie das kleinste Zeichen für eine derartige Erkrankung aufgefallen. Doch was wusste ich davon?
Ohne es zu merken, hatten wir die Klinik verlassen und standen vor der Eingangstür. Meine Uhr zeigte vier Uhr nachmittags.
»Ich muss in die Firma, mein Jackett mit Autoschlüssel holen«, sagte ich. »Du fährst nicht mehr zur Uni zurück, oder?«
»Ich habe keine Lust mehr«, antwortete Eliza. Ihr Blick sprach Bände.
»Ist in Ordnung, Schatz. Ich beeile mich, nach Hause zu ko…«
Plötzlich griff sie meinen Arm. »Wenn man die Schwester angerufen hat, gibt es vermutlich auch schon einen Totenschein. Wir sollten in Erfahrung bringen, was drinsteht!«
Ich verstand; wir drehten auf dem Absatz um und gingen in die Klinik zurück. Am Empfang erfragte Eliza den Weg zur Verwaltung. Eine Dame zeigte uns die Richtung. Der Mann, der gerade aus dem Zimmer kam, stieß um ein Haar mit mir zusammen und murmelte »T’schuldigung«. Das Mädchen vor uns warteten wir schweigend ab. Ich dachte angestrengt nach. Fragt man direkt nach dem Totenschein, wenn es denn schon einen gibt? Welche Begründung gibt man? Was tun wir, wenn man uns die Auskunft verweigert? Auf einmal machte meine Frau einen forschen Schritt auf die ältere Angestellte zu, die hinter einem Tresen thronte. Schluchzend sagte Eliza: »Guten Tag, mein Name ist Wilson, meine Mutter wurde heute eingeliefert und ist verstorben.« Sie wischte sich über die Augen. »Gibt es schon einen Totenschein und was steht drin?«
»Ja, Frau Wilson. Mein Beileid«, antwortete die Angestellte erstaunt. »Aber Ihr Bruder war doch schon hier. Der hat ihn mitgenommen. Ist gerade weg. Sie, Sie müssten ihm begegnet sein.« Sie wandte sich ab, griff in ein Kästchen, nahm ein Blatt Papier heraus und tippte auf ihrer Tastatur herum.
»Oh, dass …«, stotterte Eliza, »dass er es so schnell geschafft hat. Danke.«
Sie zog mich am Arm aus dem Zimmer.
»Mist«, sagte sie.
»Wir müssen hinterher, ihn fragen. Der Bruder war der Mann vorhin, der mich fast angerempelt hat. Ganz sicher. Sah aus wie ein Inder oder Pakistani. Marijas Eltern waren aus Pakistan. Ich habe mir sein Gesicht gemerkt.«
Ich spurtete los, hörte, wie sie mir folgte.
Auf dem Parkplatz hinter der Klinik lehnte er an einem Auto – ein Stück Papier in der Hand. Eliza überholte mich und raunte mir zu: »Lass mich, ich mach das.«
Dafür war ich ihr dankbar. Wie ich ihn hätte ansprechen sollen, wusste ich nicht. Ich bewunderte meine Frau für ihre Entschlusskraft. Sie folgte ihrem Bauch. Meine Entscheidungen waren immer Ergebnis einer gründlichen Analyse – davon war ich überzeugt.
Ich blieb stehen. Sie gestikulierte. Nach fünf Minuten kam sie zurück und hielt mir ihr Handy hin.
»Er hat ihn mir gezeigt und ich habe den Totenschein fotografiert«, sagte sie.
»Epileptischer Anfall« stand unter der Rubrik Todesursache, mehr nicht. Unterschrieben von einem Dr. Schwarz.
»Und?«, fragte ich. »Damit gibt er sich zufrieden?«
»Er hat mir zugehört, bis ich das Wort ›Obduktion‹ in den Mund nahm. Es kommt nicht in Frage, die Mutter aufzuschneiden.«
»Hat er kein Interesse, die wahre Todesursache herauszufinden? Du hast ihm erklärt, worum es uns geht? Dass beide zusammen gefunden wurden und Vater noch lebt?«
Eliza nickte und sagte: »Habe ich. Aber sie haben in der Verwandtschaft Fälle von Epilepsie. Er hält es nicht für unwahrscheinlich, dass sie daran gestorben ist.«
»Ohne irgendwelche Anzeichen vorher? Aus heiterem Himmel? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das nicht möglich, oder?«
»Korrekt. Das wollte ich ihm erklären. Epilepsie ist außerdem so gut wie nicht erblich. Er hat schroff das Gespräch mit dem Hinweis abgebrochen, dass seine Religion Obduktionen verbietet. Er sei das Familienoberhaupt und seine Mutter müsse schnellstmöglich beerdigt werden.«
Der offiziell mögliche Weg einer medizinischen Obduktion mit Zustimmung der Angehörigen war damit verwehrt. Außer bei ungeklärter Todesursache bemüht die Staatsanwaltschaft keinen Pathologen. Das hätte aus dem Totenschein hervorgehen müssen, dann hätte die Klinik von sich aus gehandelt.
Was hatten Marija und Vater zuletzt unternommen? Was bedrohte sein Leben?
***
Eliza und ich bezogen nach unserer Heirat, zurückgekehrt nach Deutschland, ein unverschämt teures, freistehendes Haus – na ja, ein Anwesen – in Buxtehude im Westen von Hamburg, im Flusstal der Este. Nie hätte ich gedacht, mir jemals so etwas leisten zu können. Die zwei Prozent Lizenzgebühren an den von mir erfundenen Wasserstoffkartuschen machten das vor neun Jahren möglich. Für mich war »Haus Dehkmann«, so benannt von einem Nachkriegsindustriellen der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, genau das, unser Haus, unser Heim. Als ich es einmal gegenüber einem Besucher so bezeichnete, löste es bei ihm schallendes Gelächter aus und die Bemerkung, ich übe mich wohl in dem Engländern nachgesagten Understatement. Es sei eher ein Landsitz als ein Haus. Für mich blieb es unser Haus, auch wenn es zugegebenermaßen recht voluminös daherkam. Vom schmiedeeisernen Eingangstor bis zur Haustür fuhr man durch knapp zweihundert Meter Park, die Straße gesäumt von hohen Pappeln. In dem zweistöckigen Sandsteinbau, viereckig mit Türmchen an den Ecken, der ein wenig so aussah, als sei er aus der Zeit gefallen, bewohnten wir ständig sieben und mit Gästen zehn oder elf der Zimmer. Unser Wohnzimmer nahm fast den ganzen hinteren Teil des Erdgeschosses ein.
Ausbedungen hatte ich mir, dass mein Arbeitszimmer in einem der Ecktürme von den Eliza bei der Einrichtung helfenden Beratern unangetastet blieb. Als Tochter eines ehemaligen Diplomaten, der nach der Pensionierung zurück nach Hamburg Blankenese gezogen war, hatte sie überall hin Beziehungen, auch zu Architekten, die »in« waren. Ich vermied Experimente und gestaltete im Grunde meinen früheren Laborkokon aus dem Forschungsinstitut für Nanotechnik in Hannover nach. »Eng« kommentierte Eliza schnippisch mein wohltuend übersichtliches Reich. Vollgestellt mit Schreib- und Computertisch, Bücherregalen, einem Denksessel, der sich flachstellen ließ, einer Musikanlage vom Feinsten mit deckenhohen Standlautsprechern und einer Teemaschine. Hierhin zog ich mich zurück, wenn mir danach war.
Ich saß im Wohnzimmer in einem der futuristisch unbequem aussehenden dreieckigen Sessel, deren Sitzkomfort bei der ersten Benutzung meine Vorurteile in Sekunden zerstieben ließ. Einmal drinsitzend, wollte ich nicht mehr aufstehen. Wenn sie vor einen Schreibtisch gepasst hätten, hätte ich mir glatt einen in mein Arbeitszimmer gestellt. In dem Sessel wurde mir immer wieder klar, dass mir Haus Dehkmann gefiel. Auf ihre unbekümmerte Art schaffte Eliza uns einen Ort zum Heimkommen.
Wir waren mehr als acht Jahre verheiratet. Ihr Gang machte mich noch genauso an wie ihre Art, mit den Händen ihr langes, schwarzes Haar zu ordnen. Ich schrieb ihr nicht mehr jeden Tag Briefchen mit Herzchen. Wir schliefen nicht mehr fünf Mal die Woche miteinander, doch es knisterte zuweilen noch ganz ordentlich zwischen uns. Sie schwebte heute wieder einmal mit dem Teetablett wie eine Königin in den Raum. Sie war direkt von der Uni nach Hause gekommen und trug ein dunkles Kostüm mit heller Bluse, das ihre schlanke Figur betonte. Sie arbeitete als Honorardozentin am Lehrstuhl für Psychologie der Hamburger Universität und forschte auf dem Gebiet der Hypnose. Angeregt durch den ehemaligen Patienten Gottfried Leibner hatte sie begonnen, Hintergründe, Techniken und Wirkungen der Eigenhypnose zu erforschen. Sie erwähnte mich nicht in ihrer Arbeit, da hieß ich Proband 186 -184. Die Zahlen standen für meine Körpergröße und den geringfügig kleineren Abstand der ausgebreiteten Arme.
Sie drückte mir einen Kuss auf die Stirn, sagte: »Dein Tee, mein Schatz. Milch ist schon drin«, und stellte die Tasse vor mich hin.
»Was machen wir jetzt ohne genauere Untersuchung der Todesursache von Marija?«, fragte ich, nachdem ich mich neben sie gesetzt und den ersten Schluck getrunken hatte.
»Du musst etwas unternehmen, Gottfried. Es geht um deinen Vater. Vielleicht können wir ihm helfen, wenn wir rauskriegen, was er mit Marija zuletzt getan hat.«
»Du hättest den Sohn fragen können, ob er etwas weiß.«
»Daran habe ich nicht gedacht, verzeih.«
»Nicht schlimm, Liebling«, sagte ich und nahm sie in den Arm. »War ziemlich stressig.«
Sie schaute mich dankbar an.
»Hast du eine Idee?«, fragte sie.
»Ich habe mich morgen mit Robert verabredet«, sagte ich. »Du weißt, er hat mir schon einmal geholfen.«
***
Mit Robert, einem Reporter des Hamburger Abendblatts, traf ich mich am liebsten in einem Lokal in der Innenstadt. Es lag nah bei einer U-Bahnstation. Ich war so früh, dass ich eine Station vorher ausstieg und gemächlich zu Fuß ging. Über der Erde angekommen, schlenderte ich an einer Bushaltestelle vorbei, als mich plötzlich jemand von der Seite anrief:
»Nicki! Endlich!« Eine alte Dame – ich schätzte an die achtzig – gestikulierte in meine Richtung.
Ich drehte mich nur halb um, konnte ja nicht gemeint sein, und ging weiter. »Was soll das, Nicki? Du kannst deine Mutter nicht hier stehen lassen. Ich friere im Flur«, zeterte sie, stand plötzlich neben mir und fasste meinen Arm. Ihr Haar war schlohweiß und unfrisiert, ihre Augen glänzten, als hätte sie gerade geweint. Sie trug einen Regenmantel, halb offen, drunter – ich erschrak – ein knielanges, geblümtes Nachthemd, das ihre nackten, dürren Beine freiließ. Die Füße steckten in rosa Schlappen. Ihre linke Hand umklammerte eine Zahnbürste, in der rechten hielt sie eine Brille.
»Meine Dame, ich bin nicht Ihr Nicki, Sie irren sich«, sagte ich.
»Erzähl kein dummes Zeug, Junge. Es ist spät, ich will ins Bett. Bring mich auf ’s Zimmer.«
Die Handy- und Smartwatchmenschen der Straße und der Bushaltestelle beachteten weder die Frau noch mich. Niemand nahm die geringste Notiz davon, wie sie an mir zerrte.
Ich hab keine Zeit. Robert wartet auf mich …
»Komm, Nicki, komm!« Die alte Dame ließ nicht locker. Ich war ihr Sohn für sie und sie erwartete von mir, dass ich hälfe.
Ich drehte mich hilfesuchend um, doch nach wie vor hingen alle um uns herum an ihren Smartphones und -uhren. Sie reichte mir nur bis zur Schulter, schob sich näher an mich heran und trat mir dabei auf den Fuß, verlor einen Schlappen.
Wenn denn sonst niemand …
Ich bückte mich nach dem Hausschuh, sie hielt mir den Fuß hin und ich schob ihn ihr über.
»Danke, Nickilein«, hauchte sie und lächelte mich zahnlos an.
Okay. Jetzt hast du mich …
»Wo ist Ihr Zimmer?«, fragte ich.
»Du weißt doch, wo es liegt. Mach schon.«
»Wie ist denn Ihr Name?«
Entrüstet blickte sie mich an und keifte: »Du weißt meinen Namen nicht mehr?«
Ein junges Mädchen blieb stehen, zog einen ihrer Kopfhörerstöpsel aus einem Ohr und wandte sich Kaugummi kauend an mich.
»Hat se was, Alt’r?«
»Sie hat keine Orientierung und verwechselt mich mit ihrem Sohn …«
»Kenn ich, m’ne Oma is auch so«, sagte das Mädchen. »Guck’n Sie in ihr’n Sach’n nach. Heime steck’n Dementen imm’r Zettel mit Name un Adresse ein, und bring’n Sie se dann am best’n zur Polizei.«
Sie tippte mit zwei Fingern an ihre Stirn, sagte: »Na, dann, viel Glück« und war verschwunden.
Ein Zettel?
»Darf ich?«, fragte ich die alte Dame und griff in die Tasche ihres Regenmantels. Sie lachte und krümmte sich, als würde ich sie kitzeln. In der linken fand ich tatsächlich ein sauber eingeschweißtes Kärtchen mit der Adresse eines Altenheims in der Nähe und einer Telefonnummer, es war mit einem Bändchen festgenäht.
Polizei oder dort anrufen?
Es wurde allmählich knapp mit Robert, deshalb entschloss ich mich für die Polizei. Die Entscheidung fiel mir auch deshalb leicht, weil ich am Ende der Straße das Schild eines Polizeireviers leuchten sah.
»Dann komm, … Mutter«, sagte ich zu der alten Dame, steckte ihre Brille in eine Regenmanteltasche und nahm sie an der Hand. »Es ist nicht mehr weit.«
»Na also«, sagte sie, »ich wusste, du kennst den Weg«, und kam brav mit, dabei lächelte sie und hielt die Zahnbürste krampfhaft fest.
In der Polizeistation erklärte ich die Situation einem diensthabenden Beamten, der die Greisin routiniert in Empfang nahm, als mache er das nicht zum ersten Mal. Ich blieb, bis er mit dem Altenheim telefoniert hatte. Man würde sie abholen. Ich musste nun wirklich los zu Robert. Der Beamte notierte meine Telefonnummer und lenkte die alte Dame mit Keksen und Tee ab, die ihrem Nickilein hinterher zeterte, das sei nicht ihr Zimmer. Sie hätte keine Mitbewohner.
Demenz hatte ich noch nie so unmittelbar erlebt. Alt zu werden sei nicht die reine Freude, hatte meine Schwiegermutter erst vor kurzem gesagt. Ihr Mann zeige auch schon Anzeichen.
Robert wartet!
Ich beamte mich wieder in die Gegenwart und legte die letzten Meter bis zu unserem Treffpunkt zügig zurück. Viel zu spät war ich noch nicht. Robert kam eh immer unpünktlich. Und er war tatsächlich noch nicht da.
Das Lokal verströmte einen Charme, der vergessen ließ, dass die ganze Gegend drum herum von gefräßiger Modernität verschlungen zu werden drohte. Das Lokal namens »Innerer Kreis« hätte besser auf das Gelände der Universitäten von München oder Freiburg gepasst. Der Besitzer schien zeigen zu wollen, dass Hamburg nicht in den Wogen der Hafen-City mit selbstfahrenden Zügen, Bussen und Virtual-Reality-Bars und der anonymen Kolossalität des Überseequartiers verschwinden würde. Sein Gasthaus stand für Tradition und Kontinuität. Die Wände waren dicht an dicht mit Bildern hanseatischer Größen gepflastert und die Decke zierten Fotos aus dem Nebenberuf des Wirts. Darunter spektakuläre Aufnahmen der Köhlbrandbrücke, des Cinnamon Towers und der letzten Elefanten Hagenbecks, die noch Kinder auf ihrem Rücken tragen durften, bevor der Tierschutz es verbot. Und natürlich Helmut Schmidt, sehenswert durch die Beine eines Polizeipferdes bei einer Diskussion mit Demonstranten in Bonn fotografiert. Der Wirt fotografierte Hamburg von unten, wie er es mir einmal erklärt hatte. Die Kamera stand auf dem Boden oder höchstens einen halben Meter hoch. Dessen ungeachtet vertrieben sich junge Leute die Zeit hier, spielten Darts, Karten oder tranken ihr Pils. Alle ohne Virtual-Reality-Brillen.
Studenten, dachte ich und schüttelte innerlich den Kopf. Die Zeit für solche Vergnügungen hätte ich im Studium nicht gehabt. Da ich Mathematik, Physik und Philosophie gleichzeitig studierte, entwickelte ich mich notgedrungen zu einem Zeitjongleur. Meine Heimatstadt Hannover hätte ein in sich so stimmiges Lokal kaum geboten, und ich hätte mir für derartige Beschäftigungen keine Zeit gegönnt. Nun war ich kein Student mehr, sondern Wissenschaftler mit einem auf rätselhafte Weise plötzlich todkranken Vater im Krankenhaus und einer diffusen Befürchtung, was den Tod seiner Freundin anging.
Es musste einen Weg geben, an die Fakten zu kommen. Robert hatte mir früher einmal geholfen, als ich nicht weiterwusste und gegen einen übermächtigen Gegner kämpfte. Deswegen saß ich im Inneren Kreis und wartete auf meinen Freund. Ich bestellte mir gerade einen Tee, da streckte er seinen deutsch-irischen Rotschopf grinsend durch die Tür. Er war rein äußerlich das Gegenteil von mir: Untersetzt, muskulös und mit dichtem Haar, spielte Rugby bei den Hamburg Exiles. Geistig tickten wir sehr ähnlich. Wir hatten uns vor fünfzehn Jahren bei einer Aktion gegen Atomkraft in Gorleben kennengelernt. Er lag angekettet auf einem Bahngleis, ich nahm spontan an dem Protest teil. Wir kamen ins Gespräch und mochten uns. Ich blieb bei ihm, bis die Polizei die Kette durchsägte und ihn abtransportierte. Wenig später wurde ich wie er Mitglied bei Greenworld und wir wurden Freunde. Einer, mit dem ich keine Enttäuschung erlebte – im Gegenteil.
»Sorry, Gottfried, der Verkehr. Das Taxi kam nicht durch«, begrüßte er mich und winkte der Bedienung.
»Du alter Geizhals fährst Taxi?«
»Die U-Bahn hat eine Störung und ich dachte, ich komme mal pünktlich.«
»Hauptsache, du bist da. Setz dich. Außerdem wäre heute beinahe ich zu spät gekommen.«
»Du und unpünktlich? Was war los?«
Ich erzählte, was mir mit der alten Dame passiert war. Er sagte: »Gut gemacht. Die gute Tat des Tages ist getan«, und klopfte mir auf die Schulter. »Hoffen wir, dass wir nie so eine Hilfe brauchen.«
Ich nickte und er bestellte sich ein Wasser. Da ich ihn am Telefon grob über die Geschehnisse um Vater in Kenntnis gesetzt hatte, stieg er – ganz Reporter – punktgenau ins Thema ein.
»Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, was dein Vater und seine Freundin gemacht haben, bevor sie dann im Stadtpark gelandet sind.«
»Das sehen Eliza und ich genauso.«
»Und, was habt ihr unternommen?«
Ich zögerte. »Noch nichts. Ich hatte in der Firma ’ne Menge zu tun.«
Robert nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas.
»Dein Vater kämpft um sein Leben und du denkst an die Firma? Gottfried, ich weiß nicht …«
»Da hast ja recht, aber du kennst meine Probleme mit ihm …«
»Er ist und bleibt dein Vater.«
Ich schwieg.
»Warum lasst ihr kein MRT von seinem Gehirn machen? Wenn er sich zusammen mit Marija etwas eingefangen hat, kann man vielleicht einen Hinweis finden oder Dinge ausschließen.«
»Verflucht. Du hast recht. Dass Eliza und ich da nicht drauf gekommen sind …«
»Hast du Schlüssel für seine Wohnung?«
»Nein, die sind sicher bei seinen Sachen im Krankenhaus.«
»Dann los, auf was warten wir? Ab ins Krankenhaus und in die Wohnung deines Vaters. Vielleicht finden wir was.«
»Möglich, dass er inzwischen wach ist und uns sagen kann, was passiert ist.«
Wir tranken hastig aus, zahlten und riefen ein Taxi.
***
In der Klinik erreichte ich den Chefarzt nicht. Er war im OP und ich ließ ihm ausrichten, dass ich ein MRT meines Vaters wünschte. Er möge mich zurückrufen, wenn es fertig sei oder er Probleme mit meinem Wunsch hätte. Vater besaß keine Patientenverfügung, aber ich wusste, dass behandelnde Ärzte in so einem Fall mit Familienangehörigen sprechen mussten. Sein Zustand hatte sich nicht verändert. Wir blickten durch ein Besucherfenster in sein bleiches Gesicht und erschraken über unregelmäßiges Zucken seines Körpers. Er schlief. Ich dachte an die unnatürlich geweiteten Augen vom letzten Besuch und war froh, sie nicht wieder anschauen zu müssen. Ob er röchelte, konnten wir durch die Scheibe nicht hören. Die Monitore über und hinter ihm erklärten ihre Anzeigen nicht von selbst, außer Blutdruck und Puls konnte ich nichts deuten. Robert zuckte wie ich mit den Schultern. Dass Vater nach wie vor auf der Intensivstation lag und angebunden werden musste, zeigte, wie es um ihn stand.
Eine Schwester ließ mich an seine Sachen, nachdem ich mich zum x-ten Mal als Sohn ausgewiesen hatte. Mit seinem Schlüssel stiegen wir in das Taxi, das brav gewartet hatte, und fuhren zu seiner Wohnung am Jungfernstieg.
Mir fiel sofort auf, dass sie ordentlich aufgeräumt war. Marija wohnte entweder mit ihm zusammen oder kam regelmäßig, um Ordnung zu machen. Sie lebte zumindest zeitweise dort, das zeigten Utensilien von ihr im Badezimmer.
Wir waren nicht in der Wohnung, um Vaters Lebensstil auszuspionieren, und wir fanden, was wir suchten. Für den 13. April 2025 um 20 Uhr war ein »Trauerdinner« handschriftlich im Terminkalender eingetragen. Daneben hatte er »Alsterchaussee« gekritzelt. Weitere Hinweise – Fehlanzeige. Also schaute Robert sofort in seinem Tablet nach, das er immer bei sich trug. Das Internet spuckte eine Menge Informationen aus. Robert las vor: »Trauerdinner in Winterhude: Verdienen Sie kinderleicht einhundert Euro, indem Sie bei mir gut essen. Einzige Voraussetzung: Sie sind ein Paar aus Mann und Frau. Sie akzeptieren die Eigenheiten eines Gedenkessens für meine vor vielen Jahren verstorbenen Geschwister Maria und Georg. Dazu gehört, dass Sie zum Essen bei indischer Trauermusik Gesichtsmasken mit den Fotos der beiden tragen und schweigen müssen. Das Geld erhalten Sie, nachdem Sie einen Fragebogen über die Wirkung der Musik auf Sie ausgefüllt haben. Die Speisen werden von einem Gourmetrestaurant geliefert. Sie werden zufrieden sein. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich (Tel. +494030867835). Das Maria&Georg-Essen findet jeden zweiten Freitag im Monat statt. Ich nehme Anmeldungen von maximal vier Paaren an. Es gibt zwölf Essen pro Jahr. Ich freue mich auf Sie, Marc Sobor.«
»Was ist das denn für ein skurriles Ding?«
»Geht noch weiter: Tausend Euro extra für die Teilnahme an einer neurologischen Studie. Interesse?« Robert klickte auf den Button und las vor:
»Dem jüngsten und dem ältesten Paar biete ich durch Teilnahme an einer neurologischen Studie die Möglichkeit, zusätzlich eintausend Euro zu verdienen. Ich forsche über die Wirkung von Musik auf das menschliche Hirn, momentan von Trauermusik. Wenn Sie an der Studie teilnehmen, lassen wir nach dem Dinner einen Hirnscan machen (in der Privatklinik Papen in Eimsbüttel, bei Chefarzt Prof. Dr. Roland Stein). Sie erhalten ein Handy und eine App mit Musik von mir, die Sie sechs Wochen lang täglich eine halbe Stunde hören müssen. Danach gehen Sie noch einmal zu einem Hirnscan. Anschließend erhalten Sie die tausend Euro. Sie unterschreiben, dass Sie mir die Rechte an den MRT-Scans für Forschungszwecke übertragen. Wenn ich die Studie abgeschlossen haben werde, erhalten Sie kostenlos ein gedrucktes Exemplar. Trauen Sie sich, Ihr Marc Sobor.«
Derartiges hatten wir noch nie gehört.
Robert suchte weiter im Netz und fand, dass diese Essen seit eineinhalb Jahren stattfanden. Ein Reporter hatte darüber berichtet. Die Paare saßen mit Halbmasken, die die Mundzone frei ließen, schweigend an ihren Tischen und nahmen die unterschiedlichen Gänge bei indischer Trauermusik zu sich. Nach eineinhalb Stunden erhielt jedes Paar sein Geld, die Teilnehmer der Musikstudie fuhren nach Eimsbüttel in die Klinik.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Vater an so einer Veranstaltung teilgenommen hatte. Das musste Marijas Einfluss sein. Sicher gehörten er und sie zu den älteren Paaren. Diese neurologische Studie hatte Marija todsicher gereizt und sie hatte Vater überredet, mit ihr zusammen teilzunehmen.
»Wie kriegen wir raus, ob er mit seiner Freundin da war?«, fragte Robert.
»Ich denke, ein Anruf genügt.«
Die Nummer aus dem Internetbericht stimmte.
»Marc Sobor, bitte sprechen Sie Ihre Nachricht auf!«, meldete sich ein Anrufbeantworter.
Um ein Haar hätte ich gesagt: »Leibner, können Sie mir sagen, ob mein Vater Wilfried Leibner vorige Woche bei Ihnen an einem dieser Gedenkessen teilgenommen hat?«
Ich bremste mich, wusste nicht, warum, und legte auf, ohne ein Wort von mir gegeben zu haben.
»Was sollte das denn?«, fragte Robert.
»Ich weiß nicht. Suchen wir nach dem Handy und der Trauermusik-App«, schlug ich vor.
Wir fanden ein Telefon und ein Merkblatt für die App in Vaters Schlafzimmer.
»Stein hat meinen Vater und Marija im Hirnscanner gehabt.«
»Und Marija kann nicht auf Epilepsie geprüft werden.«
»Das stinkt doch zum Himmel, Robert. Nur so ein Gefühl. Schau bei Google nach, was wir über diesen Marc Sobor finden.«
Robert verstand und präsentierte kurz darauf einen kurzen Wikipedia-Eintrag.
»Marc S., geb. 04.04.1991 in London; Sohn von Robert und Marta Sobor, Großeltern aus Siebenbürgen; kam mit sechs Jahren nach Deutschland; Arzt und Physiker, hat bis 2017 Medizin und Physik in Hamburg und Marburg studiert und forscht als Privatgelehrter seit 2021 an einem Weg, Alzheimer, die Geißel der Menschheit, zu besiegen.«
»Da hängt eine lange Liste von Veröffentlichungen dran«, sagte Robert.
Er las die Themen vor.
»Der beschäftigt sich mit Nanotechnologie«, entfuhr mir.
»Hier steht noch, dass er an Schweinen forscht, weil sie so menschenähnlich sind«, ergänzte Robert.
»Wozu diese komischen Essen und die Trauermusikstudie?«
»Wir wissen, dass man den – geboren in London, nicht wahr – Engländern nachsagt, sie würden spinnen.«
»Du als Deutsch-Ire bist ja außen vor.«
Robert grinste nach innen. Ich kannte das.
»Er ist deutscher als ich, meine Eltern sind nach Hamburg gezogen, als ich zehn war.«
»Egal. Ungewöhnliche Trauerarbeit, würde ich sagen, mehr nicht.«
Ich legte Vaters Terminkalender, den ich noch in der Hand hielt, auf den Schreibtisch und sagte:
»Alzheimer, Nanotechnologie … Robert, du musst rauskriegen, ob es weitere Unregelmäßigkeiten nach diesen Essen gab.«
Robert nickte. »Ich rufe den Kollegen an, der den Bericht geschrieben hat, der wird mir helfen.« Gerade wollte er die Nummer in sein Handy eingeben, da klingelte es. »Oh, meine Frau.«
Er nahm das Gespräch an und unterhielt sich kurz mit ihr, es ging um ein Abendessen bei Freunden. Robert legte auf und bestellte mir einen Gruß. »Sie hat mich gefragt, was ich denn in der City Nord mache«, sagte er beiläufig. »Ich habe es ihr erklärt.«
»Woher weiß sie denn, wo du dich aufhältst?«
»Oh, habe ich das noch nicht erzählt? Seit der Wilkens-Entführung in Afghanistan trage ich immer einen GPS-Tracker bei mir. Mein Ehegespons hat einen in ihrem Auto.«
»Wilkens?«
»Wilkens war ein Kollege, den die Taliban in Afghanistan entführt haben. Er hatte kurz vorher in seinem Rucksack einen klitzekleinen GPS-Tracker versteckt, Anweisung der Redaktion. So wurde er gefunden und befreit.«
»Und du machst das hier in Hamburg?«
»Sicherheit schadet nicht. Die Tracker lassen sich mit deinem Handy, deiner Smartwatch oder beiden koppeln, auch zu mehreren Personen. Neueste Technik. Sie haben Langzeitbatterien, diese neuartigen aus Nano-Graphen, halten zwei Jahre. Das Besondere ist, dass sie nur Strom verbrauchen, wenn man sie anwählt und man ohne Handyverbindung einen Notruf an einen zentralen Server absetzen kann. Ich habe zwei solche Dinger bei mir. Einen für Eliza, einen für dich.«
Ich sah auf meine Smartwatch, der man den Hochleistungscomputer nicht ansah. Eliza hatte sie mir geschenkt, und ich hatte darauf bestanden, dass sie aussähe wie eine normale Uhr.
»Sorry, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Ein Quäntchen zu viel Kontrolle, oder? Bei kleinen Kindern oder bei Reportern in Kampfgebieten, aber wir als Erwachsene, hier? Außerdem – meine Smartwatch hier hat eine Solarzelle für den Dauerbetrieb und auch so eine Nano-Graphen-Batterie für eine SOS-Funktion. Die braucht Sendeleistung wie bei deinem Tracker. Neueste Technik, ein Schweizer Start-up versteckt sie in Gehäusen bekannter Markenuhren.«
Robert hatte die beiden Dinger, nicht größer als ein Zwei-Euro-Stück, aus einer Tasche gekramt und hielt sie mir hin.
»Komm, nimm. Wenn du ihn nicht bei dir tragen willst, dann mache wenigsten einen in Elizas Auto, falls sie falsch parkt und den Wagen nicht mehr findet.«
So ein Blödsinn. Aber ich nahm die Dinger und steckte sie ein, damit er Ruhe gab. Ich nahm mir vor, demnächst diese SOS-Funktion meiner Uhr endlich scharfzuschalten.
»Übrigens«, sagte ich zu Robert beim Hinausgehen, »wie wäre es, wenn du diesen Marc S. interviewst? Du kannst doch Leute ausfragen wie kein Zweiter?«
Robert grinste und nickte. »Mach ich gern.«
Mein Handy klingelte. Die Klinik war dran.
»Meinem Vater geht es schlechter«, sagte ich, »ich soll sofort kommen.«
»Dann fahr, ich sage Eliza Bescheid und kümmere mich um Sobor.«
Ich lief zum Taxistand.
***
Ein Anflug von Friedhof waberte durch die Gänge des Krankenhauses. Nirgendwo ein Bild. Heute schien mir die Intensivstation der Privatklinik Papen kälter und unpersönlicher als beim letzten Besuch. Die farbigen Anzeigen der Monitore, sechs davon oberhalb von Vaters Kopf, pulsierten. Er lebte. Seine Augen waren geschlossen, das Gesicht fahl und eingefallen, ein Mundwinkel hing schlaff nach unten. Über die Kanüle in seinem Arm liefen Nährlösungen oder Medikamente. Aus dem Behälter fielen Tropfen stetig nach unten. Irgendeine Maschine zischte. Wurde er künstlich beatmet? Nein, dann hätte eine Maske das Gesicht verdeckt. Niemand war da, um mir die Frage zu beantworten.
Erst nötigen sie mich zu einem Alarmstart, dann ist keiner da.
Eliza hatte ich nicht erreicht, sie hing sicher in der Uni fest. Ich hatte ihr ein zweites Mal auf die Voicemail gesprochen.
Ein Mann in weißem Kittel mit »Dr.« auf dem Namensschild betrat den Raum. Impulsiver als ich wollte fasste ich ihn am Arm.
»Was ist mit meinem Vater? Warum ist niemand bei ihm? Was für eine Maschine zischt da?«
»Schwarz, guten Tag. Ganz ruhig, Herr Leibner. Ihr Vater kämpft, aber seine Kräfte lassen nach. Wir geben ihm Medikamente, um den Kreislauf anzukurbeln, tun, was in unserer Macht steht …«
»Und diese Maschine?«
»Sie befeuchtet die Raumluft, damit die Patienten hier lungenschonender atmen können.«
»Ach so.«
»Können Sie bitte meinen Kittel loslassen?«
»Oh. Natürlich. Entschuldigung.«
Der Arzt zupfte seinen Kittel zurecht.
»Ihr Vater hat Spasmen, Anfälle in unregelmäßigen Abständen, die sein Herz belasten. Die letzten waren so kräftig, dass sein Herz mehrfach stillstand. Deshalb haben wir Sie gerufen.«
»Im Moment …«
»In den letzten Minuten scheint er sich wieder stabilisiert zu haben. Puls, Blutdruck und Körpertemperatur sind kritisch, aber nicht hyperkritisch wie vor einer Stunde.«
»Was kann ich tun?«
Ich hatte wieder einen Schritt auf den Doktor zu gemacht, er wich zurück und ich sagte: »Entschuldigung.«
»Schon in Ordnung, Herr Leibner. Bleiben Sie bei ihm, halten Sie seine Hand, geben Sie ihm ein Gefühl von Nähe und …«
»Nimmt er mich denn wahr?«
»… beten Sie. Das ist das Beste, was Sie für ihn tun können.«
»Merkt er, dass ich da bin?«
»Er merkt es sicher nicht physisch, indem er Sie sieht oder hört. Möglicherweise fühlt er Sie.«
»Aber dann müsste er doch bei klarem Bewusstsein sein, wie geht das mit diesen Anfällen?«
»Wir wissen nichts über sein Bewusstsein. Seit er bei uns ist, haben wir nicht mit ihm kommunizieren können.«
»Was ist mit dem MRT?«
»MRT?«
»Ich habe dem Chefarzt ausrichten lassen, dass ich als Angehöriger ein MRT meines Vaters wünsche.«
»Oh, das tut mir leid. Ich weiß nichts davon.«
Der Pager des Arztes piepte. Er nahm ihn aus der Tasche und warf einen Blick darauf.
»Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zu einem anderen Patienten. Bin gleich wieder da. … Ich, ich … kümmere mich um das MRT.«
Bleibe ich oder gehe ich? Wenn er nichts mitbekommt, kann er mich auch nicht spüren. Nähegefühl? Blödsinn.
Ich entschloss mich zu gehen. Der Abteilungsschwester schärfte ich ein, mich zu jeder Zeit anzurufen, wenn sich der Zustand meines Vaters verschlechterte.
Beten, für meinen Vater beten, hatte der Doktor mir geraten.
Ich hatte ewig nicht mehr gebetet oder mit meinem Gott gesprochen, wie ich mich in früheren Zeiten ausgedrückt hätte. Als Physiker war Gott mir nicht geheuer, wenn es ihn denn gäbe. So etwas Großartiges schaffen wie das Universum und dann den Menschen zulassen, der alles kaputtzumachen droht. Sollte Gott Masochist sein, der Freude daran hat, dass sein eigenes Werk von der selbst ernannten Krone der Schöpfung zerstört wird? Und was hätte er mit meinem oder dem Schicksal meines Vaters am Hut? Einstein hat gesagt, je tiefer er in die Natur einstiege, desto wahrscheinlicher würde die Existenz Gottes für ihn. Kant hat geschrieben, Gottes Existenz ließe sich weder beweisen noch widerlegen, also sei es vernünftig, sie als gegeben anzunehmen. Mir als Physiker war Kollege Einstein zu nebulös, Kant schien mir pragmatischer. Es schadet nicht, Gott als existent anzunehmen. Ich folgte einer Eingebung, drehte vor dem Klinikausgang um und suchte die Kapelle. Neben der belebten Cafeteria wies ein unscheinbares Schild mit einem Kreuz auf den Eingang hin. Protestantische Stille umfing mich. Man hörte nichts von nebenan. Die weiß gekalkten Wände schmückte kein einziges Bild, schmale Fenster aus farbigem Glas warfen ein buntes Licht auf den Boden. Drei leere Bankreihen warteten auf Besucher. Ein schlichtes übermannsgroßes Holzkreuz und eine einsame Kerze, die von meinem Türöffnen flackerte, belegten den religiösen Charakter des Raumes. Ich war allein. Unschlüssig, ob ich mich setzen sollte, blieb ich neben der ersten Bank stehen und widerstand dem aus den Tiefen der Kinderzeit auftauchenden Impuls, mich hinzuknien.
Ein Gebetsraum, und ich wusste nicht, was denken oder beten. Das Schicksal meines Vaters beklagen? Gott um ein Ende oder Linderung seines Leidens bitten? Seelischen Müll abladen, der mich belastete? Mir fiel in dem Moment nicht einmal ein, welcher das sein sollte, ich hatte ja eine Auswahl anzubieten …
Ich entschied mich, zur Ruhe kommen zu wollen und setzte mich hin.
Meine Gedanken verselbstständigten sich. Auf einmal stand ich am Sterbebett meiner Mutter. Im Alter von neun Jahren versteht man genug, um zu sehen, dass ein geliebter Mensch leidet. Mutter hat sehr gelitten, sie hat sich von einem Treppensturz nicht mehr erholt. Ihr Rückgrat war gebrochen und heilte nicht zusammen. Außerdem litt sie an Kehlkopfkrebs. Die ärztliche Kunst vermochte ihr nicht zu helfen. Mutter kämpfte. Trotz ihrer Schmerzen und des sich abzeichnenden Endes bemühte sie sich, mir Mut zuzusprechen. Sie redete mit mir über meine Schule, so lange sie noch sprechen konnte. Dabei war mir nur zum Weinen zumute. Ich wollte sie zurückholen in unser Haus, an den Frühstückstisch und zum sonntäglichen Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel, einem geliebten Ritual mit Vater und ihr. Mutter hatte mir aufgetragen, Vater zu gehorchen, er sei ein guter Mensch. Beschwören hätte ich es nicht können, aber ich glaube, das waren ihre Worte. Was mir das Gehorchen einbrachte? Einen steif geprügelten linken Daumen, das Ende einer Pianistenkarriere vor ihrem Start und meinen Tick, die Sucht nach Eigenhypnose – Kraftquelle – und die Fähigkeit, aus dem Unterbewusstsein endlos Leibnizbriefe zu rezitieren. Liebe zu meinem Vater erzeugte das nicht. Seine Leibniz-Besessenheit verfolgt mich bis heute. Zugegebenermaßen nicht mehr belastend, doch ich hätte auf meine unterbewusste Rezitierkunst gern verzichtet.
Und dann war da ja noch die Sache mit Hagen, meinem Schulfreund, der mich verraten hatte und vom Boss der BestCarsMotors AG ermordet wurde, so dass alle Spuren auf mich zeigten und ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wurde. Vater hatte das nicht kategorisch für unmöglich gehalten, sondern geglaubt. Das hatte mich tief verletzt. Er hat sich nie dafür entschuldigt.
Die Kerze brannte ruhig, bis sie wieder flackerte. Jemand hatte die Tür geöffnet und näherte sich. Plötzlich stand Eliza neben mir, setzte sich zu mir, fasste meine Hand und flüsterte: »Du in der Kapelle? Hier hätte ich dich nicht vermutet. Habe eher zufällig hier reingeschaut.«
»Du kannst normal reden. Gott akzeptiert jede Lautstärke«, sagte ich und streichelte ihre Hand. »Danke, dass du gekommen bist.«
»Robert hat mich angerufen und ich bin sofort los.«
»Hast du mit einem Arzt gesprochen?«
Sie nickte. »Ich bin im Bilde.«
»Ich weiß nicht, warum ich hier reingegangen bin. Stand schon vor der Pforte, bin umgedreht und saß plötzlich in dieser Bank.«
»Hilft es?«
»Ich weiß nicht, wobei es helfen soll.«
Eliza strich mir über den Kopf.
»Du sorgst dich um deinen Vater.«
Ich zögerte, nickte und schüttelte dann den Kopf.
»Mir ging neben anderem durch den Kopf, dass er mich sogar für fähig gehalten hat, meinen damals einzigen Freund ermordet zu haben. Wenn ich ehrlich bin, sorge ich mich mehr darum, dass ein Wahnsinniger Versuche an Menschen zu machen scheint.«
***
Vater starb, ohne dass ich noch ein Wort mit ihm hatte wechseln können, seit er mit Marija in die Notaufnahme eingeliefert worden war. Gestern war es mir vorgekommen, als hätte ich ein Lächeln über sein Gesicht huschen sehen, aber der zweite Blick zeigte eine wächserne Maske, die ihm kaum noch ähnelte. Das Band zu ihm war nicht dick. Doch es entsetzte mich, ihn so zu sehen.
Heute früh hatte ich angerufen, nach dem MRT und seinem Zustand gefragt. Das MRT sei noch nicht fertig, hieß es, »ansonsten unverändert bedrohlich, aber stabil« und so konnte ich mit meinem Chef geschäftlich nach Frankfurt fliegen.
Die Klinik informierte mich am späten Nachmittag, dass Vater einen Schlaganfall erlitten hatte und von nicht enden wollenden Spasmen geplagt wurde. Eine Stunde später ein weiterer Anruf: Sein Herz sei stehengeblieben, Versuche, ihn wiederzubeleben, seien fehlgeschlagen. Ich rief Eliza an, die in Kiel einen Vortrag hielt. Sie war genauso erschüttert wie ich und glaubte weder an die Epilepsie noch an einen natürlichen Tod. Eine genaue Zuordnung von Vaters Symptomen zu einer Krankheit gelang ihr nach wie vor nicht. Ich brach ab in Frankfurt und schaffte es, bis zehn Uhr abends in der Klinik zu sein. Vaters Bett war leer. Sie hatten ihn ins Sterbezimmer gebracht. Es dauerte eine Weile, bis ich es lokalisiert hatte. Dort fand ich ihn auch nicht; er sei bereits zum Bestatter unterwegs, sagte man mir. Was immer das heißen mochte.
Wie das? Ohne dass wir uns verabschieden können?
Eliza – mittlerweile vor Ort – war entsetzt wie ich. Wir suchten den behandelnden Arzt. Er operierte einen Notfallpatienten und wir sollten abwarten. Wir wollten den Totenschein und rannten zur Verwaltung, die um die Zeit nicht mehr besetzt war. Nach einigem Zureden schaute ein Kollege des wenig begeisterten Pförtners im Verwaltungsbüro in die Ablage. Dort lag der Totenschein, versandfertig an mich, den man mir als Sohn anstandslos aushändigte. »Todesursache natürlich, vermutlich Langzeitfolge eines epileptischen Anfalls« stand da zu lesen mit Unterschrift von Dr. Schwarz. So ein Unsinn! Wie bei Marija. Weder in Mutters noch in Vaters Familie hatte es je einen Fall gegeben. Ich musste den Chefarzt sprechen. Der sei bis zum nächsten Morgen nicht mehr erreichbar, sagte der Pförtner, grinste breit und zuckte mit den Schultern.
***
Am nächsten Morgen gegen neun Uhr standen wir im Sekretariat des Klinikleiters. »Prof. Dr. Stein erwartet sie«, säuselte die Sekretärin und wies auf die mit Leder beschlagene Tür. Ich ließ Eliza vorgehen und wäre fast auf sie aufgelaufen, weil sie unvermittelt innehielt. »Roland, du? Du bist der Chefarzt?«
Ein hagerer Zwei-Meter-Mann, Mitte Vierzig, mit Krawatte unter einem weißen Kittel, blickte auf, schien erschreckt und freute sich Sekunden später.
»Eliza? Du in meinem Reich?«
Er stand auf, machte drei Schritte auf Eliza zu und umarmte sie. Sie ließ ihre Arme hängen.
Sie trat einen Schritt zurück, zeigte auf mich und sagte: »Gottfried, mein Mann.«
Stein überragte mich um einen halben Kopf. Er streckte mir seine Hand entgegen und sagte: »Stein, freut mich.«
Ich fasste seine Hand und hätte sie am liebsten gleich wieder losgelassen. Brrhhh. Ein Händedruck weich wie … Knetgummi.
»Angenehm, Leibner.«
»Der mit den Wasserstoffkartuschen?«
Es war mir unangenehm, auf meine wissenschaftliche Leistung angesprochen zu werden. Ich hatte da geforscht, wo andere es auch taten und mehr Glück gehabt als sie oder länger durchgehalten.
Ich nickte und schwieg.
»Dass ich Sie kennenlerne, ich habe viel über Sie gelesen.«
»Hoffentlich nur Gutes.«
»Setzen Sie sich doch, setz dich, Eliza. Kaffee? Oder lieber Tee?« Er blickte zu uns runter, die wir mehr in die unbequemen Sessel geplumpst waren, als dass wir uns gesetzt hätten.
Wie aus einem Munde sagten Eliza und ich: »Tee, bitte, mit Milch.«