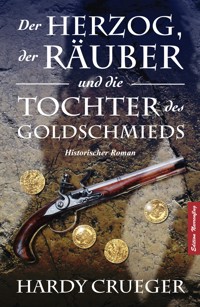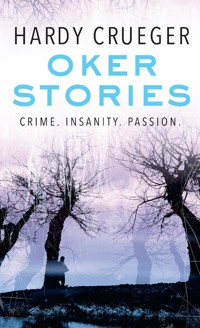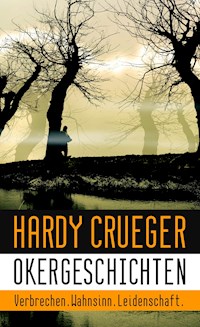5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: crueger ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Victor ist zehn Jahre alt, als er 1935 zusammen mit seiner jüdischstämmigen Mutter Deutschland in Richtung USA verlässt. Sein Vater bleibt zurück, um Geschäfte zu regeln, und will ihnen ein paar Monate später folgen. Jahrelang warten sie auf ihn. Als die Mutter Victor plötzlich verlässt, muss er sich allein durch das fremde Land kämpfen. Er verliebt sich, wird in Ketten gelegt und ausgepeitscht. Wird Clochard, Geschäftsmann und Sträfling. Und nur die Hoffnung, irgendwann nach Deutschland und zu seinen Vater zurückzukehren, verleiht ihm die Kraft, seine Odyssee durchzustehen. Mit einem Nachwort von Gabriele Haefs. »Trotz aller bekannter Umstände erzählt Crueger die Geschichte so komprimiert, dass man das Buch wie im Zwang verschlingt.« Onlinemagazin krautnick »Kann man so ein Leben in zweihundert Seiten fassen? Crueger kann das. Und macht es exzellent.« lovelybooks
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hardy Crueger
Der andere Krieg - Die Odyssee des Victor Rosenfels
Roman
Inhaltsverzeichnis
Buch und Autor
Impressum
Widmung
Prolog
1. Kapitel - Das neue Land
2. Kapitel - Die Odyssee
3. Kapitel - Das alte Land
Epilog
Danksagung
Nachwort von Gabriele Haefs
Zeittafel
Mehr Bücher von Hardy Crueger
Buch und Autor
Victor ist zehn Jahre alt, als er 1935 zusammen mit seiner jüdischstämmigen Mutter Deutschland in Richtung USA verlässt. Sein Vater bleibt zurück, um Geschäfte zu regeln, und will ihnen ein paar Monate später folgen. Jahrelang warten sie auf ihn. Als die Mutter Victor plötzlich verlässt, muss er sich allein durch das fremde Land kämpfen. Er verliebt sich, wird in Ketten gelegt und ausgepeitscht. Wird Clochard, Geschäftsmann und Sträfling. Und nur die Hoffnung, irgendwann nach Deutschland und zum Vater zurückzukehren, verleiht ihm die Kraft, seine Odyssee durchzustehen.
Hardy Crueger, geboren in den 1960ern, studierte nach einer Facharbeiter-Ausbildung Geschichte und Soziologie und lebt als freiberuflicher Schriftsteller in Braunschweig. Nach ersten Erfahrungen im literarischen Untergrund (social beat) schreibt er heute Romane zu geschichtlichen Themen, aber auch Krimis, Thriller und Suspense-Kurzgeschichten. Crueger leitet als Dozent für Kreatives Schreiben die KrimiWerkstatt Braunschweig und war viele Jahre im Vorstand des Verband deutscher SchriftstellerInnen (VS) NDS/Bremen aktiv. 2021 erhielt er ein Literaturstipendium der Stadt Braunschweig. Bisher sind zwanzig Bücher von ihm erschienen, darunter dreizehn Romane. Mehr Informationen finden Sie auf seiner Internetseite HardyCrueger.de und auf facebook.
Impressum
© Hardy Crueger 2015 / 2022
Die Erstausgabe erschien 2015 im der Edition Narrenflug, Kiel.
Die Neuauflage 2022 im Selfpublishing bei tolino-media, Albrechtstraße 14, 80636 München.
Informationen auf HardyCrueger.de,
Bernerstr. 1, 38106 Braunschweig, [email protected]
Taschenbuch-ISBN: 978-3-7546-1792-2
Lektorat: V. Braun, Edition Narrenflug.
Satz: Bella C.
Umschlaggestaltung: Martin Markworth, markworth-design.de, unter Verwendung eines Bildes von Nora Block.
Widmung
Wenigen nur werden Denkmäler erbaut
In Stein gehauen
In Bronze gegossen
Alle anderen leben fort
In flüchtigen Worten
Aus Luft gewebt
Und sterben erst
Wenn sich niemand mehr ihrer erinnert
* * *
Gewidmet meinen Großvätern Friedrich Wilhelm und Walter Fritz, die ich nie kennenlernte, weil der Krieg sie gefressen hat.
Und in Gedenken an meine Mutter Gisela, die diese Erzählung entscheidend mitgeprägt hat.
Prolog
Gut. Ich hatte Mist gebaut. Auf einem Konzert, das wir in einem zweifelhaften Schuppen nahe der polnischen Grenze gespielt hatten. Nachdem ich fünf oder sechs vollgepinkelte Bierbecher abbekommen hatte, schmiss ein Glatzkopf aus der ersten Reihe eine Flasche. Die ganze Zeit hatten er und seine Kameraden schon mit ausgestreckten rechten Armen vor der Bühne gestanden und »Sieg heil!« und »Bimbos raus!« gebrüllt. Die Flasche traf meine Gitarre, und da wurde ich echt wütend. Ich hob sie auf und warf sie zurück. Aber anscheinend konnte ich besser treffen als der Skin, und er ging blutend zu Boden. Dafür bekam ich 80 Arbeitsstunden aufgebrummt. 80 Stunden, die ich in einem Pflegeheim abreißen sollte.
Das war natürlich blöd. Ich war noch kein wirklich guter Gitarrist und wenn ich damit mal mein Geld verdienen wollte, hieß es üben, üben, üben. Denn ich träumte davon in England, Brasilien, Japan und den USA zu spielen.
Aber erstmal hieß es: Rentnerschieben! Ich sollte mich nachmittags um einen alten Mann kümmern, der in seinem Bett vor sich hindämmerte. Er war über achtzig, hatte nur noch ein paar dünne weiße Haare auf dem Kopf, fleckige Haut und einen Blasenkatheter. Ich sollte mich neben ihn setzen, mich mit ihm unterhalten oder ihm aus der Zeitung vorlesen. Wenn der Katheterbeutel voll war, sollte ich mir Einmalhandschuhe anziehen und ihn ausleeren. Aber auf keinen Fall im Waschbecken.
Als ich in sein Zimmer kam, starrte er mich an, wie alle Alten, die mich das erste Mal sehen. Nicht nur wegen meiner fünfzig Zentimeter langen Matte, sondern wegen meiner Tattoos im Gesicht und am Hals, den Piercings in Lippen und Nase und den beiden kleinen Teufelshörnchen auf der Stirn. Und dann hob er ganz cool eine Hand und sagte: "Hi, ich habe heute Geburtstag. Setz dich, Nigger."
"Hey, Mann", sagte ich. "Da gratuliere ich aber. Wie alt wird denn der Nazi? Das Ständchen können Sie übrigens vergessen, für Leute wie Sie singe ich keinen Ton."
"Fünfundachtzig, mein Junge. Und nur wenn du Glück hast, wirst du auch einmal so alt", sagte er.
Ich wusste, dass er nicht aufstehen konnte, weil man ihm beide Beine amputiert hatte, wegen Diabetes. Aber wie sich schnell herausstellte, war er im Kopf noch ziemlich klar.
Ich setzte mich auf einen Stuhl neben das Bett, und so lernte ich Victor Rosenfels kennen. Das war am 7. September 2010.
Um es kurz zu machen - er war kein Nazi und nach dem ersten Rumgezicke verstanden wir uns ganz gut. Hin und wieder hievte ich ihn mit dem Lifter in seinen Rollstuhl und wir drehten ein paar Runden um den Block, aber meistens lag er im Bett. Ich erzählte ihm warum ich hier war, von meiner Musik, den Konzerten und er erzählte mir Geschichten aus seinem Leben.
Das war echt irre, was der alte Rosenfels da erlebt hatte. Zuerst glaubte ich ihm ja nicht so richtig. Bis er stöhnend meinte, ich sollte mir mal seinen Rücken ansehen. Also half ich ihm sich umzudrehen, zerrte das T-Shirt hoch, und als ich die dünnen, roten wulstigen Narben der Peitschenstriemen auf seinem Rücken sah, da wurde das alles plötzlich Wirklichkeit.
Irgendwann brachte ich den mp3-Rekorder meiner Band mit und begann aufzunehmen, was er erzählte, weil das so total abgefahren war. So ganz anders als die Kriegsgeschichten, die meine Oma als Kind erlebt hatte, oder die man im Fernsehen präsentiert bekommt.
Er hatte jüdische Vorfahren und 1935 schickte sein Vater ihn und seine Mutter in die USA. Der Vater musste noch Geschäfte erledigen und wollte irgendwann nachkommen. Jahrelang haben sie auf ihn gewartet. Er nannte einen alten Chinesen in New York seinen »Onkel«, und erzählte, nach Ausbruch des 2. Weltkriegs sei er ein paar Mal übel verprügelt worden. Außerdem war er quer durch die Staaten Illinois, Indiana und Pennsylvania gelaufen. Gelaufen! Mann, ich wusste nicht mal, wo diese Staaten in den USA liegen. Und im Knast hatte er auch gesessen, drei Jahre lang.
Er hatte wirklich eine Menge durchgemacht und erzählte mir, woher die Narben auf seinem Rücken kamen, die "Amerika in meine Haut gepeitscht hatte", wie er es ausdrückte. Warum er schließlich 1947 nach Deutschland zurück gekehrt war, und dann jahrelang auf der Straße gelebt hatte.
Ich besuchte ihn fast jeden Nachmittag, auch als meine Strafe wegen der Tätlichkeit gegen den Neo-Nazi längst abgearbeitet war. Später tippte ich alles, was er erzählt hatte, in den Computer, und brachte die Episoden in die richtige zeitliche Abfolge, damit auch andere Leute die echt ungewöhnliche Geschichte des Victor Rosenfels nachlesen können. Es war schon fast eine Odyssee, die der Mann da erlebt hatte. Und sie begann an einem trüben Tag in Hamburg ...
1. Kapitel - Das neue Land
1
Es war Anfang September im Jahre 1935, als mein Vater uns, meine Mutter und mich, runter zum Hafen fuhr. Ein paar der grauen Fassaden, an denen wir vorbeifuhren, waren mit roten Flecken gesprenkelt, als hätten sie Ausschlag oder so was. Da wohnten Nationalsozialisten, und das war ja ihr Kennzeichen: die Hakenkreuzfahne.
Ich war gerade erst zehn Jahre alt geworden, aber es war ein einsamer, trauriger Geburtstag gewesen, denn meine Eltern hatten sich schon tagelang vor unserer Abfahrt gestritten und Mutter hatte gejammert und geheult. Aber als es dann endlich losging, war sie ganz ruhig. Ich glaube, sie hatte keine Tränen mehr. Das ist doch furchtbar, wenn du weinen musst und keine Tränen mehr hast. Da kann die Traurigkeit nicht mehr aus dir heraus fließen. Der Schmerz bleibt in dir drin, und das tut richtig weh. Sie war ganz bleich, saß stumm da und drückte meine kleine Hand so fest, dass es mir fast weh tat.
Das tiefe Horn des Dampfers dröhnte schon, als wir aus dem Taxi stiegen und der Chauffeur das Gepäck aus dem Kofferraum holte, einen großen Koffer, einen kleinen und meinen Rucksack. Auf dem Weg zur Pier kam uns durch den Regen ein Trupp SA-Männer in Uniform entgegen. Sie marschierten im Gleichschritt und die mit Nägeln beschlagenen Sohlen ihrer Stiefel schlugen dröhnend auf das Pflaster, als würden sie alles zermalmen wollen, was ihnen im Wege war.
Die Männer schauten uns grimmig an und marschierten direkt auf uns zu, so dass wir ihnen ausweichen mussten. Mutter klammerte sich an Vaters Arm, er wich nicht weit genug zurück und einer der Männer rempelte ihn an.
"Tschuldigung!", brüllte der SA-Mann in einem Ton, der eigentlich das Gegenteil meinte. Dann schlug er die Hacken zusammen, riss den rechten Arm hoch und schrie: "Heil Hitler!"
Mein Vater sagte nichts und wir wollten weiter gehen. Aber die SA-Männer waren alle stehen geblieben und starrten uns an. "Heil Hitler! … heb ick seggt!", brüllte der Mann wieder und trat noch einen Schritt auf Vater zu.
"Seid wohl keene Reichsdeutschen, wat? Seid wohl Juden, die abhauen wollen, wat?"
"Wir sind keine Juden", sagte Vater leise. "Heil Hitler."
"Na, dann is ja man got. Ward Tied, dat man de jüdische Brut kennzeichnet, mit een Stern oder so", sagte der Mann.
Mein Vater sagte: "Ja, ja", dann drehte er sich um, und wir gingen weiter auf den Dampfer zu. Ich sah, wie meine Mutter am ganzen Leib zitterte.
In einem kleinen Schalterhäuschen mussten wir unsere Papiere und die Fahrkarten vorzeigen. Erst danach durften wir zur Gangway gehen. Dort blieben wir stehen und setzten noch einmal die Koffer ab. Mein Vater umarmte erst meine Mutter, dann beugte er sich zu mir hinunter und nahm auch mich in die Arme.
"Pass gut auf Mutter auf, Victor, hörst du", sagte er zu mir. "Ich komme bald nach. So schnell ich kann." Er löste sich von mir, drehte mich an den Schultern herum und schob mich sanft die Gangway hinauf.
Ich wusste es ja - aber als mein Vater sich aufrichtete, mich an den Schultern zum Schiff drehte und mir dadurch regelrecht befahl, an Bord des Schiffes zu gehen, weg-zu-gehen. da erst wurde mir plötzlich die ganze Bedeutung dieses Augenblicks bewusst. Ich schaffte es, ein paar Schritte die Gangway hinauf. Aber dann blieb ich stehen, drehte mich um ... und fing an zu schreien. Brüllend ließ ich meinen kleinen Koffer fallen, rannte zurück zu meinem Vater, klammerte mich so verzweifelt an seinen Mantel wie ein Ertrinkender an ein Stück Holz und kreischte wie von Sinnen immer nur ein einziges riesiges Wort, das ganz allein in meinem kleinen Kopf war: Papa!
Da begriff ich zum ersten Mal in meinem Leben, was »Abschied nehmen« wirklich heißt. Nämlich: Jemanden zurückzulassen. Verlassen zu werden. Etwas zu verlieren. Aber ich wollte niemanden verlassen. Und ich wollte auch nichts verlieren. Ich wollte nicht weggehen. Und meine Mutter wollte auch nicht weggehen. Und mein Papa sollte bei uns bleiben. Das wollte ich! Ich schrie: "Ich will nicht! Ich will nicht!", und heulte und machte wirklich einen Heidenspektakel.
Mein Vater nahm mich auf den Arm und drückte mein nasses Gesicht an sich. Auch er weinte und sprach mit zitternder Stimme beruhigend auf mich ein, strich mir über das Haar und drückte mich, bis ich wieder ruhiger wurde.
"Ich komme rüber zu euch, so bald ich kann, Victor", flüsterte er. "Glaub mir. Spätestens Weihnachten bin ich bei euch. Solange musst du auf Mama Acht geben. So lange bist du der Mann im Haus." Er stellte mich wieder auf auf die Füße und nahm mein Gesicht in seine Hände. "Pass auf Victor: Du wirst einen Schatz finden, drüben, in Amerika. Das verspreche ich dir. Du bist doch Victor thevictorious, der siegreiche Victor. Wenn ich zu euch komme, hast du ihn sicher schon gefunden."
Meine Mutter zog mich an meinen dünnen Ärmchen die Gangway hinauf. Ich war gerade zehn Jahre alt geworden. Man konnte mit mir machen, was man wollte. Ich konnte mich nicht wehren. Ich wollte keinen blöden Schatz in Amerika finden. Ich wollte hier bleiben, zuhause, nichts anderes. Aber ich fügte mich, nahm meinen kleinen Koffer und ging tapfer an der Hand meiner Mutter Schritt für Schritt die Gangway hinauf.
Als wir an Deck waren, suchten wir uns einen freien Platz an der Reling, um Vater zum Abschied zu winken. Aber der hatte sich schon umgedreht und ging davon. Als er zwischen den Leuten verschwand, die am Pier standen und ihren Angehörigen und Freunden mit Tüchern zum Abschied winkten, war dies das letzte, was ich von meinem Papa, dem Transportunternehmer Edgar Rosenfels sah: sein großer, breiter Rücken.
Auf diesem Rücken hatte ich gesessen, an ihm hatte ich mich festgeklammert als seien wir zusammengewachsen, wenn wir mit den anderen bei uns im Hof huckepack Reiterkampf gespielt und uns mit dem Ruf: "Hier kommt Victor the Victorious!" in die Schlacht gestürzt hatten. Als ich schwimmen lernte und nach ein paar Zügen fast unterging, war sein Rücken meine rettende Insel gewesen. An seinem Rücken hatte ich geklebt, als seien wir beide, Vater und Sohn, ein einziges Wesen.
Jetzt klammerte ich mich mit eiskalten Händen an die Reling und schaute verbissen auf die winkenden Menschen, auf die Mole, die Kaimauer, während der Dampfer auf die Elbe hinaus geschleppt wurde, und die Häuser, der Hafen und die Kräne im Nebel verschwanden. Meine Mutter wollte mich wegzerren, aber sie hätte mir die Finger brechen müssen, um das zu schaffen. Schließlich legte sie mir ihren Mantel um und ließ mich dort stehen. Ich stand da so lange, bis die Möwen lachend an Land zurückkehrten - nach Hamburg. Sie konnten über das Wasser fliegen, wohin sie wollten. Ich heulte und dachte an meinen Vater, und an unsere Wohnung. An die Jungs in der Schule, an meine Freunde Peter und Hanseken und natürlich an Mariechen.
2
Mariechen Müller war die Tochter unserer Nachbarn. Von ihrer Mutter bekam sie die blonden Haare immer zu zwei dicken Zöpfen geflochten, die links und rechts an ihrem Kopf zu Schnecken aufgerollt wurden. Wir waren gleich alt, aber Mariechen blieb immer eine Handbreit größer als ich, ich schaffte es einfach nicht, sie einzuholen, zumindest nicht bis zu unserem Abschied. Auch im Sommer hatte sie immer rote Flecken auf den Wangen und sogar im Winter ein paar Sommersprossen auf der Nase. Wir gingen zusammen zur Schule, in die gleiche Klasse. Und gegen die Bäckerbrüder aus dem Hinterhof konnten wir uns nur gemeinsam behaupten.
Die Müllers wohnten eine Treppe tiefer als wir. Mariechen und ich hatten zusammen im Sandkasten im Hof gespielt. Unsere Mütter und die Kriegerwitwe Tantetherese, die ganz oben wohnte, hatten auf der Bank in der Sonne gesessen, wie die Hühner auf einer Stange, und über irgendwelche Witze gegackert, die wir nicht verstanden.
Tantetherese war kinderlos. Und sie hatte auch keinen Mann. Der war im "Krieg geblieben", sie hatte uns aber nicht erklärt, wo dieser Ort war und warum ihr Mann nicht mehr von dort zurück kommen wollte.
Mariechen war ein bisschen wie eine Schwester für mich, nein, wie eine Freundin muss ich sagen. Denn hinter den Mülltonnen versteckt hatten wir uns sogar mal geküsst. Ich hatte die Augen fest zusammengekniffenen, meine Lippen ganz spitz gemacht und erwartet, dass es vielleicht irgendwie süß schmeckt. Aber es war eigentlich nicht viel anders, als wenn meine Mutter mich küsste - feucht, kühl und schmatzend. Das tollste an der Sache war, dass wir es nicht tun durften.
Im Rechnen war Mariechen sehr viel besser als ich, dafür hatte ich es mit dem Schreiben und Lesen leichter. Bis zum zweiten Schuljahr, das war 1933, waren wir in der gleichen Klasse. Dann war ihr Vater ein SA-Mann geworden, und auf einmal sagte Marie, der Name Rosenfels sei jüdisch und mit Juden spiele man nicht.
Ich war sehr überrascht. Ich hatte zwar gewusst, dass es Juden gab - aber dass ichselber einer sein sollte, das hatte ich nicht gewusst. Mariechen sagte, Rosenfels sei ein jüdischer Name, ich sei doof und würde stinken.
"Ja", sagte sie. "Du stinkst wie eine Judensau. Und wer spielt schon gerne mit stinkenden Schweinen? Man muss dich erst einmal waschen, Victor Rosenfels."
Sie schleppte mich zum Wasserhahn an der Hauswand, und ich grunzte dazu wie ein Schwein. Sie wusch mir die Hände, die Beine und den Nacken. Das Wasser war sehr kalt, ich hampelte rum und quiekte wie am Spieß, so dass wir beide kichern mussten. Erst als ich sauber genug war, konnten wir gemeinsam auf die Straße laufen und mit den anderen Kindern spielen.
Im Hof aber, auf der Bank in der Sonne, da saß nur noch ganz alleine und einsam die Kriegerwitwe Tantetherese.
Irgendwann erzählte ich das meinem Vater. Der setzte sich zu mir, legte den Arm um mich und erklärte mir das so: "Pass auf, Victor, dein Opa Morgenroth, der Vater von Mama aus Frankfurt, das ist ein Jude, aber seine Frau, also deine Oma Lieselore Morgenroth, die nicht. Und mein Vater, der Opa, den du nicht kennst, weil er schon sehr lange tot ist, Aaron Rosenfels hieß der, der war auch aus einer jüdischen Familie. Aber deine Mutter, du und ich, wir sind keine Juden. Deine Mama ist Christin - und wir beide, Victor, weißt du, was wir sind?"
Ich schüttelte den Kopf, sah meinen Vater an und meinte: "Papa und Sohn?"
"Ja, da hast du natürlich recht", sagte er lächelnd und fuhr mir durch das Haar. "Aber wir beide sind - na, Menschen. Verstehst du?"
"Ach so", sagte ich, nickte kräftig und tat so, als hätte ich das alles verstanden.
Mariechen verstand das auch nicht. Als wir uns mal beim Kohlenholen im Keller trafen, erklärte ich ihr, was mein Vater mir erklärt hatte.
"Im Rechnen warst du ja nie eine Leuchte", sagte sie. "Also, pass auf, deinen toten Juden-Opa musst du natürlich mitzählen. Und ein halber toter Judenopa und ein halber lebender Judenopa sind nach Adam Riese immer noch ein ganzer Jude. Du bist auf jeden Fall ein Jude, außerdem hat mein Vater gesagt: Rosenfels-ist-jüdisch! Das ist ja wohl so klar wie Kloßbrühe!"
Ich wiegte meinen Kopf hin und her und meinte: "Aber das ist nicht gerecht. Du rechnest ja nur die beiden Juden-Hälften zusammen. Man kann doch genauso gut auch die beiden Menschen-Hälften, zusammenrechnen. Und dann bin ich doch ein ganzer normaler Mensch."
Aber das überzeugte Mariechen gar nicht. "Wo sind denn dann die beiden Juden-Hälften abgeblieben, hä?", fragte sie und stemmte die Fäuste in die Seite.
Darauf wusste ich keine Antwort und ließ nur traurig den Kopf hängen. Wenn ich wenigstens einen Bruder gehabt hätte, dann hätte ich sagen können: "Er ist der Jude, und ich bin der Mensch." Aber ich hatte keinen Bruder, also hatte Mariechen wohl recht, der Jude musste irgendwo in mir drin stecken.
Dann kam plötzlich ihre Mutter die Kellertreppe herunter. Als sie mich sah, ging sie wie eine Furie auf mich los und schrie: "Du Juden-Aas! Lass bloß die Marie in Ruhe!" Und dann gab sie Mariechen eine ordentliche Backpfeife.
Monate später, als ich mit meinem kleinen Koffer in der Hand und dem Rucksack auf dem Rücken das Haus verließ und zum Taxi ging, das uns zum Hafen fahren sollte, stand Mariechen am Fenster und sah mir nach. Sie lächelte, hob eine Hand und winkte mir zum Abschied. Bis plötzlich ihre Mutter von hinten kam und ihre Hand packte. Sie stieß Mariechen vom Fenster weg und zog schnell die Gardine zu.
3
Meine Mutter vertrug die Überfahrt nach Amerika nicht so gut. Das ewige Schaukeln machte ihr mehr zu schaffen als mir. Aber auch wenn die Tage ruhig waren und der Bug des Dampfers das Wasser durchpflügte, als könne ihn nichts auf der Welt aufhalten, war ihr Gesicht blass und wächsern.
Ich stromerte mit einigen anderen Kindern auf dem riesigen Schiff herum. Hin und wieder zeigte uns ein Matrose oder ein Stuart Bereiche, zu denen wir allein nicht gehen durften, weil die den Passagieren aus der 2. Klasse verboten waren. Einmal ließ uns einer sogar durch eine Luke in den mächtigen Maschinenraum gucken. Scheppernder Lärm und heiße Luft kamen aus der Klappe heraus, und es war so laut, dass ich nur ein Wort von dem verstand, was er sagte: "... Hölle ...!" Denn da unten brannten die mächtigen Kohleöfen und stampfte die gewaltige Dampfmaschine, die das Schiff vorantrieb.
Wenn ich in unsere große Kabine zurückkam, die wir mit den Edelsteins aus Aachen, den Goldmanns aus Lübeck und den Makowiz aus Prag teilten, saß Mutter nur da und starrte durch das Bullauge. Hinter dem Bullauge klatschte der Wind hin und wieder den Schaum der Wellen gegen das dicke Glas. Ich erzählte ihr, was ich alles erlebt hatte: von der Wirtschaft in der großen Küche, die hier Kombüse hieß, und von den schwarzen Männern, die den ganzen Tag Kohlen in die Öfen schaufeln mussten. Mutter nahm mich in den Arm und starrte nur weiter auf den Schaum draußen vor dem Bullauge.
*
An einem strahlenden Morgen fuhr unser Passagierdampfer in den New Yorker Hafen ein. Schon von Weitem konnte man die grüne Fackel und die Zacken um den Kopf der Freiheitsstatue sehen. Viele Leute standen an Deck und schauten gespannt auf die hohen Häuser der Stadt, und sogar das Gesicht meiner Mutter hellte sich auf.
Voller Aufregung lief ich hin und her, denn was war spannender, als ein unbekanntes Land zu betreten? Ein Land, in dem Abenteuer und ein wertvoller Schatz auf einen warteten? Die Möglichkeiten in Amerika seien gren-zen-los, hatte ich von den Leuten in unserer Kabine gehört, und jedermann könne dort sein Glück machen, wenn er gewitzt genug wäre.
Als wir das Schiff verließen, mussten wir in eine große Halle gehen. Dort saßen die Beamten vom Immigration-Office hinter schlichten Holztischen, die ganz zerkratzt waren. Meine Mutter und ich reihten uns mit unserem Gepäck in eine der Warteschlangen ein, die mit hohen Eisengittern voneinander getrennt waren. Es dauerte lange, Stück für Stück schoben wir uns vorwärts, bis wir endlich an der Reihe waren.
Mutter legte dem Beamten die Papiere auf den Tisch, und er las eine Weile konzentriert darin. Bis er lächelnd den Kopf hob und mich ansah: "Mister and Misses Roa-ssen-fels?"
"Oh", sagte meine Mutter. "No Mister. That is … Victor, my sunny."
"Sunny?", fragte der Mann und runzelte die Stirn. Nach einem Augenblick des Schweigens sagte er: "Oh! I believe, it’s your son and your sunshine." Er lachte. "But, where is your husband, Miss Anna Roa-ssen-fels?"
Mutter starrte ihn nur an. Sie konnte nicht antworten. Dann kamen die Tränen. Ich wusste, dass sie sich schämte, aber sie konnte sie nicht zurückhalten. Sie rollten ihr über die eingefallenen Wangen hinunter und hinterließen glänzende Spuren auf ihrem bebenden Kinn. Die Wartenden hinter uns begannen bereits zu murren. Ich nahm ihre Hand und drückte sie ganz fest. Meine Mutter holte tief Luft und beantwortete endlich die Frage des Beamten. "He … is come … later", sagte sie.
Der Mann nickte, und dann fragte er: "And your financially status?"
Meine Mutter verstand das nicht.
"Dollars. Money, Money, Mrs. Roa-ssen-fels", sagte er.
"Aha", sagte meine Mutter und zog ein dickes Bündel mit Reichsmark-Scheinen aus ihrer Tasche und einige Wertpapiere von General Motors - ihren Schmuck aber zeigte sie dem Mann nicht. Der Beamte fingerte nach den Geldscheinen und fächerte sie langsam mit dem Daumen auseinander, zog einen Schein heraus, hielt ihn gegen das Licht, zog einen anderen heraus, hielt in gegen das Licht. Er studierte ausgiebig die Wertpapiere, als würde er jedes einzelne Wort, das darauf stand, lesen, aber es reicht ihm nicht. Er langte zu seinem Nachbarn rüber, lieh sich von ihm eine Lupe, und wieder beugte er sich über die Wertpapiere wie ein Naturkundler, der einen seltenen Käfer untersucht. Endlich nickte er zufrieden und gab alles zurück. Die Gesundheitszeugnisse überflog er nur, und plötzlich hämmerte er einen Stempel in unsere Ausweispapiere.
Ich schulterte meinen Rucksack, nahm den kleinen Koffer in die eine, Mutter an die andere Hand, und gemeinsam betraten wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Edelsteins waren erwartet worden und hatten uns in der Wiedersehensfreude ganz vergessen, die Goldmanns und das Ehepaar Makowiz hatten wir schon auf dem Dampfer aus den Augen verloren. Wir gingen allein und ohne Freunde hinein nach Amerika. Und niemand, kein Mensch hätte uns sagen können, was uns hier erwartete. Heute weiß ich, dass damals alles möglich war. Wir hätten an einem Tag tot sein können oder steinreich.
Meine Mutter wollte die Reichsmark erst in der Stadt gegen Dollar eintauschen, denn der Kurs bei den Banken sollte viel günstiger sein als bei den Wechselstuben am Hafen. Wir verließen den Landungskai und suchten ein Taxi, das uns in die Jüdische Gemeinde von New York bringen sollte.
Tausende von Spatzen begrüßten uns. Sie flogen zwitschernd in einer dichten Wolke über unsere Köpfe hinweg und hinein zwischen die sich hoch in den Himmel reckenden, riesigen Gebäude. Mit offen stehendem Mund schaute ich ihnen hinterher, als sie zwischen den gewaltigen Häuserschluchten verschwanden.
Auf einem großen Parkplatz standen eine Unmenge gelber Taxis. Einer der Chauffeure kam uns grinsend entgegen und sagte gedehnt: "Welcome to Amerika!" Dann nahm er uns auch schon die Koffer ab und verstaute sie in seinem Wagen. Er schob keck die Mütze nach hinten und hielt Mutter die Tür auf. Bei all dem kaute er ständig auf etwas herum.
Hier gab es viele Autos, viel mehr als bei uns in Hamburg. Große schwarze Karossen, grüne Transportautos, dreckige Lastwagen und Taxis, die schnell auf den mehrspurigen Straßen dahinfuhren. Nur in den schmaleren Seitenstraßen konnte ich ab und zu noch ein Pferdefuhrwerk entdecken. Was mich aber wirklich wunderte: Es gab überhaupt keine Fachwerkhäuser. Nur große dunkle Gebäude aus Backsteinen mit einem Gewirre von eisernen Treppen an den Seiten.
Auf den Gehwegen links und rechts der Straße herrschte die reinste Völkerwanderung. Ich sah groß gewachsene schwarze Menschen, die ununterbrochen auf etwas herumkauten, und ich sah kleine dicke Menschen mit runden Gesichtern und zusammengekniffenen Augen. Mutter saß vorn, und ich fragte sie, was das für Menschen sind.
"Das sind Chinesen", sagte sie und wendete sich wieder dem Fahrer zu, der ununterbrochen redete. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Chinesen gesehen, und ich drückte mir an der Fensterscheibe die Nase platt, bis der Wagen plötzlich rechts ran fuhr und anhielt.
Der Chauffeur begann fürchterlich zu schimpfen. Immer wieder hob er die Hände und schlug sie auf das Lenkrad. Mutter sagte leise etwas, nahm einen Zehn- Reichsmark-Schein aus ihrer Handtasche und hielt ihn dem Fahrer hin. Aber der stieg wütend aus, rief: "No Reiksmakk! No Reiksmakk!", nahm unser Gepäck aus dem Kofferraum und stellte es mitten auf die Straße. Ehe ich noch richtig begriff, um was es überhaupt ging, stand auch ich selbst auf der Straße. Das Taxi brauste davon, hinter mir dröhnte die Hupe eines Lastwagens, und Mutter zog mich schnell auf den Gehweg.
Da standen wir nun mit unseren Koffern mitten in New York ohne die geringste Ahnung, wo in dieser riesigen Stadt wir uns befanden. In ihrem gebrochenen Englisch fragte meine Mutter die Leute nach dem Weg zur Jüdischen Gemeinde. Anfangs hatte sie auch Erfolg damit, aber je weiter der Tag fortschritt, desto weniger schien die Richtung zu stimmen, in welche die angesprochenen Passanten uns schickten. Und als es zu dämmern begann, standen wir zum zweiten Mal an ein und derselben Kreuzung.
Mutter konnte kaum noch laufen und war den Tränen nahe. Wir setzten uns erschöpft auf eine Bank am Rande eines kleinen Parks. Schon kam ein Mann grinsend und mit mahlendem Kiefer auf uns zu. Er fragte, woher wir kämen und zeigte auf die Koffer. Denn daran und an unserer Kleidung hatte er natürlich sofort erkannt, dass wir neu in der Stadt waren. Jeder konnte sehen, dass wir hier neu waren. Die Koffer sagten ihnen: Hier sind Greenhorns. Frisch angekommen. Sie beherrschen weder die Sprache noch die Sitten des Landes. Man sollte sie ausnehmen, bevor es ein anderer tut.
Sofort griff er nach dem großen Koffer. Aber Mutter hielt ihn so fest, als sei er an ihr festgeschweißt, und wurde von der Bank hoch gerissen. Sie fing an zu schreien, aber es kümmerte niemanden. Der Mann zerrte an dem Koffer, meine Mutter hielt ihn fest - und ich dachte nur: Du musst was tun, sonst ist der Koffer weg! Und schon sprang ich auf. Ich schrie wie am Spieß, rannte einfach auf ihn zu und schubste ihn zur Seite. Ich hatte den Räuber überrascht, denn er geriet ins Wanken und musste den Koffer loslassen, sonst wäre er gestürzt. Mutter stieß im gleichen Augenblick das schwere Gepäckstück mit einem kräftigen Ruck nach vorn und die eisenbeschlagene Ecke des Koffers traf den Mann mit solcher Wucht auf die Kniescheibe, dass er vor Schmerzen aufschrie und endlich stöhnend davon humpelte. Mit so viel Gegenwehr von den Greenhorns hatte er wohl nicht gerechnet.
Auch wir wollten so schnell wie möglich weg von hier und wieder in eine belebtere Gegend gehen, aber als Mutter nach ihrer Handtasche griff, die sie auf die Bank gestellt hatte, fasste sie ins Leere. Im trüben Licht der Dämmerung sahen wir eine Frau durch den Park davonlaufen.
Das war das Ende. So schnell war es über uns hereingebrochen, dass ich es erst gar nicht begriff. Meine Mutter hatte nur die Ausweispapiere in ihrer Manteltasche verstaut. In der Handtasche aber hatte unsere ganze Zukunft hier in Amerika gesteckt, das Geld, die Wertpapiere und die goldenen Ringe und edelsteinbesetzten Halsketten, die zum Teil noch von ihrer Mutter Lieselore Morgenroth stammten. Mutter rang nach Luft, taumelte und ließ sich weinend wieder auf die Bank niedersinken.
Es war dunkel geworden, und es hatte zu regnen begonnen. Ich führte Mutter an der Hand unter einen vorspringenden Treppenaufgang, wo es trocken war. Sie setzte sich zitternd auf den Koffer und lehnte mit einem leeren Blick ihren Kopf an die Wand. Ich legte meinen Kopf in ihren Schoß, und trotz meiner Angst, dem Hunger und der Kälte schlief ich vor lauter Erschöpfung irgendwann ein.
Am nächsten Morgen weckte uns früh ein heiterer Sonnenstrahl. Wir wussten nicht, wo wir waren. Einer Bäckerei entströmte ein Duft – ich bin fast ohnmächtig geworden davon.
"Victor, wir müssen jetzt tapfer sein, und sehr, sehr stark", sagte Mutter mehr zu sich selbst als zu mir. Voller Tatendrang nahm sie den Koffer in die Hand, aber schon die ersten Schritte ließen sie straucheln. Von der gestrigen Wanderschaft hatte sie Blasen an den Füßen und die taten ihr wohl ziemlich weh, so dass wir nur ganz langsam voran kamen. Die Straßen waren schon recht belebt, aber niemand kümmerte sich um uns, die beiden humpelnden Neuankömmlinge, die hungrig und ohne zu wissen, wo sie eigentlich waren, einfach immer nur geradeaus gingen.
Endlich sahen wir an einer großen Kreuzung einen Polizisten stehen. Ein großer, älterer Mann in einer dunklen, feschen Uniform und mit einer zackigen Schirmmütze auf dem Kopf. Er guckte etwas mürrisch, als Mutter versuchte, ihre Frage nach dem Weg zur Jüdischen Gemeinde so fehlerfrei wie möglich zu formulieren. Bis der Polizist sie mit einem breiten Lachen unterbrach, das seine blendenden, weißen Zähne sehen ließ. Seine Eltern stammten aus Deutschland. Ein paar Brocken Deutsch konnte er noch. Das war unser Glück.
Er erklärte uns den Weg ganz genau und zeichnete ihn sogar auf ein Blatt in sein Notizbuch. Auf die Rückseite malte er den Weg zu dem Viertel, das einmal Little Germany geheißen hatte, in dem aber immer noch viele Deutsche wohnten. Als er fertig war, riss er die Seite heraus und gab sie Mutter. Wegen des Diebstahls der Handtasche gab er ihr den Rat, eine Anzeige zu erstatten, vielleicht fände sich das eine oder andere Schmuckstück ja wieder an, aber zu große Hoffnungen dürfe sie sich nicht machen. Es gäbe einfach zu viele Halunken in der Stadt: Neger, Polen und Iren, Mexikaner und Chinesen, Russen. "Ach, die ganze Mischpoke eben", stöhnte er. Ich war froh, dass er wenigstens uns mochte.
Zum Abschied gab er Mutter zwei Nickel, das waren zehn Cent. "For Fruhstuck", sagte er, reichte erst mir und dann Mutter die Hand und tippte an seine Mütze.
In der nächsten Bäckerei verwandelte Mutter das Geld in Brot und Milch. Gestärkt machten wir uns auf, und folgten der Wegbeschreibung des Polizisten. Eigentlich war es ganz einfach: an der vierten großen Kreuzung rechts abbiegen, nach der dritten links und dann immer geradeaus. Aber es dauerte bis weit nach Mittag, ehe wir das Haus der Jüdischen Gemeinde vor uns sahen - denn New York ist wirklich eine ziemlich große Stadt.
4
In der Empfangshalle des jüdischen Zentrums hing unter einem riesigen Davidstern eine Tafel und begrüßte die Eintretenden in allen Sprachen der Welt. Das Büro der Sozialstelle war gerade nicht besetzt. Ein junger Mann, dessen Kiefer beständig mahlte, als würde er einen endlosen Sahnebonbon zerkauen, bedeutete uns zu warten. "Lunchtime", sagte er schmatzend.
Ich schaute ihn an und fragte: "Kauen hier alle Leute Sahnebonbons?"
Er verstand natürlich meine Frage nicht. Also zeigte ich mit dem Finger auf seinen Mund, ahmte übertrieben die Kaubewegungen nach und sagte wieder: "Bonbon?"
Der junge Mann lachte so sehr, dass ihm fast die Kippa vom Hinterkopf gerutscht wäre.