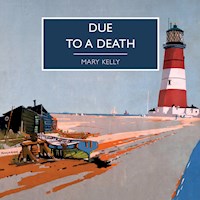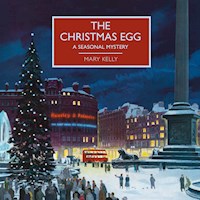Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kalifornien: Der Anhalter Jessy Johnson macht eine zufällige Bekanntschaft mit fünf Studenten. Fernab jeglicher Zivilisation möchten die jungen Leute ein Wochenende in der Ruine einer christlichen Mission verbringen. Ausgelassen und in Partylaune laden sie Jessy dazu ein. Doch schon am nächsten Tag bereut dieser seine Entscheidung. Was wie ein unerwartetes Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einem wahren Albtraum, denn am nächsten Morgen sind die Autoreifen zerstochen und eine Person aus der Gruppe wird vermisst. Nur wenig später taucht die übel zugerichtete Leiche des Verschwundenen auf und es wird schnell klar, dass ein Mörder sein Unwesen in der Ruine treibt. Ein nervenzerreißender Katz - und Maus-Spiel beginnt und der Verdacht erhärtet sich, dass einer von ihnen der Mörder ist...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Kalifornien: Der Anhalter Jessy Johnson macht eine zufällige Bekanntschaft mit fünf Studenten. Fernab jeglicher Zivilisation möchten die jungen Leute ein Wochenende in der Ruine einer christlichen Mission verbringen. Ausgelassen und in Partylaune laden sie Jessy dazu ein. Doch schon am nächsten Tag bereut dieser seine Entscheidung. Was wie ein unerwartetes Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einem wahren Albtraum, denn am nächsten Morgen sind die Autoreifen zerstochen und eine Person aus der Gruppe wird vermisst. Nur wenig später taucht die übel zugerichtete Leiche des Verschwundenen auf und es wird schnell klar, dass ein Mörder sein Unwesen in der Ruine treibt. Ein nervenzerreißendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt und der Verdacht erhärtet sich, dass einer von ihnen der Mörder ist...
Mary Kelly
Der Anhalter
Thriller
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2017 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2017 by Mary Kelly
Die Originalausgabe erschien unter dem Namen Julienne Christofferson
Lektorat: Philipp Bobrowski
Korrektorat: Martha Wilhelm
Dieses Werk wurde vermittelt durch die ABC.
Covergestaltung: Marie Wölk, Wolkenart
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-052-5
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Thoughts in time and out of seasonThe HitchhikerStood by the side of the roadAnd leveled his thumbIn the calm calculus of reason
Jim Morrison, The Hitchhiker
Vorwort
Hi.
Ich bin Jessy Johnson und das ist meine Geschichte. Ja, ich bin mir durchaus im Klaren, dass der Anfang nicht besonders einfallsreich ist. Doch das hier ist das erste Buch, das ich schreibe. Und es fällt mir nicht gerade leicht. Die Leute haben immer was zu furzen, und man muss aufpassen, was man schreibt.
Trotzdem will ich meine Geschichte aufschreiben. Denn es ist eine außergewöhnliche Geschichte.
Am besten fange ich einfach mal an.
Folgendes geschah im Sommer 1995: Ein kaltblütiger Mörder hatte es auf eine Gruppe Collegestudenten abgesehen. Klingt wie die Story aus einem Horrorfilm, sagen Sie. Nein, es war noch viel schlimmer als in einem Horrorstreifen. Aber es klingt tatsächlich wie eine Story aus einem Film. Und zwar wie aus einem dieser Splatterfilme: Böser Bube jagt gute Buben mit einem Messer, einer Kettensäge oder sonstigen scharfen Gegenständen.
Eine Gruppe befreundeter Studenten aus San Diego wollte in diesem besagten Sommer nichts anderes als ein bisschen Spaß haben. Sie verstehen schon; sich sinnlos besaufen, Marihuana konsumieren und den fleischlichen Gelüsten frönen. Die Gruppe machte einen Wochenendausflug in die Wüste in eine abgelegene Ruine einer alten, christlichen Mission. Sicherlich kennen Sie diese spanischen Missionen aus alten Westernfilmen. Die sollten einen Zufluchtsort für die vertriebenen und vom Aussterben bedrohten indianischen Stämme bieten, doch im Grunde dienten sie nur dazu, die Indianer zu bekehren. Nachdem man sie christianisiert hatte, brachte man ihnen ein paar handwerkliche Fertigkeiten bei und gab ihnen schließlich ein kleines Stück Land. Sie sollten christliche Bauern oder Landarbeiter werden, doch eigentlich wurden sie nur zu billigen Arbeitskräften. Diese Institutionen beherbergten Priester, Nonnen und einen Haufen Mexikaner. Kleine, schmutzige, dunkelhäutige Kinder liefen mit einer Bibel durch die Gegend. Mexikanische Nutten, die zu Nonnen bekehrt wurden.
Ich nehme an, dass diese eine Ruine ein Zeugnis davon war. Sie lag abgelegen, vereinsamt und war ein echter Insidertipp.
Doch dieser Insidertipp sollte für die Studenten zu einer tödlichen Falle werden. Sie liefen einem Killer direkt in die Arme. Einem Killer, der Spaß daran hatte, mit ihnen zu spielen. Der erst dann aus seinem Versteck herauskroch, als keiner mit ihm rechnete. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, sich vor einem unsichtbaren Killer zu schützen. Vor allem, wenn er alle Ihre Schritte erahnen kann. Wenn er Ihnen stets zuvorkommt, wenn er da ist, bevor Sie da sind.
Kennen Sie das Gefühl? Sie sind allein im Raum, glauben aber, es wäre noch jemand da. Sei es ein kalter Lufthauch oder ein Luftzug, der Ihnen diesen Eindruck vermittelt. Ein mulmiges Gefühl überkommt Sie. Sie verspüren ein Kribbeln im Nacken. Sie drehen sich ganz langsam um. Es könnte ja sein, dass Ihnen jemand in diesem Augenblick eine Kanone an den Kopf hält oder ein Messer an die Kehle. Doch da ist niemand. Sie lächeln daraufhin in sich hinein. Atmen erleichtert aus, vielleicht lachen Sie sogar laut auf. Nein, natürlich ist da niemand. Wieso auch. Die Türen und Fenster sind verschlossen. Sie sind sicher in Ihren eigenen vier Wänden.
Jetzt stellen Sie sich diese Situation noch einmal vor. Sie allein im Raum. Ein Lufthauch. Ein kalter Atem. Eine Intuition. Ein Kribbeln im Nacken. Sie drehen sich ganz langsam um und blicken geradewegs in eine Fratze. In zwei kalte Augen. Sie sehen ein kaltblütiges Lächeln. Eine erbarmungslose Entschlossenheit. Und nein, da ist keine Kanone an Ihrem Kopf. Es ist ein Messer, das Ihnen an die Kehle gehalten wird. Bevor Sie den Mund aufmachen können, um eine Frage zu stellen, ist das Messer mit einem kurzen Ruck von Ihrer Kehle verschwunden. Es ist blutig. Das Letzte, was Sie dann sehen, ist Ihr eigenes Blut.
So ähnlich war es in der alten Ruine. Es war ein Spiel. Ein Spiel auf Leben und Tod. Und es war ein sehr schnelles, kurzes Spiel. So schnell wie das blutige Messer. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war dabei. Das kaltblütige Lächeln war auf mich gerichtet. Manchmal sehe ich es immer noch, und ich denke, dass dieses Bild nie verblassen wird.
Ihr Jessy Johnson
1.
Es war nur ein Zufall, dass ich der Gruppe begegnet bin. Nennen wir es Schicksal, Fügung, höhere Gewalt oder Verkettung von Zufällen. Wir alle waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, und es war auch nur ein Glücksfall, dass wir uns alle auf Anhieb so gut verstanden. Sie waren in meinem Alter, in Partylaune und bekifft. Sie machten einen Abstecher in die Wüste. Das nannten sie einen Wochenendausflug anderer Art. In gewisser Weise retteten sie mir dadurch das Leben, zumindest aber befreiten sie mich aus einer misslichen Lage. Sie nahmen mich mit, als ich in der kalifornischen Wüste feststeckte.
Und ich kann eins sagen: Das war kein Zuckerschlecken. Es war heiß und glühend. Meine Augen tränten, meine Kehle war ausgetrocknet, meine Haut gerötet und der Staub blähte meine Lungen auf. Ich musste husten, husten wie ein Irrer. Das einzige schattige Plätzchen, das ich noch bis vor Kurzem nutzen konnte, war der Sonne gewichen. Der Schattenspender war ein rostfarbener Fels gewesen, groß und schmal. Unter diesem hatte ich gesessen und auf das nächste Auto gewartet. Das Dumme war nur, dass seit einer Ewigkeit kein Auto mehr vorbeigekommen war. Und eine Ewigkeit kann in einer Wüste zur reinsten Hölle werden. Sekunden vergingen, Minuten vergingen, Stunden vergingen und mit jedem Atemzug wurde die Hitze unerträglicher. Zu allem Überfluss ging mir langsam das Wasser aus. Wassernot in einer Wüste kann ziemlich schnell tödlich enden. Es verhält sich nämlich so: Ab einem Wasserverlust von 0,5 bis drei Prozent spürt man Durst. Ab zehn Prozent kommt es zu Sprachstörungen und unsicherem Gang. Innerhalb von drei bis vier Tagen rafft es einen dahin. Diese Zeitspanne ist aber natürlich temperaturabhängig. In der Wüste kann man schon innerhalb eines Tages verdursten. Keine guten Aussichten also. Echt beschissene Aussichten, wenn ich es so primitiv ausdrücken darf.
Um den Grund zu nennen, wieso ich überhaupt in der Wüste feststeckte, muss ich auf vorherige Ereignisse zurückgreifen. Das werde ich auch tun, denn sie sind in diesem Fall sehr bedeutend. In dem besagten Sommer fuhr ich als Anhalter nach L.A. Ich war einundzwanzig Jahre alt. Eigentlich ging ich nur nach L.A., weil ich mich dort als Schauspieler versuchen wollte. Ich dachte, ich könnte eine Rolle in einer Soap ergattern und in einer Serie wie zum Beispiel „Beverly Hills 90210“ spielen, neben Jason Priestley und Luke Perry. Das wäre doch was. In Hollywood ganz groß rauskommen. Einen Haufen Kohle verdienen, verstehen Sie?
Ja, ich weiß, das klingt ziemlich naiv. Doch zu jener Zeit war es mir todernst damit. Sogar das College hatte ich dafür aufgegeben. Der Grund für diesen ganzen Umschwung war der, dass ich nur kurz zuvor dem Tod von der Schippe gesprungen war. Um genauer zu sein: Mich wollte jemand töten. Ich wusste auch wer, doch ich wusste nicht warum. Aber dazu später. So weit will ich noch nicht ausholen.
Um es klar auszudrücken; ich hatte ein ganzes Jahr verloren. In meinem Fall hieß es, dass mein zweites College-Jahr vollkommen ausgelöscht war. Ich wusste also nicht, was ich in diesem Jahr getrieben hatte und auch nicht mit wem.
Nur eine riesige Wunde an meiner rechten Schläfe erinnert mich an das Drama. Ein ganzes Jahr hatte ich verloren. Das Einzige, an das ich mich bewusst erinnern konnte, war das Krankenhaus. Mein Körper war an unzählige lebenserhaltende Maschinen angeschlossen gewesen. Unter großer Anstrengung piepsten und surrten sie, als wollten sie alles geben, um den letzten Lebensfunken zu erhalten, der noch in mir steckte.
Meine Mutter wachte täglich an meinem Bett. Als ich aus dem Koma aufwachte, schaute sie mich an, als sei ich Jesus, der gerade von den Toten auferstanden war. Im Prinzip war ich das auch. Ich hatte einige Wochen im Koma gelegen. Aus diesem Koma hätte ich eigentlich nicht mehr erwachen sollen, aber nur, wenn es nach den Ärzten gegangen wäre. Diese hatten mich schon längst abgeschrieben, dennoch war ich aufgewacht. Und nicht nur das; mir ging es relativ gut, den Umständen entsprechend. Von der Amnesie abgesehen, war ich wirklich gut drauf. Ich meine damit, dass ich zu keinem Pflegefall wurde. Ich musste nicht gefüttert werden, und Windeln musste mir auch keiner wechseln.
Doch eine Sache war mir geblieben. Seit dem Unfall litt ich von Zeit zu Zeit unter gemeinen Kopfschmerzen. Erst fing es als Pochen in der Schläfe an (an dieser Stelle habe ich diese riesige Narbe, ich versteckte sie damals aber immer ganz geschickt unter meinen Haaren). Im Prinzip schien das Pochen ganz harmlos, doch kurz darauf wurde das Pulsieren schlagartig wild. Ein gewaltiger Schmerz hämmerte gegen meine Schädeldecke. Schwarze Punkte tanzten dabei vor meinen Augen und die Welt um mich herum verschwamm. Migränegeplagte kennen diesen Zustand sicherlich nur zu gut, nur dass mein Zustand zehnmal schlimmer war.
Für wirklich schlimme Schmerznotfälle hatte ich ein paar Wunderpillen dabei. Ein sehr starkes Schmerzmittel, das ich aus dem Krankenhaus hatte (ehrlich gesagt hatte ich drei Schachteln aus dem Hospital einfach mitgehen lassen). Der Nachteil meiner Wunderpillen war nur der, dass man von diesen Dingern unheimlich müde wurde. Nicht für jede Gelegenheit zu empfehlen.
Nach dieser ganzen Geschichte beschloss ich, ein neues Leben anzufangen. Im Prinzip war mir ja ein neues Leben geschenkt worden. Eine Art Wiedergeburt. Jemand da oben hatte gesagt: „Er soll leben!“ Dann war mir eine Hand auf meine kalte Stirn aufgelegt worden, und ich lebte.
Eigentlich hatte ich schon immer von der Schauspielerei geträumt. Ich sah gut aus und hatte in der Schule Theater gespielt. Natürlich sollte das nicht heißen, dass ich jetzt ein toller Schauspieler werden würde. Viele Leute sehen gut aus, haben in der Schule Theater gespielt und sind trotzdem keine Schauspieler (oder sie sind Schauspier, aber keine guten). Meine Eltern wollten jedoch, dass ich das College besuche, und meinen Eltern widersprach man nicht. Sie wollten, dass aus mir ein zweiter Einstein wird. Toll, ganz toll. Jetzt litt ich unter Amnesie und meine Kopfschmerzen trieben mich zum Wahnsinn. Das alles wäre nicht passiert, hätte ich auf mein Gefühl gehört.
So viel dazu, wieso ich überhaupt unterwegs war. So viel zu meinem alten Leben.
Mein neues Leben fing mit der Reise nach L.A. an.
Ich stieg also von einem Auto ins andere und streckte stundenlang meinen Daumen raus. Manche Fahrer hielten an und manche nicht. Aber als Anhalter darf man sich nun mal nicht beklagen. Es war ja nicht grade so, als hätte ich eine Reise gebucht. Nein. Man streckte einfach den Daumen raus und hoffte, dass jemand anhält. Ich glaube, die Fahrer sind im Allgemeinen etwas vorsichtiger geworden. Bei den ganzen Verrückten, die sich auf der Welt tummeln, ist das nicht weiter verwunderlich. Die Hälfte davon fährt per Anhalter.
Doch in manchem Auto sitzt schon mal ein Durchgeknallter hinter dem Lenkrad. Meine letzte Mitfahrgelegenheit war so einer. Tja, und genau aus diesem Auto musste ich fliehen. Klingt dramatisch? War es auch. Mehr dazu jetzt. Das war nämlich der Grund, wieso ich in der Wüste gelandet war.
Der letzte Fahrer war ein fetter, übel riechender Klops gewesen. Er passte kaum hinter das Lenkrad. Schwitzte so stark, dass ihm der Schweiß flutartig über den Körper rann. Zudem stank er nach kaltem Rauch, Talg und nach … Urin. Ich weiß ja nicht, wann er das letzte Mal die Unterhose gewechselt hatte, aber es musste schon sehr lange her gewesen sein.
Na ja, man darf sich als Anhalter ja nicht allzu viel beklagen. Das erwähnte ich bereits. Ich war froh, dass überhaupt jemand angehalten hatte. Er stimmte zu, mich die nächsten hundert Meilen mitzunehmen (ich konnte leider nicht ahnen, dass die nächsten hundert Meilen durch die Wüste führten). Während der Fahrt unterhielten wir uns ziemlich sporadisch. Im Grunde waren es wirklich belanglose Sachen. Das meiste davon habe ich wieder vergessen. Nach etwa fünfundfünfzig Meilen passierte es dann. Ich glaube, er hatte nur gewartet, bis wir weiter in der Wüste waren, damit ich nicht auf die Idee kam, aus dem Auto zu fliehen (genau in diesem Punkt hatte er sich geirrt).
Er drehte sich plötzlich zu mir um und fragte, ob ich ihm einen Gefallen tun würde. Seine Augen blitzten dabei glasig auf und auf seiner Stirn hatte sich noch mehr Schweiß gebildet.
Eigentlich hätten in diesem Augenblick bei mir die Alarmglocken läuten sollen, doch sie taten es nicht. „Was für ein Gefallen soll es denn sein?“, fragte ich interessiert. Na ja, ich hatte schon bei meiner ersten Mitfahrgelegenheit erlebt, dass mich der Fahrer um einen Gefallen bat. Es war eine Art Tilgung für die Fahrt gewesen. Ich sollte ihm die Koffer ins Motel tragen, da er irgendetwas mit dem Rücken hatte. Das tat ich dann natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken.
Doch diese Gefälligkeit überschritt meine kühnste Fantasie (und ich besitze wirklich eine sehr rege Fantasie). Der fette Klops grinste. Es war ein fettes, breites Grinsen. Er hatte plötzlich ein echt komisches Grinsen drauf. Wenn Spinnen lächeln könnten, würden sie ihre Beute haargenau so angrinsen. „Mir fallen sehr viele Sachen ein, die du für mich tun könntest.“
Seine fette Pranke lag plötzlich auf meinem Knie, und ich zuckte zusammen. In dieser Sekunde konnte ich mich nicht rühren. Nicht atmen. Nicht zwinkern.
Unterdessen sprach der Fettklops weiter, als wäre es das Normalste der Welt, dass ein Mann einem anderen Mann die Hand aufs Knie legt. „In etwa fünfzig Meilen kommt ein kleines Motel. In diesem Motel könnten wir beide sehr, sehr nett zueinander sein. Was meinst du, willst du nett zu mir sein?“, raunte er belegt. Nein, ich muss mich korrigieren. Er raunte nicht belegt, sondern erregt.
„Das verstehe ich nicht ganz“, sagte ich.
Nun wanderte seine fette Pranke höher an meinem Bein entlang. Er hatte schon fast meine Eier berührt, da hielt er inne. „Du hast einen süßen Arsch. Ich mag süße Ärsche“, brummte er.
Schweißtropfen bildeten sich auf meiner Stirn. Ich sah nur dieses Grinsen. Seinen Blick. Gelbe Zähne, die hinter zwei dicken Lippen hervorkrochen, die Zunge, die sich langsam auf seinen Lippen hin und her bewegte.
Ich weiß nur noch, wie ich zur Tür griff, sie öffnete und, ohne zu überlegen, hinaus auf die Straße sprang. Verdammt. Während ich über die Straße rollte, schrie der Fette irgendetwas hinterher und hielt dabei seinen Mittelfinger raus. Kurz danach kam meine Tasche angeflogen und landete mit einem lauten Knall ein paar Meter neben mir. Das Knie hatte ich mir geschrammt und die Jeans war an der Stelle hin.
So viel zu der Geschichte. Sie war ziemlich kurz, aber dennoch schmerzhaft. Vielmehr hätte sie ziemlich schmerzhaft werden können. Mein Arsch war noch ziemlich jungfräulich, und das sollte er auch bleiben.
Irgendwann, nach Stunden langen Wartens, blieb ein alter Oldsmobile Toronado stehen. Zuerst hielt ich es für eine Art Fata Morgana. Wissen Sie, es ist nämlich so; wenn man stundenlang in die Ferne starrt, sieht man schon mal seltsame Sachen. Schatten werden plötzlich lebendig, Felsen schwingen im Wind, der Sand verwandelt sich in ein Meer. Es ist aber nur der heiße Atem der Wüste, der einem einen Streich spielt. Nur der verflixte heiße Atem.
Doch diesmal war es kein Trugbild. Als der Motor aufheulte, sich die Tür öffnete und laute Rockmusik ertönte, begriff ich, dass es keine Einbildung war. Ich schnappte mir meine Tasche, klopfte mir den Sand von meiner Kleidung ab und eilte sofort hin.
Das Auto gehörte fünf Collegestudenten. Drei dieser Studenten waren heiße, gut gebaute Bräute. Eine Blondine, eine dunkelhaarige Gruftibraut und eine Rothaarige saßen auf der Rückbank. Halleluja.
Ich spähte hinein und wurde sogleich mit einem fröhlichen „Hallo“ begrüßt. Ich nahm jedoch stark an, dass dieses fröhliche „Hallo“ etwas mit dem mächtigen Marihuanageruch zu tun hatte, der die Luft im Inneren verpestete.
„Wohin soll’s gehen?“, fragte mich der Fahrer. Ein muskelbepackter Latino. Hatte etwas Ähnlichkeit mit Brian Austin Green. Ich nahm stark an, dass er ein Footballspieler war. Er sah auf jeden Fall wie einer aus. Groß, muskulös und gebräunt. An meinem College gab es genug solcher Typen. Sie waren allesamt eingebildet und arrogant. Doch die Frauen lagen genau solchen Typen zu Füßen. So ist es nun mal. Die bösen, starken Jungs sind immer sehr begehrt bei den Mädchen.
„Na ja, zuallererst raus aus der Wüste“, antwortete ich ganz freundlich.
„Ja, du siehst so aus, als ob du schon länger auf ein Auto warten würdest.“ Diesmal sprach der Beifahrer. Er war klein und schmächtig. Er hatte sein offensichtlich blondiertes Haar hochgegelt. Und er sah ziemlich seltsam aus. Im Vergleich zu dem Autofahrer war er ein abgebrochener Zwerg. Also, er war sicherlich kein Footballspieler.
Ich brauchte nicht in den Spiegel zu schauen, um zu wissen, was er mit seiner Bemerkung gemeint hatte. Ich war voller Sand, auf meiner Nase und meinen Wangen hatte ich Sonnenbrand. Um das Ganze abzurunden, hatten sich auch noch unter den Achseln, im Brustbereich und auf dem Rücken tellergroße Schweißflecke gebildet.
Auf dem Rücksitz wurde währenddessen gekichert. Dieses Gekicher hatte sicherlich auch etwas mit dem penetranten Marihuanageruch zu tun. Das erkannte ich an der Art, wie die Mädels ihre Köpfe nach hinten warfen. Ich habe genug vollgedröhnte Menschen in meinem Leben gesehen. In diesem Zustand zeigen sie eine bestimmte Art, sich zu bewegen, zu gestikulieren, zu lachen und zu sprechen.
Ich will erwähnen, dass ich Drogen verabscheue. Ich habe genug Erfahrung damit gemacht. Nein, ich gehöre nicht zu den Leuten, die nie ein Gramm Marihuana geraucht haben, aber trotzdem überzeugte Gegner davon sind. Leute, die niemals ein Gläschen Alkohol angerührt haben, aber die totalen Alkoholgegner sind. Ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß ja letztendlich, wovon ich rede. Im Krankenhaus war ich andauernd mit irgendwelchen Schmerzmitteln und Schlaftabletten vollgepumpt worden. Im Prinzip war ich wochenlang stoned gewesen.
„Ich denke, wir sollten dich mitnehmen. Es wird zwar eng, aber ich kann dich nicht hier in der Wüste stehen lassen“, meinte der Fahrer und nickte dem Beifahrer zu. „Terenzi, du gehst nach hinten zu den Mädels. Quetsch dich irgendwie dazwischen.“
Ich muss zugeben, ich war etwas enttäuscht. Eigentlich wollte ich ja zu den Mädels nach hinten. Aber nun gut. Als Anhalter darf man sich ja nicht allzu viel beklagen. Das erwähne ich immer wieder gern. Oder vielmehr halte ich es mir immer vor Augen. Ich könnte sicherlich über den Autospiegel immer wieder nach hinten schielen, um mir die Mädels genau anzuschauen. Wenn Sie verstehen, was ich meine (ich kann nur sagen, dass ich mich kaum an die Augenfarben der Mädels erinnern kann, aber ich kann Ihnen sagen, welche Körbchengröße sie hatten).
Ich war wirklich froh, dass die mich auflasen. Wer weiß, wann das nächste Auto vorbeigekommen wäre. Das schmale Hemd quetschte sich also zwischen die Mädels und ich war nun der neue Beifahrer.
„Ich bin übrigens Illinois. Terenzi hat dir ja gerade Platz gemacht. Die hübschen Dinger da hinten sind Madison, Kendra und Lucy“, plapperte der Fahrer drauflos, kaum dass er den Wagen gestartet hatte.
Ich nickte freundlich und erwiderte: „Ich bin Jessy. Illinois, ist das dein richtiger Name?“
Illinois zuckte mit den Schultern. „Nö, ich komme bloß aus Illinois, und irgendwie hat es sich auf dem College eingebürgert, mich Illinois zu nennen. Wir sind alle auf demselben College, weißt du.“
Hinten ertönte wieder Gekicher. Madison, Kendra und Lucy schienen sich prächtig zu amüsieren.
Zum allgemeinen Verständnis möchte ich erst einmal erklären, welcher Name zu welcher Señorita gehörte.
Lucy war die Rothaarige. Und zwar war sie eine echte Rothaarige. Am Rücken und an den Armen hatte sie Sommersprossen. Aber es waren sehr süße Sommersprossen. Sie verunstalteten Lucy in keiner Weise. Sie war sehr hübsch. Ihre Haut war sehr hell und zart. Am liebsten hätte ich sie auf der Stelle gestreichelt und vielleicht sogar geküsst, aber ich glaube, das hätte keinen guten Eindruck hinterlassen. Lucy war klein und zierlich. Gerade mal 1,63 Meter groß, schätzte ich. Sie hatte einen Schmollmund und eine schmale längliche Nase. An die Augenfarbe kann ich mich leider nicht erinnern. Sie trug ein kurzes grünes Kleid, unter dem sich ihre kleinen Brüste abzeichneten. Sie hatte einen halblangen Pagenschnitt und ihre Haare glänzten lebendig im Licht. Lucy war, wie ich später erfuhr, ein wohlbehütetes Mädchen. Sie kam aus einem guten Haus. Ihr Vater hatte irgendetwas mit dem Senat zu tun. So ganz genau habe ich es mir aber nicht gemerkt. Auf jeden Fall waren ihre Eltern steinreich, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Madison war die Dunkelhaarige in dem Grufti-Outfit. Sie hatte lange, glatte Haare wie die Sängerin Cher. Nur dass Madison mir besser gefiel als Cher. Sie war äußerst hübsch. Ich fand sie auf Anhieb toll. Madison hatte eine unglaubliche Oberweite, die ihr schwarzes, tief ausgeschnittenes Top fast sprengte. Ich musste mich beherrschen, nicht andauernd auf ihre Brüste zu starren. Und ich muss sagen, dass es mir verdammt schwerfiel. Madison war meiner Meinung nach etwas zu stark geschminkt. Ihre Lider waren übertrieben schwarz angemalt und die Lippen dunkelrot. Aber die Oberweite interessierte mich sowieso mehr. Sie trug enge Hüftlederhosen, was mich bei dieser Hitze sehr erstaunte. Aber vielleicht liebte sie es ja, stark zu schwitzen. Bei dem Gedanken an ihre blasse, verschwitzte Haut bekam ich eine Erektion. So viel zu Madison.
Kendra war die Blonde. Die Farbe war nicht echt. Ein dunkler Ansatz sprang mir sofort ins Auge. Kendra trug ein rosafarbenes Top mit dazu passenden Hotpants. Ihre schlanken, gebräunten Beine nahmen kein Ende. Kendra gehörte meiner Meinung nach in den Playboy und nicht in ein College. Sie war eine echte Cheerleaderin. Nur etwas später erfuhr ich, dass sie mit Illinois zusammen war. Aber wen wundert es, solche Mädchen waren immer mit einem Footballspieler zusammen.
Was mich jedoch am meisten an dieser ganzen Zusammensetzung wunderte, war Madison. Verstehen Sie mich nicht falsch; sie war wirklich süß und ich mochte sie von Anfang an, aber auf meinem College gaben sich Mädchen wie Kendra und Lucy nicht mit einem Mädchen wie Madison ab. Es war ein ungeschriebenes Gesetz. So etwas wie ein Ehrenkodex. Auf der einen Seite waren da die wohlbehüteten, kleinen Engel und auf der anderen Seite die Badgirls, die aus der Reihe tanzten. Und beides funktionierte nicht zusammen. So war das eben.
„Wo soll ich dich absetzen?“, fragte Illinois und holte mich aus meinen Gedanken.
Ich starrte gerade auf Madisons Brüste.
„Also, nach etwa fünfzig Meilen kommt ein kleines Motel …“, sprach er weiter, und ich nickte.
Natürlich kam da ein Motel. Das Motel, in dem mich der fette Klops ficken wollte. Das erwähnte ich aber nicht.
„… nach Meile fünfundsechzig kommt ein kleiner Ort namens Paso Doble.“
„Wo wollt ihr denn hin?“, unterbrach ich Illinois’ Aufzählungen. Auf dem Rücksitz machte ein frisch gedrehter Joint die Runde, und ich kurbelte mein Fenster etwas runter. Ich war nicht scharf darauf, etwas davon einzuatmen.
„Wir fahren in die Wüste“, meldete sich Lucy zu Wort und beugte sich zu mir vor. Ich atmete ihren Duft ein. Sie roch fantastisch nach teurem Parfüm.
„Ach so, in die Wüste also. Was gibt es denn in der Wüste?“
„Sand, Felsen und Schlangen“, sagte Madison kichernd, nachdem sie an dem Joint gezogen hatte. Anschließend überreichte sie ihn Lucy.
„Nein, nein“, sagte Lucy, nachdem auch sie an dem Joint gezogen hatte. „Wir wollen natürlich nicht zu den Schlangen. Oder den Felsen. Oder dem Sand. Da gibt es eine kleine Ruine. Es war früher eine christliche Mission oder so etwas. Da wollen wir übers Wochenende bleiben. Die Ruine soll echt cool sein. Freunde von uns haben sie empfohlen. Wir können dort so richtig die Sau rauslassen. Verstehst du. Saufen. Laute Musik hören und keiner nervt uns. Keine schnöden Mitbewohner, keine Bullen und keine langweiligen Campusaufseher.“ Aus ihrem Mund entwich eine Marihuanawolke. Lucy, das erfuhr ich auch später, war Papas Liebling. Konservativ erzogen, und jetzt tobte sie sich praktisch so richtig aus. Bereits mit fünfzehn hatte sie ihre Jungfräulichkeit verloren. Aber nicht, weil sie in den Typen, der sie gebumst hatte, sooo verliebt war, sondern um ihren Eltern eins auszuwischen. Eine typische Trotzgöre. Sicherlich bekam sie alles, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte.
„Da gibt es bestimmt Schlangen und Sand. Viele Schlangen und viel Sand. Das haben die meisten Ruinen in einer Wüste so an sich“, räumte ich ein.
Wildes Gekicher ertönte im Hintergrund.
„Übrigens, wo wir gerade von Schlangen sprechen, da fällt mir doch glatt ein Witz ein“, sagte Terenzi mit einem dämlichen Grinsen.
Kendra verdrehte die Augen. „Nicht schon wieder ein Witz, Terenzi“, jammerte sie, „die hören wir uns schon seit Stunden an.“ Zu mir gewandt sagte sie verschwörerisch: „Terenzi hält sich für einen richtigen Witzbold, musst du wissen.“
„Nein, nein, der ist wirklich gut“, protestierte Terenzi laut. „Also, da reisen zwei Kerle durch die Wüste …“
„Ja, wie originell“, sagte Lucy kichernd.
Der Joint machte erneut die Runde.
„Der eine von ihnen muss pinkeln …“
„… und er macht sich in die Hose, weil er vergeblich nach einem Baum sucht“, fiel ihm Illinois ins Wort.
„Haha, Illinois. Nein, er sucht nicht nach einem Baum. Er findet einen Felsen, an dem er sich erleichtern will. Er stellt sich also vor den Felsen, macht seinen Hosenstall auf und gerade, als er loslegen möchte, wird er von einer Schlange gebissen …“
„Aber nicht von seiner eigenen, oder?“, brüllte Madison erheitert und die anderen lachten.
Nur Terenzi sah ziemlich ernst aus. „Nein, Madison, er wird von einer Klapperschlange gebissen, okay? Jetzt lasst mich doch bitte weitererzählen! Nach kurzer Panik rennt sein Freund zu seinem Funkgerät, das er am Motorrad befestigt hatte, und funkt ein Krankenhaus an.“
„Und das Funkgerät hatte in der Wüste auf Anhieb Empfang? Muss ein gutes Funkgerät gewesen sein“, räumte Madison ein, was die anderen erneut zum Kichern brachte.
„Ja, Madison, das Funkgerät hatte Empfang. Es war ein gutes Funkgerät, okay“, konterte Terenzi genervt. „Auf jeden Fall brüllt sein Freund ins Mikrofon: ‚Mein Freund wurde von einer Schlange gebissen! Was soll ich tun?‘
Der Arzt fragt daraufhin, wie die Schlange denn aussah.
Stotternd beschreibt er die Schlange.
Darauf meint der Arzt: ‚Nehmen Sie ein Messer und öffnen Sie die Wunde.‘
Sein verletzter Kumpel fragt: ‚Was sagt der Arzt?‘
Sein Freund antwortet: ‚Ich muss die Bisswunde öffnen!‘ Zögernd greift er dann zum Messer und tut, was er tun muss. Dann schnappt er sich wieder das Mikrofon und fragt: ‚Und was jetzt?‘
Der Arzt meint: ‚Saugen Sie die Wunde aus.‘
Der Verletzte fragt neugierig: ‚Was sagt der Arzt nun, was sagt der Arzt nun?‘
Sein Kumpel guckt ihn ernst an und antwortet: ‚Sorry, Mann, aber du musst sterben.‘“
„Haha“, meinten die Mädels wie aus einem Munde und schüttelten die Köpfe.
Ich drehte mich nach hinten und sagte: „Wo wir doch schon bei Witzen sind: Ein evangelischer und ein katholischer Geistlicher gehen in den Puff. Der evangelische kommt von der Prostituierten wieder raus und sagt: ‚Boah, die ist aber besser als meine Frau.‘
Geht der katholische rein, kommt nach zehn Minuten wieder raus und sagt: ‚Yo, hast recht!‘“
Das sorgte für allgemeines Gelächter, was dazu führte, dass wir über diesen Witz so richtig ins Gespräch kamen. Es war, als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen. Wir verstanden uns alle auf Anhieb sehr gut. Das alles kann man sicherlich nicht erklären. Wie ich schon sagte; es war Schicksal. Fügung. Verkettung von Zufällen.
Aber was soll ich groß reden. Letzten Endes stiegen wir in dem kleinen Ort Paso Doble ab. Ein Kaff mit gerade mal tausend Einwohnern. Die Ruine lag etwa siebzehn Meilen davon entfernt.
Ich wollte weiter nach L.A. trampen. Illinois beschloss, ein paar Vorräte zu besorgen. Doch zuvor aßen wir noch zusammen in einem schmuddeligen, stickigen Diner. Die Cola war viel zu warm und die Pommes viel zu fettig. Quietschende Ventilatoren drehten sich unter der Decke und fette Fliegen schwirrten uns um die Ohren. Aber im Prinzip war mir das Ganze egal. Ich hatte Hunger und Durst. Da ist man für alles dankbar, was man kriegt. Allerdings drucksten die Mädchen ziemlich viel herum. Aber so ist das eben mit Mädchen.
Ich weiß nicht mehr, wer vorgeschlagen hatte, dass ich mitkommen sollte. Ich glaube, es war Kendra. Sie meinte, es sei ursprünglich sowieso eine sechste Person eingeplant gewesen. Ein Typ, mit dem Madison zusammen gewesen war. Doch der hatte sich vor einigen Tagen mit ihrer Stereoanlage, ihrem Telefon und ihrem Bargeld davongemacht.
Also sollte ich ihn ersetzen. Ich weiß noch, dass alle dafür waren. Und so stimmte ich zu. Im Prinzip hatte ich es nicht besonders eilig, nach L.A. zu kommen. Ganz im Gegenteil; ich genoss meine neue Freiheit in meinem neuen Leben. In diesem Augenblick fühlte ich mich fessel- und zwanglos.
Und so nahm das Schicksal seinen Lauf.
Ich fuhr mit in die Ruinen.
Und genau das war mein Fehler.
2.
Wir besorgten also noch einiges an Proviant und Zigaretten. Die Mädchen machten sich in der Toilette des Diners frisch, und dann fuhren wir los.
Der Weg führte quer durch die Wüste. Ohne Karte war der Ort sehr schwer zu finden, doch Illinois hatte eine genaue Wegbeschreibung. Der Weg erschien mir sehr lang, aber das lag daran, dass der Wagen im Sand nur schleppend vorankam. Seine beste Zeit hatte er hinter sich, was sollte man da erwarten.
Nach etwa vierzig Minuten erreichten wir unser Ziel. Die Ruinen bestanden aus einer kleinen Kapelle und heruntergekommenen Baracken. Mauerreste erstreckten sich um das Gelände. Sie hatten früher als Schutz vor der Wüste und diversen Banditos gedient. Südlich des Geländes stand ein altes Plumpsklo, und wenn man ganz hart im Nehmen war, konnte man dort sein Geschäft erledigen. In der Mitte des Geländes stand ein ausgetrockneter Brunnen.
Ich bückte mich über den Brunnenrand und prüfte, ob sich dort keine toten Viecher befanden. Es war aber zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Sicherlich hatte Illinois eine Taschenlampe im Rucksack. Ich nahm mir vor, ihn später danach zu fragen.