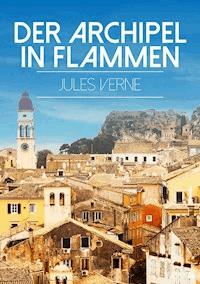
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Re-Image Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Handlung des Romans spielt während der Griechischen Revolution in den 1820er Jahren. Das Osmanische Reich unterdrückt die Griechen und verkauft Gefangene an Länder in Nordafrika. In diesem Umfeld beginnen sich die Griechen gegen ihre Unterdrücker zu wehren, dabei werden sie von europäischen Freiwilligen, den Panhellenen, unterstützt. Einer dieser Freiwilligen ist der junge französische Marineoffizier Henry d'Albaret. Während dieser Zeit verliebte er sich auf der Insel Korfu in die Bankierstochter Hadjine, Tochter des reichen griechischen Bankiers Elizundo, die er bald heiraten will. Da seine Liebe von ihr erwidert wird und ihr Vater sein Einverständnis erklärt, spricht bald ganz Korfu von der bevorstehenden Hochzeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Archipel in Flammen
Jules Verne
Re-Image Publishing
Kapitel1 Schiff in Sicht.
Am 18. Oktober 1827, in der fünften Stunde nachmittags, kämpfte ein kleines Schiff aus der Levante scharf gegen den Wind, um vor Nacht noch den Hafen Vitylo an der Einfahrt zum Golfe von Koron anzulaufen.
Dieser Hafen, das Detylos Homers, liegt in einer jener drei tiefen Einbuchtungen, die am Ionischen und am Aegäischen Meere jenes Platanenblatt aus dem Festlande herausschneiden, mit welchem man das südliche Griechenland sehr zutreffend verglichen hat. Auf diesem Blatte entfaltet sich der Peloponnesos des Altertums, das Morea der neuen Geographie. Der erste dieser Einschnitte ist der Busen von Koron zwischen Messenien und Magnos; der zweite der Busen von Marathon, der tief in das Gestade des rauhen Lakonien hineinreicht; der dritte der Meerbusen von Nauplia, dessen Gewässer das ebengenannte Lakonien von Argolis trennen.
Zu dem ersten dieser drei Meerbusen gehört der Busen von Vitylo. An der Ostküste, im Hintergrunde einer unregelmäßigen Bai, ausgebuchtet, reicht er bis zu den vordersten Ausläufern des Taygetos, dessen orographische Verlängerung das Skelett der als Magnos bezeichneten Landschaft bildet. Durch seinen sichern Ankergrund, durch die Richtung seiner Zufahrten, durch die ihn umschließenden Höhen wird er zu einem der besten Zufluchtsstätten an einer von allen Winden dieser mittelländischen Meere unablässig gepeitschten Küste.
Das Fahrzeug, das ziemlich hart gegen eine frische Brise aus Nordnordwest ankämpfte, war vom Kai von Vitylo aus nicht sichtbar. Noch trennte dasselbe ein Abstand von 6 – 7 Meilen. Obwohl sehr klares Wetter war, hob sich der Rand seiner obersten Segel doch kaum von dem schimmernden Hintergrunde des äußersten Horizonts ab.
Was aber nicht von unten zu sehen war, das war von oben, nämlich von dem Gipfel der Höhen aus, zu sehen, die sich über der Dorfschaft erheben. Vitylo ist auf steilen Felsen, die von der alten Akropolis von Kephala verteidigt werden, erbaut. Darüber erheben sich ein paar alte verfallene Türme, die jüngeren Ursprungs sind als jene merkwürdigen Überreste eines Serapis-Tempels, dessen Säulen und Kapitäle ionischen Stils noch immer die Kirche von Vitylo zieren. Neben diesen Türmen erheben sich auch noch ein paar kleine Kapellen, die von Mönchen bedient werden, aber geringen Besuch aufzuweisen haben.
Es ist hier notwendig, über diesen Ausdruck »bedienen«, ja auch über diese Bezeichnung »Mönch«, die man an der messenischen Küste den Geistlichen beilegt, Klarheit zu gewinnen. Einen von diesen Mönchen, der soeben aus seiner Kapelle trat, wird der Leser übrigens nach der Natur beurteilen können.
Zu der Zeit, da diese Erzählung spielt, war die Religion in Griechenland noch ein seltsames Sammelsurium aus heidnischen Überresten und Glaubenssätzen der christlichen Lehre. Von vielen Gläubigen wurden die weiblichen Gottheiten des Altertums als heilige Gestalten der neuen Religion betrachtet. Sogar heute noch werden dort, wie Henry Belle nachweist, die Halbgötter mit den Heiligen, die Spukgeister der verhexten Täler mit den Engeln des Paradieses »über einen Kamm geschoren«, indem man die Sirenen und die Furien ganz ebenso anruft wie die Panagia. Daher gewisse wunderliche Praktiken, Anomalieen, über die man lächeln muß, und nicht selten eine Geistlichkeit, die sich keinen Rat weiß, aus diesemalles andere eher als orthodoxen Wirrwarr sich herauszufinden und die Mitmenschheit zu erlösen.
Ganz besonders während des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts, zu der Zeit eben, in welcher unsere Erzählung spielt, war die Geistlichkeit der griechischen Halbinsel noch weit unwissender als jetzt, und die Mönche, harmlose, sorglose, gemütliche Leute, »gute Kerle«, mit einem Worte, schienen ziemlich geringe Fähigkeiten zur Leitung der von Natur abergläubischen Bevölkerung zu haben.
Ja, wenn diese Diener der Kirche bloß dumm und unwissend gewesen wären! Aber in gewissen Teilen von Griechenland, vornehmlich in den wilden Gegenden der Landschaft Magnus, machten sich diese armen Leute, die übrigens zumeist aus den untersten Bevölkerungsschichten genommen wurden, die also von Haus aus ebenso gut wie durch die Not zu Bettlern prädestiniert waren und auf die Paar Drachmen, die ihnen barmherzige Reisende hin und wieder zuwarfen, erpicht waren »wie der Teufel auf die Judenseele«, die kaum anderes zu verrichten hatten, als den Gläubigen irgend ein apokryphes Heiligenbild zum Kusse zu reichen oder die ewige Lampe in einer Heiligen-Nische zu unterhalten, die zudem in rabiater Stimmung waren über das geringfügige Erträgnis Pfründengroschen, Beichtgroschen, Begräbnis- und Taufgroschen – in gewissen Teilen Griechenlands, sage ich, machen sich diese armen Leute kein Gewissen daraus, im Solde der Küstenanwohner als Spürhunde – und als was für eine Sorte von Spürhunden! – zu wirken.
Kein Wunder, daß sich die Matrosen von Vitylo, die dort am Hafen liegen ganz wie in Neapel die Lazzaroni, und gleich diesen mehrstündige Ruhe haben müssen, wenn sie ein paar Minuten lang gearbeitet haben, im Nu erhoben, als sie einen ihrer Mönche unter lebhaften Gestikulationen eilenden Schrittes auf ihr Dorf zulaufen sahen.
Es war ein Mann von 50–55 Jahren, nicht bloß dick, sondern fett, und zwar mit solchem Fett behaftet, das als Produkt der Faulheit und Müßigkeit entsteht – ein Mann, dessen verschlagenes Gesicht einen bloß mittelmäßigen Grad von Vertrauen wecken konnte.
»Ei! was gibt es, heiliger Vater, was gibt es?« rief, auf ihn zueilend, einer der Matrosen. Der Vityliner sprach stark durch die Nase, daß einem wohl der Gedanke hätte kommen können, Nason für einen Altvordern der Hellenen zu halten, zugleich redete er jenes maniotische Platt, das ein Gemisch aus Griechisch, Türkisch, Italienisch und Albanesisch ist und den andern Gedanken wecken kann, als sei es schon zur Zeit des Turmbaues von Babel gesprochen worden.
»Haben die Soldaten Ibrahims die Höhen des Taygetes erstiegen?« fragte ein anderer Matrose mit einer Gebärde so ausgesprochener Gleichgiltigkeit, daß man von Vaterlandsliebe bei ihm kaum Spuren vermuten konnte.
»Wenn es nicht am Ende gar Franken sind, die uns gerade noch fehlten,« erwiderte der, welcher zuerst gesprochen hatte.
Aus diesem Gespräch ließ sich entnehmen, in welch geringem Maße der damals in seinem schrecklichen Stadium befindliche Kampf diese Griechen vom äußersten Peloponnes interessierte, im starken Gegensatz zu den Manioten im Norden, die sich im Freiheitskriege durch die glänzendsten Waffentaten auszeichneten.
Aber der fette Gottesknecht konnte weder diesem noch jenem Rede und Antwort stehen. Er hatte sich auf dem Wege über die steilen Abhänge ganz außer Atem gerannt. Seine Asthmatiker-Brust keuchte. Er wollte sprechen, doch es gelang ihm nicht. Einer seiner Altvordern im Hellas, der Krieger von Marathon, hatte wenigstens noch, ehe er tot zusammenbrach, den Sieg des Miltiades verkünden können. Aber es handelte sich ebenso wenig noch um Miltiades als um den Krieg der Athener wider die Perser. Waren es ja doch kaum Griechen, diese wilden Bewohner der äußersten Spitze der Landschaft Magnos!
»Ei, so sprich doch, Vater! sprich doch!« rief ein alter Matrose, namens Gozzo, der ungeduldiger war als die übrigen, als hätte er, was der Mönch verkünden wollte, erraten.
Endlich war der Gottesknecht wieder zu Atem gekommen, und die Hand ausstreckend, rief er:
»Schiff in Sicht!«
Auf diese drei Worte hin waren die Faulpelze im Nu auf den Beinen und stürmten, freudig in die Hände klatschend, einen Felsen hinauf, der den Hafen überragte. Von da aus konnte ihr Blick das weite Meer in weit größerem Umkreise übersehen.
Wer hier nicht einheimisch war, hätte meinen können, dieses Leben sei durch das Interesse geweckt, das jedes von hoher See her kommende Schiff bei fanatischen Seeleuten naturgemäß wecken müsse. Dem war nicht so oder vielmehr, dem war nur in gewisser Hinsicht so, wenn nämlich diese Halbinsulaner durch eine Nutzensfrage in Alarm gesetzt werden konnten.
Zur Zeit nämlich, wo diese Erzählung zu Papier gebracht wird – nicht in jenem Augenblick, da sich dieselbe zutrug – ist die Landschaft Magnos ein Land für sich im Mittelpunkte des durch den Willen der europäischen Signatarmächte im Vertrag von Adrianopel Anno 1829 zum unabhängigen Königreich erhobenen Griechenlands. Die Manioten oder zum wenigsten die diesen Namen führenden Küstenleute, die auf den verlängerten Landspitzen zwischen den Meerbusen wohnen, sind mehr als zur Hälfte Barbaren geblieben, denen ihre persönliche Freiheit weit mehr am Herzen liegt als die Freiheit ihres Vaterlands. Kein Wunder also, daß diese äußerste Landzunge von Nieder-Morea seit alters sich unter kein Regiment hat zwingen lassen wollen! weder den türkischen Janitscharen, noch den griechischen Gendarmen hat dieses Kunststück gelingen wollen. Händel- und rachsüchtig, gleich den Korsen Sklaven der Blutrache, räuberisch von Geburt und doch das Gastrecht heilig haltend, vor dem Meuchelmord nicht zurückschreckend, sobald er durch Raub notwendig wird, halten sich diese rauhen Gebirgsvölker trotz allem für die direkten Abkömmlinge der Spartiaten; aber von ihren unzugänglichen »Pyrgos« oder Bergfesten aus, deren man in diesen gewundenen Ketten des Taygetes zu Tausenden zählt, spielen sie mit besonderer Vorliebe die zweifelhafte Rolle jener Wegelagerer des Mittelalters, die ihre Feudalrechte mit Dolchstößen und Pfeilschüssen ausübten.
Sind nun die Manioten noch gegenwärtig halbe Wilde, so läßt sich leicht vorstellen, wie es um sie mehr denn 50 Jahre früher stand. Ehe während des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts ihrem seeräuberischen Treiben durch die an den Küsten kreuzenden Dampfschiffe der Garaus gemacht wurde, waren die Manioten als die verwegensten Seeräuber in der ganzen Levante gefürchtet. Und vor allem war es, durch seine Lage am äußersten Zipfel des Peloponnes an der Einfahrt zweier Meere, wie auch durch seine Nähe an der allem Seeräubervolk ans Herz gewachsenen Insel Cerigotto, der Hafen von Vitylo, der solchem Gesindel eine gute Zuflucht bot.
Hier wimmelte es von seetüchtigen Leuten, und von hier aus wurden der griechische Archipel sowohl als die anstoßenden Gewässer des Mittelmeeres mit Raubzügen förmlich überschwemmt. Der eigentliche Sammelpunkt für diesen Teil der Landschaft Magnos führte damals genauer den Namen Kakovonni, und die Kakovonnioten mit ihren Wohnsitzen auf der im Kap Matapan auslaufenden Landspitze hatten leichtes Feld für ihren Seeraub. Auf dem Meere gingen sie den Schiffen direkt zu Leibe. Vom Lande lockten sie dieselben durch falsche Signale heran. Ueberall plünderten sie, überall sengten und brandschatzten sie. Ob die Schiffsbesatzung türkisch war oder maltesisch, ägyptisch oder schließlich auch griechisch, war ihnen so gut wie gleichgiltig: sie wurde ohne Erbarmen niedergemacht oder nach den Barbareskenstaaten in die Sklaverei verkauft. Kam einmal stille Zeit, wurden die Küstenfahrzeuge in den Gewässern des Busens von Koron oder Marathon, auf der Höhe von Cerigo oder des Kaps Gallo rar, dann stiegen öffentliche Gebete empor zum Gott und Herrn der Stürme, damit Er die Gnade habe, ein Schiff von stattlichem Tonnengehalt und mit reicher Fracht zu ihnen zu führen! und kein Gottesknecht weigerte sich, zum größern Nutzen ihrer Getreuen solche Fürbitte in der Kirche zu tun.
Wochenlang hatte es keine Gelegenheit zu Raub und Plünderung gegeben. Kein Schiff war am Strande von Magnos gescheitert. Kein Wunder also, daß der Ruf des Mönchs: »Schiff in Sicht!« sozusagen elektrisierend wirkte.
Fast im selben Augenblick dröhnten die dumpfen Schläge der Simandra, einer Glocke aus Holz mit eisernem Klöppel, die in jenen Provinzen im Brauch ist, wo die Türken metallne Glocken nicht zulassen. Aber die unheimlich klingenden Schläge reichten hin, um eine von Habgier beseelte Bevölkerung zusammenzutreiben: Männer, Weiber, Kinder, blutdürstige gefürchtete Hunde: alle gleichmäßig erfüllt von der Gier zu plündern und zu morden.
Unterdes diskutierten die Leute von Vitylo auf dem hohen Felsen, wo sie standen, mit lautem Geschrei. Was für ein Schiff war es, das der Gottesknecht gemeldet hatte?
Unter dem Druck der Brise aus Nordnordwest, die sich bei sinkender Nacht noch frischte, machte das Schiff, das die Backbordhalsen gesetzt hatte, sehr schnelle Fahrt. Ja, es schien nicht ausgeschlossen zu sein, dass es scharf am Kap Matapan anlaufen würde, dass es lavierte. Sein Kurs schien der Vermutung Raum zu geben, dass es aus den kretensischen Gewässern kam. Schon trat das Schiff langsam über der weiße Furche, die sein Kiel zog, in Sicht; aber sein Segelzeug bildete für das Auge noch immer nur eine verworrene Masse. Demzufolge ließ sich schwer erkennen, zu welcher Gattung von Fahrzeugen das Schiff, das man sah, gehörte. Zufolgedessen widersprachen sich die Meinungen aller Minuten.
»Eine Schebecke ist's!« erklärte einer von den Seeleuten; »ich habe ganz deutlich die viereckigen Segel am Fockmast gesehen!«
»Nicht doch!« erwiderte ein anderer, »eine Pinke ist's und nichts anderes! seht doch sein hohes Achter und den ausgebauchten Vorsteven!«
»Schebecke oder Pinke! ei! wer würde die voneinander unterscheiden können aus solcher Entfernung!«
»Ob's nicht gar eine Polakra ist mit Quadratsegeln?« bemerkte ein anderer Matrose, der sich aus seinen halbgeschlossenen Händen ein Fernrohr gedreht hatte.
»Sei uns der liebe Gott gnädig!« versetzte der alte Gozzo. »Ob nun Polakra oder Schebecke oder Pinke, auf alle Fälle ist's ein Dreimaster, und ein Dreimaster ist immer besser als ein Zweimaster, wenn er bei uns stranden soll mit einer ordentlichen Weinfracht aus Kandia oder mit Stoffen aus Smyrna!«
Zufolge dieser den Nagel auf den Kopf treffenden Bemerkung hielt alles noch weit schärfere Ausschau. Das Schiff kam näher und wurde langsam größer; aber gerade weil es so dicht am Winde fuhr, konnte man es nicht von der Quere sehen; es hätte also noch immer seine Schwierigkeit gehabt, zu entscheiden, ob es ein Zwei- oder ein Dreimaster sei, das heißt: ob man auf eine beträchtliche Tonnenlast rechnen dürfe oder nicht.
»O! das Unglück verfolgt uns, und der Teufel hat die Hand im Spiel!« rief Gozzo und stieß einen jener vielzungigen Flüche aus, mit denen er all seine Sätze verstärkte … »wir werden nicht über eine Feluke hinauskommen … «
»Oder gar nur eine Speronare!« rief der Gottesknecht, nicht weniger enttäuscht als seine Gläubigen.
Ob diese beiden Bemerkungen mit Ausrufen des Verdrusses hingenommen wurden, wird nicht erst gesagt zu werden brauchen. Aber mochte es nun solch oder solch ein Fahrzeug sein, so viel ließ sich schon beurteilen, daß es nicht über 100–120 Tonnen messen würde. Schließlich kam es ja gar nicht auf ein beträchtliches Quantum an, sobald die Qualität der Fracht hervorragend war. Gar manche von diesen gewöhnlichen Feluken oder gar Speronaren sind nämlich mit köstlichen Weinen, feinen Oelen oder wertvollen Geweben befrachtet. In solchem Falle sind sie des Angriffs schon wert und bringen viel ein für einen kleinen Aufwand von Mühe. Zu verzweifeln brauchte man also noch immer nicht. Zudem fanden die Alten unter der Schar, die auf solchem Gebiete gutbeschlagen waren, an dem Schiffe einen gewissen Grad von vornehmer Form und flotter Fahrt: allemal Eigenschaften, die zu seinem Vorteil sprachen.
Inzwischen begann die Sonne im Westen des ionischen Meeres hinter dem Horizont zu verschwinden; aber die Oktoberdämmerung ließ erwarten, daß es noch immer eine Stunde lang hell genug bleiben würde, um vor Einbruch der Nacht das Schiff noch feststellen zu können. Zudem wendete es, nach Umschiffung des Kap Matapan, um bessere Einfahrt in den Busen zu haben, um zwei Quarten und zeigte sich den Blicken der Beobachter unter besseren Bedingungen.
Kein Wunder, daß im nächsten Augenblicke dem Munde des alten Gozzo das Wort »Sakolewa!« entfuhr.
»Eine Sakolewa!« schrieen seine Kameraden, deren Aerger sich durch eine Flut von Flüchen Luft machte.
In dieser Hinsicht aber gab es keinen Streit, weil kein Irrtum mehr möglich war. Das Schiff, das an der Mündung des Golfs von Koron manövrierte, war tatsächlich nichts anderes als eine Sakolewa. Zudem waren schließlich die Leute von Vitylo sehr im Unrecht, über Unglück zu schreien, denn es gehört durchaus nicht zu den Seltenheiten, daß sich auch an Bord von solchen Sakolewen kostbare Fracht vorfindet.
Als Sakolewen bezeichnet man in der Levante Fahrzeuge von mittlerem Tonnengehalt, mit leicht aufwärts gebogenem Hinterdeck und aurischem Segelwerk auf den drei Masten. Der stark zum Vorsteven hin gekippte, mitten im Schiff stehende Großmast trägt ein lateinisches Segel, ein Not- und ein Marssegel mit fliegendem Topp. Zwei Klüver am Vorsteven, zwei Spitzsegel auf den beiden ungleichen Masten des Hinterschiffs bilden die Ergänzung des Segelwerks, das solcher Sakolewa einen Anblick von merkwürdiger Beschaffenheit verleiht. Die grellen Farben, mit denen ihr Rumpf bemalt ist, die im Gegensatz zum Hinterschiff gradlaufende Form ihres Vorstevens, die Mannigfaltigkeit ihrer Bemastung, der phantastische Schnitt ihrer Segel, stellen die Sakolewa in die vorderste Reihe jener graziösen Schiffe, die in den schmalen Gewässern des griechischen Archipels zu Hunderten luven.
Obwohl die Brise Neigung steif zu werden verriet und der Himmel sich mit »Lämmchen« – Bezeichnung bei den Bewohnern der Levante für eine gewisse Wolkenbildung des südlichen Himmels – zu überziehen anfing, verringerte doch die Sakolewa ihr Segelwerk um kein Stück. Sie hatte sogar ihr fliegendes Topp beibehalten, das mancher Seemann von geringerer Verwegenheit gewiß schon hereingeholt hätte. Augenscheinlich verfolgte der Kapitän die Absicht, ans Land zu gehen, weil er keine Lust hatte, auf einem schon »harten« Meere, das noch schlimmer zu werden drohte, die Nacht zuzubringen.
Bestand nun aber bei dem Seevolk von Vitylo kein Zweifel mehr darüber, daß die Sakolewa in den Busen einfuhr, so blieb noch immer die Frage offen für sie, ob die Wahl des Kapitäns auf ihren Hafen fallen würde.
»Ei!« rief einer von ihnen, »es sieht ganz aus, als ob sie, statt einzufahren, noch immer den Wind zu kneifen sucht.«
»Dann soll sie der Satan ins Schlepptau nehmen!« rief ein anderer; »sie wird doch nicht bloß lavieren, um wieder in See hinauszustechen?«
»Hält sie denn überhaupt Kurs auf Koron?«
»Oder auf Kalamata?«
Von diesen beiden Annahmen war die eine so gut möglich wie die andere. Koron ist ein Hafen an der maniotischen Küste, der von den Kauffahrteischiffen der Levante ziemlich oft angelaufen wird und eine bedeutende Ausfuhr von Oelen aus dem südlichen Griechenland hat. Nicht anders verhält es sich mit dem im Grunde des Golfs gelegenen Kalamata, dessen Bazare von Manufakturware, Stoffen oder Töpferware, die aus den verschiedenen Ländern von Westeuropa hierher geschafft wird, strotzen. Es war also recht wohl möglich, daß die Sakolewa nach einem dieser beiden Häfen unterwegs war – was den auf Raub und Plünderung erpichten Leuten von Vitylo einen starken Strich durch die Rechnung gemacht haben würde.
Die Sakolewa machte, während sie das Ziel einer so lebhaften Aufmerksamkeit blieb, schnelle Fahrt. Nicht lange dauerte es mehr, so segelte sie auf Höhe von Vitylo. Das war der Moment, in welchem ihr Schicksal sich entscheiden sollte. Hielt sie nach wie vor auf den Hintergrund des Golfes zu, so mußte Gozzo mit seinen Kameraden alle Hoffnung, sich ihrer zu bemächtigen, fallen lassen; denn selbst in ihren schnellsten Barken würden sie keine Aussicht haben, die ihnen durch das ungeheure Segelwerk, das sie ohne Mühe trug, an Fahrgeschwindigkeit weit überlegene Sakolewa einzuholen.
»Sie kommt heran!«
Die Worte kamen aus dem Munde des alten Seemanns, dessen Arm mit seiner Hakenhand sich wie ein Enterhaken nach dem kleinen Fahrzeuge reckte.
Gozzo irrte sich nicht. Das Steuerruder war zum Winde gedreht worden, und die Sakolewa hielt Kurs auf Vitylo. Jetzt wurden ihr fliegendes Topp und ihr zweites Focksegel hereingeholt, dann klatschte ihr Klüver an seinen Raaen nieder. Hierdurch um einen Teil ihrer Takelage erleichtert, befand sie sich in besserer Gewalt des Manns am Ruder.
Es fing nun an, Nacht zu werden. Die Sakolewa hatte gerade noch Zeit, in die Kanäle von Vitylo zu steuern. Dort ragen Klippen unter Wasserflächen, denen es auszuweichen gilt, wenn ein Schiff nicht scheitern will. Am Großmast des kleinen Fahrzeugs war aber von einer Lotsenflagge nichts zu sehen. Sein Kapitän mußte also diese ziemlich gefährlichen Tiefen genau kennen, da er sich, ohne Beistand zu begehren, hineinwagte. Vielleicht traute er auch – mit Fug und Recht – den Leuten von Vitylo nichts Gutes zu, die sich wohl kaum besonnen hätten, sein Schiff an erster bester Stelle auf den Grund laufen zu lassen, wo schon zahllose Schiffe zu Grunde gegangen waren.
Zudem erhellte zu jener Zeit noch kein Leuchtturm diesen Teil der Küste von Magnos. Ein bloßes Hafenlicht diente als Wegweiser in den engen Kanal.
Die Sakolewa indessen kam näher. Bald war sie bloß noch eine halbe Meile von Vitylo. Sie steuerte ohne Zögern auf das Land zu. Man merkte, sie wurde von geschickter Hand geführt: ein Umstand, nicht nach dem Herzen all dieser Missetäter, die es natürlich lieber gesehen hätten, wenn das Schiff, nach dem sie begehrten, auf eine Klippe aufgestoßen wäre. Begann doch die Klippe das Werk, das sie dann vollendeten. Erst Strandung, dann Seeraub: so war es ihnen immer am liebsten. Dadurch kamen sie um den Kampf mit bewaffneter Hand, um einen direkten Angriff und Ueberfall herum, bei dem immer Leute von ihnen selber draufgehen konnten. Gab es doch oft genug Schiffe, deren mutige Mannschaft sich tapfer zur Wehr setzte, statt sich wehrlos überfallen zu lassen.
Gozzos Kameraden verließen nun, ohne einen Augenblick zu säumen, ihren Ausguckposten und stiegen wieder zum Hafen hinunter. Es galt nun, all jene Manöver ins Werk zu setzen, mit denen alles Seeräubervolk, im Abend- wie im Morgenlande, genau Bescheid weiß.
Die Sakolewa in den Engen des Kanals dadurch zum Stranden zu bringen, daß man ihr eine falsche Richtung wies, war in solch finsterer Nacht doch wahrlich kein Kunststück.
»Ans Hafenfeuer!« rief einfach Gozzo, dem seine Kameraden aus Gewohnheit aufs Wort gehorchten.
Man verstand, was der alte Seemann wollte. Nach zwei Minuten verlosch dies Feuer, das nichts weiter war als eine bloße Laterne, die auf der kleinen Mole oben an einer Mastspitze hing. Gleich darauf trat ein anderes Feuer in Sicht, und zwar zuerst aus der gleichen Richtung; während aber das erste von der Mole aus, wo es hing, dem Schiffer auf See einen festen Punkt wies, sollte ihn das zweite durch seine Beweglichkeit aus dem Kanal herauslocken und in die Gefahr des Aufrennens und Strandens setzen. Dieses trügerische Licht war nämlich ebenfalls eine Laterne, deren Schein von dem des Hafenlichts sich in keiner Weise unterschied. Aber diese zweite Laterne war einer Ziege an die Hörner gehängt, die am Klippenrande in langsamem Tempo entlang getrieben wurde. Ziege und Laterne veränderten also zusammen fortwährend ihren Standpunkt, wodurch die Sakolewa zu falschem Manövrieren veranlaßt werden sollte.
Daß die Leute von Vitylo durch derartiges Verfahren Schiffe ins Unglück gelockt hatten, geschah nicht zum erstenmale. Nein, wahrlich nicht! und nur selten war es sogar vorgekommen, daß sie ihr Verbrechen erfolglos übten.
Mittlerweile war die Sakolewa in den Kanal eingefahren. Sie hatte auch ihr Hauptsegel gerefft und trug bloß noch ihre lateinischen Segel am Hinterschiff und ihr Focksegel. Dieses verringerte Segelzeug mußte ihr ausreichen, um sie bis zur Anlände zu bringen.
Zur höchsten Verwunderung der sie im Auge haltenden Seeleute kam die Sakolewa mit unglaublicher Sicherheit durch alle Windungen des Fahrwassers vorwärts. Um jenes bewegliche Licht an den Hörnern der Ziege schien sie sich gar nicht zu bekümmern. Beim hellsten Tageslichte hätte sie unmöglich richtiger steuern können; ihr Kapitän mußte also Vitylo schon häufig angelaufen haben, um mitten in finsterer Nacht hier eine Landung zu wagen.
Schon wurde er sichtbar, dieser verwegene Seemann; seine Figur hob sich scharf heraus in dem Schatten auf dem Vorsteven der Sakolewa. Er stand, in die weiten Falten seiner Aba gehüllt einer Art wollnen Mantels mit Kapuze, die über den Kopf niederfiel; wahrlich! dieser Kapitän hatte nichts an sich von jenen ängstlichen Küstenfahrern, die bei keinem Manöver, das sie mit ihrem Fahrzeug ausführen, den Rosenkranz mit den großen Perlen, wie man sie fast überall im griechischen Archipel trifft, aus den Fingern legen. Nein! der hier gab dem am Hintersteven des kleinen Fahrzeugs postierten Steuermann seine Befehle mit leiser, ruhiger Stimme.
Da verlöschte plötzlich die am Strande entlang wandernde Laterne. Aber die Sakolewa ließ sich dadurch nicht beirren, sondern verfolgte zielbewußt ihre Fahrt. Eine Weile lang konnte man glauben, sie müßte bei einer jähen Wendung gegen einen knapp über Wasser ragenden gefährlichen Felsen, in Kabellänge etwa vom Hafen entfernt, aufrennen, zumal derselbe in der herrschenden Finsternis unmöglich zu sehen war. Aber ein schwacher Druck des Steuers reichte, um die Sakolewa von dem Felsen abzubringen.
Den Leuten von Vitylo blieb also keine Aussicht mehr auf die Vorteile einer Strandung, die ihnen die Sakolewa wehrlos überliefert haben würde. Nur noch Minuten konnte es dauern, bis sie im Hafen vor Anker liegen würde. Wollten sie sich ihrer bemächtigen, so blieb kein anderes Mittel mehr als sie zu entern.
Eine kurze Erörterung fand zwischen dem Seeräubervolk statt, dann wurde beschlossen, in dieser Weise vorzugehen, die bei der noch immer herrschenden Dunkelheit auch Erfolg zu versprechen schien.
»In die Boote!« rief der alte Gozzo, über dessen Kommandos niemals ein Wort fiel, vornehmlich dann nicht, wenn sie den Seeraub betrafen.
Etwa dreißig kräftige Männer, manche mit Pistolen, überwiegend aber mit Dolchen und Beilen bewaffnet, stürzten in die am Kai festgemachten Boote und rückten, an Zahl ohne Frage der Besatzung der Sakolewa überlegen, vor.
Da ertönte an Bord derselben ein kurzes Kommando. Das Schiff war aus dem Kanal heraus in den offenen Hafen gelangt, die Trossen wurden gelöst, der Anker faßte Grund und nach kurzer Erschütterung, veranlaßt durchs das Anziehen der Kette, lag das Schiff unbeweglich. Die Boote waren bis auf ein Paar Fadenlängen heran. Ohne auch nur gesteigertes Mißtrauen zu zeigen, aber in Kenntnis des schlimmen Rufes, in welchem die Leute von Vitylo stehen, hatte die Besatzung der Sakolewa, um für jeden Notfall gerüstet zu sein, zu den Waffen gegriffen.
Zunächst trat solcher Notfall nicht ein. Sobald das Schiff vor Anker lag, war der Kapitän zwischen Vor- und Hintersteven mehrmals auf und ab geschritten, während seine Mannschaft sich, unbekümmert um die heranfahrenden Boote, mit der Ordnung des Segelwerks und der Säuberung des Decks zu tun machte. Bloß ein Umstand wäre einem aufmerksamen Auge nicht entgangen, daß nämlich die Segel nicht angeschlagen wurden, daß man sich also die Möglichkeit ließ, sie sofort wieder zu hissen und in See zu stechen.
Das erste Boot kam an Backbord der Sakolewa und legte an. Die andern Boote waren fast gleichzeitig zur Stelle … und da die Sakolewa sehr niedrige Wandungen hatte, war es den Angreifern ein leichtes, sich hinaufzuschwingen. Mit wildem Geschrei stürmten die Verwegensten nach dem Hinterschiff. Einer packte einen Feuerbrand und leuchtete dem Kapitän ins Gesicht.
Mit raschem Griffe riß dieser die Kapuze auf die Schultern, so daß sein Gesicht in volles Licht trat.
»Ei, ei!« rief er, »kennen die Leute von Vitylo denn den Landsmann Nikolas Starkos nicht mehr?«
Mit diesen Worten hatte der Kapitän ruhig die Arme über seiner Brust gekreuzt. Im andern Augenblick waren die Boote abgestoßen, und im schnellsten Tempo nach dem Hafen zurückgesteuert.
Kapitel2 Auge in Auge.
Zehn Minuten später stach ein leichtes Boot, eine Gig, von der Sakolewa ab und legte am Fuß der Mole an; dort ging, ohne alle Bedeckung, ohne jede Waffe, der Mann ans Land, vor dem die Leute von Vitylo soeben so schnell das Hasenpanier ergriffen hatten.
Der Mann war der Kapitän der »Karysta« – diesen Namen führte das kleine Schiff, das eben in den Hafen eingelaufen war. Er war von Mittelgröße. Unter der dicken Seemannskappe zeigte sich eine hohe, stolze Stirn. Aus seinen kalten Augen fiel ein starrer, strenger Blick. Ueber seiner Lippe lief, wagerecht gespannt, in dickem Busche, nicht in Form einer Spitze endigend, der Klephten-Schnurrbart. Seine Brust war breit, seine Gliedmaßen verrieten gewaltige Kraft. Sein schwarzes Haar fiel in Locken auf die Schultern. Er mochte Mitte der Dreißiger sein; wenn er darüber hinaus war, so sicher nur um ein paar Monate; aber seine vom Seewinde gebräunte Haut, die Härte seines Gesichtsausdrucks, eine Falte in der Stirn, tief gegraben wie eine Ackerfurche, in der kein gutes Samenkorn keimen kann, ließen ihn älter erscheinen als er war.
Das Gewand, das er zur Zeit trug, war weder die Jacke noch die Weste, noch die Fustanella der Palikaren. Sein Kaftan mit der braunen Kapuze und mit Säumen von ziemlich nüchterner Farbe besetzt, sein Beinkleid von grünlicher Färbung, das in weiten Falten bis auf die Schäfte der hohen Stiefel fiel, um dort zu verlaufen, erinnerten vielmehr an die Tracht des Seemanns von der Barbaresken-Küste. Und doch war Nikolas Starkos Grieche von Geburt und stammte direkt aus Vitylo. Dort hatte er seine Knaben- und Jünglingszeit verlebt; in diesem Klippenbereich hatte er das Seemannsgewerbe gelernt; in diesen Gewässern hatte er Stürmen und Strömungen getrotzt. Keine Bucht, deren Tiefe und deren Ufer er nicht gekannt hätte! Keine Klippe, kein Riff, kein Felsgang unter Wasser, die ihm nicht vertraut wären! Keine Enge, kein Kanal, wo er nicht ohne Kompaß und Lotsen zurecht gefunden hätte durch all die vielen Krümmungen und Wendungen, die jede Fahrstraße in diesen Gewässern macht! Es erklärt sich also leicht, wie er seine Sakolewa, aller falschen Signale seiner Landsleute ungeachtet, mit dieser sichern Hand hatte steuern können. Zudem wußte er, welche Vorsicht den Leuten von Vitylo gegenüber am Platze war. Er hatte sie ja schon bei der Arbeit gesehen! und vielleicht war er im Grunde genommen gar kein Feind ihrer seeräuberischen Bräuche, so lange er persönlich wenigstens nicht darunter zu leiden brauchte.
Aber wenn Nikolas Starkos seine Landsleute kannte, so kannten auch seine Landsleute ihren Nikolas Starkos. Seit dem Tode seines Vaters, der zu den Tausenden gehörte, die türkischer Grausamkeit zum Opfer fielen, wartete seine von Rachedurst erfüllte Mutter nur auf die Stunde, wenn ihr Volk sich gegen das ottomanische Joch erheben würde, um als erste sich gegen die Todfeinde zu kehren. Nikolas selber hatte das Magnos in seinem 18. Jahre verlassen, um die See oder, richtiger gesagt, den Archipel zu befahren, und zwar nicht bloß als Seemann, sondern auch als Seeräuber. An Bord welcher Schiffe er während dieser Zeit gedient hatte, unter welchen Seeräuberkapitänen er gefahren war, unter welcher Flagge er seine ersten Wassertaten vollführt hatte, welches Blut, ob das der Feinde oder das der Beschützer Griechenlands, oder gar das gleiche, das in seinen Adern floß, er vergossen hatte: das zu sagen wäre wohl kaum ein Mensch imstande gewesen. Indessen mehr denn einmal war er schon in den verschiedenen Häfen des Meerbusens von Koron gesehen worden. Gar mancher von seinen Landsleuten hatte erzählen können von den Heldenstückchen als Seeräuber, die er zusammen mit ihm ausgeführt hatte, manches Kauffahrteischiff hatten sie mit ihm überfallen und in Grund gebohrt, gar manche reiche Prise mit ihm geteilt! Aber ein Geheimnis war um den Namen Nikolas Starkos gewoben, – und so rühmlich bekannt war derselbe in den Provinzen des Magnos, daß sich all und jeder vor ihm beugte.
Hiernach begreift sich der Empfang, der diesem Manne von den Leuten von Vitylo bereitet wurde; hieraus erklärt sich, daß sein bloßer Name, seine bloße Gegenwart genügt hatte, sie Abstand nehmen zu lassen von der Plünderung der Sakolewa, die sie schon als ihnen verfallen betrachtet hatten.
Sobald der Kapitän der »Karysta« kurz hinter der Mole den Fuß auf den Kai gesetzt hatte, bildeten Männer und Weiber, die herbeigelaufen waren, um ihn zu sehen, respektvoll Spalier. Kein Ruf war laut geworden, als er aus seiner Gig stieg. Sein Prestige war scheinbar groß genug, um durch sein bloßes Erscheinen schon Ruhe ringsum zu stiften. Man wartete, bis er sprechen würde, und wenn er es unterließ, zu sprechen, – ein Fall, der leicht eintrat – so getraute sich niemand, das Wort etwa selber an ihn zu richten.
Nikolas Starkos schritt, nachdem er die Matrosen mit der Gig wieder an Bord seiner Sakolewa geschickt hatte, auf den Winkel zu, der im Hintergrunde des Hafens von dem Kai gebildet wird. Aber kaum hatte er zwanzig Schritt in dieser Richtung getan, als er stehen blieb. Dann wendete er sich an den ihm bekannten alten Seemann, der ihm, gleichsam gewärtig eines Befehls, gefolgt war, und sagte:
»Gozzo! ich werde wohl noch zehn kräftige Leute brauchen, um meine Mannschaft vollzählig zu machen.«
»Die sollst du haben, Nikolas Starkos,« erwiderte Gozzo. Und hätte der Kapitän der »Karysta« hundert Leute begehrt, so würde er sie unter dieser seefahrenden Bevölkerung gefunden haben, ganz, wie er sie haben wollte … und diese hundert Leute würden, ohne zu fragen wohin man sie führen, zu welchem Gewerbe man sie bestimmen wolle, für wessen Rechnung sie fahren oder kämpfen sollten, ihrem Landsmann gefolgt sein, männiglich bereit, sein Schicksal zu teilen, da sie alle wußten, auf diese oder jene Weise auf ihre Rechnung dabei zu kommen.
»In einer Stunde,« setzte der Kapitän hinzu, »sollen die zehn Mann an Bord der »Karysta« sein!«
»Sie werden dort sein,« erwiderte Gozzo.
Nikolas Starkos bedeutete Gozzo durch einen Wink, daß er seine Begleitung nicht weiter wünsche, stieg den Kai hinauf, der sich an die Mole schloß, und verschwand in einer der engen Gassen, die beim Hafen mündeten.
Gozzo, der Alte, kehrte, gehorsam Starkos' Willen, zu seinen Kameraden zurück und widmete sich bloß der Auswahl der zehn für die Ergänzung der Mannschaft der Sakolewa notwendigen Leute.





























