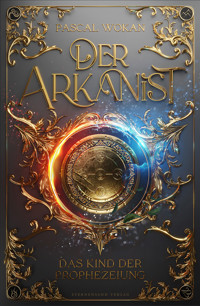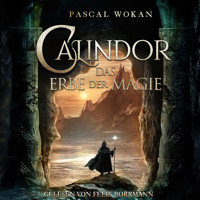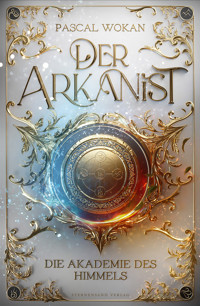
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Arkanist
- Sprache: Deutsch
Ihr seht mich in Ketten, vorgeführt wie ein Verbrecher vor den Magistern der Himmelsakademie, an der ich einst als fleißiger Schüler ein und aus ging. Doch urteilt nicht zu schnell, denn ich möchte erst meine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes voller Hoffnungen und Träume, Leid, Schmerz und Zurückweisung. Die Geschichte eines tragischen Helden. Aber beginnen wir ganz am Anfang. In meinem Leben hatte ich bereits viele Namen: Kind der Prophezeiung, Dunkler Lord, Gotttöter … Heute stehe ich einfach als Caelden vor euch. Caelden, der Waisenjunge, der vor Jahrzehnten an die Himmelsakademie kam und nicht ahnte, dass er eines Tages der mächtigste Arkanist werden würde, den die Welt je gesehen hat. Nur war das, was mich aus dem trostlosen Leben rettete, gleichzeitig meine Verdammnis. Denn sie waren schon immer meine größte Schwäche: Macht und das Streben danach, sie zu beherrschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Prolog - Der Dunkle Lord
Kapitel 1 - Vom Beginn
Die Geschichte des Dunklen Lords
Kapitel 2 - Waisen, Bettler und Adlige
Kapitel 3 - Missetaten
Kapitel 4 - Zwischenspiel: Wahre Grösse
Kapitel 5 - Von Dieben und Händlern
Kapitel 6 - Die Himmelsinseln
Kapitel 7 - Solodins feinste Auswahl
Kapitel 8 - Der erste Morgen
Kapitel 9 - Die Aufnahmeprüfung
Kapitel 10 - Der Anfang von allem
Kapitel 11 - So etwas wie Freunde
Kapitel 12 - Unterricht
Kapitel 13 - Dieselbe Welt
Kapitel 14 - Berufen
Kapitel 15 - Von Frost und Feuer
Kapitel 16 - Das Sanktuarium
Kapitel 17 - Die Werkstatt
Kapitel 18 - Kampfkünste
Kapitel 19 - Ein elender Glückspilz
Kapitel 20 - Thaumaturgie
Kapitel 21 - Verteidigung gegen Fabelwesen
Kapitel 22 - Der Tanz endet
Kapitel 23 - Ein erfolgreicher Tag
Kapitel 24 - Mondlicht
Kapitel 25 - Die Drachen
Kapitel 26 - Die Spiele
Kapitel 27 - Bitterer Ernst
Kapitel 28 - Zwischenspiel: Lüge
Kapitel 29 - Der Geschmack des Sieges
Kapitel 30 - Weisse Flamme
Kapitel 31 - Roter Tropfen
Kapitel 32 - Violett
Kapitel 33 - Was mich unterscheidet
Kapitel 34 - Vergossenes Würzbier
Kapitel 35 - Vom Regen in die Traufe
Kapitel 36 - Der wahre Grund
Kapitel 37 - Gebundene Hände
Kapitel 38 - Sieger und Verlierer
Kapitel 39 - Das Endspiel
Kapitel 40 - Erwachen
Kapitel 41 - Abschlussprüfungen
Kapitel 42 - Epilog - Gut und Böse
Kapitel 43 - Nachwort
Glossar
Pascal Wokan
Der Arkanist
Band 1: Die Akademie des Himmels
Fantasy
Der Arkanist (Band 1): Die Akademie des Himmels
Ihr seht mich in Ketten, vorgeführt wie ein Verbrecher vor den Magistern der Himmelsakademie, an der ich einst als fleißiger Schüler ein und aus ging. Doch urteilt nicht zu schnell, denn ich möchte erst meine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes voller Hoffnungen und Träume, Leid, Schmerz und Zurückweisung. Die Geschichte eines tragischen Helden.
Aber beginnen wir ganz am Anfang. In meinem Leben hatte ich bereits viele Namen: Kind der Prophezeiung, Dunkler Lord, Gotttöter … Heute stehe ich einfach als Caelden vor euch. Caelden, der Waisenjunge, der vor Jahrzehnten an die Himmelsakademie kam und nicht ahnte, dass er eines Tages der mächtigste Arkanist werden würde, den die Welt je gesehen hat. Nur war das, was mich aus dem trostlosen Leben rettete, gleichzeitig meine Verdammnis. Denn sie waren schon immer meine größte Schwäche: Macht und das Streben danach, sie zu beherrschen.
Der Autor
Pascal Wokan, geboren 1986 in Frankfurt am Main, ist Maschinenbau-Ingenieur und arbeitet an einer Technischen Universität. Seit einiger Zeit veröffentlicht er regelmäßig Bücher, die Topplatzierungen in den Amazon-Bestsellerlisten besetzen. Er lebt mit seiner Familie in Weilburg, Hessen und widmet sich in seiner Freizeit nicht nur dem Schreiben neuer Romane, sondern auch der grundlegenden Frage, warum die Pizza immer auf der belegten Seite landet.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Februar 2025
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2025
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat: Lektorat Laaksonen | Stefan Wilhelms
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-340-0
ISBN (epub): 978-3-03896-341-7
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Wenn die Wahrheit zu schwach ist, sich zu verteidigen, muß sie zum Angriff übergehen
Bertolt Brecht
Prolog - Der Dunkle Lord
Man nannte ihn den Dunklen Lord.
Aber das war nur einer von vielen Titeln, die ihm im Lauf der Geschichte nachgesagt wurden. Die ersten Erzählungen berichteten über ihn als Kind der Prophezeiung. Andere nannten ihn Verzweiflungsbringer. Dann gab es jene, die ihn noch als Hüter des Sanktuars kannten. Doch der gängigste und zugleich bekannteste Titel saß Mavia wie ein Stachel im Herzen.
Gotttöter.
Heute sollte sie über diesen Mann richten.
Der verwahrloste Gefangene, der mit klirrenden Ketten in die Mitte des höchsten Raumes der Verliese von Aldanum schlurfte, hatte das fünfzigste Lebensjahr längst überschritten. Dennoch wirkte er nicht viel älter als dreißig. Obwohl er die Arkanisten, die ihn hierhergeführt hatten, tatsächlich überragte, stellte Mavia zu ihrer eigenen Überraschung fest – und entgegen allen Geschichten, die sie von ihm gehört hatte –, dass er kein Riese war. Nicht einmal ein finsteres Wesen.
Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Mann, dem man auf einer der umliegenden Himmelsinseln begegnen könnte. Seine Gesichtszüge waren markant, aber auch nicht gut aussehend, wobei Kinn- und Mundpartie von einem wuchernden Bart bedeckt waren. Übermäßig muskulös war er ebenso nicht, eher abgemagert, was seiner langen Gefangenschaft geschuldet war.
Was hingegen die Legenden um ihn bewahrheitete, waren seine durchdringenden kohlrabenschwarzen Augen. Es hieß, damit könne er bis in die Seele jedes Menschen blicken, weshalb jeder, der sich zu lange in seiner Nähe aufhielt, ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war.
Mavia hatte vor, das Gegenteil zu beweisen.
Die Fesseln des Gefangenen wurden an einem schweren Eisenring am Boden festgemacht. Es rumpelte und rasselte, als der Ring eingerastet und die Ketten gestrafft wurden. In jedes einzelne metallene Glied war ein Symbol aus Kreisen und Strichen eingelassen, das in geisterhaftem Licht leuchtete. Bannsigille, die den Dunklen Lord, sollte er trotz aller Behauptungen über den Verlust seiner Macht einen Ausbruchversuch wagen, niederstrecken würden wie ein göttlicher Blitz.
Dann stand er dort, ausgehungert, zerlumpt, ungewaschen und dreckig, mit fettigen dunklen Haarsträhnen, die ihm in die Stirn hingen. Gelassen schaute er sich im Raum um, ließ sich dabei Zeit, als läge alldem ein besonderes Geheimnis inne. Bis sein Blick auf Mavia fiel.
Er lächelte.
Ihre Finger kribbelten vor Aufregung und sie musste sich zwingen, nicht ständig am Kragen ihres schräggeknöpften Arkanistenmantels herumzufummeln – er war hochgeschlossen, lag eng auf der Brust an, fiel weit an den Ärmeln und reichte geschlitzt bis über die Knie. Stattdessen umschloss sie das schwere Medaillon auf ihrer Brust und schöpfte Kraft.
Die Geschichten über diesen Mann füllten ganze Bibliotheken und noch heute wurden hinter vorgehaltener Hand Schauermärchen über ihn erzählt.
Der Dunkle Lord. Der Feind aller Arkanisten.
Mavias Hände wurden feucht und die Anspannung zog sich wie ein Schraubstock um ihre Eingeweide fest.
Jahrelang hatte sie auf diesen Tag hingearbeitet. Nun war der Moment endlich gekommen.
»Caelden«, las sie von ihrer Abschrift und ließ den Mann nicht aus den Augen. »Ist dieser Name korrekt?«
»Caelden«, echote er mit kräftiger, tiefer Stimme, die seinen schwachen Zustand Lügen strafte. »Diesen Namen habe ich lange nicht gehört.«
Er klang nicht wie ein Ungeheuer, eher freundlich und zuvorkommend, als hätten sie sich zu einem netten Plausch eingefunden. Aber davon ließ Mavia sich nicht täuschen. Sie war mit den Schreckensgeschichten über ihn aufgewachsen, die man noch heute Kindern am Nachtbett erzählte, um sie zu mahnen, niemals die göttlichen Gesetze infrage zu stellen.
Das Polster des Stuhls knarzte, als sie sich nach vorn beugte, um über das erhöhte, glatte Podest auf den vorgeführten Gefangenen hinabzusehen. Kurz fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild: streng zurückgebundenes blondes Haar, verkniffener Mund, hohe Wangenknochen, tiefliegende Augen. Sie sah müde aus, was nicht verwunderlich war. Die letzten Tage hatte sie vor Aufregung und Furcht kaum schlafen können.
Neben ihr regten sich die beiden anderen Richter, die mit ihr zusammen über einen Mann urteilen sollten, der jahrzehntelang die Welt in Angst und Schrecken versetzt hatte. Jahrzehnte der Furcht und des Leids, bevor er sich freiwillig dem Hohen Rat ausgeliefert hatte. Jahrzehnte der Gefangenschaft, der Folter, des Aushungerns, der Qual, um ihm seine Geheimnisse zu entlocken, auf dass niemals wieder ein Arkanist solch eine Macht besitzen sollte. Doch bis zuletzt hatte er jene Geheimnisse für sich bewahrt und allen Bemühungen getrotzt, mehr über seine Beweggründe herauszufinden.
Deshalb waren sie hier.
Wie der Dunkle Lord so aufrecht dastand, Füße und Hände gefesselt, nichts weiter als dreckige Lumpen auf seiner knochigen Brust, wirkte er keineswegs, als hätte er etwas von seinem Stolz eingebüßt. Eher vermittelte er den Anschein, als beabsichtigte er, als freier Mann diesen Raum zu verlassen.
Unwillkürlich erzitterte Mavia. Wie beiläufig strich sie über die Münzen in den Laschen ihres breiten Arkanistengürtels an der Hüfte. Kühles, vertrautes Metall unter ihren Fingerkuppen. Dreißig aufgeladene Sigillmünzen, um die Elemente selbst heraufbeschwören zu können. Dabei war sie nicht die einzige Arkanistin im Raum. Neben der großen, sechseckigen Fensterfront, die einen Schimmer des beginnenden Tages hereinfallen ließ, standen jeweils drei Arkanisten. Ihre weiten blauen Mäntel sowie die eng geschnittenen Gewänder darunter, die mit silbernen Knöpfen schräg über die Brust geknöpft waren, wiesen sie als Meister aus.
An den Ausgängen, die zu beiden Seiten abgingen, waren ein Dutzend Wachen in steifen schwarzen Uniformen postiert, die blank polierten Klingen griffbereit. Außerdem waren in den angrenzenden Gängen zwei Hundertschaften versammelt. Zuletzt befand sich das Verlies auf der höchsten Himmelsinsel Aldanums, zweitausend Schritt über den Erdlanden, so weit entfernt von anderen Atollen oder Archipels, dass man unmöglich ohne aufgeladene Schwebesigille entkommen könnte.
Niemals zuvor war ein Gefangener den Verliesen entflohen. Niemals zuvor hatte jemand es gewagt, hier einzubrechen. Man sollte annehmen, dass all das ausreichte, um einen einzelnen Arkanisten aufzuhalten. DochderDunkleLord waralles andere als gewöhnlich.
Schließlich wandte sich Mavia wieder ihm zu. »Beantwortet die Frage mit Ja oder Nein!«
Der Gefangene lächelte höflich, als gäbe es nichts, das ihn noch ängstigen könnte. »Bitte verzeiht, Richterin, mir sind wohl in den vergangenen Jahrzehnten die Manieren ein wenig abhandengekommen. Bedauerlicherweise kann ich Eure Frage nicht gänzlich zu Eurer Zufriedenheit beantworten.« Die Ketten klirrten, als er die Hände hob. »Ja, mein Name ist Caelden. Doch dies ist einer unter vielen. Namen sind wichtig. Sie prägen uns wie eine Münze, drücken uns einen Stempel auf, der uns bis zu unserem Lebensende begleitet. In vielerlei Hinsicht sind sie die erste Form, in die wir von Geburt an gepresst werden. Ich bin sicher, Ihr wisst, wovon ich spreche, Richterin Mavia.«
Sie runzelte die Stirn. Man hatte sie über seine Redegewandtheit aufgeklärt.
Es hieß, er habe die Magister der Himmelsakademie bei seiner Aufnahmeprüfung überredet, ihm trotz aller Einwände das Studium zur Arkanistik zu gestatten. Aber das hielt sie wie so viele Gerüchte über ihn für ausgemachten Blödsinn. Was hingegen zweifellos eine Tatsache war, betraf die erschütternde Erkenntnis, dass er ihren Namen kannte – was unter den gegebenen Umständen nicht sein durfte.
»Ah, Ihr seid verwirrt, Richterin Mavia. Es war nicht meine Absicht, Euch in irgendeiner Weise nahezutreten. Euer bemerkenswerter Aufstieg blieb auch mir nicht verborgen. Obwohl man an diesem Ort«, er ließ seinen Blick durch den schmucklosen Raum gleiten, »nicht viel von der Außenwelt erfährt.«
Kurz nach ihrer Geburt hatte er sich gestellt und bezog seitdem das tiefste Verlies. Sie selbst hatte erst am Morgen erfahren, dass sie zur Richterin seiner Verhandlung eingesetzt wurde. Jahre der Vorbereitung, in denen sie ihr Feuer geschürt hatte, um es auf diesen Mann auszurichten. Denn er hatte mehr als ein Leben zerstört.
Aber alles der Reihe nach.
»Nun, Caelden«, sagte sie betont langsam. »Ihr wisst, warum Ihr dem Hohen vorgeladen seid?«
Er neigte leicht den Kopf. »Zumindest kann ich mir die Gründe erdenken. Doch fürchte ich, dass Ihr nicht den richtigen Blickwinkel auf die Ereignisse habt, um ein ungetrübtes Urteil über mich treffen zu können.«
Die beiden Richter regten sich wieder. Mavia konnte es ihnen nicht verübeln. Der Dunkle Lord hatte zahllosen Menschen den Tod gebracht, sein Name war verflucht und geächtet worden, der Himmel hatte in Flammen gestanden. Und am Ende hatte er den Zorn der Götter selbst auf sich gezogen.
Sie schüttelte den Kopf. Trotz Caeldens verwahrlostem Äußeren wirkte er wie ein ganz gewöhnlicher, zweifellos intelligenter und höflicher Mann.
Wie bizarr.
»Ihr befindet Euch«, sie blätterte um, »seit fünfundfünfzig Jahren in den Verliesen von Aldanum. Ist das korrekt?«
»Fünfundfünfzig Jahre?« Er hielt kurz inne. Bedauern und Überraschung legten sich wie ein Schatten über sein Gesicht. »Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist.«
Mavia faltete die Hände zusammen und musterte ihn von den nackten Füßen bis zum Haarscheitel.
Das sollte wirklich der Dunkle Lord sein? Etliche Male hatte sie sich diese Begegnung vorgestellt, sogar in ihren Träumen hatte sie überlegt, was sie sagen und tun würde, wenn er endlich vor ihr stünde.
Doch vielleicht war dieser Moment bloß eine Verkettung ungewöhnlicher Umstände, die, wenn sie erst einmal eingetreten waren, nichts von jenem besonderen Gefühl vermittelten, nach dem sie sich gesehnt hatte. Keine Befriedung. Keine Erleichterung. Nichts. Bloß ein Eindruck von Gerechtigkeit.
»In den mir vorliegenden Unterlagen schreibt Ihr«, sie hielt ein zerknülltes Papier hoch, das mit einer hauchzarten, geschwungenen Schrift versehen war, »dass Ihr vor dem Hohen Rat aussagen wollt. Ihr wollt Eure Taten gestehen und bittet darum, angehört zu werden.« Sie knallte das Blatt auf das Podest. »Ist das korrekt?«
Abermals neigte er den Kopf und schaute sie durch den Vorhang fettiger Haare an. »Ja.«
Erneut regten sich die beiden anderen Richter. Sogar die Meisterarkanisten warfen sich verstohlene Blicke zu. Wenn Caelden wirklich aussagen würde, könnte das Licht ins schattenumlagerte Dunkel einer verheerenden Zeit bringen, die noch heute wie ein Schandfleck auf allen Arkanisten ruhte.
Mavias Herz schlug schnell und ein Hochgefühl überkam sie. »Damit ich das richtig verstehe. Ihr wollt hier und heute vor dem Hohen Rat all Eure Taten gestehen? Ihr wollt die Gründe erläutern, weshalb Ihr den Krieg begonnen habt, wie Ihr Sigille erschaffen habt, die allen Naturgesetzen trotzen und …«
»Wie ich die Götter getötet habe?«
Auf einmal kam ihr der Raum viel kälter und drückender vor, als hätte der Winter an die Tür geklopft. Mavia überkam eine Gänsehaut und es rann ihr eiskalt den Rücken hinab. Das lag nicht unbedingt an dem silberdurchzogenen Obsidian, in den er gekleidet war. Auch nicht an der schweigsamen Versammlung, die sich hier eingefunden hatte.
Es war etwas anderes. Etwas Tieferes.
Etwas Böses.
Der Dunkle Lord lächelte unschuldig, als wären seine Worte bloß eine Nebensächlichkeit. »Das ist es doch, was Ihr sagen wolltet, oder, Richterin Mavia?«
Sie nickte den Wachen zu.
Ein Soldat schlug den Speerschaft in Caeldens Kniekehle. Er sackte mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Knie.
»Ihr sprecht, wenn Ihr dazu aufgefordert werdet. Habt Ihr das verstanden?«
Er nickte.
Mavia ließ sich mit den Worten Zeit und legte wieder den Brief von ihm vor sich ab, dessen Schrift nicht die eines Massenmörders oder die der Personifikation des Bösen war. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber nicht das.
»Man behauptet, dass Ihr ohne Umschweife auf den Punkt kommt, Caelden. Daher gedenke ich, das ebenso zu tun. Nun sagt mir, was hat Euch dazu verleitet, dem Hohen Rat eine solche Nachricht zu übermitteln?«
»Die Wahrheit.«
Ihre Finger zitterten. »Und was ist die Wahrheit?«
Ein inneres Feuer loderte in seinen Augen, als wäre darin eine Esse entfacht worden. »Um das herauszufinden, sind wir hier.«
Wieder lag dieses drückende Etwas in der Luft, als lastete das Gewicht eines Berges über der Versammlung. Es war ein Gefühl von grenzenloser Trauer und tiefem Schmerz, wie eine Wunde, die selbst nach Jahrzehnten nicht verheilt war.
Mavia wusste, dass die Reaktion nicht angebracht war, aber sie musste schnauben. »Ihr seid hier, weil wir es Euch gestatten.«
»Daran hege ich keinen Zweifel. Allerdings sind wir stets die Summe unserer Entscheidungen. Ihr habt entschieden, hier zu sein, weil Ihr auf der Suche seid. Ihr sucht die Wahrheit, Richterin. Die einzig wahre.«
Er trat einen Schritt auf sie zu und sofort erwachten alle Anwesenden im Raum zum Leben. Stahl blitzte und sang, die Luft um die Arkanisten flimmerte und die Sigillmünzen an ihren breiten Gürteln leuchteten.
Das beeindruckte Caelden offenbar nicht, als er einen weiteren Schritt nach vorn wagte – soweit es seine Fesseln zuließen.
»Die Wahrheit ist so zerbrechlich wie feine Keramik, Richterin Mavia«, flüsterte er heiser. »Wir sollten äußerst umsichtig mit ihr umgehen.«
Die Worte trafen sie wie ein Schock.
Um sich Zeit zu erkaufen und ihre Unruhe zu verbergen, sortierte sie ihre Unterlagen. Aber im Grunde wollte sie nicht, dass er sah, wie aufgewühlt sie war.
Schließlich hielt sie inne und sah ihn an. »Das sind die Worte eines Mannes, der unser aller Leben gezeichnet hat. Ein großer Mann. Ein Mann, der über allen Zweifeln erhaben war.«
Abermals lag etwas Unerwartetes in Caeldens Augen.
Dieser Mann hatte zahllosen Arkanisten den Tod gebracht und er fühlte … Bedauern?
»Euch ist gestattet, eine Frage zu stellen, Caelden!«
»Der Erzmagister ist tot, nicht wahr?« Er sprach leise und brüchig wie alter Ton.
»Ein schwarzer Tag für uns alle.«
»Wann?«
Sie legte die Fingerspitzen aneinander. »An dem Tag, an dem Ihr Eure Nachricht verfasst habt.«
»Das … wusste ich nicht.« Er atmete hörbar aus. »Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich ehrte ihn.«
Sie schwieg. Ansonsten hätte der Schmerz aus ihr gesprochen.
Der Dunkle Lord nickte langsam. »Es gibt keine Zufälle.«
»Wusstet Ihr, dass der Erzmagister bis zuletzt an Euch festhielt?« Ihre Stimme zitterte leicht und sie verdammte sich für dieses Anzeichen von Schwäche. »Seinetwegen konnte die Welt heilen. Nun, nicht gänzlich. Der Ort, an dem die Götter starben, wird auf ewig gezeichnet sein.«
»Der Erzmagister wurde nie den Makel los, dass er meine Ausbildung zum Arkanisten ermöglichte und somit den gefährlichsten Mann des gesamten Weltenrunds erschuf, nicht wahr?«
»Seid Ihr denn noch dieser Mann, Dunkler Lord?«
Das Wort hallte von den Wänden wider wie ein böses Omen, ließ die Soldaten erschaudern und die Arkanisten zusammenzucken. Sie musste all ihren Mut aufbringen, um sich nichts anmerken zu lassen. Es war, als bliese der Tod seinen eiskalten Hauch in ihren Nacken.
Caelden seufzte. »Eine ausgezeichnete Frage, Richterin Mavia, und ich habe lange gebraucht, um die Antwort darauf zu finden. Die Wahrheit ist, dass ich ein Mann bin, der darauf wartet, zu sterben.«
Für einen Moment herrschte Stille an diesem Ort, der den Verlauf des Schicksals verändern könnte, auch wenn die Welt nichts davon wusste. Ein schlichter Raum, eine scheinbar wahllose Versammlung und ein Mann, der mächtiger als die Götter gewesen war.
Mavia langte in ihre Tasche und legte einen Gegenstand auf den Tisch. Eine daumengroße, in der Mitte zerbrochene Münze, deren Sigille schon lange ausgeblichen und verkratzt waren. Sie waren geschwungen, an einer anderen Stelle gezackt und an zwei Bögen mit weiteren winzigen Sigillen besetzt, die sich alle denselben Ring teilten – so viele und dicht an dicht gesetzt, dass sie bei genauerer Betrachtung vor ihren Augen verschwammen. Ein Kunstwerk und ein Sakrileg zugleich.
Sie hielt die Münze hoch. »Ihr wisst, was das ist?«
Wieder seufzte er – ein seltsam menschlicher Laut bei ihm. »Ja.«
»Mit diesem Sigill habt Ihr einen Gott getötet?«
Seine Augen waren hart und dunkel wie geschliffene Onyxe. »Ja.«
»Wusstet Ihr, dass in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte Arkanisten versucht haben, dieses Sigill zu entschlüsseln?« Sie sprach leise und eindringlich. »Weder ist es ihnen gelungen, es zu kopieren, noch genügend Arkan aufzubringen, um es zu speisen. Es ist vollkommen.«
Ein gequältes Lächeln belebte seine Züge. »Nichts ist vollkommen, Richterin. Selbst die Götter waren es nicht.«
»Blasphemie!«, rief einer der Arkanisten. Er trat vor und ließ eine Münze an seinem Gürtel auflodern.
»Zurück!« Mavia war von ihrem Sitz aufgesprungen und hatte es überhaupt nicht bemerkt. »Tretet zurück oder Ihr verbringt die Nacht in einem Verlies!«
Der Arkanist entfernte sich wieder zum Fenster und senkte demütig den Kopf, aber in seinem Blick stand gezügelter Hass.
Mit wild hämmerndem Herzen setzte Mavia sich hin, trank einen Schluck aus ihrem Krug und ließ sich Zeit, um ihre Gedanken zu sortieren.
Richter Dareth beugte sich zu ihr. Er war ein hagerer, dürrer Mann mit Augen wie die eines Habichts und grauem, schaufelartigem Bart. Da sie den Vorsitz über die Verhandlung hatte, musste er zuerst Rücksprache mit ihr halten. »Gestattet mir eine Frage.«
Sie nickte auffordernd.
Dareth wandte sich Caelden zu. »Wie habt Ihr Euer Arkan verloren?«
»Diese Frage kann ich leider nicht zu Eurer Zufriedenheit beantworten. Ich habe es verloren.«
»Man sagt, es wäre ausgebrannt, nachdem Ihr das Sakrileg begangen habt.«
»Das könnte eine Erklärung dafür sein.«
»Und welche ist Eure?«
»Ich verspreche Euch, dass ich sie Euch liefern werde. Allerdings ist die Wahrheit veränderbar, je nachdem, wen man fragt. Die Menschen wollen nicht die Geschichte eines Schurken hören, sondern sich am Aufstieg des Helden erfreuen. Sie wollen nicht miterleben, wie er unter der Last der Bürde einer Prophezeiung zerbricht und die Scherben seines Selbst aufsammeln muss, um wiederaufstehen zu können.« Caelden redete leiser, kälter, hart wie gesplittertes Eis. »Sie wollen nicht die Wahrheit erfahren und ergründen, was sich hinter alldem verbirgt.«
Mavia machte eine versöhnliche Geste, als wollte sie damit zeigen, dass sie genau aus diesem Grund hier war. »Wenn Ihr unser Vertrauen gewinnen wollt, müsst Ihr Euch schon mehr anstrengen, Caelden.«
»Man sollte sich zuerst einmal unbeliebt machen, dann wird man ernst genommen.«
Die Worte schnitten wie Glasscherben in ihre Brust. Ein weiteres Zitat des Erzmagisters, das sich ihr eingebrannt hatte wie ein heißes Eisen. »Ihr wisst, wie schmal der Grat ist, der eine Wahrheit von einer überzeugenden Lüge trennt. Die historische Wahrheit von einer unterhaltsamen Geschichte.« Sie ließ ihre Worte kurz wirken. »Ihr wisst, was davon letztendlich Bestand haben wird. Wenn Ihr sprecht, müssen wir darauf vertrauen, dass Eure Wahrheit die einzig wahre ist.«
»Niemand kennt die Wahrheit«, raunte Caelden und machte eine rasche Handbewegung, die alles umfassen könnte, die Anwesenden, den Raum, die ganze Welt. »Nur das, was niedergeschrieben steht. Ich werde sie Euch bieten, aber muss Euch zuvor warnen. Ihr werdet daran zerbrechen, Richterin Mavia.«
»Und weshalb?«
»Was könnte härter, schneidender und niederschmetternder sein als die Wahrheit?«
Mavia schlug auf den Tisch, sodass alle Anwesenden aufschreckten. »Kommen wir zum Punkt, Dunkler Lord! Wir sind hier erschienen, weil wir nach all der Zeit immer noch nach Antworten suchen. Also sagt uns, was wollt Ihr?«
Einen Moment schwieg er, wirkte tief in sich gekehrt und gar nicht mehr wie ein uralter Mann, der in einem jungen Körper gefangen war. Eine Stille breitete sich zwischen ihnen aus, wie die Ruhe vor dem Sturm. Ein Arkanist regte sich. Ein anderer hüstelte. Ein kleiner Lärm inmitten der Stille. Aber es genügte, um sie in scharfe Splitter zu zerschlagen.
»Ich werde meine Geschichte ein einziges Mal erzählen.« Er wirkte seltsam gefasst, als bestärkten ihn seine Worte. »Hier. An diesem Ort. Ohne Unterbrechung. Einen ganzen Tag wird es dauern. Um zu verstehen, was zum Tod der Götter führte, muss man meine Geschichte verstehen. Die ganze Geschichte.« Er hielt kurz inne, als müsste er seine Gedanken sortieren. »Ihr werdet mich nicht unterbrechen. Ihr werdet nicht fragen oder Bemerkungen abgeben. Ihr werdet meine Worte als das akzeptieren, was sie sind: meine Schilderung der Ereignisse.« Seine Stimme klang nun eisern. »Der Zeitpunkt ist gekommen, da die Welt erfahren soll, was wirklich geschehen ist. Man nennt mich den Dunklen Lord, doch niemand außer mir hat jemals die Dunkelheit ergründet. Niemand begreift, dass diese Dunkelheit heute in uns allen stecken könnte. Ihr wollt mir meine Geheimnisse entlocken? Ihr wollt begreifen? Ihr wollt, dass ich mich unterwerfe und all meine Sünden gestehe?« Jedes Wort schmetterte er nieder wie einen Schmiedehammer. »Dies sind meine Bedingungen!«
Mavias Herz raste vor Aufregung. Sie nickte den beiden anderen Richtern zu. In ihren Augen erkannte sie den gleichen Funken, der auch sie hierhergeführt hatte.
Hier könnte endlich das geschehen, worauf alle Arkanisten so lange gewartet hatten. Es war ein Moment, als hielt die Welt den Atem an.
Als Mavia schließlich die Worte entließ, die sie wieder und wieder im Kopf durchgegangen war, klang ihre Stimme fest und voller Überzeugung. »Wir akzeptieren diese Bedingungen.«
Kapitel 1 - Vom Beginn
Warmes Morgenlicht flutete den Raum durch das große Fenster, bestens für den Beginn eines solchen Ereignisses geeignet. Pures Gold ergoss sich über den Obsidian, das Podest und die Stühle, über die Waffen der Wächter, über die aufgereihten Arkanisten und deren schimmernde Sigillmünzen, huschte über die Gesichter der Richter und erhellte das leere Blatt vor Mavia.
Ein leeres Blatt für eine Geschichte.
Es kündete von einem Beginn.
Doch als das Licht auf den Dunklen Lord fiel, war dort nichts zu erkennen. Es wagte nicht, ihn zu berühren. Die anderen Anwesenden bemerkten es natürlich nicht, denn sie sahen nicht richtig hin. Niemand tat das außer Mavia. Das Tageslicht fürchtete ihn.
Zu Recht.
Ein sanftes, zufriedenes Lächeln umspielte Caeldens Lippen, als er zwei Schritte zurücktrat. Die Ketten an seinen Händen und Füßen klirrten und rasselten, während er sich im Schneidersitz auf dem Obsidian niederließ und so unbeschwert dasaß, als wäre alles so eingetreten, wie er es geplant hatte. Noch immer konnte Mavia nicht glauben, dass dieser Mann der Dunkle Lord sein sollte, der die Götterdämmerung heraufbeschworen und sie auch noch besiegt hatte. Ihm wurde so viel Leid nachgesagt, es füllte ganze Bibliotheken.
»Wie viele Blätter habt Ihr?«, fragte er.
Mavia runzelte die Stirn. »Weshalb fragt Ihr?«
»Meine Geschichte umfasst viele Jahre. Ich möchte nur sichergehen, um einer Unterbrechung vorzubeugen, Richterin Mavia.«
Sie sortierte ihren Stapel, begutachtete ihre Utensilien und legte ein schmales Lächeln auf. »Vertraut mir, ich habe genügend.«
Er nickte höflich. »Ich vertraue Euch nicht. Aber das wird sich bald ändern. Wir alle in diesem Raum werden uns auf die eine oder andere Weise verändern. Denn die Wahrheit schneidet tiefer, als es jedes Messer vermag, und bringt das zum Vorschein, was uns wirklich bewegt.«
Mavia berührte die metallene Schreibfeder und speiste das eingelassene Tintsigill mit ein wenig Arkan. Gleichzeitig zapfte sie ein Luftsigill höherer Ordnung an ihrem Gürtel an und ließ die Feder emporschweben.
Mit einem raschen Wink senkte sich diese über das leere Blatt. »Nun?«
»Seid Ihr eine Chronistin?«
Die Frage überraschte sie und sie hielt einen Moment inne, um ihre Antwort abzuwägen. In seiner Nähe durfte sie auf keinen Fall zu viel von sich preisgeben, damit er dies nicht gegen sie verwendete. »Angenommen es wäre so. Warum fragt Ihr?«
»Eure Geste und wie Ihr das Tint- und das Schwebesigill beherrscht, sprechen von viel Erfahrung, Richterin.«
»Möchtet Ihr beginnen?«
Kurz wirkte er enttäuscht, als hätte er sich eine Erklärung erhofft, überspielte das jedoch gut, indem er die Mundwinkel hob und sich vorbeugte. »Diese Geschichte wird nur ein Mal erzählt und deshalb sollten wir ihr auch die nötige Aufmerksamkeit schenken. Es könnte sein, dass ich abschweife oder Dinge noch einmal aufgreifen muss, weil ich sie zuerst anders in Erinnerung hatte. Vergesst nicht, ich bin kein Adliger. Ich stamme aus keinem trauten Heim, hatte nie eine Familie, auf deren Unterstützung ich bauen konnte oder gar ein Erbe. Allein meine Gabe zum Arkan hat zu damaligen Verhältnissen für einen regelrechten Skandal gesorgt.«
»Ihr wart der erste bürgerliche Arkanist.«
»Ja, das war ich. Damals war das Studium an der Himmelsakademie nur Adligen vorbehalten und selbst unter ihnen konnten nicht alle den Grad an blauem Blut aufbringen, um dort studieren zu dürfen.«
Sie rang mit sich, dann entschied sie, ihm die Wahrheit nicht vorzuenthalten. »Seit einigen Jahren werden Menschen jeden Standes an der Himmelsakademie unterrichtet.«
»Tatsächlich?« Er zog ein überraschtes Gesicht. »Das ist eine schöne Neuigkeit. Allerdings ändert sie nichts an dem Umstand, dass ich aus einer anderen Zeit stamme. Andere Adepten waren mir stets einen Schritt voraus. Sagen wir, sie hielten mich für einfältig und dumm, was zuweilen zu einigen interessanten Wendungen geführt hat.«
Sie schrieb ein paar Zeilen nieder. Nichts Bedeutendes, bloß um ihre Gedanken zu sortieren. »Ein Umstand, den Ihr bereits im ersten Studienjahr relativiert habt, wie man sich erzählt.« Sie sah auf. »Korrekt?«
Er faltete seine Hände im Schoß zusammen. »Ich bin ein Mann von niederer Geburt, der stets damit zu kämpfen hatte, seinen Makel loszuwerden. Weil alle immer das in mir gesehen haben, was ich war: jemand, der nicht dazugehört.«
»Die tragische Geschichte des jungen Helden.« Sie konnte nicht verhindern, dass Bitterkeit aus ihrer Stimme sprach.
»In meiner Geschichte gibt es keine Helden.« Einen Augenblick wirkte er tief in sich gekehrt. »Nein, es war die treibende Kraft, die mich wachsen ließ. Viele begehen den Fehler, einen Makel als Schwäche zu sehen. Aber das ist es nicht.«
»Sondern?«
»Es ist eine Chance. Eine Gelegenheit, um sich selbst anzuspornen.«
Als er in Schweigen verfiel, sah sie auf. »Beginnt!«
»Der Beginn.« Er atmete laut aus. »Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Nun hört meiner Geschichte gut zu, Richterin Mavia, denn ich werde sie nur ein einziges Mal erzählen. Diese Reise wird uns verändern. Ihr werdet die Welt mit anderen Augen sehen und dann die eine einzige Wahrheit erkennen, nach der Ihr so sehr dürstet.«
»Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen.«
Er lächelte wieder. »Bevor ich beginne, gestattet Ihr mir eine letzte Frage?«
Mavia winkte auffordernd.
»Habt Ihr Euch jemals gefragt, was geschieht, wenn der Dunkle Lord siegt, aber seine Taten bereut? Wie es für ihn weitergeht, wenn er alles erreicht hat, was er sich jemals erträumt hat, aber keine Freude daran empfindet?« Er atmete hörbar aus. »Diese Geschichte gibt die Antwort darauf.«
Mein Name ist Caelden. Einst war dieser Name der Welt nicht geläufig. Es war bloß einer unter vielen in einem Reich, das von machtvollen Arkanisten bevölkert wurde, die über die Geschicke des Landes entschieden. Dazu sollte angemerkt sein, dass ich meinen wahren Namen nie kannte. Ich wachte eines Morgens inmitten der dunkelsten Gassen Aldanums auf und entschied, wie ich fortan heißen sollte. Diese Tatsache ist wichtig, denn sie sagt viel über mich aus. Sie beweist, wie sehr ich von mir und meinem Weg überzeugt war.
Noch wichtiger als Namen sind Absichten. Ohne ein Ziel im Leben wird man nie etwas erreichen können. Meine Ziele waren schon immer hoch, denn ich begann dort, wo kein anderer Arkanist vor mir je begann: am Ende.
Caelden ist nur einer unter vielen Namen, die mir gegeben wurden, und im Verlauf der Zeit trug ich mehr, als irgendjemand tragen sollte. Viele Magister nannten mich Unruhestifter, Regelbrecher und Aufrührer – was ich nie sonderlich treffend fand. Im Nachhinein konnte man darin vielleicht ein Vorzeichen sehen.
Ich wurde als ›Kind der Prophezeiung‹ bezeichnet und tatsächlich sah es auch eine ganze Weile danach aus, als könnte ich jene große Bürde schultern, die mit dem Titel einherging. Die meisten kennen mich jedoch als Dunkler Lord, dabei war ich nie ein Lord. Ich war nur ein Mann, dem auf der Suche nach der Wahrheit jedes Mittel recht war. Es gibt noch viele Bezeichnungen mehr, die mir nachgesagt werden, allerdings möchte ich nicht vorgreifen und mich auf die Wesentlichen konzentrieren.
Ich habe das Verständnis des Arkanen verändert.
Ich habe Städte niedergebrannt, weil sie mich davon abhalten wollten, meine Ziele für einen höheren Zweck zu erreichen.
Ich habe das Blutsigill erschaffen und es so oft genutzt, um eine Armee aus ergebenen Gefolgsleuten hinter mir zu versammeln.
Ich bin weiter gegangen als irgendjemand zuvor, und selbst dann habe ich nicht aufgehört, noch weiter, noch höher, noch mächtiger hinauszukommen.
Ich wandelte auf Pfaden, vor denen andere schreiend davongerannt wären, und habe Wissen erforscht, das mich für immer verändert hat.
Ich habe das Dunkelfeuer beherrscht, habe Jungfrauen vor Drachen gerettet, den strahlenden Helden bezwungen, mit Göttern gesprochen und sie am Ende getötet.
Dies ist meine Geschichte.
Die Geschichte des Dunklen Lords.
Um zu verstehen, wer ich bin, müssen wir am Anfang beginnen. Da ich aber niemanden mit meiner Kindheit langweilen möchte, begeben wir uns direkt zum Kern dessen, was ich bin. Dazu sollte man bedenken, dass ich genau jener Bauernjunge, Ziegenhirte oder Schmiedegeselle aus den alten Geschichten bin, die wir alle so liebgewonnen haben und an denen wir uns kaum satthören können. Ein junger Mann, der allen Hindernissen zum Trotz an das Gute glaubt, und nach einer beschwerlichen Kindheit zu einem Abenteuer aufbricht, das ihn und die Welt für immer verändern wird.
Allerdings waren die Herausforderungen so groß, dass ich erst meine Rolle finden musste. Ich wurde zu dem, der das Böse besiegt und das Gute triumphieren lässt, wie es in jedem Epos der Fall ist. Doch am Wendepunkt all dessen musste ich zu dem werden, was jene Helden stets zu bekämpfen schworen.
Der Antagonist.
Als mein Abenteuer beginnen sollte, nahm ich vieles von dem mit, was ich auf der Straße gelernt habe. Wenn man als Kind ausgesetzt wird, weil die eigenen Eltern sich vor einem fürchten, oder weil sie zu arm waren, um sich um mich zu sorgen – ich bevorzuge die zweite Vorstellung, weil ich erst spät die Wahrheit erfuhr –, gibt es für einen Jungen, der nur so vor Abenteuerlust strotzte, nicht viele Optionen. Ich lernte, auf der Straße zu überleben, erfuhr vieles über die Rangordnung in Banden, machte mir schon bald einen Namen als Taschendieb in den entlegensten Gegenden Aldanums. Bis ich schließlich auf frischer Tat ertappt und in ein Waisenhaus verfrachtet wurde.
Ich will unsere Geschichte nicht damit aufhalten, wie ich zu diesem Zeitpunkt die erste einer langen Reihe heftiger Prügel erlebt habe. Manches aus der Kindheit vergisst man eben nicht.
Das Waisenhaus war eines von jenen, das Straßenkindern eine Zuflucht bot. Essen, ein Bett zum Schlafen und ein Dach über den Kopf. Die Wahrheit war jedoch: Aldanums Stadtherr hatte diese Häuser nur gebaut, um den Abschaum der Straße aufzufangen und unter Kontrolle zu bringen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir nicht gut behandelt wurden.
Ab und an besuchte uns ein Arkanist, um nach dem Rechten zu sehen. Ich hasste, fürchtete und verehrte ihn zu gleichen Teilen. Er war groß, einflussreich, sorgte für den Schutz des Reiches und galt in Aldanum als Held.
Kurz gesagt: Er schützte die Straße vor Gesindel wie uns und besaß alles, was ich mir jemals erhoffte: Macht.
Wenn man verstehen möchte, wie ich zu dem Menschen wurde, dessen Namen im gesamten Weltenrund mit Furcht ausgesprochen wird, dann sollte man hier beginnen. Hier liegt die Wahrheit dessen, was mich aufsteigen ließ.
Der Waisenjunge mit einem ganz besonderen Talent, das nur darauf wartete, entfaltet zu werden.
Die Geschichte des Dunklen Lords
Kapitel 2 - Waisen, Bettler und Adlige
Die Schüssel klatschte vor mir auf den Tisch.
Ich wagte nicht, den Kopf zu heben. Zum wiederholten Mal zählte ich die Kerben, Mulden, Kratzer und Flecken auf dem angeschimmelten Holz und wartete, bis die Leiterin die nächste Schüssel gefüllt und dem Mädchen neben mir vorgesetzt hatte. Die Leiterin war eine Vogelscheuche. Ihre Finger waren bloß Zweige, die an Äste angeklebt worden waren, ihr flachsblondes Haar erinnerte an einen Reisigbesen und ihre Augen traten so sehr aus den Höhlen, dass ich jedes Mal fürchtete, sie könnten einfach herausfallen. Leider waren wir Waisenkinder ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Die Leiterin ging weiter, tischte jedem Kind auf – wir waren insgesamt zwei Dutzend – und nahm dann Abstand, um uns das Signal zu geben. Erst jetzt durften wir den Kopf heben und nachsehen, welch köstliches Mahl uns serviert worden war.
Haferschleim mit Apfelstückchen.
Mein Magen knurrte und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Es ging nichts über einen Apfel! Wir nahmen unser Holzbesteck und warteten, bis Domin sich zu uns gesellte und am Tisch Platz nahm. Er war ein Tattergreis mit einer Glatze wie ein frisch gepelltes Ei.
Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, was wohl passieren würde, wenn ein Küken daraus schlüpfte. Wie alle Priester trug er ein graues, verschlissenes Gewand, eher ein Fetzen denn ein Kleidungsstück, ging barfuß und vermittelte mit seiner gebeugten Haltung und seinem trüben Blick jene Glaubensvorstellung an die Viereinigkeit, der auch wir unterworfen waren. Aber ich mochte ihn, denn er war ehrlich und gut zu uns.
Ich war fünfzehn Jahre alt und inzwischen einer der Älteren im Waisenhaus. Ein Jahr noch und man würde mich einem örtlichen Schmied, Bäcker oder Händler als Geselle zuweisen, damit ich etwas Vernünftiges erlernte und ein sinnvolles Mitglied der Gemeinschaft wurde.
Natürlich hoffte ich auf anderes. Dabei wusste ich nicht einmal, worauf genau ich hoffte. Man musste es mir verzeihen, ich war jung und glaubte zu wissen, wie die Welt funktionierte.
Ächzend ließ Domin sich auf seinem Stuhl an der Stirnseite nieder, schnappte sich das Besteck und schob sich einen Löffel Haferschleim in den Mund. Die Leiterin räusperte sich. Er grinste, legte das Besteck ab, hielt die Hände vor das Gesicht und beugte sich tiefer.
Ich wartete nicht darauf, dass der ungehaltene Blick der Leiterin mich traf und nahm dieselbe Gebetspose ein, um mein Antlitz vor den vier Göttern zu verbergen. Dabei spähte ich durch die Finger und bemerkte, wie die anderen zögerlich der Aufforderung folgten.
Das Mädchen neben mir – ihr Name war Yenna – rollte mit den Augen und nahm dann mit betonter Lässigkeit die Pose ein. Sie gab niemals den Kampf auf. Außerdem war sie das einzige Mädchen, das niemals weinte. Eine wahre Rebellin.
»Erdenmutter, segne unsere Familie mit Gesundheit und Nahrung«, sagte Domin mit schwerer Stimme. »Wassermann, stärke unsere Wurzeln und spende uns Ausgleich und Fürsorge. Windgebieterin, beflügle uns auf unserer Reise im Leben.«
Ich sprach mit und kannte die Worte auswendig. Die Leiterin würde mitbekommen, wenn ich das nicht tat. Manchmal überkam mich der Verdacht, sie wäre gar kein Mensch, sondern ein Dämon der Verdammnis. Und am liebsten verspeiste sie Waisenkinder.
Yenna stieß mich leicht an. Ich linste durch die Finger. Niemand regte sich. Der Blick der Leiterin brannte wie ein Peitschenhieb. Rasch verbarg ich wieder mein Gesicht. Vermutlich würde sie mich für diese Dummheit maßregeln.
Domin legte eine kurze Pause ein, wie er es immer tat, um das Gebet wirken zu lassen, bevor der Schlussteil begann. »Feuerschmied, stärke uns mit deinem Mut und deiner Flamme gegen die Verdammnis.«
»Feuerschmied, stärke uns mit deinem Mut und deiner Flamme gegen die Verdammnis«, echoten wir.
Dann ließen wir die Hände sinken und durften essen. Ich will nicht lügen, der Haferschleim war schauderhaft. Aber es war alles, was wir bekamen. Deshalb schlang ich ihn mit Heißhunger herunter und leckte sogar den Rand ab, als die Leiterin unaufmerksam war.
Als ich gerade meine Zunge in der Schüssel versenkte, bemerkte ich, wie mich Domin beobachtete. Er grinste mich an und schlabberte nun in seiner Schale herum. Ich machte es ihm nach und schon bald saßen wir alle schlabbernd am Tisch und erfreuten uns daran, Spaß haben zu dürfen.
Die Leiterin sah das nicht gerne, aber sie konnte nichts dagegen tun. Domin zeigte uns, dass wir nicht nur Ausgestoßene waren, sondern auch einmal herzhaft lachen durften – solange wir die Hausregeln befolgten.
Als wir mit dem Essen fertig waren, warteten wir wieder, bis Domin sich erhob und zur Nachtruhe begab. Das oberste Gebot besagte: niemand durfte eher aufstehen. Außerdem war die Nachtruhe etwas Heiliges.
Es wurde nicht gelacht, gerufen, geschlagen, getreten oder in sonstiger Weise auf sich aufmerksam gemacht. Die Bestrafung dafür hatte ich in meiner ersten Nacht erfahren müssen und war froh, nur eine kaum sichtbare Narbe an der Schläfe davongetragen zu haben. Doch wie in so vielen Geschichten sollte auch diese Nacht belehrend für mich sein.
Es war das erste Mal, dass ich feststellte, wie besonders ich war.
»Caelden!«
Ich wurde mit einem Ruck wach und blinzelte den Schlaf aus den Augen.
Es war dunkel und ich konnte nicht einmal die eigene Hand vor mir sehen, aber ich nahm ganz deutlich wahr, wie sich jemand über mich beugte.
Yenna, wer sonst?
»Caelden, bist du wach?«
Ich schluckte schwer. Meine Zunge klebte am Gaumen fest. »Jetzt schon.«
»Steh schon auf!«
»Wieso?«
»Darum!«
»Ach so.« Ich streckte mich.
Auch wenn ich in der Blüte meiner Jugend stand, zählte Schlafen auf dem harten Boden mit nichts als einem dreckigen, strohgefülltem Kopfkissen und einem alten Laken nicht gerade zu jenen Unannehmlichkeiten, an die ich mich gerne zurückerinnerte.
Ich brauchte einen Moment, mich zu orientieren, aber Yenna zog mich bereits auf die Füße. Da man ihr nicht widersprach – sie war mutiger als alle anderen –, ließ ich mich in der Dunkelheit durch ein Labyrinth schlafender Waisenkinder führen.
Sie brachte mich zu einer Treppe zum Dachboden. Natürlich durften wir nicht hinauf.
Das war auch der Grund, weshalb ich die ersten Nächte damit verbracht hatte, das verrostete Schloss aufzuhebeln, um das Geheimnis dort zu lüften.
Allmählich gewöhnte ich mich an die Dunkelheit. An der Treppe fiel ein Streifen Mondlicht durch die Ritzen der vorgeklappten Fensterläden und ließ mich einen Blick auf die ausgetretenen Stufen erhaschen.
Wir kletterten rasch hinauf und ich gab mir Mühe, Yenna nicht allzu sehr anzustarren. Götter, ich hatte mich immer noch nicht getraut, ihr zu gestehen, wie verknallt ich in sie war. Vielleicht wusste sie es bereits. Es war egal.
Sie blieb auf der obersten Stufe stehen und winkte mich heran. Ich kletterte zu ihr und war ihr so nahe, dass mein Herz raste. Yenna nickte mit dem sturen Kinn zum vorgelegten Schloss.
»Was?«, flüsterte ich.
»Mach schon!«, zischte sie.
»Ich werde jedes Mal so müde.«
»Willst du sehen, was ich dir zeigen will, oder nicht?«
»Yenna …«
»Dann frag ich eben Lobos.« Sie machte Anstalten, die Treppen wieder hinunterzuklettern.
Darin war sie gut. Yenna wusste ganz genau, dass ich ihr keinen Wunsch abschlagen konnte. Außerdem war Lobos ein Arsch, der ihr nur hinterherrannte, um mich zu ärgern.
»Warte!«
»Ich warte.«
Ich rang mit mir, ehe ich seufzte. »Also gut.«
»Braver Junge!«
»Rück mal ein Stück zur Seite, Yenna.«
Sie grinste mich frech an. Im Mondlicht erkannte ich jede einzelne Sommersprosse auf ihrer Stupsnase. Sie war ein Jahr jünger als ich, aber den Gerüchten nach war sie schon seit ihrer Geburt im Waisenhaus.
Es gab Gerede, sie wäre die Tochter der Leiterin, was ich nicht glaubte. Dafür wurde sie zu oft verprügelt.
Ich starrte das Schloss an und versuchte, mich in jenen Zustand zu versetzen, den ich benötigte, um ein Wunder zu wirken. Mir fiel kein anderer Begriff dafür ein und ich war froh, dass Yenna mein Geheimnis für sich behielt.
Behutsam legte ich eine Hand auf das rostige Schloss und griff mit meinem Geist in mich hinein.
Natürlich hatte ich die Gerüchte von den Arkanisten und ihren Mächten vernommen. Zwar hatte ich nie gesehen, wozu sie imstande waren, doch sie waren so imposant, groß und einfach eindrucksvoll, dass sie vermutlich die Elemente selbst heraufbeschwören konnten. Deshalb war für mich ausgeschlossen, dass es mit dem sagenumwobenen Arkan zu tun haben könnte. Es war mein Wunder; mein eigenes geheimes Wunder, das ich manchmal vollbringen konnte, um die Welt nach meinem Willen zu formen.
Nun, nicht ganz, allerdings reichte es, ein gespenstisches Glühen unter meiner Hand zu erschaffen. Das Schloss stöhnte und ächzte, dann erklang ein leises Knacken, wie ein Spiegel, der eingedrückt wurde.
Das Schloss öffnete sich wie von Geisterhand.
Es war nicht kaputt oder etwas in der Art. Es hatte sich nur auf meinen Wunsch hin für einen Augenblick so verbogen, dass es aus dem Riegel schnappte. Schließlich war es wichtig, nicht bei einem spontanen Rundgang der Leiterin auf den Dachboden entdeckt zu werden.
In dem Riegel selbst gab es ein Muster aus Ringen und Linien. Ich hatte keine Ahnung, wer so mutig gewesen war, es einzuritzen, aber es war schon hier, seit ich mich erinnern konnte.
Ich versuchte, mich auf meine unbeholfene Art zu verbeugen und wurde sogleich für meinen Hochmut bestraft. Mit rudernden Armen rutschte ich von der Stufe … und eine Hand bewahrte mich vor einem Sturz.
»Gern geschehen!« Yenna zog mich zurück.
Für ihre geringe Größe hatte sie erstaunlich viel Kraft. Ein wenig eingeschüchtert und mit wild pochendem Herzen kletterte ich ihr auf den Dachboden hinterher.
Ein Wechsel aus Helligkeit und Finsternis verlieh diesem Ort etwas Magisches. Staubkörner tanzten in Mondlichtbalken, die durch das undichte Dach fielen, es roch alt und abgestanden und nach Geheimnis. Einige der Dielen knarzten, deshalb hatten wir ein Spiel entwickelt, welche Dielen wir berühren durften, um ans andere Ende zu kommen. ›Der Boden ist Feuer‹ nannten wir es und Yenna schlug mich jedes Mal. Ich ließ sie gewähren, weil ich es mochte, wie sie sich darüber freute.
Wir tänzelten einen verborgenen Pfad entlang, wichen den Lichtbalken aus und bewegten uns ans Ende des Dachbodens, wo ein kleines, vergittertes Fenster angebracht war.
Natürlich war Yenna zuerst da. »Zu langsam!«
Als ich schließlich neben ihr auf dem Sims saß und hinaussah, wusste ich, dass es jede Mühe wert gewesen war. Zwar war ich von meinem Wunder nun erschöpft – ich hätte auf der Stelle einschlafen können –, außerdem knurrte mein Magen so laut, als wollte er sich selbst aufessen. Aber ich mochte diese Zeit der tiefsten Nacht, wenn die Stadt im Schlummer lag; wenn die Welt den Atem anhielt und das Tuch der Dunkelheit für Frieden an jedem Ort im Weltenrund sorgte.
Von hier aus konnten wir die ganze Stadt überblicken, ein Teppich aus flachen und schiefen Steingebäuden, so dicht an dicht gedrängt, dass sie kaum voneinander zu unterscheiden waren. Ein Netz wirrer Gassen und Straßen, in denen man sich leicht verirren konnte, zog sich bis zum Horizont, wo die Stadt weiter anstieg und die Bezirke der Adligen begannen. Dort waren die Dächer nicht mit schlecht gebrannten Ziegeln bedeckt, sondern mit Schiefer. Die Fachwerkhäuser waren mehrstöckig, die Fassaden besaßen keine Risse und es gab breite Prachtstraßen, Alleen, Springbrunnen und grüne Parks. Eine andere Welt, die mir so weit entfernt vorkam wie der Mond.
In der ganzen Stadt verteilt standen etwa ein Dutzend monolithischer Festungen. Die Heimstätten der Arkanisten waren reich verziert, mit hohen Toren, die nur wenigen Durchlass boten, und trugen Familienwappen in Form von riesigen Symbolen an der Front. Dabei war das Privileg, über das Arkan zu verfügen, nichts, was ein gewöhnlicher Mensch erlangen konnte. Es war das Geburtsrecht der Adligen.
»Irgendwann will ich dorthin«, flüsterte Yenna und deutete in den Himmel.
Über der Stadt, mehrere tausend Schritt am Himmel, schwebten die Himmelsinseln und warfen ihre Schatten auf die Welt. Gewaltige schwarze Umrisse, die sich um einen gigantischen Brocken in ihrem Zentrum tummelten, der alle anderen überragte. Ein Berg aus Türmen; ein Ort, der für alles stand, was für mich unerreichbar war.
»Die Himmelsakademie?«, fragte ich.
Ein freches Grinsen erhellte ihr sommersprossiges, rundliches Gesicht. Wie bei allen Waisenkindern waren ihre blonden Haare fingerlang geschoren, was mich allerdings keineswegs störte. Für mich war sie das hübscheste Mädchen im Heim – nicht dass ich viele kannte.
»Klar die Himmelsakademie, du Dummkopf!«
»Nur Arkanisten können dorthin.«
Sie verdrehte die großen grünen Augen. »Weiß ich doch.«
Ich rückte näher. »Bist du denn eine?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht.«
»In diesem Fall musst du wohl eine Adlige sein.« Ich räusperte mich. »Verzeiht, dass ich die werte Dame mit meinem üblen Geruch belästige.«
Sie hielt sich in gespielter Entrüstung die Brust. »Wie kannst du es nur wagen, du anrüchiger Dieb? Oder bist du gar hier, um mein Herz zu stehlen?«
»Ich dachte, das hätte ich längst, Mylady.«
Yenna grinste, ehe sie auf einmal ernst wurde. »Ich werde es hier vermissen.«
Die Worte schockten mich. Ich öffnete den Mund, doch bekam keinen Laut darüber.
»Gestern kam jemand ins Waisenhaus.« Traurig blickte sie über die Stadt. »Er will für mich sorgen.«
Mir blieb für einen Schlag das Herz stehen. »Du gehst?« Blass und dünn, als könnte der schwächste Windhauch meine Stimme zerteilen wie ein Messer.
Sie seufzte und wandte den Blick ab. »Ich muss.«
Mir verschlug es glatt die Sprache und ich brauchte einen Moment, bis ich meine Stimme wiederfand. »Aber … du kannst nicht gehen!«
Sie sah mich an, ihre Augen schimmerten vor Traurigkeit. »Und warum?«
Ich griff in die Luft, als verbarg sich dort das Argument, mit dem ich sie überzeugen könnte. »Weil … weil …«
»Stich- und hiebfestes Argument, was?«
Langsam ließ ich die Hände sinken. Meine Eingeweide füllten sich mit Eis. »Wer?«
Erst schaute sie scheu zu Boden, dann hob sie den Kopf und atmete tief durch. Ja, Yenna war eine Rebellin, aber sie war auch nicht dumm und wusste, wann ein Kampf verloren war. »Ein Adliger. Er hat eine Frau und einen Sohn. Sie wünschen sich eine Tochter.«
»Und wenn nicht? Was, wenn sie bloß …«
Yenna warf mir einen solch grimmigen Blick zu, dass ich mich an meinen eigenen Worten verschluckte.
Wer war ich, dass ich über sie urteilen wollte? Sie hatte Glück, von jemandem aufgenommen zu werden. Mir würde ein anderes Schicksal blühen. Vermutlich würde ich Schmiedelehrling werden und irgendwann mein Leben als alter, gebrochener Mann beenden – ohne etwas Großes vollbracht zu haben.
Ich presste die Hände zusammen, bis es schmerzte. Und presste weiter.
Das war ungerecht! Warum war ich hier? Warum wollte mich niemand aufnehmen? Warum …
Knack!
Erschrocken sah ich auf. Ein feines Netz aus Rissen breitete sich im Fenster aus.
War etwas dagegen geflogen? Nein, kein Vogel. Ein weiteres Wunder?
Yenna beugte sich vor und strich die Risse entlang. Dann starrte sie mich einen quälenden Augenblick an. »Warst du das?«, flüsterte sie.
»Ich … Keine Ahnung.« Ich betrachtete meine verkrampften Hände und öffnete sie vorsichtig. Mich ereilte die Erschöpfung, als hätte mir die Leiterin die Pfanne über den Latz gezogen. Der Raum drehte sich um mich und ich fiel zur Seite. Mit einem dumpfen Aufschlag landete ich auf den Dielen, die bedrohlich knackten. Schließlich war mein Blick wieder klar.
Yenna hielt sich einen Finger vor die Lippen und sah sich verstohlen um. Ich wagte nicht einmal zu atmen.
Nichts geschah.
Wir entspannten uns und ich ließ mich auf dem Sims nieder. Das Fensterglas war gesprungen.
Hatte ich mir die Schwäche nur eingebildet?
»Wirst du an mich denken, Caelden?«, fragte Yenna.
Götter, was für eine Frage! »Immer.«
Sie beugte sich vor und küsste mich auf die Lippen. Ich erstarrte. Ihre Lippen berührten meine – sanft und zögerlich.
Ehe ich mich berappeln konnte, sah sie wieder aus dem Fenster, als wäre nichts geschehen. Alles in mir schrie, sie in den Arm zu nehmen und ebenfalls zu küssen. Aber ich war jung und unerfahren. Deshalb tat ich so, als wäre nichts geschehen, auch wenn in mir ein Zwillingsgefühl aus Traurigkeit und Freude lebte.
»Ich glaube, du bist besonders, Cael.« Sie strich weiter über die Risse im Glas. »Vielleicht bist du ein Arkanist?«
»Nur Adlige sind Arkanisten.«
»Ich weiß, aber …« Sie zögerte. »Was, wenn doch?«
»Dann wäre ich nicht hier, oder?«
»Vielleicht waren deine Eltern Adlige? Vielleicht …« Sie biss sich auf die Lippen.
Offenbar hatte sie bemerkt, wie sehr es mich grämte, darüber zu sprechen. Es war nicht so, dass ich meine Eltern dafür verachtete, wie sie mich ausgesetzt hatten. Ich kannte sie ja nicht einmal.
Dennoch lebte in mir die Frage: Warum? Ich sollte mich glücklich schätzen, wenigstens im Waisenhaus Zuflucht gefunden zu haben. Ich und ein Adliger? Nein, davon war ich so weit entfernt wie Himmel und Erde.
Ich war so sehr in Gedanken, dass ich viel zu spät den Kopf entdeckte, der durch die Luke in den Dachboden spähte. Ehe ich mich versah, war er auch schon wieder verschwunden.
Hatte ich etwa vergessen, die Luke zu schließen?
»Yenna«, sagte ich angespannt.
Sie strich über das Glas. »Hm?«
»Wir müssen gehen. Jetzt!«
»Warum? Es ist doch noch …«
Stiefel polterten auf der Leiter. Wir sahen uns gehetzt an.
Der wirre Kopf der Leiterin erschien in der Luke. Selten hatte ich jemanden so wütend gesehen.
Sie kletterte auf den Dachboden, marschierte über die Dielen, die ein Konzert knarzender Laute ausstießen, und packte mich am Kragen. Wie ein Karnickel schleifte sie mich über den Dachboden zur Luke und stieß mich die Leiter hinunter.
Ich fand nicht einmal genug Atem, um zu schreien, als ich auf den Boden schlug. Meine Seite explodierte vor Schmerz und mein Kopf füllte sich mit blendender Helligkeit. Ich rollte herum und hob instinktiv die Hände.
Dann war sie über mir und prügelte mir fast die Seele aus dem Leib. Die anderen Waisenkinder standen schweigsam vor ihren Schlafplätzen. Ich bekam es nur durch einen Tränenschleier mit, denn ich war mehr damit beschäftigt, mich zusammenzukrümmen, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
»Regeln!«, kreischte sie und schlug zu. »Regeln!« Wieder schlug sie zu. »Regeln!« Eins, zwei, drei – jeder Schlag raubte mir die Sinne.
Ich hätte mich wehren können, aber wozu?
Als sie innehielt und ich nach Atem ringen konnte, entdeckte ich Domin am Eingang des Schlafzimmers. Es war das erste Mal, dass ich einen Anflug von Bedauern bei ihm sah.
Erst später verstand ich, dass es gar nicht um meine Missetat gegangen war. Auch nicht um das zerbrochene Fensterglas. Er war der Einzige, der verstanden hatte, was ich war.
Yenna ging dazwischen. »Das war meine Schuld!«
»Aus dem Weg, Yenna!«, blaffte die Leiterin.
»Aber …«
Die Leiterin griff in Yennas Haare und riss sie zur Seite.
»Nein!«, schrie ich und bäumte mich auf.
Ich packte das Hemd der Leiterin und krallte mich an einem Knopf fest. Jemand packte meine Arme – ich riss einen Knopf ab – und bog sie mir auf den Rücken. Ein Gesicht näherte sich meinem Ohr und schwerer Atem drang mir entgegen.
»Sieh zu!«, flüsterte Lobos. Vermutlich hatte er nur auf diese Gelegenheit gewartet.
Völlig überrumpelt starrte ich ihn mit offenem Mund an. »Du hast uns verpfiffen?«
Er zog ein finsteres Gesicht, wie es die Leiterin immer tat, hob die Brauen und straffte sich. »Regeln!«
Ich warf mich herum und versuchte, aus seinem Griff zu schlüpfen wie ein windiger Aal. »Lass mich los, du dummes Arschloch, sonst …«
Lobos zog meine Arme weiter hoch. Meine Schulter explodierte vor Schmerz und ich keuchte auf. »Sonst was?«
»Lass … mich … LOS!« In diesem Moment erwachte etwas in mir. Eine Kraft, von der ich bis dahin nichts gewusst hatte.
Hitze flutete meine Hand. Mit einer Stichflamme loderte ein Feuer darum auf.
Vor Schreck warf ich den Knopf weg. Ein Symbol zierte ihn, das ich vorher gar nicht bemerkt hatte. Eine strichähnliche, aufleuchtende Kerzenflamme innerhalb eines Rings.
Das Feuer lechzte über und erfasste die Dielen.
Sofort geriet der Boden in Brand. Flammen wallten auf.
Lobos ließ mich schreiend los. Ich achtete nicht auf ihn, sprang durch das Feuer und stieß die Leiterin zur Seite. Sie riss die Augen weit auf, als hätte sie ein Gespenst gesehen.
Ich packte Yenna am Arm und hievte sie auf die Füße. »Hau ab!«
Sie öffnete den Mund, dann grinste sie. »Ich wusste doch, dass du besonders bist.«
»Geh!«, brüllte ich.
Yenna hetzte an den anderen Kindern vorbei und passierte sogar den Priester, der zu alldem nichts sagte. Zum ersten Mal sah ich Furcht in seinen Augen.
Ich wirbelte herum, suchte nach jemanden, auf den ich meinen Zorn richten konnte, und verstand noch immer nicht, was hier geschah. Das Feuer fand reichlich Nahrung in den Laken von zwei Jungen. Die Kinder schrien und wollten aus dem Schlafzimmer eilen, aber die Leiterin hielt sie mit eiserner Stimme zurück und stapfte auf mich zu.
»Lösch es!«
Das Feuer griff um sich. Die Hitze brannte auf der Haut, versengte mir die Augenbrauen. Rauch strömte durch den Raum. Mit einem Knall splitterten die Fenster. Die Kinder wimmerten. Der Priester stand still und starr am Eingang.
»LÖSCH ES!«, schrie die Leiterin.
»Ich weiß nicht wie!« Meine Stimme zitterte.
Schließlich begriff ich, was sie meinte. Das Feuer zehrte von etwas, das sich in mir befand. Es gab eine Verbindung zwischen den Flammen, dem glühenden Symbol auf dem Boden und dem Etwas in mir. Und dieses Etwas leerte sich wie ein Fass ohne Boden.
Mir wurde schwindelig. Die Welt drehte sich um mich und meine Kehle war wie ausgedörrt.
Ich stolperte zur Seite und fand keine Kraft, wieder aufzustehen. Erschöpft kniete ich da, die Fäuste auf dem Boden, die Knie geschunden und das Herz voller Gram und Schmerz.
Das Feuer verging. Das Symbol auf dem Knopf leuchtete nicht länger und dann senkte sich Dunkelheit über den Raum wie ein riesiger Schleier.
Die Leiterin hob den Knopf auf und betrachtete ihn einen langen Moment, als wäre er ein widerliches Insekt, das in ihrer Kammer genistet hatte.
Sie trat vor mich. Ich sah auf.
Ihre Fingernägel verkrallten sich in mein Kinn. Die Ohrfeige, die sie mir verpasste, war vermutlich bis zum Rand des Weltenrunds zu hören. Wieder umschloss sie mein Kinn wie eine stählerne Klammer und hob es an, damit ich sie ansehen musste.
»Steh auf!«
»Was?« Ich war noch immer ganz benommen.
»Aufstehen!«
Ich hievte mich auf die Füße. Die Leiterin zeigte zum Dachboden. Also schleppte ich mich zur Leiter und bei jedem Schritt schoss Schmerz durch meine Glieder – nicht nur aufgrund der Schläge, sondern auch wegen dem, was ich gerade getan hatte.
Jede Stufe kam mir vor wie die Bewältigung eines Berges, aber ich gab mir nicht die Blöße, Schwäche zu zeigen.
Vielleicht war es Stolz, vielleicht mein eiserner Wille, der mich dazu trieb. Jedenfalls schaffte ich es irgendwie nach oben und war deshalb ein klein wenig erstaunt. Dort hockte ich mich auf den staubigen Boden, zog die Knie an und schlang die Hände darum.
Die Leiterin steckte den Kopf durch die Luke, entdeckte das gesplitterte Fenster, durch das ein kalter, zugiger Wind blies, und verfinsterte ihr ohnehin zorniges Gesicht noch mehr.
Ich schwieg.
Ein Moment der Stille verging, in dem niemand von uns nachgab. Die Schmerzen machten mich fast wahnsinnig, ich war erschüttert und innerlich vollkommen aufgewühlt, denn ich verstand nicht, was gerade geschehen war. Dennoch hielt ich meine Schutzmauern aufrecht und gab mich unantastbar.
Die Leiterin sagte kein einziges Wort, bevor sie verschwand. Als die Luke geschlossen wurde, kam es mir seltsam endgültig vor.
Kapitel 3 - Missetaten
Der Wind fand jede Lücke im Dach.
Er blies durch das gebrochene Fenster, fegte in den drückenden Raum und brachte einen Schwung Regen der beginnenden Herbststürme mit sich.
Es war eiskalt auf dem Dachboden und dabei half nicht, dass ich nur Hemd und Hose besaß. Das bisschen Wärme, das ich bei mir behalten konnte, hütete ich wie einen Schatz. Es stand für alles, was mir noch geblieben war, und ich wollte nicht, dass mir auch noch der letzte Rest Würde genommen wurde.
Doch der Wind und die Kälte schafften es schon bald, mich zu zermürben, bis ich zitternd, frierend und hungernd auf dem Boden hockte und die Luke mit all der Verachtung anstarrte, die ich aufzubringen vermochte. Dabei war sie nicht einmal daran schuld, dass ich in dieser Misere steckte. Allein meine Missetaten hatten mich an diesen Punkt gebracht.
Fast zwei ganze Tage vergingen, bis die Luke das erste Mal geöffnet wurde. Priester Domin quälte sich die Stufen hoch, stellte ein vollbeladenes Tablett ab und bog stöhnend den Rücken durch. Es knackte, als hätte er drei morsche Stöcke entzweigebrochen.
»Ich war lange nicht mehr hier.« Er blickte sich geduldig um, während ich ihn keinen Moment aus den Augen ließ. »Ich erinnere mich noch gut, wie dieses Haus gebaut wurde. Damals war ich jung.« Er lächelte. »Das heißt, ich hatte noch Haare auf dem Kopf.«
Meine Mundwinkel zuckten. Der Priester schlurfte zu mir, setzte sich vor mich und stellte das Tablett zwischen uns ab. Er füllte zwei Becher mit Tee und hielt mir einen hin. Mit zitternden Fingern nahm ich ihn entgegen und wagte nicht, daraus zu trinken. Apfeltee mit einer Prise Zimt. Ich spürte Druck hinter den Augen, aber ich hielt tapfer stand.
»Trink, mein Junge!«
Ich nippte daran. Die Süße füllte meinen Mund und die Wärme breitete sich in mir aus. Ich unterdrückte einen Seufzer und musste mich zwingen, den Becher abzustellen, sonst hätte ich ihn in einen Zug geleert – ganz egal, wie heiß der Tee auch war.
»Hunger?« Er schob mir eine Schüssel mit Brei und einen Teller mit Gebäck hin.
Gebäck … Ich musste wohl träumen.
Zögerlich griff ich zu. Domin beobachtete mich. Als ich abbiss, hätte ich auf der Stelle heulen können. Süß, knusprig, frisch gebacken. Ich war so hungrig, dass ich sogar darüber nachgedacht hatte, mein eigenes Hemd zu essen.
»Nicht so zögerlich, mein Junge! Iss! Es ist alles für dich.«
Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte, und stopfte mir das gesamte Gebäck in den Mund. Dann löffelte ich von dem Brei, mehr und mehr.
Domin lachte. »Nicht alles auf einmal.«
Schließlich war ich so gesättigt und zufrieden, dass ich ausnahmsweise mein Misstrauen niederkämpfte und nicht darüber nachdachte, was die Begegnung hier bedeuten mochte. Ich war zwei Tage lang wachgeblieben. Hinzu kamen die Schmerzen, die allmählich ihren Biss verloren, und diese andere Erschöpfung in mir, die ich nicht beschreiben konnte. Domin stapelte das Geschirr, verschüttete beinahe die Kanne und versuchte es erneut. Ich nahm ihm die Kanne ab und tat so, als hätte ich nicht bemerkt, wie sehr seine Hände inzwischen zitterten.
»Danke, mein Junge«, sagte er leise und lehnte sich zurück.