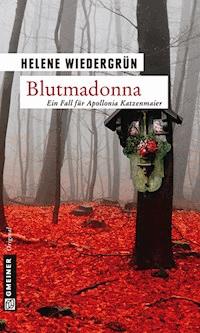Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Apollonia Katzenmaier
- Sprache: Deutsch
Ein schwarzer Kater wird überfahren, kurz darauf stirbt seine Besitzerin unter ungeklärten Umständen. Als aus deren Nachlass auch noch zwei kostbare Zuchtkatzen verschwinden, ist die alte Dorfhebamme Apollonia Katzenmaier überzeugt, dass da etwas nicht stimmt. Sie bittet ihre Nichte Polli um Hilfe. Diese beginnt zu recherchieren, doch als sie erkennt, welche Machenschaften hinter all dem stecken, ist es schon fast zu spät. Und nicht nur sie selbst schwebt plötzlich in höchster Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helene Wiedergrün
Der arme schwarze Kater
Ein Fall für Apollonia Katzenmaier
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Vollständige ursprüngliche Version des Romans »Blutmond«, der 2010 in gekürzter Fassung bei Piper erschienen ist.
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © Julia Franze nach einem Bild von Ernst Ludwig Kirchner
Umschlaggestaltung: Julia Franze
ISBN 978-3-7349-9250-6
Zitat
»Es wird ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen.«
Mark. 13,12
Kapitel 1
Er sah zuerst nur die alte Frau am Straßenrand. Hoffentlich läuft sie mir nicht in die Fahrbahn, dachte er. Als er das dunkle Bündel vor ihr auf der Straße liegen sah, war es zu spät. Er spürte kaum ein Rucken am Lenkrad, der Audi hatte gute Stoßdämpfer. Im Rückspiegel riss die alte Frau die Arme hoch. Mein Gott, dachte er, ich hab was überfahren.
Max Gerstner war schon fast zu Hause. Er hatte einen Achtstunden-Arbeitstag im Landratsamt Ravensburg hinter sich, plus 1,5 Überstunden. Sein Nachhauseweg von Ravensburg nach Baselreute betrug genau 20,4 Kilometer, und er brauchte dafür im Schnitt 16 Minuten, jedenfalls seit die neue B 30 fertig war. Zu seinen Studentenzeiten war er noch selber gegen diese Straße auf die Straße gegangen, »Keine B 30 Neu« hatte auf den Plakaten gestanden bei der Demo, weil die Trasse ein Feuchtgebiet durchschnitt, und überhaupt. Aber jetzt wo sie fertig war, benutzte er sie täglich zur Arbeit im Landratsamt. Hin und zurück. Er kannte den Weg im Schlaf. Neulich hatte er gelesen, dass das Großhirn tatsächlich schlief, wenn man eine Routinestrecke fuhr, nur das Stammhirn arbeitete, und das hatte nun nicht schnell genug reagiert. Er hatte etwas überfahren.
Verdammter Mist, dachte er, ich hab doch Probe heute Abend. Und Sabine wartet mit dem Essen. Max Gerstner war Posaunist im Musikverein, und Sabine war seine Frau. Sie arbeitete nur halbtags, im Edekamarkt, denn da waren auch noch zwei Kinder, die versorgt werden wollten, wenn sie mittags aus der Schule kamen. Meistens kochte sie abends für ihn noch mal warm oder wärmte noch etwas vom Mittag auf, das hatte sich im Laufe der Jahre so eingespielt. Nun würde sie es noch mal aufwärmen müssen, oder, je nachdem, würde er sogar ohne Essen zur Musikprobe gehen müssen. Er seufzte tief, hielt am Straßenrand und stieg aus.
Die alte Frau hatte sich vor das dunkle Etwas auf der Straße hingekniet und weinte laut.
»Mein Moritz, mein Moritz! Moritzle!« Das Bündel entpuppte sich als schwarze Katze, die eindeutig tot war. Die Frau nahm sie wie einen Säugling auf die Arme, wiegte sie hin und her, »mein Moritzle!«, und drückte ihre Wange in das silberglänzende, schwarze Fell.
Nun erkannte Max Gerstner sie auch.
»Um Gottes Willen, Rosl, steh doch auf!«
Er nahm Rosa Haberbosch am Ellbogen, wollte ihr hoch helfen, aber sie reagierte nicht, bemerkte ihn in ihrem Schmerz und Schock gar nicht.
»Rosl, komm, das tut mir so leid, das hab ich doch nicht wollen!« Fast kamen ihm ebenfalls die Tränen. Seine Kinder hatten auch eine Katze, und obwohl er sich nicht sonderlich um sie kümmerte, hatte er es doch gern, wenn sie sich abends beim Fernsehen zu ihm legte und unter seinen streichelnden Händen schnurrte. Sie unter einem Auto zu verlieren hätte ihm auch wehgetan.
Schließlich gelang es ihm, Rosa Haberbosch von der Straße wegzuführen. Langsam ging er mit ihr bis zu dem Haus, in dem sie seit dem frühen Tod ihres Mannes allein mit einem ganzen Rudel Katzen hauste. Niemand wusste, wie viele es genau waren, ein Dutzend mindestens. Man sagte, sie habe Rassekatzen, teure, und auch der tote Kater, fiel ihm auf, sah nicht so aus wie seine Katze, die er mit den Kindern vom Bauernhof geholt hatte. Er war größer, ein stattlicher Kerl, und sein Fell war länger, aber sehr gepflegt, fast schien es zu glitzern. Oje, was der wohl kostet! schoss ihm durch den Kopf, vor allem jetzt mit dem Euro, aber im nächsten Moment schämte er sich für diesen Gedanken. Die alte Frau trauerte wirklich um das Tier, wahrscheinlich war sein Geldwert das letzte, woran sie gerade dachte.
Er half ihr die drei abgetretenen Stufen hoch und öffnete die ausgebleichte Holztür, die knarrend den Blick in den Flur freigab. Der Geruch nach Katzenseiche, der ihm entgegenschlug, raubte ihm für einen Moment den Atem. Er war bestimmt 30 Jahre nicht mehr in diesem Haus gewesen; damals hatte der alte Haberbosch, Rosas Mann, noch gelebt. Als Junge hatte er einmal Farbe hierher bringen müssen, aus dem väterlichen Geschäft, denn Willi Haberbosch war neben seiner Tätigkeit als Gemeindelehrer auch Kunstmaler gewesen. Aber damals gab es hier noch keine Katzen, oder höchstens eine. Jedenfalls konnte er sich nicht an den Gestank erinnern. Die Frau schien ihn nicht zu riechen. Ihren Arm loszulassen wagte er nicht. Er wollte sie ins Wohnzimmer führen, das rechter Hand lag, wie er sich noch erinnerte, aber da hielt sie zum ersten Mal im Weinen inne und sagte etwas Undeutliches, wobei sie mit dem Kinn auf die offen stehende Haustür wies. Er verstand und schloss die Tür. Dann öffnete er die Wohnzimmertür und sofort schossen zwei, drei Katzen an ihm vorbei in den Flur. Im Augenwinkel bemerkte er, dass auch diese Katzen sehr edel aussahen, nur nicht schwarz, sondern eher wie Siamesen gefärbt, aber mit längeren Haaren. Im Wohnzimmer gelang es ihm schließlich, die alte Frau in einen Sessel zu setzen, mit dem toten Kater auf dem Schoss, den sie unablässig streichelte und immer wieder an sich drückte. Er sah, dass das Tier vier weiße Pfoten hatte.
Max Gerstner setzte sich auf das Sofa gegenüber, von dem zwei weitere Katzen Reißaus nahmen. Nur ein dicker, schwarzer Perserkater mit eingedellter Nase blieb liegen und blickte ihn aus grüngelben Augen durchdringend an. Das Zimmer war voll gestopft mit dunklen Möbeln, an die er sich noch vage erinnern konnte, in einer Vitrine schimmerten einige Pokale im spärlichen Licht einer Stehlampe – war Willi Haberbosch sportlich aktiv gewesen? – aber was ihn vor allem verblüffte, war, dass jeder verbleibende Raum zwischen den Möbeln mit Katzenkratzbäumen zugestellt worden war. Er hatte zu Hause auch einen kleinen, für den Winter, wenn die Katze keine Lust hatte, raus zu gehen, den hatte Sabine im Baumarkt für neunzehn fünfundneunzig gekauft, mit einem sisalumrundeten Rohr in der Mitte und einer kleinen plüschbezogenen Liegefläche darüber. Was er hier zu sehen bekam, waren indes wohl die Ferraris unter den Kratzbäumen, jeder mit zwei oder drei Säulen, die hoch bis zur Decke gingen, einer sogar mit richtigen Holzstämmen, dazwischen Höhlen, Hängematten, Schaukeln, Tücher – ein Paradies für Katzen, die nicht aus dem Haus durften. Eine allerdings hatte das Paradies verlassen, und nun war sie tot. Nach und nach entdeckte Max Gerstner auch weitere Stubentiger in den Ästen und Höhlen des künstlichen Dschungels, deren blaue Augen ihn ängstlich bis feindselig musterten. Ob sie verstanden, was vorgefallen war?
Die alte Frau hatte sich inzwischen etwas beruhigt, nur hin und wieder wurde sie noch von einem schweren Schluchzer geschüttelt. Ihre Frisur hatte mitgelitten, die rotbraun gefärbten Haare, sonst immer akkurat frisiert, standen ihr wirr ums Gesicht. Früher war Rosa Haberbosch eine richtige Schönheit gewesen, mit langen Beinen und einer kurzen Stupsnase über dem sinnlichen Mund. Sie hatte in ihrer Jugend jedes Jahr im Weihnachtstheater mitgespielt, das abwechselnd vom Musikverein und vom Liederkranz aufgeführt wurde, und obwohl Rosa in keinem der beiden Vereine war, hatte man sie immer geholt für die Rolle der naiven Schönen, die von einem fiesen Finsterling verführt, zum guten Schluss aber vom braven Dorfburschen geküsst wurde. Die jungen Männer rissen sich um die Rolle des braven Dorfburschen, vor allem die weniger braven. Rosas Ruf war bald nicht mehr der beste – wer auf der Bühne küsst, der küsst auch im richtigen Leben, und die frechen Burschen, die das hinter den Kulissen ausprobiert hatten, suchten sich zum Heiraten doch lieber brave Mädchen. Aber dann wurde Anfang der Sechzigerjahre Willi Haberbosch an die Baselreuter Schule versetzt, gerade noch rechtzeitig, bevor Rosa ins Rollenfach der Mutter der naiven Schönen wechseln musste. Er verliebte sich sofort in sie, und schon nach einem halben Jahr wurde Hochzeit gefeiert. Kinder konnten sie offenbar keine bekommen, aber beide fanden Ersatz: Er malte Bilder und sie züchtete Katzen.
Max Gerstner nahm einen neuen Anlauf, die Sache mit dem überfahrenen Kater zu klären.
»Hör mal, Rosl, das wollte ich wirklich nicht, das tut mir so leid!«
»Schon gut, du bischt nicht schuld«, antwortete die alte Frau leise zwischen zwei Schluchzern, ohne aufzublicken.
»Das ist nett, dass du das so siehst! Weißt du, ich hab ihn wirklich erst im letzten Moment gesehen, und da hab ich einfach nicht mehr reagieren können.«
»Neinnein, mach dir keine Sorgen, du hascht ihn nicht umgebracht.«
Nun war er doch etwas erstaunt.
»Wie meinst du das? Ich hab ihn doch überfahren!«
»Ja, aber er war praktisch schon tot. Sie haben ihn vergiftet.«
»Vergiftet?« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber wieso? Und wer soll denn das gewesen sein?«
Rosa schluchzte wieder, dann sagte sie mit plötzlicher Wut in der Stimme: »Das werden sie mir büßen!«
»Wer denn, Rosl?«
Aber sie hörte ihn gar nicht.
»Sie haben ihn vergiftet und da hat er verrückt gespielt und isch mir entwischt. Er hat mich gebissen und gekratzt, als ich raus bin, und dann isch er einfach an mir vorbei gerannt. Das hat er sonscht nie gemacht!«
Sie schluchzte wieder heftiger. »Bis zur Straße isch er noch gekommen. Und dann bischt du gekommen. Aber sie werden schon sehen, was sie davon haben! Das werden sie schon sehen!«
Ihre Augen waren zu schmalen Schlitzen geworden und ihr Kinn zitterte vor Wut. Ihm wurde unheimlich. Wie eine Hexe, dachte er und war froh, dass sie nicht ihn als den Schuldigen betrachtete. Er wollte auch gar nicht mehr wissen, wen sie in ihrem Trauerwahn für schuldig hielt, er wollte nur noch weg. Demonstrativ sah er auf die Uhr.
»Hör mal, kann ich noch etwas für dich tun? Ich müsste sonst los zur Musikprobe.«
»Neinnein, geh nur. Dem kann sowieso niemand mehr helfen. Ich werd ihn morgen begraben.«
»Also dann, tut mir wirklich leid!«, wiederholte er sich zum dritten Mal und stand auf.
Sie nickte nur und winkte ihn zur Tür. »Pass auf, dass keine Katze mit rausgeht!«, war der einzige Gruß, den sie ihm noch nachsandte. Als er die Haustür hinter sich geschlossen hatte, atmete er tief durch.
Eigentlich hätte sie den toten Kater zur Tierkörperbeseitigungsanstalt bringen müssen, fiel ihm ein, aber er war froh, dass es ihm so spät eingefallen war, zu spät, um ihr gegenüber dieses Wort von Amts wegen erwähnen zu müssen.
Als er nach der Probe mit seinen Musikerkollegen im »Mohren« saß, hatte er den Vorfall schon fast wieder vergessen.
Kapitel 2
Rosa Haberbosch konnte nicht schlafen. Ihr hoher Blutdruck ließ das Blut gegen die Schläfen hämmern und in ihren Ohren sausen. Sie hatte keine Medikamente mehr genommen und kaum etwas gegessen in den letzten Tagen, denn alles war ihr zuwider. Wenn sie die Drohungen ernster genommen hätte! sagte sie sich immer wieder, wenn sie irgendwie darauf reagiert hätte, anstatt sie zu ignorieren, vielleicht wäre es nicht passiert, vielleicht, vielleicht …
Drei Tage war es nun her, dass Moritz gestorben war, dass sie ihn begraben hatte, bei den Johannisbeerbüschen im Garten, drei Tage, dass er abgestiegen war zu den Toten. Blasphemie!, hätte ihre Schwägerin ausgerufen, wenn sie Rosas Gedanken hätte hören können. Aber die Analogie endete ohnehin bei den drei Tagen, der Kater würde nicht auferstehen wie Jesus, er war tot und begraben und würde es bleiben.
Rosa dachte an die Zeit zurück, als Willi gestorben war, der Mann, den sie wirklich geliebt hatte, der ihr so spät – fast hätte sie gedacht: zugelaufen war, aber so etwas denkt man nicht von einem Menschen -, der Mann, den sie erst kennen gelernt hatte, als sie beide schon in einem Alter waren, wo die Kinder normalerweise aus dem Haus gehen, und da war es zu spät gewesen, sich noch Kinder ins Haus zu holen. Aber sie hatten ja sich, waren mit sich zufrieden gewesen. Er war der erste Mann, der sie verstanden hatte, der nicht auf der Suche war nach einer Mutter für seine zukünftigen Kinder, sondern sie einfach für das liebte, was sie war, eine schöne, nicht mehr ganz junge Frau mit dem Bedürfnis, andere Dinge zu tun, als »die Leute« von ihr erwarteten. Sie hatte ihn wirklich geliebt, und dennoch … Sie wagte kaum, es sich selber einzugestehen, aber in ihrer Erinnerung war der Schmerz um ihn nicht so groß gewesen, wie der, den sie jetzt um Moritz empfand.
War es richtig, dass man ein Tier so liebte? Dass man sich so traurig und leer fühlte nach seinem Tod, mehr als jemals zuvor im Leben? Sie sah Moritz’ blaue Augen vor sich, meeresblau, sommerhimmelblau, ihr kamen keine Worte in den Sinn, die ausgedrückt hätten, was sie empfand, wenn sie in diese Augen sah, wenn er ihrem Blick standhielt und sie ihn dann zärtlich auf die Arme nahm und er sich schnurrend an sie schmiegte. Sie dachte an seine Augen und plötzlich hörte sie ihn, sein leises Miauen, er lief im Flur auf sie zu, als sie die Tür öffnete, und sie nahm ihn hoch, drückte ihn an sich, hielt ihre Nase in sein weiches Fell, roch überglücklich seinen feinen Nussgeschmack, aber plötzlich stank er nach Seiche und sie wandte sich angeekelt ab.
Als Rosa die Augen aufschlug, war es dunkel, das Traumbild fort, aber der Gestank noch da. Irgendetwas hatte sich verändert im Zimmer. Sehen konnte sie absolut nichts. Die Straßenlampen, deren Licht sonst durch die Spalten in den Fensterläden sickerte, wurden in Baselreute um elf Uhr abends gelöscht. Offenbar ging es schon auf Mitternacht zu. Geisterstunde. Plötzlich bekam sie Angst in dieser vollkommenen Dunkelheit, die seltsam belebt schien. Eine Gänsehaut rieselte langsam ihren Nacken hoch. Von Menschen hatte man schon gehört, dass sie als Geister zurückkamen nach dem Tod, aber von Tieren? Doch wenn ein Tier so sehr geliebt wurde wie Moritz, konnte es dann vielleicht auch zurückkommen? War das womöglich gar die Strafe für ihre übertriebene Liebe zu ihm, dass er nach seinem Tod zu ihr kommen musste? Sosehr sie auch in die Dunkelheit starrte, in der Nachtschwärze des Zimmers war sie völlig blind, aber dafür reagierten ihre anderen Sinne umso heftiger. Sie glaubte, irgendwo unten eine Tür schlagen zu hören, aber das war bestimmt der Wind, redete sie sich ein. Ihre Nase konnte sie jedoch nicht täuschen: Seiche, meldete diese eindringlich, und Erdgeruch, und noch etwas Anderes, Ekligeres.
Rosa bot all ihren Mut auf und drückte auf den Lichtschalter neben dem Bett. Ihr Schrei erstickte zwischen den hochgerissenen Händen. Moritz war von den Toten auferstanden. Er lag vor ihr auf dem Bett, sein Maul aufgerissen, die Lefzen über die spitzen Eckzähne hochgezogen, als ob er sie angrinsen wollte, das Fell nass, zerzaust und voller Erdklumpen, seine vier weißen Pfoten waren blutigen Stümpfen gewichen – das war der eklige Gestank gewesen, verfaulendes Fleisch und Blut! – aber das Schlimmste waren seine Augen. Ihr Blau hatte sich in blutigrote Löcher verwandelt, und als Rosa sich in sie hineinversenkte, breitete sich das Rot aus, ihn ihren Ohren trommelte es, sie sah nur noch Rot, Rot, und dann wurde alles schwarz.
Um 0.17 Uhr schaute Bernhard Bühler auf den Radiowecker. Seine Blase hatte ihn geweckt, zum ersten Mal in dieser Nacht, sicher nicht zum letzten. Seit seiner Prostataoperation blieb ihm keine Nacht der dreifache Gang erspart. Früher hatte man dafür einen Nachthafen gehabt, aber das war ja nicht mehr Mode. Hilde hätte ihm etwas erzählt, wenn er so einen stinkenden Bottschamper die ganze Nacht unter dem Bett stehen gehabt hätte! Auf dem Weg zum Klo machte er Licht im Flur, dessen Fenster zum Häuschen von Rosa Haberbosch hinüberging. Erstaunt sah er, dass dort im Erdgeschoss noch Licht brannte. So ebbes, dachte er, die Rosl geht doch immer so früh ins Bett. Er öffnete das Fenster und beugte sich hinaus, um besser sehen zu können. In diesem Augenblick ging das Licht aus. Auf dem Rückweg von seinem Klogang, der ziemlich lange dauerte, schaute er noch einmal hinüber. In Rosas Haus blieb alles dunkel. Dafür leuchteten in der Einfahrt zwei Häuser weiter plötzlich die Scheinwerfer eines Autos auf, das schnell weg fuhr. So ebbes! Bernhard Bühler schüttelte den Kopf und schloss das Fenster.
Kapitel 3
»Nuurr nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Eerrden nicht nur den Einen!«, schmauchte die tiefe Bassstimme von Zarah Leander aus meinen Lautsprecherboxen. »Es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden, der mir gefääälllt!«, brüllte ich mit, während mir die Tränen übers Gesicht liefen. Der Eine, oder zumindest der, von dem ich für kurze Zeit geglaubt hatte, er sei der Eine, hatte sich aus meinem Leben davon geschlichen, einfach so. Wir hatten einen wunderbaren Sommer verbracht – nächtliche Spaziergänge am See mit Mond, intime Picknicks auf »unserer« Parkbank an der Schmugglerbucht, atemlos vertanzte Salsaabende auf der »Rheinterrasse«. Dann hatte er plötzlich immer weniger Zeit für mich gehabt, nur noch Ausreden, kaum Anrufe, schließlich gar keine mehr, auch sonst kein Lebenszeichen, und wenn ich bei ihm läutete, dann war er nicht da oder tat jedenfalls so. Und heute hatte mir meine Freundin Angelika am Telefon berichtet, dass sie ihn mit seiner Ex gesehen hatte, Arm in Arm und »sehr verliebt haben die getan«, was bedeutete, dass wahrscheinlich ich jetzt die Ex war und die andere die Ex-Ex. Da gab es nur zwei Alternativen: In tiefste Depression versinken und seitenlange, anklagende Briefe schreiben oder – Zarah Leander. Ihre Lieder mitzubrüllen verwandelte den Schmerz in Trotz, und am liebsten wäre ich sofort losgezogen, um mir in irgendeiner Kneipe irgendeinen Typen anzulachen.
Da läutete das Telefon.
Ich wischte mir mit dem Ärmel das Gesicht trocken, dann stellte ich die Musik leiser und nahm den Hörer ab. Vielleicht war er es! Bestimmt hatte er doch noch kapiert, was er an mir hatte und dass ich die Richtige für ihn war, die einzig Wahre!
»Ja, hallo?«, fragte ich vorsichtig hoffnungsvoll.
Eine wohlbekannte weibliche Stimme wünschte mir fröhlich einen Guten Abend. Apollonia! Meine Tante und Freundin und Namensbase, die älteste Schwester meines Vaters, die schon stramm auf die Hundert zuging, und mit der ich vor einigen Jahren eine alte Mordgeschichte in Baselreute aufgedeckt hatte.
Ich zog schnell noch einmal die Nase hoch, bevor ich versuchte, ihr ebenso fröhlich zu antworten. Sie musste sich in ihrem Alter nicht auch noch mit meinem Liebeskummer beschäftigen. Aber Apollonia hatte einen siebten Sinn für das Unglück anderer Menschen.
»Sag mal, Polli, geht’s dir nicht gut? Was isch denn los?«
Bevor ich »Ach nichts« sagen konnte, brach ich schon wieder in Tränen aus.
»So ein Blödmann, ich dachte, diesmal sei es etwas Ernstes«, antwortete ich zwischen zwei Schluchzern, »aber Angelika hat ihn heute mit seiner Ex gesehen, und er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Verdammt, Apollonia, warum gerate ich immer an solche Typen?«
Ich versank im Selbstmitleid, und Apollonia tröstete mich, so gut sie konnte. Ich wusste, dass sie mich verstehen konnte, denn sie hatte in ihrer Jugend etwas Ähnliches erlebt. Allerdings war sie dann einfach allein geblieben, eine Option, die für mich nicht in Frage kam, und so wiederholten sich bei mir die Beziehungsenddramen in regelmäßigen Abständen.
»Ach Kind,« sagte sie, »der Richtige wird schon noch kommen!«
Na, dann sollte er sich mal beeilen, der Richtige, wenn es ihn denn gab, das Kind war immerhin schon zweiundvierzig!
Als ich mich etwas beruhigt und mit drei Tempotaschentüchern Nase und Augen vom Rotz befreit hatte, fragte ich endlich nach dem Grund ihres Anrufs.
»Sag mal, Polli, kennscht du Haberboschs Rosl?«
Ich musste einen Moment überlegen.
»Ist das die in dem kleinen Häusle, wenn man Richtung Breitenreute raus fährt, mit den vielen Katzen?«
»Ja, genau die.«
»Und was ist mit der?«
»Sie isch tot.«
»Aha.« Mehr fiel mir dazu nicht ein. Immerhin war Haberboschs Rosl schon reichlich über siebzig gewesen, wenn ich mich recht erinnerte. Da war die Hebamme wohl nicht mehr schuld, wenn sie starb.
Mehr aus Gewohnheit fragte ich: »Wann ist denn die Leich?«
»Morgen Nachmittag um zwei. Kannscht du kommen?«
Eine Beerdigung war nun wirklich das Letzte, wonach mir der Sinn stand. Und warum sollte ich gerade zur Beerdigung von Rosa Haberbosch gehen? In Baselreute starben jede Woche Menschen, die mir näher gestanden hatten. Mama berichtete mir bei meinen sonntäglichen Anrufen immer, auf wessen Leich sie gewesen war oder noch hin musste. Sie verlangte nie, dass ich auch kam, außer als der Rektor der Schule starb, bei dem ich selbst noch Unterricht gehabt hatte, im Rechnen in der Grundschule. Da war ich selbstverständlich gekommen, das ganze Dorf war gekommen, die Leute hatten sogar noch auf den Treppen gestanden, die vom Friedhof und von der Kirche runter führten.
»Weißt du, ich hab sie eigentlich nicht so gut gekannt. Und in einer Woche beginnt mein Kurs an der Volkshochschule zum Expressionismus, da muss ich noch eine Menge vorbereiten.«
Apollonia atmete tief durch. Dann sagte sie mit unheilschwangerer Stimme:
»Polli, da stimmt ebbes it!«
»Was meinst du damit, da stimmt ebbes it?«
»Mit dem Tod von dr Rosl stimmt ebbes it!«
»Wie ist sie denn gestorben?«
»Man hat sie tot im Bett gefunden. Der Dokter Zoller sagt, des Herz habe nicht mehr mitgemacht.«
An ihrem Tonfall wurde deutlich, dass sie Dr. Zoller für einen alten Esel hielt, der keine Ahnung hatte. Witterte sie schon wieder Mord und Totschlag?
»Ich wusste gar nicht, dass Dr. Zoller noch praktiziert,« versuchte ich abzulenken.
»Eigentlich nicht, der Hannes hat die Praxis übernommen, du weischt schon, sein Sohn, mit seiner Frau zusammen, die isch Schweizerin, aber manchmal schickt er noch seinen Vater los, wenn’s dem seine Patienten waren, oder wenn er glaubt, dass der Fall sowieso klar isch.«
»Na, dann war der Fall hier wahrscheinlich auch klar.«
»Das glauben vielleicht der Hannes und der alte Zoller!«
»Und was glaubst du?«, fragte ich leicht ungeduldig.
»Ich glaub, dass die Rosl ein gutes Herz hatte.«
»Ein Herz für Tiere jedenfalls,« erwiderte ich. Mutter hatte manchmal über Rosa gelästert und über ihre Menagerie. Zeitweise hatte sie zu ihren Katzen auch noch Hunde und Papageien gehalten. »Die könnte einen ganzen Zoo aufmachen!«, hatte Mutter immer gesagt.
»Polli, ich war nicht eng mit der Rosl befreundet, aber manchmal isch sie vorbei gekommen auf eine Tasse Kaffee, und dann haben wir uns unterhalten, und sie hat nie etwas davon gesagt, dass sie Herzprobleme hätte. Gut, seitdem der Willi tot war, hat sie ein wenig hohen Blutdruck gehabt, aber daran stirbt man doch nicht gleich! Und wenn, dann hätte sie der Schlag getroffen, als ihr Kater Moritz vor kurzem überfahren worden ist, aber nicht drei Tage später friedlich im Bett!«
»Naja, eine Bekannte von mir saß eines Nachmittags tot am Schreibtisch, plötzlicher Herztod, mit 43. So was gibt’s!«
Apollonia erwiderte nichts. Eine ganze Weile lang.
Ich seufzte. »Was glaubst du denn, woran sie gestorben ist?«, fragte ich noch einmal.
»Das weiß ich nicht, Polli, aber ich weiß, dass da ebbes nicht stimmt! Zuerst ist ihre Katze umgebracht worden, das hat sie mir nämlich noch erzählt, und dann, nur ein paar Tage später, stirbt sie. Einfach so! Das ist doch nicht normal!« Sie wurde richtig laut. »Und mit dem blöden Karren kann ich nicht allein aus dem Haus, aber wenn du kämscht, dann könnten wir zusammen auf die Beerdigung gehen und hinterher vielleicht noch mit ihren Verwandten reden. Wer weiß, vielleicht finden wir ja etwas heraus!«
Apollonia hatte seit dem letzten Jahr eine Gehhilfe mit vier Gummirädern und einem schicken Einkaufskorb dran. Allein konnte sie sich fast nicht mehr aufrecht halten, eine Folge des Alters und der Medikamente, die sie gegen ihren Krebs einnehmen musste. Bisher schaffte sie es aber einfach nicht, sich mit dem Gefährt anzufreunden, ja sie sah in ihm geradezu die Ursache für ihre Unbeweglichkeit, obwohl es ihr doch zumindest einen gewissen Freiraum bot. Ihre Neugier und ihren Tatendrang schien es wenigstens nicht bremsen. Vielleicht wollte sie ja einfach mal wieder raus und wusste nicht, wie sie ihre Nichte dazu bringen konnte, sie dabei zu unterstützen, außer indem sie an ihre detektivische Ader appellierte.
Mein schlechtes Gewissen regte sich. Ich war tatsächlich schon lange nicht mehr bei ihr gewesen. War Kranke besuchen nicht eines der sieben Werke der Barmherzigkeit? Oder hieß es Kranke pflegen und Gefangene besuchen? Mit meiner Bibelfestigkeit war es doch nicht ganz so weit her, aber an eines erinnerte ich mich noch genau: Tote begraben gehörte auf jeden Fall dazu. Wenn man es recht bedachte, konnte ich hier also für mein himmlisches Konto mindestens einen Punkt erringen, bei großzügiger Auslegung sogar zwei, was nicht schlecht war; meine Buchführung fürs Paradies wurde sonst doch sehr vernachlässigt. Außerdem fiel mir ein, dass Rosa Haberbosch die Tante meiner Schulfreundin Sigrid gewesen war. Vielleicht würde ich sie ja wieder treffen; wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen.
Und vermutlich tat es mir ohnehin ganz gut, wenigstens mal für einen Tag wegzufahren, anstatt mich hier in meiner Wohnung der Depression oder irgendwelchen aufgegabelten Typen zu ergeben.
Ich versprach zu kommen.
Kapitel 4
Am nächsten Tag nahm ich die Elf-Uhr-Fähre nach Meersburg. Nach einer unruhigen Nacht mit schmerzlichen Träumen von Ihm hatte ich am Küchentisch gefrühstückt, Müsli und Kaffee aus der Alu-Caffettiera, die ich mir vor vielen Jahren in Rom gekauft hatte. Es war ein düsterer Morgen, ich brauchte Licht, um die Zeitung zu lesen. Die Fenster meiner Wohnung gingen zwar auf der einen Seite nach Süden, aber davor standen hohe Kastanien, deren Blätterhände das Licht fern hielten, auch wenn sie allmählich anfingen, sich golden zu färben. Außerdem war es jetzt, Anfang Oktober, schon neblig am Morgen. Ein passender Nachklang zur vergangenen Nacht und eine hervorragende Einstimmung auf eine Beerdigung!
Ich hatte schließlich ein paar Klamotten eingepackt, meine schwarze Lederjacke und einen dicken Schal angezogen und war aus dem Haus geflüchtet. Zunächst war ich in die Stadt gefahren, um dort noch Bank, Post und ähnliche lästige Institutionen aufzusuchen. Als ich alles erledigt hatte, lenkte ich meinen alten Golf nach Staad zum Fährehafen. Die Fähre lag vor Anker, und ich konnte gleich auffahren, denn um diese Jahreszeit war an einem Mittwochmorgen nicht viel Verkehr. Der Kontrolleur stempelte trotz meines gewinnenden Lächelns die volle Anzahl Streifen von meiner Mehrfahrtenkarte ab, nicht mal das funktionierte mehr! Ich fühlte mich alt.
Auf dem Oberdeck setzte ich mich im Nichtraucherraum in die Ecke der Holzbank, legte meine Hände wärmesuchend auf die Heizung, die zwischen Banklehne und Fenster eingebaut war und schaute hinaus. Schon nach kurzer Zeit sprangen mit röhrendem Rauschen die Schiffsmotoren an, und wir liefen aus.
Heute war der See wieder ein Meer. Das Nordufer konnte man gerade noch erahnen als dunklere Schattierung im Nebel, aber im Südosten, wo die Sonne den Dunst zum Leuchten brachte, ohne selbst sichtbar zu sein, ging das wellenglitzernde Silbergrau des Wassers ganz unmerklich ins opake Lichtgrau des Himmels über, kein Ufer war mehr zu sehen. Auf der anderen Seite liegt Amerika, hatte ich mir als Kind vorgestellt, wenn ich mit meinen Eltern an solchen Tagen einen Ausflug an den Bodensee gemacht hatte. Die scheinbare Grenzenlosigkeit des Sees war für mich zur Unendlichkeit des Meeres geworden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!