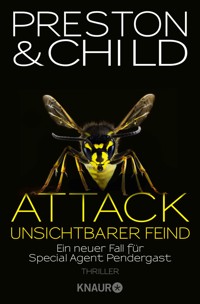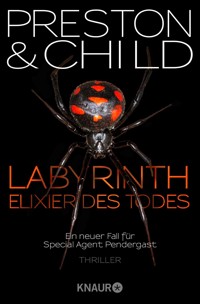6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Es sollte nichts weiter werden als ein abendlicher Ausritt. Doch dann zerreißen Schüsse die Stille des Canyons. Wenig später findet Tom Broadbent einen tödlich verwundeten Archäologen. Mit letzter Kraft vertraut ihm dieser ein Buch an, das mit verschlüsselten Informationen gefüllt ist. Was bedeuten sie – und wer wäre bereit, dafür über Leichen zu gehen? Tom beginnt zu recherchieren – und ahnt nicht, dass er sich damit in tödliche Gefahr bringt. Denn der Canyon hütet seit Jahrhunderten ein erschütterndes Geheimnis … Vom Autor des Bestsellers »Der Codex«! Der Canyon von Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Ähnliche
Douglas Preston
Der Canyon
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Isaac, meinen Sohn
Prolog
Dezember 1972 Taurus-Littrow-Krater Mare Serenitatis Auf dem Mond
Am elften Dezember 1972 erreichte die letzte bemannte Apollo-Mondmission den Landeplatz im Taurus-Littrow-Krater, einem eindrucksvollen, von Bergen umringten Tal am Rand des Mare Serenitatis. Das Gebiet sah viel versprechend aus, ein geologisches Wunderland aus Hügeln, Bergen, Kratern, Geröllfeldern und Schutthalden. Von besonderem Interesse waren mehrere seltsame Stellen, an denen offensichtlich Meteoriteneinschläge tiefe Löcher in der Talsohle hinterlassen und hoch verdichtetes Gestein und Glas über das Tal verstreut hatten. Die Mission durfte hoffen, mit einem wahren Schatz von Mondproben nach Hause zu kommen.
Eugene Cernan war der Kommandant der Mondlandefähre, Harrison »Jack« Schmitt der Pilot. Beide Männer waren für die Apollo-17-Mission bestens geeignet. Cernan war ein erfahrener Veteran zweier vorheriger Missionen, Gemini IX und Apollo 10, Schmitt ein brillanter Geologe, der in Harvard promoviert und an der Planung vorangegangener Apollo-Missionen mitgewirkt hatte. Drei Tage lang erforschten Cernan und Schmitt mit Hilfe ihres Mondautos, des Lunar Rover, das Taurus-Littrow-Gebirge. Bei der ersten Expedition auf der Mondoberfläche wurde rasch deutlich, dass sie einen geologischen Volltreffer gelandet hatten. Eine der aufregendsten Entdeckungen der Mission, die indirekt auch zu dem mysteriösen Fund am Van-Serg-Krater führte, ereignete sich am zweiten Tag an einem kleinen, tiefen Krater, der als Shorty bekannt ist. Als Schmitt aus dem Mondauto stieg, um den Rand von Shorty zu untersuchen, wirbelten seine Stiefel den grauen Mondstaub auf und enthüllten zu seinem größten Erstaunen darunter eine helle, orangefarbene Schicht. Cernan war so verblüfft, dass er sein orangerot getöntes Blendschutzvisier hochklappte, um festzustellen, ob es sich vielleicht um eine optische Täuschung handelte. Schmitt hob einen kleinen Graben aus und entdeckte, dass die Farbe des Bodens in tieferen Schichten von Orange zu leuchtendem Rot überging.
Im Kontrollzentrum in Houston wurde aufgeregt über den Ursprung und die Bedeutung dieses eigenartig gefärbten Mondstaubs diskutiert, und man bat die beiden Astronauten, zwei Bohrkernproben zu entnehmen und zur Erde mitzubringen. Nachdem Schmitt die Bohrproben genommen hatte, wanderten die beiden Männer zum Kraterrand, wo der Meteorit eine ebensolche orangerote Schicht durchbrochen hatte; diese lag nun an den Kraterrändern offen.
Houston wollte Proben des orangefarbenen Staubs von einer zweiten Stelle. Deshalb wurde ein kleiner, noch unbenannter Krater in der Nähe, wo man ebenfalls eine exponierte Schicht des orangeroten Materials zu finden hoffte, auf den Expeditionsplan für den dritten Tag gesetzt. Schmitt taufte ihn Van-Serg-Krater, nach einem seiner Geologieprofessoren aus Harvard, der unter dem Pseudonym »Professor Van Serg« humoristische Schriften verfasste.
Tag drei sollte lang und sehr anstrengend werden. Der Mondstaub verstopfte ihre Instrumente und behinderte die Arbeiten. Am Morgen waren Cernan und Schmitt mit dem Mondauto zum Fuß der Berge am Rand des Littrow-Kraters gefahren, um einen gewaltigen, gespaltenen Felsbrocken namens Tracy’s Rock zu untersuchen; der Gesteinsbrocken war offenbar vor Urzeiten von den Bergen herabgerollt und hatte eine sichtbare Spur im Boden hinterlassen. Von dort aus erforschten die beiden Männer das Gebiet der so genannten Sculptured Hills, wo sie jedoch wenig Interessantes fanden. Unter großen Schwierigkeiten kletterten Cernan und Schmitt einen dieser Hügel ein Stück weit empor, um einen seltsam aussehenden Gesteinsbrocken zu untersuchen, der sich jedoch als wissenschaftliche Niete herausstellte: nur ein »durchgerütteltes Stück alte Mondkruste«, die durch einen lange zurückliegenden Einschlag auf diese Hügelflanke geschleudert worden war. Die beiden Astronauten bewältigten den Abstieg an der steilen, staubigen Hügelflanke mit großen Känguru-Sprüngen. Schmitt hüpfte dabei hin und her, gab Geräusche von sich und imitierte einen Skifahrer, wobei er scherzte: »Hätte die Kanten noch mal schleifen sollen. Wuuusch. Wuuusch. Gar nicht einfach, die Drehung aus der Hüfte.« Cernan legte einen Sturz hin, der bei geringer Gravitation sehr spektakulär wirkte, und landete unverletzt auf der tiefen Staubschicht.
Als die Männer den Van-Serg-Krater erreichten, waren beide erschöpft. Unmittelbar vor dem Ziel mussten Cernan und Schmitt das Mondauto über ein Trümmerfeld mit fußballgroßen Gesteinsbrocken steuern, die beim Einschlag aus dem Krater geschleudert worden waren. Schmitt, der Geologe, fand, dass die Brocken merkwürdig aussahen.
»Ich bin noch nicht sicher, was hier passiert ist«, sagte er. Alles war dick mit Mondstaub bedeckt. Von der orangefarbenen Schicht, nach der sie suchten, war nichts zu sehen.
Sie stellten das Mondauto ab und bahnten sich ihren Weg über das Geröllfeld; Schmitt erreichte als Erster den Kraterrand und beschrieb ihn Houston wie folgt: »Das ist zumindest ein großer Krater mit blockigem Rand. Sogar hier ist der Kraterrand mit Mondstaub-Material überzogen, das die Gesteinsbrocken zum Teil bedeckt. Der Staub ist auch unten am Grund, soweit ich das erkennen kann, und an den Wänden. Im Krater selbst erhebt sich ein zentraler Hügel aus Gesteinsbrocken von etwa fünfzig Meter Durchmesser – Moment, das ist zu viel – dreißig Meter Durchmesser.«
Cernan kam hinzu. »Na, so was!«, sagte er, als er in den beeindruckenden Krater hinabschaute.
Schmitt fuhr fort. »In diesem mittleren Bereich ist das Gestein stark zertrümmert, ebenso an den Wänden.« Er sah sich nach orangeroten Stellen um, entdeckte aber keine, nur eine Schicht graues Mondgestein, vor allem so genannte shatter-cones, die durch die Wucht des Einschlags entstanden waren. Es schien ein ganz gewöhnlicher Krater zu sein, nicht mehr als sechzig oder siebzig Millionen Jahre alt. Houston war enttäuscht. Dennoch begannen Schmitt und Cernan, Proben zu sammeln und in nummerierte Probenbeutel zu legen.
»Dieses Gestein ist stark zertrümmert«, bemerkte Schmitt mit einer Probe in der Hand. »Und es bröckelt leicht. Nehmen wir den hier, bei dem lässt sich der Fundort am einfachsten dokumentieren. Holst du noch zusätzlich einen von hier innen?«
Cernan entnahm die Probe, und Schmitt hob einen weiteren Brocken mit seiner Schaufel auf. »Hast du einen Beutel für mich?«
»Beutel 568.«
»Ich glaube, das ist eine Ecke von dem Block, den Gene gerade dokumentiert hat.«
Schmitt hielt ihm einen weiteren leeren Beutel hin. »Wir nehmen noch eine Probe, die aus dem Inneren des Brockens stammt.«
»Da komme ich mit der Zange leicht dran«, sagte Cernan.
Schmitt sah sich um und entdeckte ein weiteres Exemplar, das er einpacken wollte – einen merkwürdig aussehenden Stein, etwa fünfundzwanzig Zentimeter lang, geformt wie ein Tablett. »Den sollten wir im Ganzen mitnehmen«, sagte er zu Cernan, obwohl das Stück fast zu groß für einen einzelnen Probenbeutel war. Mit der Zange hoben sie es auf.
»Ich halte dieses Ende«, sagte Cernan, als sie versuchten, die Probe in den Beutel zu manövrieren. »Ich halte ihn fest, und du packst ihn ein.« Dann hielt er inne und schaute näher hin. »Na, so was, siehst du das? Die weißen Fragmente hier?« Er deutete auf einige weiße Einschlüsse in dem Stein.
»Ja«, sagte Schmitt und betrachtete die Stellen aus der Nähe. »Weißt du was, das könnten Stücke des eingeschlagenen Gesteins sein. Ich weiß nicht. Es sieht jedenfalls nicht aus wie … Nein, das stammt nicht aus dem Unterboden. Okay. Halt es fest.«
Als der Stein sicher verpackt war, fragte Schmitt: »Welche Nummer?«
»Das ist die 480.« Cernan las die auf den Beutel aufgedruckte Zahl ab.
Mittlerweile wurde Houston ungeduldig, weil die beiden so viel Zeit bei Van Serg verschwendeten, obwohl sie schon festgestellt hatten, dass es dort keinen orangefarbenen Staub gab. Man bat Cernan, den Krater zu verlassen und einige 500-mm-Aufnahmen des North Massif zu machen, während Schmitt die Ausbreitung des Auswurfmaterials rund um den Krater vermessen sollte. Schmitt und Cernan waren inzwischen schon fast fünf Stunden unterwegs. Schmitt arbeitete langsam, und während der Vermessung ging das Instrument kaputt – wieder einmal Probleme mit dem Staub. Houston wies ihn an, die Vermessung abzubrechen und alles zum Aufbruch vorzubereiten. Im Mondauto führten sie eine letzte gravimetrische Messung durch, nahmen noch eine Bodenprobe, sicherten Proben und Ausrüstung für den Transport und kehrten zur Mondlandefähre zurück. Am nächsten Tag hoben Cernan und Schmitt vom Littrow-Krater aus ab und waren somit (zumindest vorerst) die letzten Menschen auf dem Mond. Apollo 17 kehrte mit einer Wasserlandung am 19. Dezember 1972 zur Erde zurück.
Die Mondprobe Nummer 480 wurde nach Houston, Texas, gebracht, wo das Johnson Space Center in seinem Lunar Receiving Laboratory insgesamt 421 Kilogramm Mondgestein von sämtlichen Apollo-Missionen aufbewahrte. Als das Apollo-Programm acht Monate später beendet wurde, schloss man das Lunar Receiving Laboratory und verlagerte die Sammlung in ein neu erbautes High-Tech-Institut am Johnson Space Center, das Sample Storage and Processing Laboratory, kurz SSPL.
Irgendwann während dieser acht Monate vor der Verlegung des Gesteins in das neue SSPL verschwand der Stein mit der Nummer 480. Etwa zur selben Zeit verschwanden außerdem alle Einträge zu seiner Entdeckung aus dem EDV-Katalog und aus den Karteien.
Wenn Sie heute zum SSPL gehen und in der Lunar Sample Registry Database den Eintrag LS480 eingeben, erhalten Sie nur folgende Fehlermeldung:
SUCHENACH: LS480
?>UNGÜLTIGEKENNUNG/KENNUNGNICHTVERGEBEN
BITTEPROBENKENNUNGÜBERPRÜFENUNDERNEUTEINGEBEN
TEIL I
Im Labyrinth
1
Stem Weathers mühte sich die letzten Meter zum Plateau der Mesa de los Viejos hinauf, band seinen Esel an einen verdorrten Wacholderbusch und ließ sich auf einem staubigen Felsbrocken nieder. Keuchend wischte er sich mit einem Halstuch den Schweiß aus dem Nacken. Ein stetiger Wind strich über das Plateau, zupfte an seinem Bart und brachte nach der stickigen Hitze der Canyons angenehme Kühlung.
Weathers putzte sich die Nase und stopfte das Tuch in die Tasche. Er betrachtete die vertrauten Formationen und sagte sich stumm die Namen vor – Daggett Canyon, Dead Eye Canyon, Blue Earth, La Cuchilla, Echo Badlands, White Place, Red Place und Tyrannosaur Canyon. Der heimliche Künstler in ihm sah eine Fabelwelt in Gold, Rosarot und Violett; der Geologe in ihm sah stattdessen eine Reihe verworfener Plateaus aus der frühen Kreidezeit, geneigt, gespalten, kahl gefegt und von der Zeit glatt geschmirgelt, als hätte die Unendlichkeit selbst die Erde verwüstet und nur einen Trümmerhaufen aus bizarr geformtem Fels zurückgelassen.
Weathers zog ein Päckchen Tabak aus einer schmierigen Westentasche und drehte sich mit knotigen, schmutzstarrenden Fingern eine Zigarette. Seine Fingernägel waren gesplittert und gelb verfärbt. Am Hosenbein entfachte er ein Streichholz, zündete die Kippe an und nahm einen tiefen Zug. Während der vergangenen Wochen hatte er seinen Tabak strikt rationiert, aber jetzt konnte er auf den Putz hauen.
Sein ganzes bisheriges Leben war nur der Prolog zu dieser aufregenden Woche gewesen.
Das Leben würde sich jetzt schlagartig verändern. Er würde sich mit seiner Tochter Robbie versöhnen, sie hierher bringen und ihr seinen Fund zeigen. Sie würde ihm alles verzeihen, seine Besessenheit, sein unstetes Leben, seine ständige Abwesenheit. Dieser Fund würde alles wiedergutmachen. Er hatte Robbie nie das bieten können, was andere Väter ihren Töchtern so gern gaben – Geld fürs College, ein neues Auto oder einen Zuschuss zur Miete. Jetzt würde er sie aus ihrem Job als Kellnerin im Red Lobster herausholen und ihr das Atelier und die Kunstgalerie finanzieren, von denen sie immer geträumt hatte.
Weathers kniff die Augen zusammen und blickte zur Sonne auf. Noch zwei Stunden bis Sonnenuntergang. Wenn er nicht zusah, dass er weiterkam, würde er den Chama River vor der Dunkelheit nicht mehr erreichen. Salt, sein Esel, hatte seit dem Morgen nichts mehr getrunken, und Weathers konnte jetzt kein totes Tier gebrauchen. Er beobachtete, wie der Esel im Schatten döste und mit angelegten Ohren und zuckenden Lippen von irgendetwas Bösem träumte. Weathers empfand beinahe so etwas wie Zuneigung für das boshafte alte Biest.
Er drückte die Zigarette aus und schob den Stummel in die Westentasche. Dann trank er einen Schluck aus seiner Feldflasche, goss ein wenig Wasser auf das Halstuch und kühlte sich damit Gesicht und Nacken. Er hängte sich die Feldflasche wieder um, band den Esel los und führte ihn in östlicher Richtung über das kahle Sandsteinplateau. Einen knappen halben Kilometer weiter bildete der Schwindel erregende Abgrund des Joaquin Canyon eine spektakuläre Schlucht in der Mesa de los Viejos, der Mesa der Alten. Diese Schlucht teilte sich in ein verworrenes Geflecht von Canyons, das Labyrinth, und zog sich bis zum Chama River.
Weathers spähte hinunter. Der Grund der Schlucht lag in blauen Schatten wie unter Wasser. Wo der Canyon eine Biegung nach Westen beschrieb – die Orphan Mesa auf der einen, die Dog Mesa auf der anderen Seite –, entdeckte er in einer Entfernung von etwa acht Kilometern den breiten Eingang des Labyrinths. Die Sonne fiel gerade in diesem Moment auf die typischen schrägen Felsnadeln und die wie böse Omen wirkenden Felsformationen, die den Eingang markierten.
Er suchte den Rand des Canyons ab, bis er den kaum erkennbaren, steilen Pfad fand, der hinunterführte. Der Abstieg war tückisch, denn der Pfad war an mehreren Stellen von Erdrutschen verschüttet, und dort musste man mehr als dreihundert Meter über dem Boden schmale Felsvorsprünge passieren. Dies war die einzig mögliche Route vom Chama River zum Hochland der Tafelberge im Osten, und nur ausgesprochen mutige Menschen nahmen diesen Pfad.
Dafür war Weathers sehr dankbar.
Er suchte sich seinen Weg hinunter, vorsichtig auf seine eigene und die Sicherheit des Esels bedacht, und war erleichtert, als sie dem trockenen Flussbett am Grund immer näher kamen. Der Joaquin Wash würde ihn zum Eingang des Labyrinths und von dort zum Chama River bringen. An einer engen Flussbiegung, der Chama Bend, gab es eine Stelle, die sich als natürlicher Lagerplatz anbot, mit einer Sandbank, hinter der man gut schwimmen konnte. Schwimmen … das war mal ein schöner Gedanke. Morgen Nachmittag würde er in Abiquiú sein. Als Erstes würde er Harry Dearborn anrufen (der Akku seines Satellitentelefons hatte schon vor Tagen den Geist aufgegeben), nur um ihm Bescheid zu sagen … Allein der Gedanke daran, diese Neuigkeit zu überbringen, machte Weathers kribbelig.
Endlich erreichten sie den Grund der Schlucht. Weathers blickte den Steilhang hinauf. Er war dunkel, doch der obere Rand wurde von der tief stehenden Sonne flammend rot erleuchtet. Er erstarrte. Einige hundert Meter über sich am Rand des Canyons entdeckte er die Silhouette eines Mannes, der offenbar zu ihm hinabstarrte.
Weathers fluchte leise. Das war derselbe Mann, der ihm schon vor zwei Wochen von Santa Fe aus in diese Wildnis gefolgt war. Solche Typen wussten von Weathers’ einzigartiger Fähigkeit; diese Leute waren zu faul oder zu dumm, um selbst nach Schätzen zu suchen, und wollten sich seine Funde unter den Nagel reißen. Er erinnerte sich an den Mann: ein magerer Kerl auf einer Harley, ein Möchtegern-Biker. Der Mann war ihm durch Espanola gefolgt, vorbei an Abiquiú und der Ghost Ranch, immer im Abstand von knapp zweihundert Metern; er hatte gar nicht erst versucht, unbemerkt zu bleiben. Denselben Kerl hatte er auch am Anfang seiner Tour in die Wildnis gesehen. Er hatte immer noch so ein Biker-Kopftuch aufgehabt und war ihm zu Fuß vom Chama River aus den Joaquin Wash entlang gefolgt. Weathers hatte seinen Verfolger im Labyrinth abgehängt und das Plateau der Mesa de los Viejos erreicht, bevor der Biker den Weg hinausgefunden hatte.
Nun war er wieder da, zwei Wochen später – ein hartnäckiger Bastard.
Stem Weathers betrachtete die gemächlichen Kurven des Joaquin Wash, dann die Felsnadeln, die den Eingang des Labyrinths markierten. Er würde ihn eben wieder im Labyrinth abhängen. Und vielleicht würde der Mistkerl diesmal da drin verrecken.
Er kletterte vorsichtig weiter den Canyon hinab und drehte sich ab und zu um. Doch statt ihm zu folgen, war der Mann verschwunden. Vielleicht glaubte sein Verfolger, einen schnelleren Abstieg zu kennen.
Weathers lächelte, denn es gab keinen anderen Weg.
Nachdem er eine Stunde lang dem Joaquin Wash gefolgt war, ließen seine Wut und seine Sorge nach. Der Typ war ein Amateur. Er war nicht der Erste, der Weathers hinaus in die Wüste folgte, um sich dort völlig zu verirren. Alle wollten sie sein wie Stem, aber das waren sie eben nicht. Er hatte das schon sein ganzes Leben lang gemacht, und er besaß einen sechsten Sinn – es war unerklärlich. Er hatte das weder aus einem Buch gelernt noch an einer Universität studiert, doch diese ganzen Wissenschaftler mit ihren geologischen Karten und ihrer hochmodernen SAR-Vermessungstechnik konnten das nicht. Ihm gelang, was sie nicht schafften, mit Hilfe eines Esels, eines selbst gebastelten Bodenradars und eines alten 286er IBM. Kein Wunder, dass sie ihn nicht ausstehen konnten.
Weathers’ prächtige Laune kehrte zurück. Der Mistkerl würde ihm nicht die beste Woche seines Lebens versauen. Der Esel wurde störrisch, und Weathers blieb stehen, goss ein wenig Wasser in seinen Hut, ließ das Tier trinken und trieb es dann fluchend weiter. Das Labyrinth lag unmittelbar vor ihm, und da wollte er hinein. Tief drinnen, in der Nähe der Two Rocks, befand sich eine der wenigen Wasserquellen in dieser Gegend – ein Felsvorsprung, bedeckt mit Frauenhaarfarn, von dem Wasser in ein uraltes Bassin tröpfelte; in prähistorischer Zeit hatten Indianer es in den Sandstein gehauen. Weathers beschloss, lieber dort zu lagern statt an der Chama Bend, wo er ein leichtes Ziel abgegeben hätte. Es war besser, auf Nummer sicher zu gehen.
Er marschierte um die riesige Felsnadel herum, die den Eingang markierte. Mehr als dreihundert Meter hoch ragten die Wände der Schlucht über ihm auf – äolischer Sandstein, die majestätische Entrada-Formation, die verdichteten Überreste einer jurassischen Wüste. Im Canyon war es kühl und eigenartig still, wie im Innern einer gotischen Kathedrale. Tief atmete er die angenehme Luft ein, die nach Tamarisken duftete. Das Licht auf den angeblich Unheil bringenden Felsformationen über ihm glich nun nicht mehr Weißgold, sondern Kupfer, denn die Sonne sank dem Horizont entgegen.
Weathers setzte seinen Weg in das Netz aus Canyons fort und näherte sich der Stelle, wo der Hanging Canyon auf den Mexican Canyon traf – die erste von vielen solchen Abzweigungen. Im Labyrinth nutzte einem die beste Karte nichts. Und die Canyons waren so tief, dass GPS und Satellitentelefone auch nicht funktionierten.
Der erste Schuss traf Weathers von hinten in die Schulter, und es fühlte sich eher an wie ein harter Faustschlag denn wie ein Projektil. Er fiel auf Hände und Knie, wie gelähmt vor Staunen. Erst als er den Knall und das Echo in den Canyons hörte, wurde ihm klar, dass jemand auf ihn geschossen hatte. Noch spürte er keinen Schmerz, nur eine seltsame Taubheit, aber er sah Knochensplitter aus seinem zerfetzten Hemd ragen, Blut schoss in einer rhythmischen Fontäne hervor und klatschte auf den Sand.
Herr im Himmel.
Taumelnd kam er wieder auf die Beine, als der zweite Schuss direkt neben ihm den Sand aufspritzen ließ. Die Schüsse kamen vom Plateau über ihm, von rechts. Er musste zurück in den Canyon, zweihundert Meter weit – hinter die Felsnadel. Es gab hier keine andere Deckung. Er rannte um sein Leben.
Der dritte Schuss wirbelte Sand vor ihm auf. Weathers rannte und sah, dass er noch eine Chance hatte. Der Angreifer hatte sich oben am Rand in Stellung gebracht und würde mehrere Stunden für den Abstieg brauchen. Wenn Weathers es hinter diese Felsnadel schaffte, konnte er vielleicht noch entkommen. Er rannte im Zickzack, und seine Lunge kreischte vor Schmerz. Fünfzig Meter, vierzig, dreißig –
Er hörte den Schuss erst, nachdem er das Projektil im Rücken gespürt hatte. Er sah seine eigenen Gedärme, die sich vor ihm auf den Sand ergossen, und wurde vornübergeschleudert. Er versuchte aufzustehen, schluchzend und um sich schlagend, entsetzlich wütend, weil nun jemand seinen Fund stehlen würde. Er wand sich, heulte, klammerte sich an sein kleines Notizbuch, das er wegwerfen, verstecken, zerstören wollte, um es vor dem Mörder in Sicherheit zu bringen – doch er konnte es hier nirgends verstecken, und dann war alles wie in einem Traum, er konnte nicht mehr denken, sich nicht bewegen …
2
Tom Broadbent zügelte sein Pferd. Vier Schüsse hallten von den gewaltigen, hohen Canyons östlich des Flusses den Joaquin Wash entlang. Er fragte sich, was das bedeuten mochte. Jetzt war keine Jagdsaison, und niemand, der noch ganz bei Trost war, würde in diesen abgelegenen Canyons Schießübungen veranstalten.
Er sah auf die Uhr. Es war acht. Die Sonne war eben hinter dem Horizont versunken. Die Echos kamen offenbar von dem Haufen seltsam geformter Felsen am Eingang zum Labyrinth. Es wäre ein Ritt von höchstens einer Viertelstunde. Er hatte Zeit genug für einen kleinen Umweg. Bald würde der Vollmond aufgehen, und seine Frau Sally rechnete ohnehin nicht vor Mitternacht mit ihm.
Er lenkte sein Pferd Knock das trockene Flussbett hinauf auf den Canyon zu und stellte fest, dass er den frischen Spuren eines Menschen und eines Esels folgte. Er kam um eine Biegung und entdeckte vor sich einen dunklen Umriss auf dem Boden: ein Mann, bäuchlings ausgestreckt.
Er ritt hinüber, schwang sich aus dem Sattel und kniete sich mit hämmerndem Herzen neben die Gestalt. Der Mann war in den unteren Rücken und in die Schulter getroffen worden, und immer noch sickerte Blut in den Sand. Tom legte die Finger an die Halsschlagader – nichts. Er drehte den Mann um, wobei dessen restliche Eingeweide in den Sand rutschten.
Tom arbeitete rasch: Er wischte dem Verletzten den Sand aus dem Mund und beatmete ihn. Dann beugte er sich über ihn und begann mit der Herzmassage, stemmte sich auf den Brustkorb, so dass die Rippen beinahe brachen, einmal, zweimal, dann beatmete er wieder. Luft blubberte aus der Wunde. Tom setzte die Wiederbelebung fort und überprüfte erneut den Pulsschlag.
Erstaunlicherweise hatte der Herzschlag wieder eingesetzt.
Plötzlich schlug der Mann die Augen auf, klare, blaue Augen, die Tom aus einem staubigen, von der Sonne verbrannten Gesicht anstarrten. Der Mann rang nach Atem, und die Luft rasselte in seiner Lunge. Seine Lippen bewegten sich.
»Nein … du Bastard …« Der Mann riss die Augen weit auf, seine Lippen waren nun mit Blut gesprenkelt.
»Moment«, sagte Tom. »Ich habe nicht auf Sie geschossen.«
Die Augen musterten ihn, und die Angst darin ließ nach – verdrängt von etwas anderem. Hoffnung. Der Blick des Mannes glitt zu seiner Hand, als wollte er auf etwas hinweisen.
Tom folgte dem Blick und bemerkte, dass der Verletzte ein kleines, in Leder gebundenes Notizbuch umklammert hielt.
»Nehmen …«, krächzte der Mann.
»Versuchen Sie nicht, zu sprechen.«
»Nehmen Sie es …«
Tom nahm das Notizbuch. Der Einband war klebrig vor Blut.
»Es ist für Robbie …«, keuchte der Mann, und seine Lippen zuckten, offenbar vor Anstrengung. »Meine Tochter … Versprechen Sie mir, dass Sie es ihr geben … Sie weiß schon, wie sie ihn finden kann …«
»Ihn?«
»… den Schatz …«
»Machen Sie sich jetzt keine Gedanken darum. Wir müssen Sie hier rausbringen. Halten Sie durch, bis –«
Der Mann krallte sich mit zitternden Fingern an Toms Hemd. »Er ist für sie … Robbie … niemand sonst … Um Himmels willen nicht zur Polizei … Sie müssen es … versprechen.« Seine Hand zerrte mit erschreckender Kraft an Toms Hemd, ein letztes Aufbäumen des sterbenden Mannes.
»Ich verspreche es.«
»Sagen Sie Robbie … ich … liebe …«
Sein Blick ging ins Leere. Die Hand entspannte sich und sank herab. Tom bemerkte, dass der Mann nicht mehr atmete.
Er begann erneut mit der Wiederbelebung. Nichts. Nachdem er es zehn Minuten lang vergeblich versucht hatte, band er das Halstuch des Mannes ab und breitete es über dessen Gesicht.
Da erst wurde ihm schlagartig klar: Der Mörder musste noch in der Nähe sein. Er suchte die Felsüberhänge und das umliegende Geröll ab. Die Stille war so tief, dass es schien, als hielten die Felsen lauschend Wache. Wo ist der Mörder? Es waren keine anderen Spuren zu sehen, nur die des Schatzsuchers und seines Esels. Das Tier stand etwa hundert Meter entfernt, schwer bepackt; es döste. Der Mörder hatte ein Gewehr und freies Schussfeld. Er könnte Broadbent bereits im Visier haben.
Raus hier, sofort. Er stand auf, griff nach den Zügeln seines Pferdes, schwang sich in den Sattel und drängte das Tier vorwärts. Im Galopp jagte das Pferd den breiten Canyon entlang und um die Felsnadel herum ins Labyrinth. Erst als sie den Joaquin Wash schon zur Hälfte hinter sich gelassen hatten, zügelte Tom das Pferd zum Trab. Ein riesiger, buttergelber Mond ging im Osten auf und beleuchtete das sandige Flussbett.
Wenn er sein Pferd ordentlich rannahm, konnte er Abiquiú in zwei Stunden erreichen.
3
Jimson »Weed« Maddox marschierte am Grund des Canyons entlang, pfiff vor sich hin und fühlte sich einfach großartig. Sein AR-15, Kaliber 5,56 mm, lag zerlegt, gereinigt und sorgsam versteckt hinter Steinen in einem Spalt.
Die Schlucht beschrieb eine Kurve, dann noch eine. Weathers hatte versucht, ihn zum zweiten Mal mit demselben Trick hereinzulegen und ihn im Labyrinth abzuhängen. Der alte Mistkerl mochte Jimson A. Maddox einmal drangekriegt haben. Ein zweites Mal gab es nie.
Zügig ging er das ausgetrocknete Flussbett entlang und kam mit seinen langen Beinen gut voran. Sogar mit Hilfe einer Karte und eines GPS-Geräts war er fast eine Woche lang im Labyrinth herumgeirrt. Doch das war keine Zeitverschwendung gewesen: Nun kannte er das Labyrinth und auch die Plateaus dahinter ziemlich gut. Er hatte reichlich Zeit gehabt, den Hinterhalt für Weathers zu planen – und er hatte ihn perfekt ausgeführt.
Er atmete die duftende Luft des Canyons ein. Hier war es gar nicht so viel anders als im Irak, wo er im »Desert Storm« als Soldat gedient hatte. Wenn es das Gegenteil zu einem Gefängnis gab, dann war es dieser Ort hier – niemand bedrängte einen oder hockte einem dauernd auf der Pelle, es gab keine Homos, Tacofresser oder Nigger, die einem den Tag versauten. Trocken, leer und still.
Er kam um die Felsnadel aus Sandstein zum Eingang des Labyrinths. Der Mann, den er erschossen hatte, lag auf dem Boden – nur ein dunkler Umriss im Zwielicht.
Er blieb stehen. Frische Hufspuren im Sand führten zu der Leiche und wieder weg.
Er rannte los.
Der Leichnam lag auf dem Rücken, die Arme eng an die Seiten gedrückt, und ein Halstuch bedeckte das Gesicht. Es war jemand hier gewesen. Dieser Jemand könnte sogar ein Zeuge sein. Er war beritten und mit Sicherheit schon unterwegs zur Polizei.
Maddox zwang sich zur Ruhe. Sogar zu Pferd würde der Mann ein paar Stunden bis Abiquiú brauchen, und einige Stunden mehr, um mit der Polizei zurückzukehren. Selbst, wenn sie einen Hubschrauber anforderten, musste der erst mal aus Santa Fe hergebracht werden, und das lag gut hundertzwanzig Kilometer südlich von hier. Er hatte noch mindestens drei Stunden Zeit, um das Notizbuch an sich zu nehmen, die Leiche zu verstecken und sich aus dem Staub zu machen.
Maddox durchsuchte die Leiche, stülpte sämtliche Taschen nach außen und durchwühlte den Rucksack. Seine Hand schloss sich um einen Stein in der Hosentasche des Mannes; er holte ihn heraus und untersuchte ihn im Schein einer Taschenlampe. Das war ganz sicher eine Probe, und auf genau so ein Fundstück hatte Corvus ausdrücklich Wert gelegt.
Jetzt das Notizbuch. Unbeeindruckt von Blut und Eingeweiden suchte er den Leichnam noch einmal gründlich ab, drehte ihn um, tastete die andere Seite ab und versetzte ihm dann einen frustrierten Tritt. Er blickte sich um. Weathers’ Esel stand etwa hundert Meter weiter, noch voll bepackt, und döste.
Maddox löste den Knoten und zog den Packsattel von dem Tier. Er riss das obere, in Segeltuch gewickelte Bündel herunter, nahm die großen Segeltuchtaschen vom Gestell und kippte den Inhalt auf den Boden. Alles Mögliche fiel heraus: irgendein selbst gebasteltes Elektrogerät, Hämmer, Meißel, einige Landkarten der U.S. Geological Survey, ein kleiner GPS-Empfänger, Kaffeekanne, Bratpfanne, leere Beutel, die offenbar Essbares enthalten hatten, ein Strick zum Anbinden für den Esel, schmutzige Unterwäsche, alte Batterien und ein zusammengefaltetes Stück Pergament.
Maddox griff nach dem Pergament. Es war eine sehr einfache Karte mit grob gezeichneten Berggipfeln, Flüssen, Felsbrocken, gestrichelten Linien, mit altmodischer Schrift in Großbuchstaben – und dort, in der Mitte: ein fettes, verziertes X in schwarzer Tinte.
Eine wahrhaftige Schatzkarte.
Seltsam, dass Corvus die gar nicht erwähnt hatte.
Er faltete das fettige Stück Pergament wieder zusammen, stopfte es in seine Brusttasche und machte sich dann erneut auf die Suche nach dem Notizbuch. Auf Händen und Knien krabbelte er herum, durchsuchte gewissenhaft die verstreute Ausrüstung und die Vorräte und fand alles, was ein Goldsucher brauchen konnte – bis auf das Notizbuch.
Wieder betrachtete er das seltsame Elektrogerät. Ein selbst zusammengeschustertes Stück Schrott war das, nur ein zerbeulter Metallkasten mit ein paar Schaltern, Skalen und einem winzigen LED-Display. Corvus hatte nichts davon gesagt, aber das Ding sah wichtig aus. Das würde er lieber auch mitnehmen.
Er kämmte noch einmal alles durch, öffnete jeden Beutel, schüttete Mehl und getrocknete Bohnen aus, suchte die Packtaschen nach Geheimfächern ab und riss sogar die Fleece-Unterlage des Packsattels heraus. Immer noch kein Notizbuch. Maddox kehrte zu der Leiche zurück, durchsuchte zum dritten Mal die blutgetränkten Kleider und tastete alles nach einem rechteckigen Gegenstand ab. Er fand nur einen schmierigen Bleistiftstummel in der rechten Hosentasche des Toten.
Er lehnte sich zurück; sein Kopf schmerzte. Hatte der unbekannte Reiter das Notizbuch mitgenommen? War es ein Zufall, dass der Kerl hier aufgetaucht war – oder gab es dafür einen bestimmten Grund? Da kam ihm ein schrecklicher Gedanke: Der Reiter war ein Konkurrent. Er hatte es genauso gemacht wie Maddox: sich an Weathers drangehängt in der Hoffnung, sich dessen Entdeckung unter den Nagel zu reißen. Vielleicht hatte der Kerl das Notizbuch in die Finger gekriegt.
Na ja, immerhin hatte Maddox die Karte gefunden. Und er hatte den Eindruck, dass die Karte mindestens so wichtig war wie das Notizbuch.
Maddox sah sich die Szene an – die Leiche, das Blut, den Esel, das verstreute Gepäck. Die Cops waren auf dem Weg hierher. Maddox nahm all seine Willenskraft zusammen, wandte die Meditationstechniken an, die er sich im Gefängnis angeeignet hatte, und brachte damit seine Atmung und seinen Herzschlag unter Kontrolle. Er atmete aus und ein und beruhigte das Hämmern in seiner Brust, bis sein Herzschlag wieder sanft pulsierte. Allmählich breitete sich Ruhe in ihm aus. Er hatte immer noch reichlich Zeit. Er holte die Gesteinsprobe aus seiner Tasche, drehte sie im Mondlicht hin und her und zog auch die Karte hervor. Außer diesen beiden Dingen hatte er noch das seltsame Gerät, und damit dürfte Corvus mehr als zufrieden sein.
Aber zunächst einmal musste er eine Leiche vergraben.
4
Detective Lieutenant Jimmie Willer saß hinten im Polizeihubschrauber; er war todmüde und spürte das Dröhnen der Rotoren in sämtlichen Knochen. Unter ihnen glitt die gespenstische nächtliche Landschaft vorüber. Der Heli-Pilot folgte dem Lauf des Chama River, dessen Biegungen wie Säbelklingen schimmerten. Sie kamen an kleinen Ortschaften am Flussufer vorbei, wenig mehr als zusammengedrängte Lichtpunkte – San Juan Pueblo, Medanales, Abiquiú. Ab und zu kroch ein einsames Auto den Highway 84 entlang und warf einen winzigen gelblichen Lichtkegel in die Dunkelheit. Nördlich des Wasserspeichers von Abiquiú war es vorbei mit den Lichtern; jetzt kamen die Berge und Canyons der Chama Wilderness und das riesige, zerklüftete Hochland, unbewohnt von hier bis zur Staatsgrenze von Colorado.
Willer schüttelte den Kopf. Ganz ungünstiger Ort, um sich ermorden zu lassen.
Er tastete nach der Marlboro-Schachtel in seiner Brusttasche. Es ärgerte ihn, dass man ihn mitten in der Nacht aus dem Bett geworfen hatte; es ärgerte ihn, dass er den einzigen Polizeihubschrauber aus Santa Fe hatte anfordern müssen; es ärgerte ihn, dass er die Gerichtsmedizinerin nicht erreichen konnte und sein eigener Deputy draußen im Cities of Gold Casino seinen jämmerlichen Lohn verspielte und das Handy abgeschaltet hatte. Obendrein kostete der Heli-Einsatz sechshundert Dollar pro Stunde, eine Ausgabe, die er von seinem Budget würde bezahlen müssen. Und dieser Flug war erst der Anfang. Sie würden noch einmal rausfliegen müssen, mit der Gerichtsmedizinerin und der Spurensicherung, bevor sie den Leichnam und eventuelles Beweismaterial bergen konnten. Und dann die Presse … Vielleicht, dachte Willer hoffnungsvoll, war das nur ein weiterer Mord in der Drogenszene und der Presse nicht mehr als eine kleine Meldung in der Lokalzeitung wert.
Ja, bitte, Gott, lass es einen Drogenmord sein.
»Da. Der Joaquin Wash. Jetzt nach Osten«, wies Broadbent den Piloten an. Willer warf dem Mann, der ihm den Abend versaut hatte, einen Seitenblick zu. Er war groß und langgliedrig, und einer seiner abgetragenen Cowboystiefel wurde von einem Streifen Klebeband zusammengehalten.
Der Hubschrauber legte sich in die Kurve, weg vom Fluss.
»Könnten Sie etwas runtergehen?«
Der Heli flog tiefer und zugleich langsamer. Willer konnte die Ränder des Canyons im Mondlicht klar erkennen, während die Schluchten selbst wie bodenlose Abgründe wirkten. Verdammt unheimliche Gegend.
»Das Labyrinth ist genau unter uns«, sagte Broadbent. »Die Leiche lag am Eingang, an der Stelle, wo das Labyrinth auf den Joaquin Canyon trifft.«
Der Hubschrauber flog noch langsamer und zog eine Schleife. Der Mond stand fast genau über ihnen und beleuchtete zum Großteil sogar den Grund der Schlucht. Willer sah nichts außer silbrigem Sand.
»Landen Sie da auf der offenen Fläche.«
»Klar.«
Der Pilot ließ den Heli schweben und begann das Landemanöver. Die Rotoren wirbelten einen kleinen Sandsturm auf, bevor die Maschine den Boden erreichte. Gleich darauf kamen sie zum Stehen, die Staubwolken zogen ab, und das pfeifende Dröhnen der Rotoren wurde leiser.
»Ich bleibe beim Hubschrauber«, erklärte der Pilot. »Macht ihr euer Ding.«
»Danke, Freddy.«
Broadbent kletterte hinaus, und Willer folgte ihm; er duckte sich, hielt gegen den aufgewirbelten Sand eine Hand vor die Augen und joggte, bis er aus dem Luftstrom heraus war. Dann blieb er stehen, richtete sich auf, zog die Packung aus der Brusttasche und zündete sich eine Zigarette an.
Broadbent ging weiter. Willer schaltete seine starke Taschenlampe ein und leuchtete die Umgebung ab. »Dass Sie mir nicht auf irgendwelche Spuren treten«, rief er Broadbent zu. »Sonst kriege ich es mit den Jungs von der Spurensicherung zu tun.« Er richtete den Lichtkegel auf den Eingang des Canyons. Da war nichts, nur flacher Sand zwischen zwei hohen Sandsteinwänden.
»Was ist da drüben?«
»Das ist das Labyrinth«, sagte Broadbent.
»Wo führt es hin?«
»Das sind eine Menge Canyons, die Richtung Mesa de los Viejos führen. Da drin kann man sich leicht verlaufen, Detective.«
»Hm.« Er schwenkte die Taschenlampe von einer Seite zur anderen. »Ich sehe keine Spuren.«
»Ich auch nicht. Aber sie müssen hier irgendwo sein.«
»Gehen Sie vor.«
Er folgte Broadbent langsam und vorsichtig. Die Taschenlampe war im hellen Mondlicht kaum nötig, eigentlich eher hinderlich. Er schaltete sie ab.
»Ich sehe immer noch keine einzige Fußspur.« Er blickte voraus. Der Canyon war von Felswand zu Felswand in Mondlicht getaucht und völlig leer – kein Felsbrocken, kein Busch, keine Fußspur und keine Leiche, so weit das Auge reichte.
Broadbent zögerte und sah sich um.
Willer hatte allmählich ein mieses Gefühl bei der Sache.
»Die Leiche lag hier in diesem Bereich. Und meine Hufspuren müssten da drüben deutlich zu sehen sein …«
Willer sagte nichts. Er bückte sich, drückte die Zigarette im Sand aus und steckte die Kippe in die Tasche.
»Die Leiche war genau hier. Da bin ich ganz sicher.«
Willer schaltete die Taschenlampe wieder an und suchte die Umgebung ab. Nichts. Er knipste sie wieder aus und holte sich noch eine Zigarette.
»Der Esel stand dort drüben«, fuhr Broadbent fort, »etwa hundert Meter von der Leiche entfernt.«
Hier gab es keine Spuren, keine Leiche, keinen Esel, nichts als einen leeren Canyon im Mondlicht. »Sind Sie sicher, dass das die richtige Stelle ist?«, fragte Willer.
»Absolut.«
Willer hakte die Daumen in den Gürtel und beobachtete Broadbent, der herumlief und den Boden absuchte. Er war groß und bewegte sich behände. Im Ort hieß es, er sei ein Krösus – aber aus der Nähe betrachtet sah er keineswegs reich aus mit diesen kaputten alten Stiefeln und dem Hemd von der Heilsarmee.
Willer hustete einen Schleimbatzen hoch. Hier draußen musste es Tausende solcher Canyons geben, und es war mitten in der Nacht – Broadbent hatte sie zur falschen Stelle geführt.
»Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind?«
»Er lag genau hier, am Eingang zu diesem Canyon.«
»Vielleicht vor einem anderen Canyon?«
»Nein, es war ganz sicher hier.«
Willer sah doch mit eigenen Augen, dass der Canyon völlig leer war. Der Mond schien taghell.
»Na, jetzt ist hier jedenfalls nichts. Es gibt keine Spuren, keine Leiche, kein Blut – gar nichts.«
»Hier lag eine Leiche, Detective.«
»Höchste Zeit, endlich Feierabend zu machen, Mr. Broadbent.«
»Sie wollen einfach aufgeben?«
Willer atmete tief durch. »Ich sage nur, dass wir morgen früh noch mal herkommen sollten. Bei Tageslicht sieht so eine Gegend vertrauter aus, vielleicht erinnern Sie sich dann besser.« Er würde bei diesem Kerl nicht die Geduld verlieren.
»Kommen Sie mal hier rüber«, sagte Broadbent plötzlich. »Sieht so aus, als wäre der Sand hier glatt gestrichen worden.«
Willer musterte den Mann. Für wen, zum Teufel, hielt er sich eigentlich, dass er ihn, Willer, so herumkommandierte?
»Ich kann hier keinerlei Hinweis auf ein Verbrechen erkennen. Dieser Hubschrauber kostet mein Department sechshundert Dollar die Stunde. Wir kommen morgen wieder her, mit Karten und einem GPS-Gerät, und suchen nach dem richtigen Canyon.«
»Sie haben mich wohl nicht verstanden, Detective. Ich gehe nirgendwohin, solange ich dieses Problem nicht gelöst habe.«
»Wie Sie wollen. Sie kennen sich hier ja bestens aus.« Willer machte kehrt, ging zurück zum Hubschrauber und stieg ein. »Nichts wie raus hier.«
Der Pilot setzte seinen Kopfhörer ab. »Und was ist mit ihm?«
»Der kennt den Weg.«
»Er winkt Ihnen zu.«
Willer fluchte leise und sah nach der dunklen Gestalt in ein paar hundert Meter Entfernung. Sie winkte und gestikulierte.
»Sieht so aus, als hätte er was gefunden«, sagte der Pilot.
»Herrgott noch mal.« Willer stieg mühsam aus dem Heli und marschierte hinüber.
Broadbent hatte etwas trockenen Sand mit dem Fuß weggescharrt und darunter eine schwarze, nasse, klebrig wirkende Schicht zum Vorschein gebracht.
Willer schluckte, griff nach seiner Taschenlampe und schaltete sie ein. »O Gott«, sagte er und wich einen Schritt zurück. »O Gott.«
5
Weed Maddox kaufte bei Seligman’s in der Vierunddreißigsten Straße ein blaues Seidensakko, seidene Boxershorts und eine graue Hose, dazu ein weißes T-Shirt, seidene Socken und italienische Schuhe – und zog in der Umkleidekabine alles an. Er bezahlte mit seiner eigenen American-Express-Karte – seine erste echte Kreditkarte, da stand es, vorne drauf: Jimson A. Maddox, Karteninhaber seit 2005. Dann trat er hinaus auf die Straße. Die neuen Klamotten milderten seine Nervosität wegen des bevorstehenden Treffens mit Corvus. Schon komisch, kaum war man von Kopf bis Fuß neu eingekleidet, fühlte man sich auch wie ein neuer Mensch. Er straffte Schultern und Rücken und spürte, wie der Stoff sich kräuselte und spannte. Besser, viel besser.
Er winkte ein Taxi heran, nannte die Adresse, und los ging es Richtung Uptown.
Zehn Minuten später wurde er in das holzgetäfelte Büro von Dr. Iain Corvus gebeten. Es war beeindruckend. Ein nicht mehr funktionstüchtiger Kamin aus rosa Marmor zierte eine Ecke des Raums, und durch eine Reihe Fenster hatte man einen Blick auf den Central Park. Der junge Brite stand neben seinem Schreibtisch und blätterte hastig in irgendwelchen Unterlagen.
Maddox blieb an der Tür stehen, die Hände vor sich gefaltet, und wartete, bis der andere Notiz von ihm nahm. Corvus war aufgeregt wie immer, die kaum vorhandenen Lippen aufeinandergepresst wie von einem Schraubstock; das Kinn ragte vor wie der Bug eines Bootes, und das schwarze Haar war streng zurückgekämmt – vermutlich die neueste Mode in London, dachte Maddox. Corvus trug einen gut geschnittenen dunkelgrauen Anzug und ein weißes Button-down-Hemd von Turnbull and Asser, dazu eine blutrote Seidenkrawatte.
Das war mal ein Mann, dachte Maddox, dem Meditation echt guttäte.
Corvus hielt in seiner Blätterei inne und spähte über den Rand seiner Brille. »Na, so was, wenn das nicht Jimson Maddox ist, frisch von der Front.« Sein britischer Akzent wirkte affektierter denn je. Corvus war etwa in Maddox’ Alter, Mitte dreißig, doch die beiden Männer hätten unterschiedlicher nicht sein können – als stammten sie von zwei verschiedenen Planeten. Seltsam, wenn man bedachte, dass eine Tätowierung sie zusammengeführt hatte.
Corvus streckte die Hand aus, und Maddox schüttelte sie – ein fester Händedruck, weder zu lang noch zu kurz, weder schlaff noch aggressiv. Maddox musste seine aufwallenden Gefühle unterdrücken.
Dies war der Mann, der ihn aus Pelican Bay herausgeholt hatte.
Corvus umfasste Maddox’ Ellbogen und führte ihn zu einem Sessel in einer kleinen Sitzgruppe am anderen Ende des Raums, vor dem unbrauchbaren Kamin. Dann ging er zur Tür, sagte etwas zu seiner Sekretärin draußen, schloss die Tür ab und setzte sich Maddox gegenüber. Rastlos schlug er erst das eine, dann das andere Bein über, bis er offenbar eine bequeme Position gefunden hatte. Er beugte sich mit leuchtenden Augen vor, und sein Gesicht zertrennte die Luft so scharf wie ein Beil. »Zigarre?«
»Ich rauch nicht mehr.«
»Kluger Mann. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich …?«
»Teufel, nein.«
Corvus holte eine Zigarre aus einem Humidor, schnitt das Ende ab und zündete sie an. Er nahm sich einen Moment Zeit dafür, bis die Spitze schön glühte, ließ sie dann sinken und musterte Maddox durch einen wirbelnden Vorhang aus Rauch.
»Schön, Sie zu sehen, Jim.«
Es gefiel Maddox, dass Corvus ihm stets seine volle Aufmerksamkeit widmete und mit ihm wie mit seinesgleichen sprach, ihn als den aufrechten Kerl behandelte, der er war. Corvus hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Mit einem einzigen Anruf konnte er Maddox dorthin zurückbringen. Diese Tatsachen riefen starke, widersprüchliche Gefühle in Maddox wach, mit denen er noch nicht ganz klarkam.
»Nun«, sagte Corvus, lehnte sich zurück und stieß eine lang gezogene Rauchwolke aus.
Irgendetwas an Corvus machte ihn immer nervös. Maddox holte die Karte aus der Jackentasche und reichte sie ihm. »Das habe ich bei dem Kerl gefunden.«
Corvus nahm stirnrunzelnd das Blatt Papier und faltete es auf. Maddox wartete auf sein Lob. Stattdessen lief Corvus rot an. Mit einer schroffen Bewegung ließ er die Karte auf den Tisch fallen. Maddox beugte sich vor, um sie an sich zu nehmen.
»Nicht der Mühe wert«, kam die scharfe Erwiderung. »Sie ist wertlos. Wo ist das Notizbuch?«
Maddox antwortete nicht direkt. »Das war so … Ich bin Weathers in die Mesas gefolgt, aber er hat mich abgeschüttelt. Ich habe zwei Wochen lang gewartet, bis er wieder rauskam. Dann habe ich ihm aufgelauert und ihn getötet.«
Es herrschte geladenes Schweigen.
»Sie haben ihn getötet?«
»Ja. Wollen Sie, dass der Kerl zu den Cops geht und allen erzählt, Sie hätten sich sein Claim unter den Nagel gerissen, oder wie Sie das sonst nennen wollen? Glauben Sie mir, der Kerl musste sterben.«
Ein langes Schweigen. »Und das Notizbuch?«
»Das ist es ja. Ich hab kein Notizbuch gefunden. Nur die Karte. Und das hier.« Er holte den Metallkasten mit den Schaltern und der LED-Anzeige aus der Tasche, die er neben sich abgestellt hatte, und legte ihn auf den Tisch.
Corvus würdigte das Ding keines Blickes. »Sie haben das Notizbuch nicht gefunden?«
Maddox schluckte. »Nein. Keine Spur.«
»Er muss es aber bei sich gehabt haben.«
»Er hatte nichts. Ich habe ihn von einem Hochplateau aus erschossen und musste erst mal gut sieben Kilometer laufen, um runter in den Canyon zu kommen. Bis dahin war mir jemand zuvorgekommen, ein anderer Goldsucher, der was abstauben wollte. Er war zu Pferde, seine Spuren waren überall. Ich habe den Toten und seinen Esel abgesucht, alles auf den Kopf gestellt. Da war kein Notizbuch. Ich habe alles Wertvolle mitgenommen, sämtliche Spuren verwischt und ihn begraben.«
Corvus wandte den Blick ab.
»Nachdem ich Weathers verbuddelt hatte, habe ich versucht, den Spuren dieses anderen Kerls zu folgen, aber ich habe ihn verloren. Zum Glück stand sein Name am nächsten Tag in der Zeitung. Er wohnt auf einer Ranch nördlich von Abiquiú und ist angeblich Pferdedoktor. Er heißt Broadbent.« Maddox verstummte.
»Broadbent hat das Notizbuch an sich genommen«, sagte Corvus tonlos.
»Das glaube ich auch, und deshalb hab ich mir den Kerl mal näher angesehen. Er ist verheiratet und reitet viel im Hinterland herum. Jeder kennt ihn. Es heißt, er sei reich – aber das würde man nie vermuten, wenn man ihn sieht.«
Corvus starrte Maddox direkt in die Augen.
»Ich beschaffe Ihnen dieses Notizbuch, Dr. Corvus. Aber was ist mit der Karte? Ich meine –«
»Die Karte ist eine Fälschung.«
Ein weiteres quälendes Schweigen.
»Und dieser Metallkasten?«, fragte Maddox und deutete auf das Ding, das er in Weathers’ Satteltasche gefunden hatte. »Sieht doch ganz nach einem Computer aus. Vielleicht ist was auf der Festplatte –«
»Das ist das Herzstück von Weathers’ selbst gebasteltem Bodenradar. Es hat keine Festplatte – die Daten stehen in dem Notizbuch. Deshalb wollte ich ja das Notizbuch haben – und keine wertlose Karte.«
Maddox wich Corvus’ starrem Blick aus, schob die Hand in die Hosentasche, zog den Stein hervor und legte ihn auf die gläserne Tischplatte. »Das hatte Weathers in der Tasche.«
Corvus starrte darauf hinab, und sein Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig. Mit Spinnenfingern griff er danach und hob den Stein vorsichtig hoch. Er holte eine Lupe von seinem Schreibtisch und untersuchte das Stück genauer. Eine lange Minute verstrich, dann noch eine. Schließlich blickte er auf. Maddox erkannte überrascht, dass Corvus’ Gesicht völlig verändert wirkte. Die angespannte Miene und das Glitzern in den Augen waren verschwunden. Sein Gesicht wirkte beinahe menschlich.
»Das ist … sehr gut.« Corvus erhob sich, ging zu seinem Schreibtisch, holte einen Gefrierbeutel aus einer Schublade und legte das Fundstück so vorsichtig hinein, als handle es sich um einen Edelstein.
»Das ist eine Probe, oder?«, fragte Maddox.
Corvus beugte sich vor, schloss eine Schublade auf und entnahm ihr ein zwei Finger dickes Bündel Hundert-Dollar-Scheine, mit Gummibändern umwickelt.
»Das ist wirklich nicht nötig, Dr. Corvus. Ich habe noch reichlich Geld von –«
Die schmalen Lippen des Mannes zuckten. »Für eventuelle, unerwartete Ausgaben.« Er drückte Maddox das Geldbündel in die Hand. »Sie wissen, was Sie zu tun haben.«
Maddox stopfte sich das Geld in die Sakkotasche.
»Auf Wiedersehen, Mr. Maddox.«
Maddox wandte sich ab und ging steifbeinig zu der Tür, die Corvus eben aufgeschlossen hatte und ihm nun aufhielt. Maddox spürte ein brennendes Kribbeln im Nacken, als er an ihm vorbeiging. Gleich darauf hielt Corvus ihn mit festem Griff an der Schulter zurück; der Druck seiner Hand war ein wenig zu fest, um freundschaftlich zu wirken. Maddox spürte, wie der Mann sich dicht zu ihm vorbeugte und ihm überdeutlich ins Ohr flüsterte: »Das Notizbuch.«
Maddox’ Schulter wurde frei gegeben, und er hörte, wie sich die Tür leise hinter ihm schloss. Er ging durch das leere Vorzimmer in die weitläufigen, hallenden Flure des Gebäudes.
Broadbent. Der Mistkerl war so gut wie erledigt.
6
Tom saß am Küchentisch, auf dem Stuhl zurückgelehnt, und wartete darauf, dass der Kaffeesatz in der Zinnkanne auf dem Herd zu Boden sank. Eine Junibrise ließ die Pappeln vor dem Fenster rascheln und zupfte die baumwollartigen Samenhüllen von den Zweigen, die wie große Schneeflocken am Fenster vorbeitrieben. Über den Hof hinweg konnte Tom die Pferde in ihren Paddocks sehen. Sie schnupperten an dem Wiesenlieschgras, das Sally ihnen heute Morgen gebracht hatte.
Sally kam herein, immer noch im Nachthemd. Sie ging an der gläsernen Schiebetür vorbei, so dass die aufgehende Sonne ihre Gestalt in strahlendes Licht tauchte. Sie waren kein ganzes Jahr verheiratet, und alles war noch neu. Er beobachtete, wie sie die Zinnkanne vom Herd nahm, hineinschaute, das Gesicht verzog und sie wieder hinstellte.
»Ich kann es nicht fassen, dass du auf diese Art deinen Kaffee kochst.«
Tom beobachtete sie lächelnd. »Du siehst heute Morgen hinreißend aus.«
Sie blickte auf und strich sich das goldblonde Haar aus dem Gesicht.
»Ich habe beschlossen, Shane heute die Praxis zu überlassen«, sagte Tom. »Bis jetzt haben wir nur ein Pferd mit Kolik drüben in Espanola auf der Liste.«
Er stützte die Stiefel an die Stuhlbeine und beobachtete, wie Sally sich umständlich ihren Kaffee machte – erst schäumte sie Milch auf, dann fügte sie einen Teelöffel Honig hinzu, und schließlich kam noch ein wenig dunkler Kakao aus einem Streuer obendrauf. Das war ihr Morgenritual, und Tom wurde es nie müde, ihr dabei zuzusehen.
»Shane wird das schon verstehen. Diese … Geschichte oben im Labyrinth hat mich fast die ganze Nacht lang wach gehalten.«
»Hat die Polizei denn schon eine Theorie?«
»Nein. Keine Leiche, kein Motiv, keine passenden Vermisstenmeldungen – nur ein paar Eimer blutgetränkten Sand.«
Sally verzog das Gesicht. »Und was hast du heute stattdessen vor?«, fragte sie.
Er beugte sich nach vorn, so dass die vorderen Stuhlbeine mit einem dumpfen Schlag wieder auf dem Boden landeten, griff in seine Hosentasche, holte das abgegriffene Notizbuch heraus und legte es auf den Tisch. »Ich werde diese Robbie suchen, wo auch immer sie stecken mag, und ihr das hier geben.«
Sally runzelte die Stirn. »Tom, ich finde immer noch, du hättest es der Polizei übergeben müssen.«
»Ich habe es dem Mann versprochen.«
»Es ist unverantwortlich, der Polizei Beweise in einem Mordfall vorzuenthalten.«
»Ich musste ihm versprechen, dass ich es nicht der Polizei gebe.«
»Wahrscheinlich hat er da draußen irgendetwas Illegales getrieben.«
»Kann sein, aber ich habe einem Sterbenden mein Wort gegeben. Außerdem habe ich es einfach nicht über mich gebracht, es diesem Detective Willer zu überlassen. Der schien mir nicht gerade der Hellste zu sein.«
»Dieses Versprechen wurde dir praktisch abgepresst. Das sollte nicht zählen.«
»Wenn du die Verzweiflung in seinem Gesicht gesehen hättest, würdest du es verstehen.«
Sally seufzte. »Und wie willst du diese geheimnisvolle Tochter ausfindig machen?«
»Ich dachte, ich fange oben beim Sunset Mart an, vielleicht hat er ja dort getankt oder eingekauft. Ich könnte auch ein paar dieser Nebenstraßen im Hinterland absuchen, ob ich irgendwo seinen Wagen finde.«
»Mit Pferdeanhänger für den Esel.«
»So ist es.«
Ungebeten stand ihm das Gesicht des sterbenden Mannes vor Augen. Dieses Bild würde ihn nie wieder loslassen; es erinnerte ihn zu sehr an den Tod seines Vaters, der gleiche verzweifelte Versuch, sich ans Leben zu klammern, selbst noch in jenen letzten Sekunden voller Schmerz und Angst, wenn alle Hoffnung schon verloren ist. Manche Menschen konnten das Leben einfach nicht loslassen.
»Ich könnte auch mal mit Ben Peek sprechen«, sagte Tom. »Er hat jahrelang in diesen Canyons nach Gold gesucht. Vielleicht hat er eine Ahnung, wer dieser Kerl war oder auf was für einen Schatz er es abgesehen hatte.«
»Das ist eine gute Idee. Steht denn nichts in diesem Notizbuch?«
»Nur Zahlenreihen. Kein Name, keine Adresse, nur sechzig Seiten Zahlen – und zwei gewaltige Ausrufezeichen hinter den letzten Ziffern.«
»Du glaubst also, dass er tatsächlich einen Schatz gefunden hat?«
»Ich habe es in seinem Blick gesehen.«
Die verzweifelte Bitte des Mannes hallte immer noch in seinen Ohren wider. Sie hatte ihn tief getroffen, vielleicht deshalb, weil der Tod seines Vaters ihm noch so gegenwärtig war. Sein Vater, der große, Furcht einflößende Maxwell Broadbent, war auch eine Art Schatzsucher gewesen – ein Grabräuber, Sammler und Händler seltener Artefakte. Er war zwar ein schwieriger Vater gewesen, doch sein Tod hatte in Toms Seele ein gewaltiges Loch hinterlassen. Der sterbende Schatzsucher mit seinem Bart und den durchdringenden blauen Augen hatte ihn sogar rein äußerlich an seinen Vater erinnert. Das war eine verrückte Assoziation, aber aus irgendeinem Grund war das Versprechen, das Tom dem Unbekannten gegeben hatte, für ihn unumstößlich.
»Tom?«
Tom blinzelte.
»Du hast schon wieder diesen verlorenen Gesichtsausdruck.«
»Entschuldige.«
Sally trank ihren Kaffee aus, stand auf und wusch ihre Tasse ab. »Weißt du eigentlich, dass wir dieses Haus genau heute vor einem Jahr gefunden haben?«
»Das hatte ich vergessen.«
»Gefällt es dir immer noch?«
»Es ist alles, was ich mir je gewünscht habe.«
In der wilden Landschaft von Abiquiú am Fuß des Pedernal Peak hatten sie gemeinsam das Leben gefunden, von dem sie immer geträumt hatten: eine kleine Ranch mit Pferden, einem Garten, einem Reitstall für Kinder und Platz für Toms Großtierpraxis – ein ländliches Leben ohne die Hektik und den Schmutz der Stadt oder lange Pendelfahrten. Seine Pferdepraxis lief gut. Selbst die sturen alten Rancher riefen inzwischen bei ihm an. Er arbeitete fast ausschließlich im Freien, die Menschen waren großartig, und er liebte Pferde.
Es war ein bisschen zu ruhig hier, das musste er zugeben.
Seine Gedanken kehrten zu dem Schatzsucher zurück. Er und sein Notizbuch waren interessanter als die Aussicht darauf, irgendeinem widerspenstigen Gaul mit Bretthals und Rattenschwanz auf Gilderhus’ Dude Ranch in Espanola – der Mann war für die Hässlichkeit sowohl seiner Pferde als auch seines Temperaments bekannt – einen Eimer voll Paraffinöl einzuflößen. Ein großer Vorteil daran, der Chef zu sein, lag darin, dass man die Drecksarbeit an seinen Angestellten delegieren konnte. Er tat das nicht oft, deshalb hatte er jetzt auch keine Gewissensbisse. Oder zumindest waren sie nicht allzu schmerzhaft …
Wieder wandte er sich dem Notizbuch zu. Es war offensichtlich in einer Art Code verfasst. Lange Reihen von Zahlen in peinlich ordentlicher Handschrift bedeckten die Seiten. Es war nirgends etwas durchgestrichen oder überschrieben worden, keine Fehler, kein Gekritzel – als hätte der Verfasser das alles Zahl für Zahl irgendwo abgeschrieben.
Sally stand auf und legte ihm den Arm um die Schultern. Ihr Haar fiel ihm ins Gesicht, und er sog den Geruch tief ein – frisches Shampoo und ihr ganz eigener Duft, der ihn an frisch gebackene Kekse erinnerte.
»Versprich mir nur eines«, sagte sie.
»Was denn?«
»Sei vorsichtig. Was auch immer dieser Mann gefunden hat, war jemandem wertvoll genug, um dafür zu töten.«
7
Melodie Crookshank, technische Assistentin, schob ihren Stuhl zurück und machte sich eine Cola auf. Sie trank einen Schluck und sah sich nachdenklich in ihrem Kellerlabor um. Nach ihrem Abschluss in Geophysikalischer Chemie an der Columbia University hatte sie sich eine völlig andere Karriere vorgestellt – sie wollte durch den Regenwald von Quintana Roo trekken, um den Chicxulub-Krater zu kartographieren, in der Wüste Gobi bei den legendären Flammenden Klippen kampieren und Dinosauriernester ausgraben oder mit einem Vortrag in makellosem Französisch ihre hingerissenen Zuhörer im Musée d’Histoire Naturelle in Paris beeindrucken. Stattdessen fand sie sich in diesem fensterlosen Kellerlabor wieder, wo sie langweilige Forschung für einfallslose Wissenschaftler durchführte, die sich nicht einmal ihren Namen merken konnten und von denen viele einen IQ hatten, der nur halb so hoch war wie ihrer. Sie hatte diese Stelle noch während der Promotion angenommen und sich gesagt, das sei ja nur ein Nebenjob, bis sie mit ihrer Dissertation fertig sei und eine glanzvolle wissenschaftliche Karriere eingeschlagen habe. Doch nun waren vier Jahre vergangen, seit sie den Doktorgrad erlangt hatte, und sie hatte Hunderte – ach was, Tausende – von Bewerbungen verschickt und kein einziges Angebot bekommen. Die Konkurrenz war brutal, jedes Jahr drängten sich sechzig neue Absolventen um ein halbes Dutzend Dozentenstellen wie bei einer »Reise nach Jerusalem« – wenn die Musik aufhörte, hatten die wenigsten einen Stuhl ergattert. Wie weit es mit ihr gekommen war, wurde ihr eines Tages klar, als sie die Todesanzeigen im Mineralogy Quarterly aufschlug und voll freudiger Erregung feststellte, dass ein Professor, Inhaber eines sehr begehrten Lehrstuhls, von seinen Studenten verehrt, mit zahllosen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, ein wahrer Pionier seines Fachgebiets, tragischerweise viel zu früh dahingeschieden war. Hurra.
Andererseits war Melodie eine unbeirrbare Optimistin, und im tiefsten Inneren hatte sie das Gefühl, dass sie zu etwas Großem berufen war. Deshalb verschickte sie weiterhin Hunderte von Lebensläufen und bewarb sich für absolut jeden Posten, der irgendwo ausgeschrieben wurde. Bis dahin war ihr Leben hier erträglich: Im Labor ging es ruhig zu, sie trug die Verantwortung für ihren Bereich allein, und wenn sie alledem einmal entkommen wollte, brauchte sie nur die Augen zu schließen und sich in die Zukunft zu versetzen, jenes weite, wundersame Reich, in dem sie Abenteuer erleben, fantastische Entdeckungen machen, Lobreden entgegennehmen und einen Lehrstuhl ihr Eigen nennen konnte.
Melodie öffnete die Augen wieder und stellte sich der gewöhnlichen Welt, dem Labor mit seinen nackten Betonwänden, dem leisen Summen der Neonröhren, dem steten Zischen der Luftumwälzung, den Regalen voller Fachbücher und den mit mineralischen Proben vollgestopften Schränken. Sogar die millionenteure technische Ausstattung, einst so aufregend, langweilte sie inzwischen. Ruhelos glitt ihr Blick über die gewaltige energiedispersive Röntgenanalysesonde JEOLJXA-733 Superprobe, den Epsilon-5-Röntgendiffraktometer mit dreidimensionaler, polarisierender Optik, eine 600-Watt-Gd-Anode-Röntgenröhre mit 100-Kilovolt-Generator, das Watson 55 Transmissionselektronenmikroskop, den PowerMac G5 mit wassergekühltem 2,5-Gigahertz-Multicore-Prozessor, zwei petrographische Labormikroskope, ein polarisierendes Lichtmikroskop von Meiji, digitale Kameraaufbauten, eine voll ausgestattete Probenpräparationseinheit mit diamantbeschichteten Schneideklingen, Poliereinheiten, Kohlenstoffbeschichtern –
Was nutzte das alles, wenn die ihr nur langweiliges Zeug zum Analysieren gaben?
Melodies Tagtraum wurde von einem leisen Summen unterbrochen; es zeigte an, dass jemand ihr menschenleeres Labor betreten hatte. Zweifellos ein weiterer wissenschaftlicher Mitarbeiter mit der Bitte, sie möge für eine kleine Abhandlung, die dann doch kein Mensch lesen würde, irgendeinen grauen Stein untersuchen. Mit den Füßen auf dem Schreibtisch und der Cola in der Hand wartete sie auf den Eindringling, der bald um die Ecke kommen musste.
Bald hörte sie das selbstsichere Klappern teurer Schuhe auf dem Linoleum, und ein schlanker, eleganter Mann in einem schicken blauen Anzug erschien – Dr. Iain Corvus.
Hastig zog sie die Füße vom Tisch, wobei die beiden vorderen Stuhlbeine mit lautem Krachen auf dem Boden landeten. Sie strich sich das Haar aus dem errötenden Gesicht. Die Kuratoren kamen so gut wie nie ins Labor, denn sie empfanden es als unter ihrer Würde, sich mit dem technischen Personal abzugeben. Dennoch stand nun Corvus persönlich vor ihr, eine beeindruckende Erscheinung in dem Savile-Row-Anzug und den handgefertigten Schuhen von Williams and Croft. Er sah gut aus, auf eine unheimliche Jeremy-Irons-Art.
»Melodie Crookshank?«
Erstaunlich, er kannte sogar ihren Namen. Sie blickte in sein längliches, lächelndes Gesicht; er hatte makellose Zähne, und sein Haar war schwarz wie die Nacht. Sein Anzug raschelte leise bei jeder Bewegung.
»Ja«, sagte sie schließlich und versuchte, möglichst locker zu klingen. »Das bin ich, Melodie Crookshank.«
»Wie schön, dass ich Sie gleich antreffe, Melodie. Störe ich Sie gerade?«
»Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich sitze hier nur rum«, platzte sie heraus, dann sammelte sie sich, errötete und kam sich dumm vor.
»Ich habe mich gefragt, ob ich Ihren Arbeitstag mit einer Probe unterbrechen dürfte, die ich gern analysiert hätte.« Er streckte ihr einen Probenbeutel entgegen und ließ ihn vor ihr hin und her baumeln. Seine Zähne blitzten.
»Natürlich.«
»Ich habe hier eine kleine, äh, Herausforderung für Sie. Sind Sie dabei?«
»Ja, sicher.« Corvus stand in dem Ruf, etwas abgehoben zu sein, sogar arrogant, aber jetzt kam er ihr beinahe verspielt vor.
»Das ist eine Sache nur zwischen uns beiden.«
Melodie zögerte und fragte dann vorsichtig: »Wie meinen Sie das?«
Er reichte ihr die Probe, und sie betrachtete das Stück. In dem Beutel steckte ein kleiner Zettel, von Hand beschriftet, auf dem stand: New Mexico, Probe #1.
»Ich möchte, dass Sie diese Probe analysieren, und zwar ohne jegliche vorgefasste Vorstellung davon, woher sie stammt oder um was es sich handeln könnte. Eine vollständige mineralogische, kristallographische, chemische und strukturelle Analyse.«
»Kein Problem.«
»Jetzt kommt der Haken. Ich würde das gern geheim halten. Halten Sie nichts schriftlich fest, speichern Sie nichts auf einer Festplatte. Wenn Sie Ihre Untersuchungen durchgeführt haben, kopieren Sie die Daten auf CDs und löschen Sie alles. Bewahren Sie die CDs in Ihrem verschlossenen Probenschrank auf. Erzählen Sie niemandem davon, was Sie hier tun, und sprechen Sie mit keinem Menschen über Ihre Ergebnisse. Erstatten Sie ausschließlich mir persönlich Bericht darüber.« Er schenkte ihr ein weiteres strahlendes Lächeln. »Sind Sie dabei?«
Crookshank spürte ein Prickeln der Erregung ob dieser Heimlichtuerei und der Tatsache, dass Corvus sie ins Vertrauen zog. »Ich weiß nicht. Warum so geheimnisvoll?«
Corvus beugte sich vor. Sie roch einen Hauch von Zigarrenrauch und teurem Tweed. »Das, meine liebe Melodie, werden Sie erfahren – nachdem