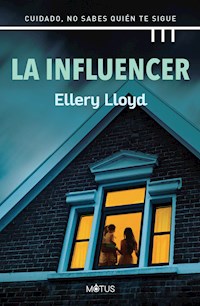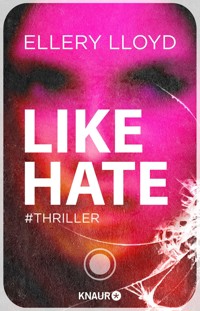12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für diesen Club gilt: Wer einmal drin ist, kommt nie wieder raus! Ellery Lloyds Thriller »Der Club. Dabeisein ist tödlich« dreht sich um ein verruchtes Luxus-Resort, jede Menge schmutzige Geheimnisse – und Mord. Auf einer vergessenen Insel vor der britischen Küste herrscht seit kurzem der Gipfel des Luxus: Nur die wahrhaft Reichen, Schönen und Berühmten haben Zugang zum elitären Private Member Club »Island Home«, wo sie geschützt vor neugierigen Augen ausgiebig feiern – und andere Dinge tun – können. Um bei der drei Tage dauernden Eröffnungsparty des Clubs dabei zu sein, würde so mancher Prominente sein Leben geben. Und mindestens einer tut das auch: Als sich am dritten Abend alle im spektakulären Unterwasser-Restaurant versammeln, wird ein Land Rover gesichtet. Unter der Wasseroberfläche. Und mit einer Leiche darin … Der glamouröse Thriller mit seinem herrlich abgedrehten Promi-Setting ist die perfekte Urlaubslektüre für Leser*innen raffinierter Whodunits und alle Fans der Serie »Succession«. »Als wäre Agatha Christie ein Soho-House-Mitglied gewesen.« Cosmopolitan über den New-York-Times-Bestseller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ellery Lloyd
Der Club
Dabeisein ist tödlich
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Für diesen Club gilt: Wer einmal drin ist, kommt nie wieder raus!
Auf einer vergessenen Insel vor der britischen Küste herrscht seit kurzem der Gipfel des Luxus: Nur die wahrhaft Reichen, Schönen und Berühmten haben Zugang zum elitären Private Member Club »Island Home«, wo sie geschützt vor neugierigen Augen ausgiebig feiern – und andere Dinge tun. Um bei der drei Tage dauernden Eröffnungsparty des Clubs dabei zu sein, würde so mancher Prominente sein Leben geben. Und mindestens einer tut das auch: Als sich am dritten Abend alle im spektakulären Unterwasser-Restaurant versammeln, wird ein Land Rover gesichtet. Unter der Wasseroberfläche. Und mit einer Leiche darin …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorspann
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Epilog
Dank
Ungefähr als der Land Rover auf der Mitte des Damms war, muss klar gewesen sein, dass sie es niemals schaffen würden. Das Wasser lief viel zu schnell auf. Die Strecke, die noch vor ihnen lag, war viel zu lang. Was tut man an welchem Punkt? Abgesehen von einer einzigen Haltebucht ist die Straße, die Insel und Festland verbindet, in keinem Abschnitt breiter als für gerade mal anderthalb Fahrzeuge. Selbst an ihrer höchsten Stelle liegt sie selbst bei niedrigstem Niedrigwasser nicht mehr als einen halben Meter über dem sie umgebenden Watt. Keine Möglichkeit zu wenden. Total betrunken, mitten in der Nacht und in einem unbekannten Wagen im Rückwärtsgang zur Insel zurück? Keine Chance.
Hinter einem, auf der Insel, ist die Party noch in vollem Gang, mit Feuerwerk und allem. Ein, zwei Kilometer voraus ist vage das Dorf auszumachen, das rötliche Glühen des Hafens, vereinzelt noch ein erleuchtetes Fenster in einem oberen Stockwerk. Wofür entscheidet man sich also? Der erste Impuls ist, einfach weiterzufahren, Gas zu geben. Auf die vierzig, fünfundvierzig Prozent Wahrscheinlichkeit zu setzen, dass man es schafft auf dieser gewundenen Spur durch nachtschwarze Dunkelheit, im Licht der Scheinwerfer immer nur ein kleines Stück des unvorhersehbar kurvigen Damms, über den weiter vorn schon schwarze Wellen schwappen und die Fahrbahn verengen, ja, sie zum Verschwinden bringen. Man kann hupen und wild aufblenden, aber selbst wenn es einem gelänge, jemanden auf sich aufmerksam zu machen, selbst wenn jemand auf dem Festland einen sehen und hören und sofort die Küstenwache rufen würde, was könnte die Küstenwache in der Kürze der verbleibenden Zeit und bei diesen Entfernungen schon tun?
Und dann ist nicht nur das, was im Moment passiert, ein Horror, sondern vor allem die Tatsache, dass man sich – so betäubt und wirr im Kopf und benebelt man auch ist – ohne Weiteres vorstellen kann, was als Nächstes kommt. Die gnadenlos dämmernde Erkenntnis, dass das Wasser binnen Minuten auf Höhe der Achsen sein wird, auf Höhe der Scheinwerfer. Dass irgendwann, wahrscheinlich eher früher als später, der Motor Wasser aufnehmen und abwürgen wird und der Wagen zum Stehen kommt.
Und die ganze Zeit schreit der Mensch auf dem Beifahrersitz des Land Rover auf einen ein, gibt einem die Schuld an allem, fuchtelt panisch herum und verlangt, dass man etwas unternimmt.
Und man kommt auf die Idee, dass man jemanden anrufen sollte, irgendwen, aber dann fällt einem ein, dass das Handy noch auf der Insel ist, dass sie einem das Handy abgenommen haben, wobei es, selbst wenn sie es einem nicht abgenommen hätten, hier draußen wohl ohnehin keinen Empfang gäbe.
Und man fragt sich, wie lange man in dem kalten Wasser und bei dieser Dunkelheit und bei dieser Entfernung zum Ufer durchhalten würde, wenn man versuchen würde zu schwimmen.
Und irgendwann dämmert einem, dass es, was man auch tut, am Ende auf dasselbe hinauslaufen wird.
Und irgendwann dämmert einem, dass diese Geschichte für die Medien ein gefundenes Fressen sein wird.
Und vielleicht – aber nur vielleicht und nur für einen Augenblick – dämmert einem dann, dass dies nicht mehr und nicht weniger ist als das Ende, das man verdient.
MORD AUF DER INSEL
Es war der Club, dem man um jeden Preis angehören musste. Der Launch, zu dem die A-Prominenz unbedingt gebeten sein wollte. Niemand konnte ahnen, wie tragisch die Sache aus dem Ruder laufen würde. Ian Shields ist dem Fall, der die Welt in Atem hielt, auf den Grund gegangen. Hier exklusiv sein Bericht.
Die Party auf der Insel ging über Tage.
Den ganzen Freitagvormittag, den ganzen Freitagnachmittag waren Hubschrauber gelandet, gestartet und über der Insel gekreist. Speedboote schossen über glitzernde Wellen zur Insel und wieder zurück. Ein nicht abreißender Strom von SUVs mit dunkel getönten Scheiben wälzte sich über die heckengesäumten Straßen von Essex, an kahlen braunen Feldern und schwarzen Bäumen vorbei und durch die engen Gassen des Dorfes Littlesea, und gegen Mittag wurden drei Tesla Model S in Kolonne gesichtet.
Eine Promi-Hochzeit, hätte man meinen können, aber das war es nicht. Es war der Fünfzigste eines Millionärs.
Den ganzen Samstagnachmittag, den ganzen Samstagabend dröhnten unablässig mal lauter, mal leiser die fernen Bässe herüber. Im Lauf des Wochenendes konnte, wer gute Augen oder ein Fernglas hatte, vom Festland aus erkennen, wo am Strand die Leute die blau-weiß gestreiften Decken ausgebreitet hatten. Man sah hier und da einen Kopf aus dem Wasser ragen. Man sah ein Pferd über den Sand sprengen und den Reiter im Sattel hüpfen.
An den Abenden sah man zwischen den Bäumen hin und wieder das Flackern großer Fackeln, und dass die Fassade des großen Hauses gelb, grün oder blau illuminiert wurde. Wenn der Wind günstig stand, konnte man sich sogar einbilden, dass man die Leute hörte: wie sie einander zuprosteten, juchzten, lachten. Schrien.
Mit dem riesigen Event wurde nicht nur die Eröffnung von Island Home gefeiert, sondern auch, dass der CEO der Firma, Ned Groom – einer der großen Visionäre des Gastgewerbes –, genau dreißig Jahre zuvor von seinem Großvater den Home Club in Covent Garden geerbt und sich beherzt darangemacht hatte, diesen Club von einem angestaubten und wenig gefragten privaten Trinkschuppen für Schauspieler, Künstler und andere Bühnenprofis in das elegant umbenannte Home zu transformieren, den in jener Dekade (es waren die Neunziger) exklusivsten und in aller Munde befindlichen Hotspot des nächtlichen London, aus dessen berühmter Tür die Superstars direkt auf die Titelseiten der Boulevardpresse stolperten. Kate Moss hat hier in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren ihren Geburtstag gefeiert. Kiefer Sutherland und seine Entourage sind eines Abends abgewiesen worden, was natürlich sofort die Runde gemacht hat. Der gesamte Cast von Friends hat für seine letzte große Party mit der Londoner Presse die Dachterrasse okkupiert.
Inzwischen sind fast fünfundzwanzig Jahre vergangen, seit Ned und seine rechte Hand, sein Bruder Adam Groom, den Sprung über den Atlantik gewagt und ihren zweiten Club etabliert haben, das inzwischen ikonische Manhattan Home.
In den Jahren und Jahrzehnten seither ist die Home Group zu einer im wahrsten Sinne des Wortes globalen Marke geworden, ein Verbund von elf Clubs mit angeschlossenen Hotelsuiten, die den wenigen Auserwählten – gegen eine stolze jährliche Gebühr – alle die gleiche angenehme Mischung bieten: bodenständigen Luxus, betont schlichte Eleganz und absolute Privatsphäre. Es gibt Santa Monica Home, Highland Home, Country Home, Cannes Home, Hamptons Home, Venice Home, Shanghai Home, es gibt Homes in Malibu, in Paris und Upstate New York, und sie befinden sich alle an atemberaubenden Orten: in einer ehemaligen Botschaft (Shanghai), einem großen Palazzo (Venedig), einer umgewidmeten Kathedrale (Cannes), einem restaurierten Landsitz (Country Home in Northamptonshire; Highland Home in Perthshire).
Aber nichts von all dem, was Ned Groom bislang auf die Beine gestellt hatte, hat auch nur annähernd die Klasse von Island Home. Eine ganze Insel, vier Kilometer lang, anderthalb Stunden Fahrt von London entfernt, ein neu hergerichtetes Herrenhaus im Stil von Palladio, großflächige Wälder und endlose Strände, siebenundneunzig individuelle Hütten, fünf Restaurants, drei Bars, mehrere Fitnessstudios, Tennisplätze, ein Spinning-Studio, Spa, Sauna, Hubschrauberlandeplatz, Filmvorführräume, Ställe und ein beheizter natürlicher Außenpool. Das Ganze im privaten Besitz, vom Festland aus nur bei Ebbe zu erreichen, und zwar über einen zweieinhalb Kilometer langen gewundenen Damm. Trotz der 5000 Pfund extra, die es pro Nacht kosten sollte, war Island Home für ein ganzes Jahr ausgebucht, bevor auch nur ein Mitglied einen Fuß auf die Insel gesetzt hatte.
Angesichts der Größe der Anlage und angesichts der ehrgeizigen Pläne von Ned Groom und seiner Mannschaft – ganz zu schweigen von Neds legendärem Perfektionismus – war wohl damit zu rechnen, dass nicht alles hundertprozentig nach Plan laufen würde. Zunächst sollte am Anfang des Frühjahrs eröffnet werden, dann im späteren Frühjahr, dann im Sommer, dann im Herbst.
Über Monate hatte man bei Home Personal gesucht – Küchenpersonal, Leute für die Rezeption, Techniker, Kellner, Reinigungskräfte, eine dreißigköpfige Crew von Event-Spezialisten, eine Security-Mannschaft von achtzig Leuten – und auf alle Besonderheiten und Feinheiten vorbereitet, die es mit sich bringt, für eine der exklusivsten und am besten abgeschirmten Cliquen der Welt zu arbeiten; mit Leuten zu tun zu haben, die so speziell und heikel sind wie sonst niemand.
Wochenlang packten alle mit an, überprüften und testeten und überprüften noch einmal, um sicherzustellen, dass die über die Insel verstreuten Hütten – allesamt aus Vintage-Holz von alten Scheunen, Häuschen und Schuppen, die das Design-Team über Jahre hinweg in so entlegenen Weltgegenden wie Bulgarien, der Slowakei oder Estland ausfindig gemacht und erworben hatte – für die ersten Übernachtungsgäste bereit waren. Um sicherzustellen, dass die Kaminöfen korrekt zogen, damit niemand im Schlaf erstickte. Zu gewährleisten, dass alle Lichtschalter und Toilettenspülungen funktionierten und das Wasser in den Bädern mit genügend Druck aus den Hähnen schoss, um die gusseisernen Wannen mit den Krallenfüßen in weniger als drei Minuten zu füllen. Um abzusichern, dass die gewundenen Schotterwege in Ordnung und sowohl zu Fuß als auch per Rad oder E-Scooter oder in einem Golf Buggy mit Chauffeur gut zu nehmen waren. Dass unvorhersehbare Gefälle und tiefes Wasser und andere natürliche Gefahrenquellen unmissverständlich gekennzeichnet waren. Dass bis zur Ankunft der ersten Mitglieder sämtliche Anstriche getrocknet, alle rauen Stellen im Holz geschliffen und noch die letzten bloß liegenden Leitungen verputzt waren, damit niemand durch einen Stromschlag getötet oder irgendwo aufgespießt wurde.
Im Rückblick erscheint vermutlich jede Tragödie auf ihre Art unausweichlich.
»Der Abschluss des Launch-Events, der Brunch am Sonntagvormittag, sollte das Highlight des gesamten Wochenendes werden«, sagt Josh Macdonald, einer von sechs Chefarchitekten, die das Island-Home-Projekt während der acht Jahre seiner Entstehung nacheinander betreut haben. »Ned war in einem teuren Wettrüsten gegen sich selbst gefangen – jeder neue Home Club musste den vorigen mit mindestens einem einzigartigen Feature überbieten. So etwa der Rooftop-Pool mit Acrylglasboden in Shanghai, die gläserne Bar in der verfallenen Kapelle im Highland Home. Diesmal war es das Unterwasserrestaurant Poseidon.«
Die Idee, sagt Macdonald, habe Ned von den Malediven mitgebracht. »Auf Strandniveau gibt es eine Bar und einen Eingangsbereich mit Blick aufs Wasser, rüber zum Festland. Will man zum Essen, geht man über eine Brücke aus poliertem Beton, durch einen Tunnel und ein paar Stufen abwärts, und plötzlich steht man in diesem Raum, der wie ein riesiges Goldfischglas anmutet. In der Mitte befinden sich die Küche und die Bar, darum herum sind die Tische und Stühle angeordnet, und schaut man aus dem Fenster, sieht man nichts als das Meer«, erklärt Macdonald. »Makrelenschwärme, ganze Wolken aus blauen Quallen, den Kiel von Booten. Die Sonne, die sich in den Wellen über einem bricht. Ned wollte, dass das das Letzte war, was die Leute sahen, bevor die Party zu Ende ging; sie sollten von Island Home einen wirklich starken letzten Eindruck mitnehmen, etwas, das wochenlang Gesprächsstoff sein würde.«
Das ist ihm jedenfalls gelungen.
Glaubt man denen, die dabei waren, haben sich die Mitglieder, die an jenem letzten Morgen der Drei-Tage-Party zum Frühstück erschienen und noch dabei waren, ihren Kater zu kurieren, vor allem eines gefragt: Wo ist Ned? Normalerweise wäre er bei einem Anlass dieser Größenordnung omnipräsent gewesen, hätte Witze gerissen und dafür gesorgt, dass es allen gut ging. Eins fünfundneunzig groß, mit der Statur eines ehemaligen Rugbyspielers und als voll ausgebildeter Rechtsanwalt sprach er mit dröhnender Stimme und hatte eine Lache, die man im ganzen Raum hörte. Stattdessen begannen nun die Gäste, denen sein Fehlen auffiel, sich darüber auszutauschen, wann sie zuletzt mit ihm gesprochen hatten. Spekulierten, wo Ned sich wohl aufhielt, tratschten über Ereignisse des Abends zuvor und des Abends davor, machten sich über ihre Eiweißomelettes und grünen Säfte und Kurkuma-Lattes her und hielten Ausschau nach vertrauten Gesichtern. Und es sollte noch eine Weile dauern, bis jemand jenseits der gewölbten Walzglasfenster, im Wasser, etwas Seltsames wahrnahm.
Das geschah erst, als die Sonne zum ersten Mal an diesem grauen Herbstmorgen die Wolkendecke durchbrach, einen hellen Strahl bis auf den trüben Meeresgrund schickte und etwas beleuchtete, das eben noch ausgesehen hatte wie eine Ansammlung von Steinen, eine undefinierbare Gestalt.
»Die Leute erhoben sich von ihren Plätzen, gingen ans Fenster und zeigten auf das Objekt«, erinnert sich ein Home-Mitglied, das nicht namentlich genannt sein möchte. »Sie haben gelacht und gewitzelt. Wir dachten, es wäre eine Land-Rover-Publicity-Action, eine Art Stunt. Die Leute waren beeindruckt, vor allem weil der Wagen auf dem Dach lag, sechs Meter tief unter Wasser und halb hinter einen riesigen Stein geklemmt. Was für ein Aufwand, nur um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen! Alle fragten sich, wie der Wagen nach da unten gebracht worden war und wie lange er sich wohl schon da befand.« Und dann, erzählt sie weiter, hätten die Leute allmählich begriffen, was da in dem Fahrzeug war. Da erst, sagt sie, habe jemand angefangen zu schluchzen.
Kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass auf der Insel ein Leichnam gefunden worden sei.
Und in dem Augenblick wurde aus der Party des Jahres der geheimnisvollste Mord des Jahrzehnts.
Erstes Kapitel
Ich hab’s geschafft.
Immer wieder ertappte Jess sich bei diesem Gedanken.
Head of Housekeeping, Island Home. Ihr Name war Jess Wilson, und sie war die neue Head of Housekeeping im Island Home.
Sie konnte es noch immer nicht glauben.
Die vergangene Woche war ein bisschen wie ein Traum gewesen. Erst der Anruf aus der Chefetage von Home, die Einladung zum Vorstellungsgespräch – nach all den Jahren des Bewerbungenabschickens. All den Jahren des Hoffens. All den Jahren, in denen ihr immer wieder mitgeteilt worden war, man werde ihre Unterlagen behalten.
Dann das Vorstellungsgespräch in London, bei Adam Groom, Direktor für Sonderprojekte der Home Group, dem zweitwichtigsten Menschen im ganzen Unternehmen. Die plötzliche Panik bei der Frage, was sie anziehen und was sie sagen sollte.
Es war gar nicht in Worte zu fassen, wie sehr sie sich das gewünscht hatte. Sie war in Northamptonshire aufgewachsen, ganz in der Nähe vom Country Home. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Eltern an der alten Trockenmauer entlanggefahren war, hatte sie zwischen den Bäumen hindurch zu dem blinkenden Privatsee hinübergespäht und durch das Gittertor einen Blick auf die lange Auffahrt zu dem elisabethanischen Herrenhaus geworfen. Es war aufregend gewesen, sich auszumalen, wie es da drinnen aussah. Über sich einen Hubschrauber zu hören und zu rätseln, wer da wohl drinsaß. Als Teenager Zeitschriftenartikel über Home zu lesen und sich vorzustellen, wie es wäre, dort zu arbeiten, Teil einer solchen Welt zu sein.
Irgendwo in ihrem Innern gab es noch die Sorge, das Ganze könnte sich als großer Irrtum erweisen. Sie könnte auf der Insel eintreffen und gesagt bekommen, man hätte sich ihre Referenzen noch einmal angesehen und herausgefunden, dass sie eine Hochstaplerin sei. Sie brauche nur den Mund aufzumachen – neuer Haarschnitt und neue Klamotten hin oder her –, und jeder wüsste, dass sie einfach nicht cool genug war, um an einem solchen Ort zu arbeiten, dass sie da nie hinpassen würde, dass sie absolut nicht die Person war, nach der sie gesucht hatten.
Das war jedenfalls das Gefühl, das sie aus dem Vorstellungsgespräch mitgenommen hatte.
Es hatte im HomeCovent Garden stattgefunden. Die ganze Zeit war sie auf einem Lehnstuhl herumgerutscht, der etwas zu niedrig für den Tisch war, hatte gewusst, dass der leicht spannende Knopf an ihrer neuen Bluse jeden Moment aufgehen konnte; hatte versucht, eine Position zu finden, in der sie locker und interessiert zugleich rüberkam, und gegrübelt, was sie mit ihren Ellbogen anfangen sollte. All die guten Ratschläge, die ihre Freunde ihr mit auf den Weg gegeben hatten, all die motivierenden Sprüche, die sie sich auf der Fahrt zu dem Gespräch selbst vorgebetet hatte, waren ihr angesichts eines offensichtlich verkaterten Adam Groom, der sich mit einem Full English Breakfast beschäftigte, hinfällig, ja absurd vorgekommen.
Während er an einer Bloody Mary nippte, hatte er, garantiert zum ersten Mal, auf ihren Lebenslauf geschaut, der ausgedruckt vor ihm lag, und wenn er doch einmal von seinem zerknitterten Blatt Papier aufblickte, dann immer nur bis zu ihrem Busen, dem er zusammenhangloses Zeug über sich selbst erzählte. Dass sie die ganze Strecke von Northamptonshire runtergekommen war, um ihm persönlich gegenüberzusitzen, fand nur Erwähnung, als er über das Hotel, in dem sie aktuell arbeitete – The Grange –, sagte, es liege gleich um die Ecke vom Country Home. »Ich weiß«, hatte sie gesagt, »da habe ich mich auch ein paarmal beworben.« Acht Mal, um genau zu sein. Sie hätte auch noch mehr dazu gesagt, warum, vielleicht hätte sie erklärt, wie sehr sie das, was Adam und sein Bruder mit Home erreicht hatten, bewunderte, dass es ihr als einmalige Chance erschien, beim Launch eines ihrer Clubs mitmachen zu können, aber während sie noch redete, hatte Adam die Kellnerin herangerufen (jung, schlank, hübsch) und um mehr Ketchup gebeten, und sie war verstummt.
Auf dem Weg nach Hause, während der endlosen, kostspieligen, nicht erstattungsfähigen Bahnfahrt, hatte sie unentwegt mit sich gehadert – wegen der dummen Sachen, die sie gesagt hatte, weil sie so viele Gelegenheiten, sich gut zu verkaufen, ungenutzt hatte verstreichen lassen, weil sie nun wusste, was sie Adam alles erzählen würde, wenn sie sich noch einmal vorstellen würde. Wegen der Sachen, die sie besser nicht gesagt hätte. Weil sie wusste, dass das ihre große Chance gewesen war und sie es vergeigt hatte.
Am selben Abend war sie angerufen und gefragt worden, ob sie sofort anfangen könne.
»Selbstverständlich«, hatte sie gesagt und überhaupt erst angefangen zu denken, als das Telefonat beendet war. Es war so unerwartet gekommen, das Ganze – bei ihrem Arbeitgeber, bei ihren Kolleginnen und Freunden würde es einschlagen wie eine Bombe. Erst viel später war ihr bewusst geworden, dass sie kein einziges Mal gefragt hatte, warum ihre Vorgängerin so plötzlich aufgehört hatte und was – wenn überhaupt etwas – bezüglich der Übergabe geplant war.
Kaum zu glauben, dass seitdem erst eine Woche vergangen war. Die letzten Tage waren der reine Wahnsinn gewesen. Hektische Shoppingtouren, der Last-minute-Haarschnitt, von dem sie noch immer nicht wusste, wie sie ihn finden sollte (der ausgefranste schulterlange Bob sei pflegeleicht, hatte die Friseurin gesagt, doch sie selbst konnte bislang nichts anderes daraus machen als eine Art Vogelnest), leichte Panik am Vorabend, als ihr Koffer nicht zugehen wollte. Ein paar Tage Einweisung im Londoner Hauptsitz von Home. Eine unruhige Nacht, wie man sie vor einem großen Tag hat, inklusive Aufwachen vor dem Weckerklingeln.
Und nun war es so weit. Sie hatte auf dem Festland gewartet, bis der Damm passierbar war, und jetzt wurde sie in einem Elektro-Land-Rover Defender mit Chauffeur rübergebracht. Außer ihr saßen noch zwei Neue im Wagen, beide hier aus Littlesea; sie waren alle eingeschüchtert, gaben sich aber große Mühe, sich nichts anmerken zu lassen. Nie würde sie dieses Bild vergessen: wie die Straße, erstaunlich gewunden, beängstigend schmal, aus dem Wasser aufgetaucht war, erst die Felsbrocken zu beiden Seiten, dann, innerhalb von Minuten, die nasse Fahrbahn selbst, schimmernd im Licht der frühnachmittäglichen Sonne und mit einem Muster aus Seegrasbündeln, die sie überzogen wie eine Tuschezeichnung. Die Insel war eine massige Silhouette am Horizont.
Jetzt nicht nervös zu sein hätte von Dummheit gezeugt. Alles würde anders sein als im Grange, dem Hotel, in dem sie so lange gearbeitet hatte, dem Haus mit den endlosen Karoteppichen, dem förmlichen Speisesaal einschließlich der Kellner mit Fliege, der Bar mit den Golfbildern an der Wand, den kleinen Plastikflaschen aus dem Lilly-of-the-Valley-Sortiment an Pflegeprodukten, dem permanent in den Fluren hängenden Geruch von Desinfektionsmittel. Es würde völlig verrückt sein, von einem dermaßen vertrauten Ort, an dem sie jeden kannte und jeder sie, zu einem komplett neuen und fremden zu wechseln.
Es war ein strahlender Oktobertag, kein Wölkchen am Himmel, nur ein Netz aus Kondensstreifen.
Während die bewaldete Insel vor ihnen immer mehr Gestalt annahm, sich immer größer und ausladender und dunkler erhob, versuchte Jess, die verschiedenen Gebäude und Merkmale, über die sie in der Einweisung unterrichtet worden waren, zu identifizieren. Als Erstes tauchte das Herrenhaus auf, jedenfalls das Türmchen mit seinen Fenstern, das zwischen Kiefernwipfeln emporragte. Und als sie näher kamen, erkannte sie ihr eigentliches Ziel: das Bootshaus, ein zweigeschossiges Gebäude aus verwittertem Holz, vielleicht hundert Meter von der Stelle entfernt, an der der Damm auf die Insel stieß. Daneben befanden sich ein großer Parkplatz voller glänzender schwarzer SUVs und die verglaste Rezeption, wo die Mitglieder sich ihre Schlüssel holten, für die Dauer des Aufenthalts ihr Telefon deponierten und vor einem lodernden Feuer Champagner schlürften, bis ein Träger mit Golf Buggy erschien. Ein Stück weiter den kieferngesäumten Strand hinunter ragte ein flaches Gebäude aus Beton und Zedernholz bis ins Wasser – das musste das Unterwasserrestaurant Poseidon sein. Dahinter wand sich eine Straße den steilen Hang hinauf und verschwand hinter einer letzten Böschung im Wald.
Diese Landschaft war anders als die, in der sie aufgewachsen war, aber sie erfasste ihre Schönheit, auch – oder vielleicht gerade – zu dieser Jahreszeit. Die blassen, schlanken Stämme der Silberbirken. Das kräftige Leuchten der Buchen. Die gelben Wolken von Ginster. Die dunklen Kieselstrände. Die Abschnitte mit weißem Sand. Dicke Büschel von Seegras. Die dichten Gruppen sich bräunlich färbender Farne. Wie die Wellen in der Herbstsonne funkelten.
Zum größten Teil – und aus naheliegenden Gründen – waren die Hütten und die dazugehörigen Terrassen so angeordnet, dass man sie aus der Ferne, vom Wasser aus, nicht ohne Weiteres sehen konnte. Spa und Tennisplätze befanden sich auf der anderen Seite der Insel, gleich bei dem denkmalgeschützten Wasserturm, der jetzt ein sich drehendes italienisches Restaurant war, unweit der Anlagen für Segeln und andere Wassersportarten und in der Nähe der Angestelltenunterkunft (vom Wasser aus auch nicht zu sehen), wo die Hälfte des Inselpersonals, Jess eingeschlossen, wohnte, während die andere Hälfte allmorgendlich vom Festland herüberkam. Es war lustig, sich vorzustellen, dass ihr all das, was ihr jetzt noch so fremd war, schon in ein paar Tagen völlig vertraut sein würde. Ihr Zuhause, ihr Home.
Auch an die Leute würde sie sich noch gewöhnen müssen. Annie Spark zum Beispiel, Head of Membership, eine außergewöhnliche Erscheinung mit Jessica-Rabbit-rotem Haar bis zur Taille, einem leuchtend rosa Jumpsuit, knöchelhohen Turnschuhen und riesigen goldenen Creolen, die sie im Causeway Inn empfangen hatte. Das Pub aus dem siebzehnten Jahrhundert stand genau da, wo der Damm aufs Festland traf, und war, wie Annie erläutert hatte, von der Homeland Group quasi als Wartehäuschen erworben worden; hier konnten die Mitglieder sitzen und warten, bis wieder Niedrigwasser war und der Damm passiert werden konnte.
In einer der Bars im Erdgeschoss – einem Raum mit Meerblick, eingerichtet mit bunt zusammengewürfelten niedrigen Vintage-Sesseln und einem Kamin, in dem ein paar Scheite vor sich hin glommen – hatte Annie ihnen die Marschroute für das Wochenende erläutert.
An diesem Abend, Donnerstag, würde Ned Groom im Herrenhaus ein Dinner in sehr kleinem Kreis geben. Ausgewählte fünf Gäste, Annie hatte die Namen aufgezählt. Jess’ Herz hatte einen Satz gemacht. Alle um sie herum, alle, die ebenso neu waren wie sie, hatten sich um einen neutralen Gesichtsausdruck bemüht. Sowohl im Vorstellungsgespräch als auch in einer deutlichen Belehrung durch Annie war darauf hingewiesen worden, dass man, wenn man der Typ war, der sich von Stars beeindrucken ließ, nicht lange bei Home blieb.
Als sie den Job zugesagt hatte, war ihr auch klargemacht worden, was für ein Privileg es war, dass sie als Angehörige der mittleren Führungsebene während der Arbeit ein Handy bei sich haben durfte. Und tatsächlich hatten sie ihr sofort bei der Ankunft im Hauptsitz ein brandneues iPhone in die Hand gedrückt und sie angewiesen, es für den Fall, dass sie gebraucht wurde, jederzeit aufgeladen bei sich zu tragen. Sie hatten ihr aber auch eingeschärft, es niemals hervorzuholen, wenn ein Gast in der Nähe war – denn zugleich sollten alle Angestellten darauf achten, dass kein Mitglied vergaß, seins bei der Ankunft abzugeben.
»Dies ist für die meisten dieser Leute einer der wenigen Orte auf der Welt«, hatte Annie gesagt, »wo sie etwas essen oder einen Drink nehmen oder einfach nur herumsitzen und gar nichts tun und sicher sein können, dass niemand sie dabei fotografiert. Versucht, euch vorzustellen, wie das sein muss. Versucht einfach, euch vorzustellen, wie viel ihr dafür zu zahlen bereit wäret. Deshalb muss jedes Mitglied, das ihr mit einem Handy seht – und ob ihr’s nun glaubt oder nicht, die sind genauso süchtig danach –, die Insel sofort verlassen, und seine Mitgliedschaft wird annulliert. Und aus demselben Grund darf auch kein Kellner, keine Kellnerin, niemand vom Tresenpersonal und niemand vom Housekeeping ein Handy haben.«
Das kriege ich hin, hatte Jess sich gesagt. Sie arbeitete seit ihrem Schulabschluss in der Hotellerie, und selbst davor, wenn das zählte, hatte sie schon als Wochenendaushilfe in einem benachbarten Bed and Breakfast Betten gemacht. Zehn Jahre war sie im Grange gewesen und hatte sich immer weiter hochgearbeitet, bis zur Hausdame. Sie hatte sich immer mit ihren Leuten verstanden, war immer stolz darauf gewesen, diese Arbeit zu machen. Sie kriegte das hin. Die Leute waren, wie sie waren. Gäste waren Gäste.
Die übrigen Geladenen – Annie hatte die Namen heruntergeleiert, darunter bekannte und solche, von denen sie offenbar annahm, dass sie es waren – würden in genau koordinierten Wellen ab Freitagmorgen anreisen, und es gab ein dichtes Programm, mit dem sie bis Sonntagnachmittag beschäftigt werden sollten: Bootstouren, Ausritte, Brunch-Büfetts, Mittag- und Abendessen, Filmvorführungen. Alle Hütten würden belegt sein, bei den Gästen handelte es sich ausschließlich um besonders geschätzte Mitglieder von Home. Es werde – hatte Annie mit leichter Emphase und aufmunternder Miene verkündet – keine, wirklich keine großen Schwierigkeiten geben.
Die ganze Zeit, während sie zu ihnen sprach, hatte Annies Handy gepiept und geklingelt. Hin und wieder hatte sie einen Blick darauf geworfen und mal gelächelt, mal die Stirn gerunzelt. Kaum war sie mit ihren Ausführungen am Ende, hatte sie sich das Telefon ans Ohr geklemmt und, noch ehe sie wirklich draußen war, laut und mit glockenheller Stimme drauflosgeredet.
Wie Jess sie um ihr Selbstbewusstsein, ihre unerschütterliche Ruhe, ihren gewagten Style beneidete! Dieses endlos lange rote Haar, locker zusammengenommen und über eine Schulter gelegt. Der dicke schwarze Eyeliner und die fett getuschten Wimpern. Die dunkelroten Krallen. Vielleicht war es einfacher, selbstbewusst zu sein, wenn man so groß war, Annie war mindestens eins achtzig. Jess wünschte, sie hätte sich etwas energischer vorgestellt oder den Mut gehabt, während Annies Ansprache mal die Hand zu heben und wenigstens eine der hundert Fragen zu stellen, die ihr zu dieser Insel, diesem Wochenende, diesem Job durch den Kopf gingen.
Um durch die nächsten Tage zu kommen, würde sie allen Mut zusammennehmen müssen.
»Fast da«, sagte der Fahrer über die Schulter. Er trug ein enges blaues Polohemd und eine verspiegelte Sonnenbrille. Als sie sich dem Ende des Damms näherten, hupte er kurz. Gleich darauf trat jemand mit einem Klemmbrett unter dem Arm aus der verglasten Rezeption im Bootshaus und winkte.
Da waren sie.
Wenn meine Eltern mich sehen könnten, dachte Jess, oderdie Mädchen aus der Schule!
Dies war zweifellos eine Chance, die man nur einmal im Leben bekam.
Jetzt musste sie sich nur noch an den Plan halten.
Er konnte grausam sein, dieser Job.
»Meine Liebe, mein Engel! Wenn es einen Platz gäbe – ich würde dich sofort herholen, das weißt du! Nein, nein, nicht weinen …«
Seit Monaten führte Annie nun schon Gespräche dieser Art – oder wich ihnen aus. Während der letzten Wochen hatte ihr Handy vom Aufstehen bis zum Schlafengehen buchstäblich ununterbrochen geklingelt. SMS. Instagram-DMs. Voicemail-Nachrichten. SMS, die klären sollten, ob sie die DM erhalten oder schon Gelegenheit gehabt hatte, sich die Voicemail anzuhören. Mails, mit denen sie feststellen wollten, ob sie noch Annies richtige Mobilnummer hatten.
Bei der letzten Zählung waren es weltweit fünftausendsiebenhunderteinundsechzig Home-Mitglieder gewesen. Zu einem Launch konnten immer nur hundertfünfzig kommen.
Die Einladung zur Eröffnungsparty von Island Home am Halloween-Wochenende war den Auserwählten am 14. August zugestellt worden. Wochenlang hatte Annie vorher Namen auf die Liste geschrieben oder davon entfernt und ständig Anpassungen vorgenommen. Sobald die begehrten Goldrandkarten verschickt waren – jeweils in einem Nest aus Kaschmirbademantel mit individuellem Monogramm und Seidenpyjama –, hatte Annie sich für den Ansturm gewappnet. In der Vorstellung der Mitglieder nahm sie eine merkwürdige Stellung ein, war eine Mischung aus Feuerwehrfrau, bezahlter bester Freundin und persönlicher Assistentin, die man herumscheuchen konnte. Eine, mit der man bis nachts um zwei sitzen und Espresso und Martinis trinken konnte; eine, an deren Schulter man sich ausweinen konnte, wenn man gerade eine schlimme Scheidung durchmachte. Aber auch diejenige, die man angiften konnte, wenn es einem verwehrt wurde, am Labour Day drei zusätzliche Freunde auf ein paar Drinks mit ins Malibu Home zu bringen. Oder anschreien, wenn die Rosen im Apartment die Köpfe hängen ließen oder es an dem Tisch, der einem auf der Dachterrasse des Venice Home zugewiesen worden war, zog.
Als die Leute begriffen, dass sie es nicht auf die Launch-Gästeliste geschafft hatten, fingen sie an durchzudrehen. Es hagelte kurzfristige Einladungen zum Abendessen, sie wollten sich auf einen Drink verabreden oder fragten an, wann ein guter Zeitpunkt für ein kurzes Telefonat sei. Persönliche Assistentinnen – oder weniger betuchte Mitglieder, die sich als die persönliche Assistentin ausgaben, die sie sich, wie Annie wusste, nicht leisten konnten – fingen an, zehn Mails am Tag zu schreiben, um sich zu vergewissern, dass es sich nicht um einen »administrativen Fehler« handelte, um irgendeine Art von Versehen.
Die Leute taten ihr leid. Wäre es anders gewesen, hätte sie den Job nicht machen können. Genauso wenig hätte sie den Job aber machen können, wenn sie sich von ihrem Mitleid hätte hinreißen lassen. Ihre Loyalität gehörte Ned, und sie wusste, er baute darauf, dass sie Entscheidungen so traf, wie es für Home am besten war. Zum Beispiel, was die Schauspielerin anging, die sie am Telefon hatte, während sie nun, in einen riesigen smaragdgrünen Steppmantel gewickelt, auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Causeway Inn auf und ab ging und eine Zigarette nach der anderen rauchte.
Am anderen Ende der Leitung? Ava Huxley. Britische Schauspielerin, rötlich braunes Haar, erschreckend dünn, winzig, immer vornehm. Einst ein Geheimtipp, ein sehr positiv besprochener Sonntagabend-Kostümfilm in der BBC, dann ein paar britische Thriller, die nicht besonders gut gelaufen waren, dann Serienkillerin in einer HBO-Serie, in der ihr unter anderem die amerikanische Aussprache zum Opfer gefallen war. Würde Ava sich jetzt bewerben, würde sie vermutlich gar nicht als Home-Mitglied akzeptiert – wobei niemand, der oder die sich um eine Mitgliedschaft bewarb, je abgelehnt wurde. Wer es nicht ins Finale schaffte, kam auf eine Warteliste, reihte sich ein in eine Schlange, die sich nie bewegte, schmorte (so sah es Annie) im Promi-Fegefeuer. Und warum war das so? Weil man, das hatte sie in diesem Job nun wirklich gelernt, nie wissen konnte, wann eine Karriere durch die Decke ging oder wiederbelebt wurde, und es gar nicht gut war, wenn eine Person, die einen Oscar bekam, einem grollte.
Aber selbst wenn man das im Hinterkopf hatte, war Ava Huxley derzeit alles andere als erfolgreich genug, um auf die Gästeliste zu kommen. Das war keine persönliche Gemeinheit von Annie, sondern einfach die raue Wirklichkeit.
Auch wenn sie sich niemals daran erinnerte – es half Ava auch nicht gerade, dass sie die Letzte gewesen war, die Annie interviewt hatte, bevor sie ihren Job als Promi-Schreiberin hingeschmissen hatte und zu Home gegangen war. Eine Titelgeschichte für OK!. Für Ava eine lästige Pflicht; es hatte in ihrem Vertrag mit der Parfümmarke gestanden, deren Gesicht sie war. Übellaunig und nervös war die Schauspielerin zu dem Fünfzehn-Minuten-Termin erschienen – zu spät –, hatte sämtliche Fragen schnippisch mit einem Wort beantwortet und war, als Annie auf der verzweifelten Suche nach einem Thema, bei dem sie anbeißen könnte, gefragt hatte, wo ihre Schuhe her seien, wutentbrannt abgerauscht, wobei sie etwas von Feminismus vor sich hin gemurmelt hatte. Annie war dann gezwungen gewesen, aus genau zweiunddreißig Wörtern, die das junge Talent von sich gegeben hatte, darunter dreiundzwanzigmal »nein«, ein 1200-Wörter-Porträt zu stricken. »Nicht das Beste, was du je abgeliefert hast, Spark«, hatte ihr Redakteur angemerkt, woraufhin sie das Ganze auf einen Absatz eingekürzt und statt der ursprünglich geplanten Story eine »Ava Huxleys Outfits«-Bildstrecke gefahren hatte.
Ein paar Tage nach diesem Debakel hatte Ned ihr den Job als Head of Membership bei Home angeboten, und zu sagen, dass Ava der Grund war, aus dem sie eingewilligt hatte, war keine Übertreibung.
Annie war immer darauf versessen gewesen, ihren völlig unspektakulären, durch und durch netten, Luft abschnürend vorstädtischen Hintergrund abzuschütteln und in die Welt der Schönen, Begabten und Berühmten vorzustoßen. Sie hatte nie hinterfragt, warum der Dunstkreis der Prominenten sie so anzog – das Einzige, was sie sich je gefragt hatte, war vielmehr, wie man sich nicht danach sehnen konnte, von Prominenten umgeben zu sein. Da sie aber selbst über keinerlei Fähigkeiten in dieser Richtung verfügte – sie hatte alles Mögliche versucht, war aber weder durch schauspielerisches Talent aufgefallen, noch konnte sie tanzen, singen oder irgendetwas spielen –, hatte sie entschieden, dass es auch genügte, einfach in der Nähe dieser Leute zu sein. Heute wusste sie, dass es eine Reihe von Jobs gab, die einen dahin brachten – Agentin, Assistentin, Stylistin, Floristin, Masseurin, Hellseherin, Life Coach, Dog-Sitter –, aber nachdem sie ausschließlich mit Heat- und Hello!-Lektüre aufgewachsen war, hatte sie sich angesichts ihrer eigenen Gaben keine andere Möglichkeit vorstellen können als die, Journalistin zu werden. Was ihr niemand gesagt hatte, was nach außen überhaupt nicht klar wurde, war, dass man als Interviewerin den schönen Menschen zwar tatsächlich nahekam, dass die schönen Menschen die Presse aber als eine furchtbare, nervige Zumutung betrachteten, die sie allenfalls notgedrungen tolerierten.
In der ersten Zeit hatte es sie fertiggemacht, wie gemein sie sein konnten. Statt auf roten Teppichen herumzustehen und mit denen, über die sie schreiben wollte, auf Du und Du zu sein, wurde sie herablassend behandelt oder ganz ignoriert, zurechtgewiesen und beschimpft, angesehen, als hätten sie sie eben unter ihren High Heels hervorgekratzt, als wäre sie persönlich hinter ihnen her, halte ihnen die Kamera ins Gesicht, wühle in ihrem Müll oder hacke ihre Handys. Am Beginn ihrer Laufbahn, in den späten Neunzigern, war sie zu so vielen Release-Presseterminen geschickt worden – nicht selten ins HomeCovent Garden –, hatte so viele Gespräche geführt, bei denen immer die Agentin oder der Presseverantwortliche mit aufgestellten Ohren in der Ecke saß. (»Oh, keine Sorge, ich bin hier nur gerade an meinem Laptop, ich höre gar nicht hin … Entschuldigung? Nein! Dieses Thema ist außen vor. Und das. Und das auch.«) Es hatte sie auch erschreckt, wie langweilig sie waren. Diese Leute, die ein so außergewöhnliches Leben führten, waren so niederschmetternd fade, hatten so wenig zu sagen, bezogen so selten Position, waren für kaum eine Anekdote gut, hatten fast nie interessante Schrullen. (Inzwischen wusste sie natürlich, dass der Mensch, zu dem sie da geschickt worden war, nicht selten genauso eine Erfindung war wie die Figur, die sie im Film gesehen hatte.)
Zu der Zeit, als Ned angerufen und ihr den Job angeboten hatte – diesen Job –, war sie reif gewesen. Es hatte ihr gereicht. Die Vorstellung, selbst diejenige zu sein, die das Sagen hatte, die Person zu sein, bei der sie sich einschleimten oder mit der sie zumindest das Gespräch suchten, war einfach zu verführerisch gewesen. Ava hatte natürlich nicht die leiseste Erinnerung an ein Ereignis, das Annies Karriere in komplett andere Bahnen gelenkt hatte. Lustig, wie das Leben so spielt, dachte Annie, während sie sich anhörte, wie Ava zwischen Schluchzern erklärte, sie habe sich mit ein paar anderen Schauspielerinnen zum Mittagessen getroffen, und die hätten sich darüber unterhalten, was sie zu diesem Island-Home-Launch anziehen würden, und sie hätte irgendwie – versehentlich, kaum zu glauben, unerklärlicherweise – gedacht, sie werde auch dabei sein.
»Ich meine, ich weiß auch nicht, was mir eingefallen ist, natürlich habe ich nie damit gerechnet, dass ich eingeladen werde, warum sollte ausgerechnet ich zu so etwas eingeladen werden, wahrscheinlich wär es mir peinlich gewesen, eingeladen zu sein, ich hätte gedacht, euch ist ein Fehler unterlaufen, aber – ich bin so ein Idiot – ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck erweckt, dass ich auch da sein werde. Könntest du also bitte, bitte, bitte eine Ausnahme machen, weil das sonst einfach zu demütigend ist?«
Annie unterdrückte einen Seufzer. Wenigstens die Amerikaner waren geradeheraus. Briten konnten wirklich die Pest sein. Lernte man das im Internat der Mädchenschule, diese Art, sich selbst zu geißeln? Oder gehörte es für britische Schauspieler oder Musiker zu ihrer Abmachung mit der Öffentlichkeit, dass sie, wenn sie groß rauskamen, so tun mussten, als sei das irgendwie ein Versehen?
Ava redete immer noch.
Als sie an einem der Erkerfenster des Causeway Inn vorbeikam, spähte Annie in die Lounge Bar, wo drei Frauen aus ihrem Team über ihre Laptops gebeugt auf die Sofas verteilt waren. Sie klopfte kurz an die Scheibe. Alle drei blickten auf, sahen sie und lächelten. Annie verdrehte die Augen, zog ein Gesicht und zeigte auf ihr Telefon. Dann räusperte sie sich.
»Es tut mir leid, Ava, da kann ich wirklich nichts machen. Aber weißt du was? Nächste Woche lade ich dich zum Mittagessen ein und erzähle dir sämtlichen Klatsch und Tratsch. Versprochen.«
Man musste nicht gröber sein, als die Situation es erforderte. Immerhin bestand noch die schwache Möglichkeit, dass Ava Huxley durch eine schwer vorstellbare Verkettung von Ereignissen in die Lage versetzt wurde, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen, dass sie vielleicht sogar eines jener Mitglieder wurde, denen Annie die ganze Zeit hinterherlief, denen eher sie Honig um den Bart schmierte als umgekehrt. Allerdings sollte Ava sich wohl beeilen. Wenn Annie das richtig in Erinnerung hatte, wurde sie in einem Monat vierzig.
Kaum hatte Annie das Gespräch beendet, leuchtete ihr Handy-Display schon wieder auf.
Verdammte Axt. Die persönliche Assistentin von Jackson Crane, zum dritten Mal an diesem Tag. Zweifellos, um sie über die Anreise ihres sehr berühmten, sehr bedeutenden Klienten auf den neuesten Stand zu bringen, ihr die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, sich zu vergewissern, für wann das Abendessen auf dem Plan stand, zum dritten Mal abzuklären, dass Jackson und seine Frau, Georgia, jeder eine eigene Hütte bekamen (sie wurden bei Home immer getrennt untergebracht, ohne dass irgendjemand Fragen stellte oder die Brauen hob). Und genau wie bei den beiden vorausgegangenen Telefonaten versicherte Annie der persönlichen Assistentin, dass sowohl Jacksons als auch Georgias Zimmer absolut nach den jeweiligen Vorgaben hergerichtet waren – bis hin zur exakten Anzahl und Art von Flaschen in Jacksons Bar und der richtigen Sorte Aktivkohle auf Georgias Nachttisch.
Sie würde dafür sorgen, dass alles passte, das tat sie immer, aber zu einer erfolgreichen Launch-Party gehörte mehr, als die Very Important People einzuladen und sicherzustellen, dass sie alles hatten, was sie brauchten. Es gehörte eine gewisse Alchemie dazu, wie es vor allem auch Alchemie war, wer überhaupt als Home-Mitglied akzeptiert wurde. In gewisser Weise war das sehr kompliziert. Andererseits war es ganz einfach.
Keine Wichser.
Das war die einzige Direktive, die Ned ausgegeben, das einzige Kriterium, das er Annie geliefert hatte, als sie die Stelle antrat. Für die Frage, wer als Mitglied aufgenommen werden musste und wer gerade nicht. Keine Wichser. Dass Ned ihr zugetraut hatte, diese Anweisung zu befolgen, war die Grundlage ihrer gesamten Karriere bei Home. Für Ned war »Wichser« eine weit gefasste und facettenreiche Kategorie. Dazu gehörten zunächst einmal sämtliche Banker, sämtliche Consultants, sämtliche Anwälte (obwohl er selbst etliche Jahre als Anwalt bei Gericht tätig gewesen war). Wer ins Telefon bellte, er sei der CEO irgendeiner App, und gleichzeitig ostentativ auf seiner Laptoptastatur herumhackte, fiel durch. Sich in den Clubs danebenzubenehmen war in Ordnung, ja geradezu erwünscht, es durfte nur keinesfalls gewöhnlich sein. Niemals wollte er einen Oligarchen erleben, der mit seiner Platin-Amex wedelte, eine Flasche Chablis vom unteren Ende der Weinkarte bestellte und verlangte, dass Eiswürfel drin waren. Denn selbst wenn durch solche Leute kurzfristig zweifellos riesige Mengen Geld in die Kassen geflossen wären, hatten diese überteuerten, gerade gehypten Schuppen doch alle ein eingebautes Verfallsdatum. Die langfristige Reputation von Home stand und fiel mit einer unbeschreiblichen, unangestrengten Ruhe – und mit der Qualität der Mitglieder.
Natürlich musste man über ein gewisses Maß an Wohlstand verfügen, um eine Mitgliedschaft überhaupt in Erwägung ziehen zu können, aber im Grunde sollte Home, wenn auch um einiges nobler als sein angestaubter Ursprung, nach wie vor ein Ort sein, an dem Künstler, Träumer, kreative Leute, Darsteller aller Art zusammenkamen. Das war Neds Vision. Man brauchte nur zu sehen, welche fünf Mitglieder er für diesen Abend zum Essen eingeladen hatte. Einen bedeutenden Hollywoodstar und seine Frau, eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Einen der bekanntesten (und teuersten) Künstler Großbritanniens. Einen transatlantisch sichtbaren Talkmaster. Einen angesagten jungen Filmproduzenten, Sohn eines der berühmtesten Regisseure aller Zeiten. Von wegen Gandhi, Jesus und Oscar Wilde – das war der Stoff, aus dem Dinnerparty-Träume gemacht waren. Und sie, Annie, hatte das Ganze arrangiert und musste dabei sein, Small Talk machen. Statt vorgestanzter Ein-Wort-Statements, hingerotzt von Promis, die überall lieber gewesen wären als bei diesem Pressetermin, würde sie nun zu hören bekommen, wie Jackson Crane es wirklich fand, mit Christopher Nolan zusammenzuarbeiten. Wie es Georgia bei ihrem Gastauftritt auf dem Chanel-Haute-Couture-Laufsteg ergangen war. Würde aus erster Hand erfahren, was für ein Kraftakt es war, im Live-Fernsehen beispielsweise einem Formel-1-Fahrer eine unterhaltsame Anekdote zu entlocken. Was Elton wirklich an Ausstattung für seine Garderobe verlangt hatte.
Und alle fünf, so berühmt sie auch sein mochten, waren wahrscheinlich ebenfalls ein bisschen aufgeregt. Und keine und keiner von ihnen hatte auch nur die leiseste Ahnung, was sie an diesem Abend erwartete, was Ned vorhatte.
Er konnte grausam sein, dieser Job.
Für Annie war er das Größte.
Seit dem Augenblick, da er zum Frühstück erschienen war, hatte sie gewusst, dass Ned Groom auf einen Ausbruch zusteuerte.
»Großer Tag heute, nicht dass die Bande hier es versaut«, hatte er gebellt und das Kinn in Richtung der Kellner gereckt, die in steifen Jeansschürzen herumwuselten. »Alles klar?«, hatte er einem von ihnen zugerufen, und als der Junge nickte, hatte er gelächelt, ihm einen Klaps gegeben und gesagt, er werde bestimmt niemanden hängen lassen.
Scherz. Scherz. Kein Scherz. Scherz. So lief es mit Ned. Alles war lustig, bis es plötzlich ernst war. Bis es plötzlich lustig war, war alles ernst.
Ihr Tisch – ihr üblicher Tisch – war der direkt neben dem großen Panoramafenster. Ned setzte sich. Schaute kurz hinaus auf die Wildblumenwiese, wo das Gras im Schatten der Bäume noch starr war vor Kälte und über dem Boden noch Nebel hing. Zupfte seine Serviette zurecht.
»Also, Nikki, was liegt an?«
Während sie in kleinen Schlucken grünen Tee trank, erläuterte Nikki ihm die Agenda für den Vormittag – bevor die ersten Mitglieder erwartet wurden, letzte Absprachen mit dem Chefkoch, dem Chefbarkeeper, dem Chefgärtner, der Spa-Chefin, dem Chefdesigner und dem Event-Team. Als Ned sich kurz in die Speisekarte vertiefte, schickte sie eine Mail an alle raus: Achtung! Schlechte Laune.
»Ich brauche vollen Einsatz. Das ist die größte Eröffnung in der Geschichte von Home. Auf jeden Fall die scheißteuerste. Es darf nichts schiefgehen«, sagte er, leerte die erste von vielen Tassen Kaffee und tupfte sich mit der zusammengefalteten Serviette die Lippen ab. »Schon was von meinem Bruder gehört?«
Nikki sah nach. Es war 6.45 Uhr.
»Auf dem Weg, nehme ich an. Ich habe ihn gebeten, anzurufen, wenn er auf dem Damm ist.«
Adam musste einfach auf dem Weg sein, auch wenn er bislang weder von sich aus geschrieben noch auf ihre Nachfragen reagiert hatte. Sie hatte ihm das Taxi bestellt, hatte ihm die Telefonnummer des Fahrers in den Kalender geschrieben, ihm am Vorabend und morgens jeweils Nachrichten geschickt, um ihn daran zu erinnern, dass und wann er abgeholt werden sollte. Er brauchte nichts weiter zu tun, als aufzuwachen, sich in den Wagen zu schleppen und wieder einzuschlafen. An einem so wichtigen Wochenende würde Adam das doch schaffen, oder?
Wie an beinahe jedem Morgen im vergangenen Monat waren Ned und Nikki die Einzigen, die im Barn – dem lässigsten Restaurant auf der Insel, mit edelrustikalem Chic, bequemen Couches und durchgehend geltender Frühstückskarte, von der man sich, falls einem der Sinn danach stand, auch abends ein Full English Breakfast kommen lassen konnte – saßen und etwas aßen. Nikki hatte das Birchermüsli bestellt, Ned die Eggs Florentine. Schon von Weitem und erst recht aus drei Metern Entfernung sah Nikki am wabbeligen Zustand der Eier, dass das Eigelb noch zu weich war. Erschrocken versuchte sie, der Kellnerin ein Zeichen zu geben – zog eine Grimasse, warf ihr einen Blick zu, hob vielsagend eine Braue –, dass sie ihre Mission abbrechen sollte, aber die Kellnerin bekam es nicht mit. Sie stellte Ned den Teller hin. Ohne die Eier auch nur mit der Gabel anzuticken, geschweige denn einen Bissen zu kosten, ergriff Ned den Teller mit beiden Händen, drehte den Oberkörper um neunzig Grad und ließ sein Frühstück auf den Boden krachen. Was seine Frühstückseier betraf, war Ned Groom eigen. Er war in vielen Dingen eigen, aber so schlimm war es, soweit Nikki wusste, noch nie gewesen.
»Wir könnten in die Orangerie rübergehen«, sagte sie schnell, um die schockstarre Kellnerin zu verscheuchen, bevor Ned sich erheben und zu der unvermeidlichen Standpauke anheben konnte. »Du hast dort in einer Viertelstunde das Meeting mit dem Chefkoch – der macht sowieso die besten pochierten Eier …«
Seit einem Vierteljahrhundert war Nikki Hayes die persönliche Assistentin des Home-Group-CEO. Sie wusste, wann ihr Boss Anlauf zu einem Wutausbruch nahm. Das Zucken in den Muskeln an seinem Hals, das unbewusste Kieferzusammenbeißen, die Art, wie er an seiner Platin-Rolex nestelte. Und wenn sie dann endlich entfesselt war, die Wut, konnte sie den Luftdruck in einem Raum dermaßen verändern, dass einem schwindlig wurde.
Am Ende waren es die Leute vom Design-Team, die es abbekamen. Bei dem Treffen hatte Ned einen letzten Blick in das restaurierte Herrenhaus werfen sollen – der Lampenschirm dort wackelt, dieses Kissen würde sich da drüben besser machen, ersetzt diese Damien-Hirst-Spots durch ein paar Tracey-Emin-Kritzeleien, solche Sachen. Stattdessen geriet das Meeting zu einer Zerstörungszeremonie. Als Ned, zum Warmwerden, eine Art-déco-Vase aus einem der Fenster im ersten Stock pfefferte, zuckte Nikki noch zusammen. Dann sah sie entgeistert zu, wie er hochsprang und den Kristalllüster anstieß und zum Schaukeln brachte, um zu demonstrieren, dass er fünf Zentimeter zu niedrig aufgehängt worden war.
»Wo habt ihr das ganze Zeug her?«, schrie Ned. »Seid ihr einfach nur faul und dumm, oder wollt ihr mich verarschen? Zeitgenössische Vintage-Sachen, so wart ihr gebrieft. Und was habt ihr angeschleppt? Drittklassigen Museumskrempel. Wie er in der guten Stube von Vorstadt-Antiquitätensammlern rumsteht. Im Haus von eurer toten Oma. Wie viel hat der ganze Scheiß mich gekostet, und welcher Idiot hat den Scheck unterschrieben?«
Nikki holte tief Luft. Er erwartete keine Antwort, natürlich nicht, aber alle schauten zu ihr, siebzehn Augenpaare fixierten sie mit der stummen Bitte, etwas zu sagen, irgendetwas. »Na ja, also eigentlich«, hob sie an und scrollte auf ihrem iPad durch die Mails, »steht hier, dass das dein … Ich bin sicher, dass du vor einer Woche gesagt hast, das hier sei dein Lieblingsraum auf der ganzen Insel … Vielleicht ist das Licht heute irgendwie anders? Der Sessel da hat neulich vielleicht woanders gestanden …«
Sie verstummte. Wie üblich machte Ned weiter, als sei nichts gewesen.
»Ich habe Statement-Stücke verlangt. Statement-Stücke! Welches Statement macht dieses Scheißding?«, rief er mit sich überschlagender Stimme, fetzte ein goldgerahmtes ovales Ölporträt von der Wand, hielt es auf Armlänge von sich weg, inspizierte es, zog ziemlich genau so ein mürrisches Gesicht wie die Matrone, die es zeigte, und warf es mit wütendem Schwung aus dem Fenster.
Wie viele Szenen dieser Art hatte sie schon miterlebt? Wie viele solche Darbietungen?
Alles weg, das war es, was er wollte. »Dieser Schnickschnack. Dieser Müll. Schiebt diesen Louis-Vuitton-Koffer-Kaffeetisch da rüber. Schmeißt die ganze Kunst weg. Hängt einen Keith-Little-Akt über den Kamin. Überlegt euch, welchen Gesamteindruck ihr erzeugen wollt, verdammt. Das ist doch keine Geheimwissenschaft. Muss ich denn alles selber machen?«
Der Chefdesigner, ein zierlicher Mann mit grauem Pferdeschwanz und um die Schultern gebundenem Cricket-Pullover, rieb sich verstohlen die Stelle am Kiefer, wo er kurz zuvor von einem ledergebundenen Buch mit botanischen Kunstdrucken getroffen worden war. Nikki hatte gesehen, wie er es, während Ned weiter tobte, schweigend aufgehoben und behutsam wieder auf den Kaffeetisch gelegt hatte.
Sie taten ihr leid, alle. Da hatten sie sich im Salon des Herrenhauses versammelt und eine oder anderthalb Stunden lang voller Spannung darauf gewartet, ihm ihr Werk präsentieren zu können, denn das war ihr Job, ihre Karriere, etwas, worauf sie jahrelang hingearbeitet, wovon sie geträumt hatten – nur um zu erleben, wie Ned hereingestürmt kam und sofort anfing herumzuschreien, also wirklich zu schreien, dass Speichelfetzen flogen und sein Gesicht dunkelrot anlief. Er schrie Leute an, die seit zehn Jahren für ihn arbeiteten. Designer, für die das bei Home das erste Projekt war. Unterbezahlte Assistentinnen, die Abende und Wochenenden durchgearbeitet und Magengeschwüre bekommen hatten über dem Versuch, mit Neds Forderungen, seinen Blitzideen und abrupten Meinungsumschwüngen Schritt zu halten. Siebzehn Profis, die nicht genau zu wissen schienen, ob es besser war, die Flucht nach vorn anzutreten und sich dem Vandalismus anzuschließen oder stumm stehen zu bleiben und jeden Blickkontakt zu meiden.
Nikki respektierte ihren Chef, aber das hier konnte anstrengend sein. Dass Ned oft solche Ausbrüche hatte, dass sie schnell vorübergingen und die Leute vollkommen wahllos trafen, hieß ja nicht, dass sie diesen Leuten nichts ausmachten. Denn im Ernst, hier wurde doch nichts anderes demonstriert als Macht! Ein angejahrtes Rumpelstilzchen hüpfte, sichtlich außer Atem, herum und schubste einen Kronleuchter an, und niemand wagte zu lachen. Ein erwachsener Mann plusterte sich beim Anblick des Ölbildnisses einer alten Dame dermaßen auf, dass ihm die Knöpfe vom Hemd zu springen drohten, und niemand wagte zu fragen, ob er nicht vielleicht ein bisschen übertrieb.
Ganz hinten stand eine junge Frau und knabberte an den ohnehin schon abgekauten Nägeln, zog mit den Zähnen einen dünnen Streifen Nagel vom kleinen Finger, während sie angestrengt versuchte, nicht in Tränen auszubrechen. Die Arme musste neu sein, dass sie sich das alles so zu Herzen nahm. Wenn man eine Weile bei Home arbeitete, gewöhnte man sich an diese Ausbrüche, lernte, sie nicht so an sich heranzulassen, hörte auf, sie in irgendeiner Weise persönlich zu nehmen. Wutanfälle, Tiraden, Streitereien? Gehörten zum Mythos, oder? Ned Groom, Visionär und Pedant. Das unberechenbare Genie, das auf gutem Geschmack ein ganzes Imperium errichtet hatte. Der Mann, der, wenn er wollte, eine Karriere pushen konnte (oder ihr aus einer Laune heraus den Garaus machen). Nikki hatte erlebt, wie er einen dekorativen Briefbeschwerer kaum einen Meter am Kopf einer Reinigungskraft vorbei durch eine Fensterscheibe geschmissen hatte (drei Tage vor dem Launch von Country Home). Sie hatte ihn mit einem Küchenmesser vor dem Gesicht eines Trägers herumfuchteln sehen (am Eröffnungsabend von Highland Home). Während ihrer ersten Schicht im HomeCovent Garden, vor langer, langer Zeit, als ängstliche kleine Garderobenfrau, hatte sie ihn eine Empfangsdame anbrüllen hören, weil sie sich beim Nachnamen eines Mitglieds vertan hatte.
Immerhin musste man zugeben, dass er, auch wenn sein Auftreten etwas Weichspüler hätte vertragen können, in aller Regel recht hatte. Wären diese pochierten Eier auf dem Teller eines Mitglieds gelandet, wären sie zurückgegangen. War dieser Raum erst nach seinen Anweisungen zurechtgezupft, würde er mit Sicherheit tausendmal besser aussehen. Und Nikki wusste – bis auf die arme junge Frau ganz hinten wussten sie es alle –, dass Ned, sobald er Dampf abgelassen hatte, den Lüster und die Vase und die Kunst an den Wänden vergessen würde. Er würde ihnen auf die Schulter klopfen, ihnen eine Bonuszahlung zusichern und sie für ihren Sportsgeist loben.
»Du!«, schnauzte er und baute sich vor der verängstigten, gerade mal eins fünfzig großen Assistentin auf. »Du siehst doch aus, als hättest du ein Minimum an Geschmack – im Gegensatz zu diesem Heini da.« Dazu deutete er mit dem Finger in Richtung ihres Chefs. »Hast du kein einziges Mal den Drang verspürt, darauf hinzuweisen, dass es hier aussieht wie nach einer Schlägerei in einem Trödelladen?«
Sie blickte flehentlich zu ihrem Chef, doch der zuckte nur die Achseln. Ned schaute von ihr zu ihm und wieder zurück. Keiner sprach ein Wort.
»Gut«, sagte Ned schließlich und schüttelte den Kopf. Um seine Lippen spielte ein winziges Grinsen. »Wer zeigt mir die Bibliothek?«
Niemand schien scharf darauf zu sein, Ned die Bibliothek zu zeigen.
An der Stelle entschuldigte sich Nikki, indem sie auf ihr Handy zeigte und so tat, als müsse sie ein Telefonat erledigen. Im ersten Stock des Herrenhauses reihten sich endlose Räume mit hoher Decke und großartigem Meerblick aneinander, Restaurants und Bars und im Stockwerk darunter eine Orangerie mit gläserner Decke. Sie ging den eichengetäfelten Flur entlang, schaute links und rechts in die opulenten Räume und dann die beeindruckende Haupttreppe hinunter. In der Halle drängten sich ein paar von Annies Leuten um den Empfangstresen, gingen auf ihren iPads die Mitgliederfotos durch und kicherten, während Barkeeper kistenweise alten Krug-Champagner anschleppten und sich bemühten, den Reinigungskräften auszuweichen, die mit vollem Einsatz die Perserteppiche saugten und die beiden ausgestopften Flamingos links und rechts vom Eingang mit Staubwedeln bearbeiteten.
Draußen war es ein wenig kälter, als die strahlende Morgensonne vermuten ließ. Nikki sah auf die Uhr. War es zu früh, um Adam noch einmal zu schreiben? Oder ihn anzurufen? Immerhin war er Neds Bruder. Er hätte da sein und sich auch um die Sachen kümmern sollen, mitbekommen, was los war, helfen, die Wogen zu glätten. »Adam«, seufzte sie auf seinen Anrufbeantworter. Es war die dritte Nachricht, die sie ihm an diesem Morgen hinterließ. »Kannst du mir bitte schreiben, wann du ankommst? Ned hat schon vor einer Stunde mit dir gerechnet, und er ist … nicht gerade bester Laune.«
Als sie sich wieder zum Herrenhaus umdrehte und die Überreste der zerschmetterten Antiquitäten auf dem Rasen, in den Beeten und auf dem Schotterweg liegen sah, seufzte sie noch einmal. Okay, das war nun wenigstens erledigt. An einem Tag wie diesem stellte sich nicht die Frage, ob Ned explodieren würde, sondern nur die, wann und wie viel Schaden er dabei anrichtete. Genau wie meine Mutter, dachte Nikki oft – weshalb es meistens an ihr vorbeirauschte.
Was für eine Entdeckung es gewesen war, welche Erlösung, als sie mit etwa zwölf Jahren begriffen hatte, dass sich die Ausbrüche ihrer Mutter nicht abwenden ließen. Dass man noch so leise auftreten, noch so gründlich aufräumen und noch so sorgsam darauf bedacht sein konnte, ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen – sie fand immer etwas, das sie aus der Fassung brachte. Das hatte es natürlich nicht angenehmer gemacht, im Auge des Orkans zu sein, aber es hatte bedeutet, dass sie aufhörte, es auf sich zu beziehen.
Eine Tür knallte. Nikki blickte auf und sah die junge Frau, die so heftig mit den Tränen gekämpft hatte, aus dem Haus stürmen. Als sich ihre Blicke trafen, blieb sie abrupt stehen. Nikki lächelte und winkte sie zu sich.
»Entschuldige«, sagte sie, »eigentlich müsste ich es wissen, aber auf dieser Insel gibt es so viele Leute – wie heißt du noch mal?«
»Chloe«, murmelte die junge Frau. »Es tut mir leid, wirklich. Ich bin erst seit einem Monat hier. Ich hab mich so gefreut. Ich dachte, ich bin gut.« Sie schniefte. »Meinst du, er feuert mich? Soll ich versuchen, mich zu entschuldigen?«
Nikki legte Chloe den Arm um die bebenden Schultern und drückte sie kurz. Nein, dachte sie, dir passiert nichts,die Hübschen feuert er selten. Einmal hatte er sogar darüber gewitzelt, hatte auf einen großspurigen und längst gefeuerten Home-Architekten angespielt: »Wie William Morris gesagt hat, oder, Nikki? Lass niemanden in dein Haus, den du nicht für schön oder nützlich hältst.«
Zufälligerweise war Nikki sich der Tatsache, dass sie selbst nicht zuletzt aufgrund ihres Äußeren schon so lange zum Inventar von Home gehörte, sehr wohl bewusst. Das war keine Überheblichkeit, sondern schlicht eine Tatsache. Wenn einem nämlich eine Model-Laufbahn – selbst eine so kurze wie ihre – eines einbrachte, dann eine unabhängige Bestätigung der eigenen Attraktivität, ein klares Bewusstsein für die Türen, die sie einem öffnete, und die Probleme, die sie mit sich brachte.
Außerdem war sie extrem gut in ihrem Job.
Und sie mochte ihn. Meistens.
Sicher, Ned war manchmal gemein, aber er konnte auch unglaublich großzügig und aufmerksam sein. Einige der Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, die er ihr im Lauf der Zeit gemacht hatte – »Tut mir leid, dass ich im vergangenen Jahr so ein Arsch gewesen bin« –, waren geradezu grotesk. Der Kleiderschrank in ihrem kleinen viktorianischen Reihenhaus in Südlondon quoll über von Celine-Handtaschen, Louis-Vuitton-Stiefeln und Hermès-Armreifen. Ned konnte lustig sein, er hatte Charisma. Konnte Leute imitieren. War wortgewaltig. Er war einer von denen, die man irgendwann anflehte, sie sollten aufhören, weil man vor Lachen keine Luft mehr bekam. Wenn sie bei Home blieb, würde Chloe das alles eines Tages erleben.
»Ach, Süße, nun wein bloß nicht. Ihr habt das super gemacht, euer ganzes Team – sieh dir das Haus doch an! Es ist wunderschön!«
Gemeinsam blickten sie auf das vollkommen symmetrische Gebäude mit den korinthischen Säulen, die honigfarbene Fassade mit dem überbordenden Blauregen, den Ned eine Woche zuvor für eine beachtliche Summe hatte anbringen lassen.