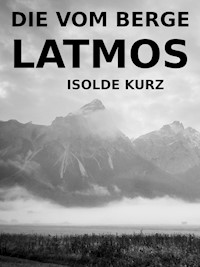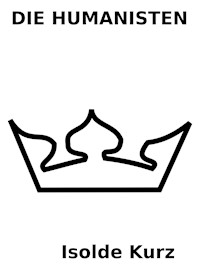Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Despot ist ein Roman von Isolde Kurz. Reinlesen: Als Sohn deutscher Eltern in Amerika geboren, hatte ich schon ein Menschenleben hinter mir, als ich mit wenig mehr als zwanzig die kleine Universität am Neckar bezog. Denn ich war seit frühester Jugend auf eigenen Füßen gestanden, hatte als halbwüchsiger Junge in den Pampas kleinere Jungen unterrichtet, war dreizehnjährig in den Sezessionskrieg entlaufen, hatte mit den Indianern gelebt, war Zeitungsberichterstatter geworden, alles ohne noch jemals einen regelrechten Unterricht genossen zu haben. Da war dann plötzlich inmitten des tätigen Lebens mein deutsches Blut in mir erwacht, das nach gründlicheren Kenntnissen und einer wissenschaftlichen Ausbildung dürstete, und ich fuhr nach Europa, um mit einer kleinen Erbschaft, die mir zugefallen war, auf einer deutschen Hochschule durch Geschichte, Literatur und verwandte Fächer die Lücken meiner Weisheit zu stopfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Despot
BriefDer DespotAnmerkungenImpressumBrief
Erinnern Sie sich, liebe Freundin, wie Sie vor Zeiten einmal mit dem Schreiber dieser Blätter das kleine Friedhöfchen von La Tour de Peilz am Genfer See besuchten? – Die ersten Vogelstimmen waren in der Luft, und die Bäume zeichneten ihr zartes Geästel noch laublos, aber schon mit verdickten, drängenden Knötchen wie mit abertausend Perlen in den tiefblauen Äther. Sie sprachen nur die zwei Worte: Heiliges Leben! Dann aber blickten Sie mich fragend an, weil ich vor einem namenlosen Grabstein mit befremdender Inschrift stehen blieb. Und Ihr alter Freund versprach, Ihnen von dem Schläfer zu erzählen, dessen Ruhe diese Grabschrift hütet. Ein Menschenalter verging, bevor er dazu die Muße fand. Jetzt, da er sich selber anschickt, in den dunklen Nachen zu steigen, sendet er Ihnen diese Blätter. Verfahren Sie damit nach Ihrem Ermessen: streichen Sie, kürzen Sie nach Bedarf, lassen Sie Jahre, Jahrzehnte vergehen, lassen Sie die ganze Welt sich wandeln; jener Tote hat Zeit zu warten. Nur einmal noch soll er im Glanz der Jugendtage wieder aufstehen, ehe die einst so verheißungsvollen Züge für immer verlöschen.
Kann sein, es lebt noch da und dort einer, der ihn gekannt und geliebt und dann verurteilt hat. Kann sein, es sind noch irgendwo Spuren seines Werkes erhalten. Dann findet er vielleicht spät noch das Verstehen und die Lossprechung, die dem Lebenden versagt waren.
Sein Freund und der Ihre
Ewers
Der Despot
Was waren das für goldene Tage, meine Tübinger Studententage. Denke ich daran zurück, so höre ich tausend Lerchen zwitschern!
Als Sohn deutscher Eltern in Amerika geboren, hatte ich schon ein Menschenleben hinter mir, als ich mit wenig mehr als zwanzig die kleine Universität am Neckar bezog. Denn ich war seit frühester Jugend auf eigenen Füßen gestanden, hatte als halbwüchsiger Junge in den Pampas kleinere Jungen unterrichtet, war dreizehnjährig in den Sezessionskrieg entlaufen, hatte mit den Indianern gelebt, war Zeitungsberichterstatter geworden, alles ohne noch jemals einen regelrechten Unterricht genossen zu haben. Da war dann plötzlich inmitten des tätigen Lebens mein deutsches Blut in mir erwacht, das nach gründlicheren Kenntnissen und einer wissenschaftlichen Ausbildung dürstete, und ich fuhr nach Europa, um mit einer kleinen Erbschaft, die mir zugefallen war, auf einer deutschen Hochschule durch Geschichte, Literatur und verwandte Fächer die Lücken meiner Weisheit zu stopfen.
In Tübingen fehlte es mir aber zunächst an einem passenden Umgang. Zwischen einem Menschen von meiner buntscheckigen Vergangenheit und den Familiensöhnen, die ganz warm aus dem engen häuslichen Nest auf die Hochschule kamen, war die Kluft zu groß. Ich ließ mir zuweilen einen der harttrabenden »Philistersgäule« satteln und ritt in den sonnigen Spätherbsttagen allein in die reizvolle Gegend hinaus. Im übrigen lebte ich still über meinen Büchern und fand mich inmitten des lauten Studententreibens einsam wie im Urwald.
Man spricht soviel vom Blitzstrahl der Liebe. Daß es auch einen Blitzstrahl der Freundschaft gibt, werden wenige verstehen, ich aber sollte es in jener Zeit erfahren.
Eines Morgens, als ich in einer der langen Alleen spazierenging, die in dreifacher Reihe dem Städtchen vorgelagert sind, begegnete ich einem jungen Mann von ungewöhnlich anziehender Erscheinung, der in Gang und Haltung etwas Soldatisches an sich hatte, womit ein seltsam abwesendes, verträumtes Auge im Widerspruch stand. Er war mir durch sein edles Äußere schon früher in den Straßen aufgefallen; auch zu Pferde hatte ich ihn mehrmals gesehen und bemerkt, daß er kein Sonntagsreiter war, sondern mit bequemer Selbstverständlichkeit im Sattel saß. Aber als er jetzt in dem raschelnden Kastanienlaub nahe an mir vorüberging und mich mit einem schnellen Blick streifte, da durchfuhr mich's: diesen oder keinen suchst du dir zum Freund. Ich nahm es für eine gute Vorbedeutung, daß ich ihn noch am selben Vormittag in einem Kolleg über ältere deutsche Literatur wiederfand. Er saß nur wenig von mir entfernt, und ich war die ganze Zeit über mehr mit ihm als mit dem Vortrag beschäftigt. Ich hätte es kaum in Worte fassen können, was mich so ganz eigen zu ihm hinzog. Aber alles an ihm fesselte mich: die Stirn, die unter dem dichten Haar mit edler Wölbung in den Schädel überging, die dunklen, über der Nase leise zusammentreffenden Augenbrauen, die Art, wie er den Kopf trug, lauter Äußerlichkeiten, die mir der Ausdruck für etwas waren, wofür ich noch keinen Namen hatte. Während die anderen mit vorgeneigten Köpfen emsig kritzelten, hielt er die Augen ruhig auf den Vortragenden geheftet und machte nur dann und wann eine rasche Aufzeichnung. Von da ab saßen wir fast einen Winter lang zweimal wöchentlich im gleichen Hörsaal beisammen, ohne je ein Wort zu tauschen. Mein Herz brannte danach, ihn anzureden, aber sein abgeschlossenes Wesen benahm mir den Mut. Und doch war ich sicher, daß auch er mich bemerkt hatte, denn bei jedem besonderen Anlaß begegneten sich unsere Augen. Ich will ihn Gustav Borck nennen, es ist der Name, den er sich später gewählt hat; warum ich seinen wirklichen Namen, dem ein »von« vorgesetzt war, nicht nenne, wird sich aus seiner Geschichte von selbst erklären. Außer dem Namen konnte ich nichts von ihm erkunden, als daß er Norddeutscher war, als Jurist immatrikuliert, und daß er ein Türmchen hart am Neckar bewohnte, worin ein Unsterblicher in vierzigjähriger geistiger Umnachtung gelebt hatte. Dort konnte man vom jenseitigen Flußufer aus zuweilen seinen dunklen Kopf am Fenster erkennen.
Was sich anzieht, muß sich endlich finden. Bei einem Festkommers zu Ehren eines scheidenden Lehrers ergab es sich, daß wir beide nebeneinander zu sitzen kamen. Ich stellte mich vor, wie ich's die andern tun sah:
Gestatten Sie – – mein Name ist Ewers.
Er erhob sich: Mein Name ist Borck.
Eine Verbeugung, dann setzten wir uns, aber durch die dürre Formel hindurch grüßten sich unsere Seelen.
Sie sind Amerikaner, ich weiß von Ihnen, sagte er verbindlich. Sie sind so glücklich, einem großen Gemeinwesen anzugehören und schon viel gesehen zu haben. Ich beneide Sie.
Die leise Bitterkeit dieser Worte war die Folge der unsäglich beengenden Verhältnisse des damals noch ungeeinten Deutschland. Ich aber fühlte mich dadurch gehoben, als ob man mir ein Adelsdiplom auf den Tisch gelegt hätte.
Jene Nacht wurde die Geburtsnacht einer Freundschaft, die durch eine Reihe von Jahren den stärksten Inhalt meines Lebens gebildet hat. Wir schlossen uns zusammen, wie wenn jeder dem andern bisher zu seinem Dasein gefehlt hätte. Ich bewunderte ihn als Vorbild altvererbter, veredelter Kultur, er sah in mir, wonach sein heftiges Verlangen stand: Freiheit und Weltweite.
Sie haben noch gar nichts gedacht, aber Sie haben gelebt, pflegte er mir unter den verschiedensten Formen immer wieder zu sagen. Ich, der nicht leben darf, wandere mit dem Geist durch Raum und Zeit; so geben wir zwei zur Not einen ganzen Menschen.
Gustav Borck stammte aus altpreußischem Militäradel, für den es sich von selbst verstand, daß der einzige Sohn einer töchterreichen Offiziersfamilie, deren Vorfahren die Schlachten Friedrichs mitgeschlagen hatten, in der Kriegsschule erzogen wurde. Allein dieser feurige und selbstherrliche Mensch war wie durch ein Versehen der Natur in seine steifleinene Umwelt hineingeboren; statt wie die Kameraden mit vollen Lungen den Kastengeist einzuatmen, behielt er auch in der Anstalt seinen eigenen Geist, mit dem er bei Vorgesetzten und Mitschülern anstieß. Zu Hause in den Ferien war es fast noch schlimmer, denn da herrschte dieselbe strengsoldatische Lebensauffassung, und er konnte sich weder mit den Eltern noch mit den Schwestern verstehen, die die Dienstordnung auswendig wußten und von nichts redeten als von Übungsplatz und Truppenschau. Sein Vater, ein Veteran aus den Schleswig-Holsteinschen Kämpfen, der mit einer Kugel im Bein, die er sich vor den Düppler Schanzen geholt hatte, und dem Oberstenrang verabschiedet war, erwartete im stillen Großes von diesem Sohne, behandelte ihn aber mit Strenge, um sein Freiheitsgefühl und die Neigung zu außermilitärischen Dingen in ihm niederzuhalten. Es half nichts, daß dieser in der Anstalt nicht bloß als begabtester Kopf, sondern auch als bester Reiter und Fechter galt; was sein Vater an ihm vermißte, konnte und wollte er sich nicht geben. Nur an seine frühesten Jugendjahre, die er bei einem mütterlichen Oheim in Paderborn zubrachte, dachte er mit Freude als an die einzig glückliche Zeit seines Lebens zurück. Der alte Herr war Justizbeamter, hatte aber so etwas wie ein Poetengemüt und widmete seine ganze freie Zeit der Erkundung und Sammlung vaterländischer Altertümer. Seine umfangreiche Bibliothek, worin der frühreife Knabe ungehindert wühlte, und die Stille der norddeutschen Ebene gaben seiner Phantasie eine überschwengliche Nahrung und förderten den Hang zum Grenzenlosen, der von Natur in ihm lag. So konnte er sich in einem Beruf, wo jeder Schritt von oben gelenkt und nirgends Raum für das Persönliche war, nicht anders als todunglücklich fühlen.
Da kam das Jahr Sechsundsechzig. Mit Jubel zog er von der Kriegsschule weg ins Feld, denn der Krieg bedeutete ihm Freiheit und Leben. Er fand bei der schweren Verwundung seines unmittelbaren Vorgesetzten die Gelegenheit, sich auszuzeichnen und kehrte mit den Achselstücken und der Aussicht auf eine rasche Laufbahn im Generalstab nach Hause. Jetzt war das Entzücken der Familie groß, aber nach zwei Jahren voll Zwiespalt und Pein machte er allem Wünschen und Hoffen ein jähes Ende, indem er den bunten Rock auszog, um zu studieren. Jener Mutterbruder, dem er die schönen Jahre seiner Kindheit verdankte, hatte bei dem Entschluß mitgewirkt. Damit wurde die Kluft zwischen ihm und seinem Elternhause unausfüllbar; die Mutter zog sich scheinbar noch weiter von ihm zurück als der Vater, sie schämte sich, dem Mann, den sie liebte, keinen Sohn nach seinem Herzen geboren zu haben. Mit solchem Riß im Leben lief Gustav Borck in den ersehnten Hafen der Hochschule ein. Nach Rat und Beispiel des Oheims wählte er die Jurisprudenz, der er denn auch mit Pflichtgefühl oblag, aber nur um jetzt am Ziel seiner Wünsche zu erkennen, daß ihn das Rechtswesen genau so öde anblickte wie das Soldatenspiel im Frieden. Nur an den brotlosen Nebenfächern, die er um so feuriger trieb, erlabte sich seine lechzende Seele. In die kleine Universitätsstadt am Neckar hatte ihn, wie so manchen Norddeutschen, der Ruf gezogen, daß dort wohlfeil zu leben sei, auch war einer der juristischen Lehrstühle glänzend besetzt; den Ausschlag mochte jedoch der Wunsch gegeben haben, so weit wie möglich von seiner Familie entfernt zu sein.
So kam es, daß Gustav Borcks Lebensweg sich auf diesem Kreuzungspunkt mit dem meinen treffen mußte, und von all den vielgestalten Begegnungen meines Lebens ist keine innerlich bedeutungsvoller für mich geworden als diese. Auf allen Gebieten des Geistes, die ich als tastender Neuling betrat, gehabte er sich wie ein König im angestammten Reiche. Gingen wir nach der Vorlesung noch eine Strecke zusammen, so vernahm ich aus seinem Munde manches Wort über den gleichen Gegenstand, das mir hundertmal mehr zu denken gab, als die Worte des Lehrers, und vieles hat sich damals meinem Gedächtnis eingeprägt, was ich erst in reiferen Tagen richtig verstehen konnte. Es schien mir dann immer, als hätte er einen Geheimschlüssel zu all den Dingen, vor deren Tür die andern im Dunkel tappten.
Eines Tages nach einem trockenen Shakespeare-Kolleg, das ich jedoch pflichtschuldig nachgeschrieben hatte, sollte ich plötzlich inne werden, was für ein Schlüssel das war.
O die Methode! die Methode! sagte er. Die Erbsünde der Deutschen! Mit was für Hebeln und Schrauben gehen sie dem armen Genius zu Leibe. Der aber macht sich schlank und schlüpft ihnen aus den Händen und läßt die ganze staunenswerte Gelehrsamkeit im Dunkeln suchen und raten, wie er zu Werke geht.
Wie geht er nach Ihrer Ansicht zu Werke? fragte ich, nach jedem seiner Worte begierig wie nach einem Goldkorn haschend.
Er lachte leise vor sich hin.
So ist's recht. Sie fragen wie ein Mohikaner, ohne alle Gelehrsamkeit, aber zum Zweck. Wie geht er zu Werke? Gar nicht geht er zu Werke. Er sucht nicht die Poesie, sie kommt zu ihm, er atmet sie ein und aus, er findet nur sie im Leben, weil er alles andere als leere Schale liegen läßt.
Aber auf welchem Wege kommt sie zu ihm?
Durchs Ohr.
Durchs Ohr?
Jawohl, durch das offene Ohr, in das alles Lebende seine Beichte flüstert. Warum sind Goethe, Shakespeare, Dante so groß, als weil sie die größten Beichtväter des Menschengeschlechtes waren? Und keiner ist berechtigt, sich einen Dichter zu nennen, dem es nichts von seinen geheimsten Heimlichkeiten anvertrauen mag. Es sind ausgeplauderte Beichtgeheimnisse, womit uns Shakespeare oft so jählings bis ins Mark erschüttert.
Meinte nicht der trockene Herr auf dem Katheder etwas ähnliches, als er von des Dichters Lebenskenntnis und Beobachtung sprach?
Lebenskenntnis! Beobachtung! rief er empört, als wäre er persönlich beleidigt. Ist denn der Dichter ein Detektiv? Was sollte er mit der Beobachtung? Nichts, was das Leben liefert, kann die Dichtung, so wie es ist, gebrauchen, und doch sind alle ihre Gebilde schon irgendwo auf Menschenbeinen gegangen. Verstehen Sie, lieber Unkas, wie ich es meine?
»Unkas« nannte er mich nach dem »Letzten Mohikaner« aus dem »Lederstrumpf«, wenn er mir besonders wohlwollte.
Ich mußte bekennen, daß ich ihn ganz und gar nicht verstand, es schien mir vielmehr, als ob er sich geradezu widerspreche.
Der Stoff, den der Dichter zu kneten bekommen hat, sagte er mit Nachdruck, mehr und mehr in Feuer geratend, ist immer nur er selbst. Wohl findet er auch in seiner Umwelt die lebendigen Ansätze zu seinen Charaktergebilden, und wo ihm ein solcher begegnet, da schießen ihm gleich die verwandten Züge von allen Seiten zu. Aber den zeugenden Urstoff, in dem sie sich zur unlöslichen, naturgewollten Einheit zusammenfinden, den Lebensfunken, der sie erst stehen und gehen macht, holt er aus dem eigenen Innern. Denn in sich hat er das Zeug zu allen Charakteren und Leidenschaften, er umspannt mit seiner Natur die ganze Stufenleiter der Menschheit und reicht von der einen Seite bis an den Heiligen, mit der andern an den Verbrecher. Diese Fähigkeiten aber, die ihm nicht des Handelns wegen gegeben sind, ruhen zunächst unbewußt und untätig in ihm; sie wollen erst aufgeregt und befruchtet sein. Dafür ist nun das Leben da. Es berührt ihn mit irgendeiner Erfahrung, einem inneren Erlebnis, das vielleicht für einen anderen gar keines wäre, denn was ein rechter Poet ist, der erlebt fort und fort, von außen und von innen. Solch ein Erlebnis, sei es ein Vorgang oder vielleicht nur ein Wort, eine erhaschte Gebärde, irgendein Laut aus den Tiefen der Menschenbrust, ein Blick, der stärker getroffen hat, springt wie ein Keim in seine Seele. Da bleibt er unbewußt liegen, aber er ruht nicht, er verwandelt sich ganz leise und unbemerkt, er ist in Bälde nicht mehr, was er ursprünglich gewesen. Er wächst immer weiter, indem er verwandte Stoffe des Innern an sich zieht. Von diesen formlosen, aber innerlich befruchteten Zellengebilden ist des Dichters Seele ganz voll, sie tauchen beständig in ihm auf und nieder, er greift hinein, wenn er ihrer bedarf. Sie sind gleichsam der Urnebel, aus dem er seine Gestalten formt. So meinte ich das. Habe ich mich jetzt verständlich gemacht?
Ich nickte, um ihm nur nicht ganz als Böotier zu erscheinen. Aber tatsächlich schwankte mir das Hirn. Ich raffte alle meine Geisteskräfte zusammen, um zu der naheliegenden Frage zu kommen: Woher wissen Sie denn, wie dem Dichter zumute ist?
Weil ich auch einer bin.
Ich sah ihn mit scheuem Staunen von der Seite an. Alle Arten von Menschen hatte ich schon gesehen, Kaufleute und Soldaten, Richter, Geistliche und Zeitungsschreiber, einen Dichter niemals. Aber augenblicklich stand es in mir fest: Ja, er ist einer, so muß ein Dichter aussehen.
Gustav aber lachte plötzlich laut und bitter auf und schlug sich mit der Faust auf den Mund.
Ich ein Dichter? – Ein Bruder Langohr bin ich, der seinen Sack zur Mühle trägt wie die anderen auch. Vergessen Sie, was ich Ihnen da vorgeschwatzt habe. Wer darf überhaupt von solchen höchsten Dingen reden? Es geht alles irre, ist alles nur Gestammel und Widerspruch.
Wenn ich meinem neuen Freund auch nicht immer auf seinen Denkwegen folgen konnte, so danke ich es doch ihm, daß ich nicht wie tausend andere mit einem Ranzen voll fertiger Begriffe, woran sich hernach nichts mehr ändern läßt, von der Hochschule gekommen bin. Denn nie ließ er mich ungestört die bequeme Straße einschlagen, auf der die Mehrzahl der studierenden Jugend hinter den Worten des Meisters herwandelte, immer wies er auf irgendeinen abseitigen Fußpfad, der nach einem einsamen Aussichtspunkt führte.
Allmählich fand sich ein kleiner Kreis von jungen Leuten zusammen, die alle in der gleichen Gedankenwelt lebten. Wir trafen uns des Abends in dem beliebten Studentenkaffeehaus Molfetta. Ein kleines Seitengelaß, nicht größer als ein Alkoven, hart neben der Anrichte, wo die Schwester des Wirts, eine schöne blasse Südtirolerin, den Kaffee braute, das köstlich duftende Getränk von Mokka, Portoriko und gebranntem Zucker, für das sie eben so berühmt war wie für ihre dunklen, schwermütigen Augen, war der Schauplatz unserer Zusammenkünfte. Dieser bescheidene Raum hörte damals manchen anregenden Gedanken, manches ungewöhnliche Wort, das man gern in sein späteres Leben hinübergenommen hätte, zum Genuß des Augenblicks verrauschen. Denn dort saßen wir die halbe Nacht hindurch, fünf, sechs junge Gesellen mit Gustav Borck als unserem König.
Wenn ich an die Tafelrunde bei Molfetta zurückdenke, so drängen sich vor allem drei blonde, echt germanische Häupter in meine Erinnerung. Da war ein großer, hagerer Rheinländer mit bleichem Gesicht und starken Backenknochen, der einen verkürzten Arm hatte, Kuno Schütte, der nachmalige bekannte Theosoph. Er war schon damals ein Sonderling, der es liebte, nie genau wissen zu lassen, was er tat, und sich einen Anschein von Allgegenwart zu geben, indem er immer auftauchte, wo man ihn nicht erwartete. Er hatte denselben unwiderstehlichen Zug zu Gustavs Wesen wie ich, legte ihn aber auf seine eigene mystische Weise aus, indem er sich einbildete, ihm irgendwann in abgelebten Zeiten nahegestanden zu haben. Da war der stämmige, blatternarbige Heinrich Sommer, Preuße von Geburt und ehemaliger Theologe, der sich lange mit religiösen Zweifeln gequält hatte und noch in hohen Semestern zur Medizin übergegangen war, um später ein namhafter Chirurg zu werden. Da war endlich unser Benjamin, der rührend jugendliche und schöne Olaf Hansen, ein Landeskind, aber von schwedischen Ureltern stammend. Die übrigen waren mehr oder weniger Strohmänner, stumme Personen, und gehörten nicht zum festen Bestand unseres Kreises. Wir Fünfe aber hingen fest zusammen, durch Gustavs Überlegenheit wie mit einem gemeinsamen Stempel geprägt. Nach Studentenbrauch standen wir alle bald auf Du; nur Gustav Borck blieb außer der Vertraulichkeit und immer von einem letzten Rätsel wie von einer geheimnisvollen Wolke umgeben. Er beherrschte das Gespräch, auch wenn er schwieg, was oft halbe Abende lang der Fall war; er wirkte dann durch seine bloße Gegenwart geistig ein. Kam es zu Redekämpfen, so gab sein Wort den Ausschlag, und dabei fiel mir auf, daß er selten etwas ganz Außerordentliches, sondern meist nur das scheinbar Naheliegende sagte, das wir anderen übersehen hatten. War es ausgesprochen, so verstand es sich von selbst. Einzig Olaf Hansen traf zuweilen den Nagel noch besser auf den Kopf, aber bei ihm klang es, wie wenn ein Kind etwas Tiefsinniges sagt, dessen Tragweite ihm selber verborgen ist.
Am glücklichsten war ich, wenn Borck ein Buch aus der Tasche zog und aus Shakespeare oder Kleist vorlas. Er besaß zwar nicht die Gabe, von einer Rolle in die andere zu schlüpfen und dem Dichterwort mit der Stimme Körper und Farbe zu geben, dafür war sein nordisches Wesen zu spröde, aber er lebte dann so ganz in der Dichtung, daß keine Schönheit ungefühlt vorüberging, und der Raum füllte sich mit übermenschlichen Gestalten. Mitunter las er auch Gedichte vor, in derselben gleichmäßig gehobenen Tonart, und verlangte unser Urteil zu hören. Wir ahnten, daß es die seinigen waren, und da wir alle unter seinem Banne standen, so fanden wir die Gedichte wundervoll und lobten sie über die Maßen. Nur Olaf sagte gelegentlich in seiner einfachen Art, daß ihn dies oder jenes nicht befriedige, doch ohne sein Urteil begründen zu können. Dann zerriß Borck das Blatt auf der Stelle. Ich glaubte, es geschehe aus Ärger, und machte ihm einmal Vorwürfe darüber, wobei mir die Bemerkung entfuhr, daß Olaf doch zu jung sei, um mit seiner Meinung ernst genommen zu werden.
Die Jahre tun nichts zur Sache, antwortete Gustav abweisend.
Auch Olaf machte Verse, die er uns dann und wann vortrug. Er sagte sie mit leiser, etwas zitternder Stimme ganz kunstlos her, wobei er die Augen schloß und sehr bleich wurde. Es klang nur, wie wenn ein Bächlein über Kiesel murmelt. Ich wunderte mich, daß Gustav Borck mit wahrer Andacht zuhörte, denn für uns andere war es nur ein Gestammel.
Die Verse des guten Jungen sind aber doch gar zu kindlich, äußerte ich einmal gegen ihn, da sah er mich seltsam an und erwiderte: Gott ist mehr im Säuseln der Blätter als im Heulen des Sturmes. Lassen Sie mir Olafs Verse ungerupft.
Wenn wir anderen auch mit Olafs Gedichten nicht viel anzufangen wußten, für die lebendige Poesie seiner Gegenwart hatten wir alle eine Empfindung. Wenn er hereintrat, so war's, als würde ein Veilchenstrauß auf den Tisch gestellt. Junge Mädchen, auch die lieblichsten und unschuldigsten, schienen im Vergleich zu ihm irdischer und minder rein. Von der Welt wußte er so gut wie nichts und mißtraute niemand. Er sah aus, als ob er die Sprache der Tiere verstünde und mit den Naturkräften auf du und du sei. Er hatte kein eigentliches Fachstudium, sondern hörte nur wenige Kollegien, die ihn besonders anzogen, aber er las viel, um die Mängel seiner Vorbildung auszugleichen, weil er durch Kränklichkeit am regelrechten Schulbesuch verhindert worden war. Zukunftspläne machte er auch keine, und er glich einer Pflanze, die nur zum Blühen, nicht zum Früchtetragen bestimmt ist. Es war ein offenes Geheimnis, daß er mit schwärmerischer Verehrung an der blassen Adele hing, die ihrerseits nur Augen hatte für Gustav Borck. Wenn sie mit der Bedienung der Korpsstudenten, die im großen Saale über uns ihren Stammsitz hatten, fertig war, kam sie herunter und setzte sich zu uns an den Tisch, um Gustav vorlesen zu hören.
Er nahm aber ihr Wohlgefallen kalt auf, und als ich ihn einmal damit neckte, sagte er obenhin:
Es gilt ja doch alles bloß der Montur (womit er seine stolze männliche Erscheinung meinte), für das Beste in uns haben die Mädchen keine Fühlhörner.
Überhaupt gefiel er mir in Frauengesellschaft am wenigsten. Ohne irgend frech zu sein, lag doch in seiner Stellung zum weiblichen Geschlecht so etwas wie eine leise Mißachtung.
Olaf Hansen sah dies auch, und es kränkte ihn für die mit Andacht Geliebte, weshalb er Gustav lange Zeit mit Zurückhaltung begegnete. Auch mochte das straffere, zielbewußte, norddeutsche Wesen den harmlos vor sich Hinlebenden befremden. Er war der einzige, der sich, freilich in der sanftesten Weise, seiner Herrschaft entzog. Dagegen beugte sich jener stolze Geist vor Olafs Kinderseele, und seltsam war es, daß, während wir anderen Olaf liebten und hegten, Gustav aber bewunderten, dieser der zarten, verletzlichen Menschenblume eine Art von Ehrfurcht entgegenbrachte. Die mißverstandenen Griechen, sagte er einmal, wußten wohl, warum sie im Jüngling, nicht in der Jungfrau, die aufgebrochene Blüte der Menschheit verehrten. Das Mädchen ist das unfertige, der Jüngling das vollendete Gebild. Seine Unschuld ist nicht Naturzustand wie die ihre, dumpf und pflanzenhaft, sie ist ein Zustand der Gnade, sehend, allumfassend wie das Sonnenlicht; in ihr spiegeln sich die ewigen Dinge.
Und später, setzte er wegwerfend hinzu, glaubt der Mann fortzuschreiten, weil er die vergänglichen besser sieht.
Eines Abends gesellte sich ein Durchreisender zu uns, der durch einen von der Gesellschaft eingeführt war. Er gehörte nicht zu den akademischen Kreisen, hatte aber dafür ein Stück Welt gesehen und betrug sich vorlaut und taktlos. Als es gegen Mitternacht ging und er schon mehrere Gläser Likör geleert hatte, begann er sich in Zweideutigkeiten zu gefallen, die Fräulein Adele veranlaßten, sich unauffällig in ihren Anrichtwinkel zurückzuziehen. Trotz der kalten Aufnahme, die er fand, und trotz der ablenkenden Zwischenreden des Verwandten, der ihn mitgebracht hatte, blieb der Eindringling in der angeschlagenen Tonart und begann gewisse Histörchen zu erzählen, die er für witzig hielt, die aber nur gemein waren.
Sei's, daß uns der Kopf schon schwer war vom genossenen Punsch, sei's, daß die Ödigkeit seines Sprechens sich lähmend auf uns legte, wir saßen angewidert aber stumm und fanden nicht den richtigen Augenblick, ihm das Wort zu entziehen; er brachte auch nichts geradezu Grobunanständiges vor, es war nur wie leises Einsickern von schmutzigem Wasser und dazu noch ganz unsäglich albern. Olaf legte den Kopf gegen die Stuhllehne und schloß die Augen, als ob ihm körperlich übel würde.
Da erhob sich Borck, der bisher mit verächtlich zuckenden Mundwinkeln gesessen hatte, und bewegte sich nach dem unteren Tischende. Ich glaubte, er wolle seinen Hut vom Nagel nehmen, um fortzugehen, aber er packte den Eindringling am Kragen, schüttelte ihn mit einer Kraft, die niemand hinter seiner schlanken Gestalt gesucht hätte, und stieß ihm den Kopf auf die Tischplatte, riß ihn dann wieder in die Höhe, drückte ihn abermals auf den Tisch, und so sechs- bis siebenmal in regelmäßigen Absätzen, daß es dröhnte und dem Gemaßregelten Hören und Sehen verging. Dann kehrte er gelassen an seinen Platz zurück, als wäre nichts geschehen. Niemand sagte ein Wort zu dem seltsamen Auftritt, auch nicht der Gezüchtigte selbst, der eine Zeitlang ganz benommen saß, mit blöden Augen vor sich hinglotzte und sich dann taumelnd entfernte.
Wir waren noch alle stumm nach diesem unerwarteten Strafgericht, als Olaf sein Kelchglas erhob und feierlich sagte:
Auf Ihr Wohl, Borck!
Da sprangen alle auf die Füße und stießen mit an, auch jener Mitgast, der den Unhold eingeführt hatte und sich jetzt seines Schützlings schämte.
Als wir aufbrachen, glitt Adele wie eine Lazerte herbei und sagte, indem sie dem Helden des Abends den Hut reichte:
Das haben Sie großartig gemacht, Herr von Borck. Ich werde es nie vergessen, wie Sie den garstigen Menschen packten. Und ich muß Ihnen sehr, sehr danken.
Zum Danken liegt kein Grund vor, antwortete er kühl. Glauben Sie denn, ich möchte selber im Schmutzwasser baden? Ganz zerknickt schlich die Ärmste an ihren Anrichttisch zurück und hob die Augen nicht mehr auf, aus denen langsam zwei große Tränen herabrollten.
***
Studententage! Fülle des Daseins, wie ich sie nirgends wiedergefunden habe. Äußerlich fast unbewegt, aber mit geheimnisvollen Schätzen in der Tiefe, wie ein glatter Seespiegel über kristallenen Wunderpalästen. Alles war unser im Diesseits und Jenseits, wohin wir mit unseren Gedanken reichen konnten; Homer und Goethe, Platon und Schopenhauer, Kunst, Liebe, Unsterblichkeit. Durch Gustavs Nähe besaßen wir das alles. Mit seiner übermächtigen Phantasie zog er wie die thessalischen Zauberer Mond und Sterne zu sich herunter und hängte sie als Tafelbeleuchtung auf, daß wir oft nicht mehr wußten, in welcher Welt wir waren.
Vom Genius der Völker sprach er gern, und wie das eine sich vom anderen unterscheide. Wenn ich mich wunderte, woher er all diese Kenntnis eines Weitgereisten brachte, so lachte er mich aus:
Im kleinsten Teil ist das Ganze enthalten. Zeigt einem Künstler eine Hand, einen Fuß, er erkennt daraus die ganze Gestalt. Gebt mir ein einziges Dichterwerk eines Volkes, so weiß ich dieses Volkes Wesen und Wollen.
Frankreich lobte er, aber er liebte es nicht. Es war ihm das Land der großen Schriftsteller und der kleinen Dichter. Sein Schrifttum verglich er einem breiten, künstlich angelegten Berieselungsfeld, wo bei äußerster Ausnützung mäßiger Naturmittel eine reiche Ernte erzielt wird. Das war die Einleitung zu Anklagen feuriger Liebe gegen das eigene Volk.
Deutschland, du ewig morgiges, sagte er, du Widerspruch der Natur, Kind des Überflusses und der Not, das seine Fülle nicht beherrschen kann, die ihm immer überströmt, zerrinnt, daß es mit leeren Händen steht, und o Schmach! bei den ärmeren Nachbarn borgen geht.
Bei solchen Worten erhob sich dann wohl ein Sturm des Widerspruchs, aber er ließ sich nicht irremachen.
Welch ein Edelgut liegt verschüttet in unserem Boden: Kleist, Hebbel, Grabbe, Hölderlin! Wer nennt ihre Namen draußen in der Welt, und wer kennt sie bis heute im Vaterland! Und noch immer wächst die Zahl der Unverstandenen. Was wird das für ein Augenblick sein, wenn sie einmal alle aufstehen zur Geisterschlacht, ein Heer von lauter Feldherrn, um zusammen die Welt zu erobern.