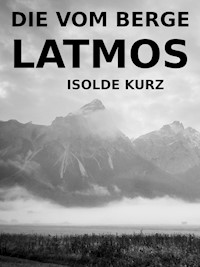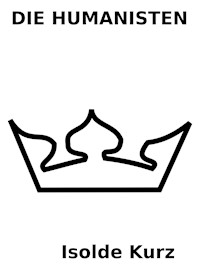Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pensa ist eine Erzählung von Isolde Kurz. Auszug: Diese Ermattung schien sich allmählich dem ganzen Raume mitzuteilen. Die Bilder an der Wand, vom vollen Sonnenschein getroffen, blinzelten schläfrig, der hohe grüne Wandschirm zwischen Bett und Thüre nickte so im Stehen ein, die Möbel knackten, als wollten sie sich recken und dehnen, und das kattunbezogene Kanapee in der Ecke sah aus, als werde es gleich alle Viere von sich strecken. Auch die übellaunige kleine Rekonvaleszentin gab den nutzlosen Kampf auf und schlummerte selber ein, wobei die Schweißperlen auf ihre blasse Stirn traten. Die Wärterin aber ließ den Kopf wohlig über die scharfe Kante des Stuhlrückens herabhängen, ohne von seiner Härte eine Empfindung zu haben. Nur der Tanz der Sonnenstäubchen in dem stillen Gemach dauerte fort, und ein paar Mücklein, die kümmerlich in den Vorhangfalten überwintert hatten und bei dem ersten warmen Sonnenblick wieder hervorgekommen waren, schwirrten in der Helle umher, wie um zu beweisen, daß es sich doch verlohnte, das bischen Leben gerettet zu haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pensa
PensaAnmerkungenImpressumPensa
Die Fenster des Krankenzimmers waren weit geöffnet und ließen die warme Frühlingsluft herein, die sich schon mit dem Blütenduft vom Viale her mischte. Die kleine Jessie, heute zum erstenmal fieberfrei, saß im Bettchen aufgerichtet und zupfte mit ihren spitzigen Fingerchen abgeschälte Hautfetzen von ihren mageren wachsweißen Händchen und Aermchen los. An dieser wunderlichen Unterhaltung mußte sich auch die junge Bonne beteiligen, die an ihrem Bette saß und einmal übers andere im Sitzen einnickte, denn sie war zwölf Nächte nicht aus den Kleidern gekommen. So oft sie aber ihr blasses Gesicht auf die Kissen niederfallen ließ, wurde sie von der Kleinen mit dem ungeduldigen Ruf: »Pensa! Aber Pensa!« weggestoßen und emporgezerrt, um dann gleich auf der anderen Seite wieder wie ein toter Körper vornüber zu fallen.
Diese Ermattung schien sich allmählich dem ganzen Raume mitzuteilen. Die Bilder an der Wand, vom vollen Sonnenschein getroffen, blinzelten schläfrig, der hohe grüne Wandschirm zwischen Bett und Thüre nickte so im Stehen ein, die Möbel knackten, als wollten sie sich recken und dehnen, und das kattunbezogene Kanapee in der Ecke sah aus, als werde es gleich alle Viere von sich strecken. Auch die übellaunige kleine Rekonvaleszentin gab den nutzlosen Kampf auf und schlummerte selber ein, wobei die Schweißperlen auf ihre blasse Stirn traten. Die Wärterin aber ließ den Kopf wohlig über die scharfe Kante des Stuhlrückens herabhängen, ohne von seiner Härte eine Empfindung zu haben. Nur der Tanz der Sonnenstäubchen in dem stillen Gemach dauerte fort, und ein paar Mücklein, die kümmerlich in den Vorhangfalten überwintert hatten und bei dem ersten warmen Sonnenblick wieder hervorgekommen waren, schwirrten in der Helle umher, wie um zu beweisen, daß es sich doch verlohnte, das bischen Leben gerettet zu haben.
Die goldene Standuhr, die so viel bange Stunden gezählt hatte, stand heute zum erstenmal still, daß es schien, als halte die Zeit den Atem an, um den erquickenden Schlaf der Kranken und der Gesunden nicht zu stören. Sie war daher auch nicht imstande, anzugeben, wie lang dieser Schlummer gedauert hatte, doch mußte es eine ziemliche Weile gewesen sein, denn die Sonne hatte unterdessen Zeit gefunden, ihren Platz zu wechseln, und den hellen Streif, worin die Mückchen und Stäubchen tanzten, an die andere Seite des Zimmers zu verlegen.
Mit einem Mal ward die Stille durch eine Klingel von der Gangthüre her unterbrochen. Schritte und Stimmen kamen über den Korridor, die Thür ging nicht eben geräuschlos auf und ein schöner, junger Mann, in der Uniform eines Stabsarztes, erschien auf der Schwelle. Ihm folgte die Mutter der kleinen Patientin, eine Frau mit harten männlichen Zügen und strengen blauen Augen, jener Sorte von Augen, die nicht bezaubern, sondern gebieten wollen und die ihre Inhaberin ohne weiters als Brittin kenntlich machen. Pensa war in die Höhe gefahren und stand ergebungsvoll mit gefalteten Händen am Bettende. Ihr Gesicht war mit Purpur übergossen und die vom Schlummer erfrischten Augen leuchteten. Auch die Kleine war erwacht und lächelte ihrem Doktor zu, der es so gut verstanden hatte, sich in ihre Gunst zu schmeicheln, daß sie sich von ihm jederzeit geduldig den Löffel in den Mund stecken ließ und ohne Widerspruch die Medizinen schluckte, die er verschrieb. Freilich in den Augen ihrer Wärterin war dabei wenig Verdienst; Pensa würde mit Freuden Gift genommen haben, wenn Er es der Mühe wert gehalten hätte, ihr welches zu verordnen.
Sie hatte auch Ursache, ihn zu verehren, den schönen jungen Doktor mit den goldenen Litzen auf dem Aermel, der immer so freundlich mit ihr sprach und keine Gelegenheit versäumte, ihr etwas Gutes zu thun. Während Jessie's Krankheit hatte sie ihn sogar einmal zu der Mutter ihrer Patientin sagen hören: »Signora, an diesem Mädchen haben Sie eine Perle gefunden.« Eine Perle! – Ihr Leben lang hatte noch niemand die arme Pensa eine Perle genannt, sie fühlte sich vor sich selbst emporgehoben und wäre von Stunde an für den Doktor Gusberti vom zweiten Bersaglieriregiment durch Wasser und Feuer gegangen.
Der Doktor fand den Zustand der Kleinen über Erwarten befriedigend, die Abschuppung auf gutem Wege und die Signora, die über Rückenschmerzen klagte, frisch wie eine Rose. Dann wollte er blitzschnell nach der Mütze greifen, um sich zu empfehlen, denn er liebte nicht die langen Krankenbesuche. Aber die Dame legte ihm nachdrücklich die Hand auf den Arm und sagte mit ihrem englischen Accent, den auch ein zehnjähriger Aufenthalt in der Toskana nicht zu mildern vermocht hatte:
»Gusberti, thun Sie mir noch den Gefallen und untersuchen Sie die Bonne, ich fürchte, sie wird mir auch krank. Sehen Sie nur, wie sie beständig die Farbe wechselt.«
Gusberti hatte auf einmal keine Eile mehr. Er legte die Mütze wieder ab, zog das junge Ding, aus dessen Gesicht jetzt wirklich die Flammen schlugen, mit sich ans Fenster und stellte eine eingehende Untersuchung an. Er hatte eine angeborene Sympathie für hübsche junge Mädchen, die er nicht zu verbergen suchte, und wenn er mit einem solchen sprach, gab er seiner Stimme den schmeichelnden Ton, wie ihn Erwachsene gegen hübsche Kinder anzuschlagen pflegen. Von Pensa hegte er überdies die beste Meinung, da er sie so brauchbar und treu am Krankenbette gesehen hatte, also lächelte er sie mit einer unverhohlenen Zärtlichkeit an, die dem guten Kinde wie ein Blick ins Paradies erschien, und fuhr ihr mit dem Handrücken über das brennende Gesicht. Nachdem er gewissenhaft den Puls befühlt und den Schlund besichtigt, knöpfte er mit einer Art, die keinen Widerspruch zuließ, ihr Leibchen auf und zog das grobe, doch zum Glück saubere Hemd etwas über die Achsel herunter, um sich zu überzeugen, daß kein Scharlach im Anzug sei. Hals und Schultern waren blendend weiß und aus dem festen Stoff, dessen Poren an das Korn des Marmors erinnern, und der kindliche Schnitt eines kleinen grauen Miederchens mit Achselträgern konnte die darunter schwellende Fülle nicht mehr verbergen.
»Gott, wie schön du bist, kleine Pensa!« rief Gusberti mit unbefangenem Entzücken, indem er zwei Schritte zurücktrat.
Das Mädchen zog in der Verwirrung die Schultern herauf und wollte sich wieder verhüllen, aber Gusberti ließ es nicht zu, ehe er sich durch den Augenschein von der völligen Abwesenheit jedes Ausschlags überzeugt hatte. Doch that er dies auf so diskrete Weise, daß auch die Padrona, welche daneben stand, keinen Anlaß zur Mißbilligung fand. Er verordnete gründliches Ausschlafen und guten alten Wein zur Stärkung und wollte dann eilig davonstürmen, aber die Signora rief ihm unter der Thüre nach:
»Und Ihre Mütze, Gusberti? Wollen Sie denn baarhäuptig fort?«
Er griff an den Kopf – richtig, die Mütze fehlte. Wo hatte er sie nur hingelegt? Pensa half ihm suchen und bei dieser Gelegenheit konnte er es nicht lassen ihr in der Ecke heimlich zuzuflüstern:
»Dir fehlt nichts, aber mir um so mehr. Pensa, Pensa, du hast mir heute ein Leides angethan. Wer giebt dir denn das Recht so schön zu sein?«
Pensa war elternlos und stand unter der Obhut eines geistlichen Verwandten, der seinen Pflichten vollauf genügt zu haben glaubte, als er sie im Haus des Majors Roselli unterbrachte. Sie stammte aus einer jener Soldatenehen, denen zwar nicht der Segen der Kirche, wohl aber die Anerkennung des Staates fehlt. Ihr Vater hatte als Unteroffizier bei den Carabinieri gedient, ein rauher piemontesischer Ehrenmann, der in seinem Leben nur die eine Ungesetzlichkeit begangen hatte, ihr das Dasein zu geben. Doch führte sie seinen Namen und er hatte gehofft, ihr dermaleinst als Unterlieutenant sogar eine kleine Mitgift zu hinterlassen. Diese Aussicht, zu der ihn seine Verdienste berechtigten, war der Traum seines Lebens; brachte er es bis zum Unterlieutenant, so brauchte er auch nicht mehr im Quartier zu schlafen, er konnte ein Familienleben führen und seinem Kind in Wahrheit Vater sein. Seine Frau hatte sich im Dienst herumdrücken müssen und war noch ganz jung wenige Tage nach Pensas Geburt im Spital gestorben. Aus Pietät für die Tote zog er ihre beiden Taufnamen Penelope und Elisa in einen zusammen und nannte das Kind Pensa; vielleicht wollte er auch sein ganzes inniges Gedenken in diesem selbstgeschaffenen Namen niederlegen. Pensa wurde bei guten Leuten im Sienesischen untergebracht und der Vater sorgte nach Kräften für sie, versäumte auch nie, wenn er Urlaub hatte, sie in Staggia zu besuchen und der stattliche Mann mit dem stolzen Zweispitz auf dem Kopf und den glitzernden Litzen auf den Aermeln erschien dem Mädchen wie der liebe Gott auf Erden. Sein ernstes gebräuntes Gesicht und die roten Streifen auf den Beinkleidern flößten ihr eine grenzenlose Verehrung ein, sie war überzeugt, daß es keine edlere und gebietendere Persönlichkeit auf der Welt geben könne, als ihren lieben Vater und ihr innigstes Bestreben ging darauf aus, sich der Ehre ihrer Abstammung würdig zu zeigen. Er war in ihren Augen sogar mehr als der Sindaco des Orts, denn dieser ging im abgeschabten Rock und auch bei den höchsten Gelegenheiten, wie dem Verfassungsfest und dem Geburtstag des Königs, trug er nichts Buntes als die dreifarbige Schärpe, während ihr Vater bei solchen Anlässen sogar eine große blau und rote Feder auf den Hut zu stecken hatte. Er kam auch nie mit leeren Händen dieser gute Vater; aber die kleinen Geschenke, die er brachte, waren niemals mädchenhafter Tand, sondern zielten immer in der einen oder andern Form auf eine moralische Wirkung ab. Seine größte Furcht war, daß es dem Kinde einst ergehen könne wie der Mutter oder vielleicht noch schlimmer, und er hätte sie lieber weniger hübsch gesehen, obgleich der niedliche Anblick ihn doch immer mit geheimem Vaterstolz erfüllte. Oft sprach er mit ihr von den Gefahren, denen ein unbeschütztes Mädchen ausgesetzt sei, und er pflegte dann halb im Scherz zu sagen: »Ich habe dich Pensa genannt, damit du denken sollst, denken, was recht und unrecht ist.«
»Nur brav bleiben,« schloß er gewöhnlich seine Ermahnungen, »das ist die Hauptsache, dann kommt das Glück von selbst.«
Nun, brav wollte sie schon bleiben, das sollte ihr nicht schwer fallen, hatte sie doch an ihrem Vater und den beiden Pflegeeltern das beste Beispiel vor Augen und daß das Glück auch einmal an sie kommen mußte, daran zweifelte Pensa nicht im geringsten, denn Gott ist ja so gut.
Einst hatte der Vater ihr eine schöne Photographie der Madonna della Seggiola geschenkt und sie dabei ermahnt, sie solle die Heilige jeden Tag bitten, daß sie ihr denken helfe, und wenn einmal das Herz mit dem Verstand durchgehen wolle, dann solle sie nur vor die Madonna treten und sie um Rat fragen; was die dazu sage, das sei gewiß das rechte. Das Bild war Pensas liebstes Eigentum, sie faßte es in einen hübschen Strohrahmen mit himmelblauen Schleifchen, die sie aus ihrer Sparbüchse kaufte, stellte ein Sträußchen steifer künstlicher Blumen davor, welche nach ihrer Meinung der Madonna viel gefälliger sein mußten, als die Blumen vom Felde, die ja gar nichts kosten und gleich verwelken, und machte von nun an all ihre kleinen Angelegenheiten mit der Mutter Gottes aus. Stundenlang konnte sie mit gefalteten Händen vor dem Bilde stehen und den schönen ernsten Knaben anstarren, zu dem sie eine leidenschaftliche Liebe gefaßt hatte, und gern hätte sie die Madonna gebeten, ihr auch einmal das Jesuskind auf den Schoß zu geben, sie wolle es gewiß nicht fallen lassen, aber das ging leider nicht an. Doch zum Lohn für ihre Frömmigkeit bekam sie von der Madonna ein so reines Herz, daß viele ihre Einfalt für Verstellung hielten.
Schon bei der ersten Kommunion hatte sie das allgemeine Aufsehen erregt: denn als sie im weißen Kleid, von allen Sünden reingesprochen, unter den Mädchen kniete und der Priester sich eben zur Messe anschickte, hörte man plötzlich Pensas Stimme, die in hellem Jammer rief:
»Ach, Herr Erzpriester, verzeihen Sie, ich hab' eine vergessen« – und unter dem unterdrückten Gekicher der Mädchen und den spöttischen Blicken der Jungen lief das gute Kind aus den Reihen heraus dem Priester nach, um sein Gewissen zu erleichtern.
»Warte, warte, liebes Kind,« antwortete der, »bis ich mit der Messe fertig bin. Knie nur dort vor dem Beichtstuhl nieder, ich komme gleich.«
So mußte das unschuldigste Lamm in der ganzen Heerde an dem heiligen Ort wie eine Ausgestoßene abseits knieen, und in ganz Staggia sprach man noch lange von der großen Sünde der kleinen Pensa, die der alte Geistliche unter dem Beichtsiegel lächelnd mit sich hinwegnahm.