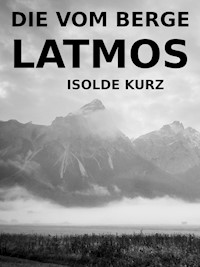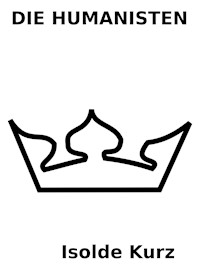0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schuster und Schneider ist eine Erzählung von Isolde Kurz. Auszug: Paul Andersen war, wie so mancher junge Künstler vor ihm, auf einer Studienreise in Italien hängen geblieben und hatte niemals wieder den Rückweg nach Deutschland gefunden. Ueber seine Aussichten gab er sich selber keiner Täuschung hin, er besaß weder Vermögen, noch die nötige Protektion, um sich auf dem fremden Boden vorwärts zu bringen, auch war sein Talent und sein Selbstgefühl von dem überwältigenden Anblick der großen Alten allmählich so zusammengedrückt worden, daß er es kaum mehr wagte, den Pinsel in eigener Sache einzutauchen, sondern sich zumeist auf das Kopieren alter Bilder warf. An diese Aufgabe wandte er den ganzen Ernst und Fleiß und die unermüdliche Treue seiner tiefgründigen Natur und die Eigentümlichkeiten der alten Meister wurden ihm mit der Zeit so geläufig, daß für ein ungeübtes Auge seine Kopien von den Originalen kaum zu unterscheiden waren. Darüber ging freilich die eigene schöpferische Kraft zu Grunde und sein Interesse beschränkte sich bald ganz auf das Ausdenken technischer Kunstfertigkeiten im Behandeln der Farben und Leinwand, wodurch er seinen Arbeiten auch noch das Aussehen des Alters gab und sie den Urbildern auf Haaresbreite vollends annäherte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 40
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Schuster und Schneider
Schuster und SchneiderAnmerkungenImpressumSchuster und Schneider
Paul Andersen war, wie so mancher junge Künstler vor ihm, auf einer Studienreise in Italien hängen geblieben und hatte niemals wieder den Rückweg nach Deutschland gefunden. Ueber seine Aussichten gab er sich selber keiner Täuschung hin, er besaß weder Vermögen, noch die nötige Protektion, um sich auf dem fremden Boden vorwärts zu bringen, auch war sein Talent und sein Selbstgefühl von dem überwältigenden Anblick der großen Alten allmählich so zusammengedrückt worden, daß er es kaum mehr wagte, den Pinsel in eigener Sache einzutauchen, sondern sich zumeist auf das Kopieren alter Bilder warf. An diese Aufgabe wandte er den ganzen Ernst und Fleiß und die unermüdliche Treue seiner tiefgründigen Natur und die Eigentümlichkeiten der alten Meister wurden ihm mit der Zeit so geläufig, daß für ein ungeübtes Auge seine Kopien von den Originalen kaum zu unterscheiden waren. Darüber ging freilich die eigene schöpferische Kraft zu Grunde und sein Interesse beschränkte sich bald ganz auf das Ausdenken technischer Kunstfertigkeiten im Behandeln der Farben und Leinwand, wodurch er seinen Arbeiten auch noch das Aussehen des Alters gab und sie den Urbildern auf Haaresbreite vollends annäherte.
Obgleich er nun so hoch über dem Troß der Kopisten stand, wie die alten Meister über ihm, brachte er sich doch nur kümmerlich fort, denn er wußte sich keine Geltung zu verschaffen und fast alle seine Bestellungen gingen durch dritte Hand, wobei die Hälfte der Einnahmen unterwegs blieb. Dennoch zog er dieses trübe schattenhafte Dasein dem freundlichen aber spießbürgerlichen Sonnenschein seiner heimischen Verhältnisse bei weitem vor, und war gesonnen, in Florenz zu leben und zu sterben. Nie gönnte er sich eine Abwechslung oder Zerstreuung, die Geld gekostet hätte und die ängstliche Gewissenhaftigkeit, mit der er über seine Ausgaben wachte, wurde ihm im Lauf der Jahre zur zweiten Natur. Das Erdarbte brachte er seiner Braut, einem blonden schüchternen Mädchen, das als Gouvernante in einer kinderreichen deutschen Fabrikanten-Familie auch nicht auf Rosen gebettet war. Diese trug es mit dem ihrigen auf eine Bank, wo sie sich von einem Kommis, der ihr persönlich bekannt war, beim Ankauf der Papiere beraten ließ. Paul Andersen mischte sich nie in dieses Geschäft, er war bei aller Besonnenheit ein wenig Phantast und sah das Geld für eine dämonische, dem Menschen feindselige Natur an, mit der er so wenig wie möglich zu schaffen haben mochte, ja er fühlte sich immer ordentlich erleichtert, wenn die kleinen Summen, die er bei Seite legen konnte, nicht mehr in seinen Händen waren.
In der Via Ghibellina bewohnte er hoch oben im dritten Stockwerk eines alten Hauses zwei dürftig eingerichtete Zimmer, deren eines mit Bilderrahmen, Mappen und Skizzenbüchern angefüllt war und deshalb das Atelier hieß, obwohl er nicht darin malte. Eine zerbröckelnde steinerne Terrasse, die an seinen Korridor stieß und auf den sogenannten »Garten«, einen gepflasterten Hof mit mehreren Bäumen hinuntersah, wurde ihm von der Wirtin noch unentgeltlich zum Trocknen seiner Bilder überlassen.
Diese Terrasse war seine einzige Freude, denn er, dem alles andere fehlschlug, hatte eine glückliche Hand für Blumen und schuf sich den trübseligen Winkel, den zuvor nur Waschseile mit aufgehängten Hemden und zerrissenen Strümpfen zu schmücken pflegten, in ein kleines Paradiesgärtlein um, in dem es das ganze Jahr hindurch Frühling war. Aus Sämereien und Setzlingen zog er seine Blumen, die sich Kopf an Kopf in dreifacher Abstufung die steinerne Ballustrade hinandrängten, während dunkle Blattpflanzen, deren ihm keine je verdarb, in diesem Farbenkonzert den Grundbaß spielten. Der Duft seiner Terrasse füllte wetteifernd mit dem Firnißgeruch der Bilder das ganze Haus. Jeden Abend schleppte er selber einen großen Eimer Wasser, der den Tag über im Hof gesonnt werden mußte, seine drei Treppen hinauf, um die Blumen zu begießen, und wenn er sich auch in den heißesten Monaten nicht entschließen konnte, die Stadt zu verlassen, so geschah es ebenso sehr aus Rücksicht auf seine Blumen, wie auf sein Budget.
Im Winter wurde die Terrasse durch große Glasscheiben, den einzigen Luxus, den Paul Andersen sich gestattete, geschützt. Dorthin zog er sich zurück, wenn die Tramontana das Haus rüttelte und er zu sparsam war, um einzuheizen, und in den schwülen Sommernächten, wo die Zimmer vor aufgespeicherter Tageshitze dampften, saß er draußen auf seiner Terrasse beim Schein der Lampe lesend oder in einsamer Grübelei.
Ab und zu aber wurde dies stille, heimliche Blumenland der Schauplatz einer lärmenden Orgie. Dies geschah, wenn es dem Bewohner des ersten Stockwerks, dem tollen Baron Neubrunn, einfiel, die gemeinsamen Freunde zu einer Bowle auf Andersens Terrasse einzuladen. Dann widerhallte der schweigsame Hofraum von deutschen Studentenliedern, italienischen Operettenmelodien und einem Gewirr lachender, trunkener Stimmen, durch die Neubrunns Baß wie ein Trompetentusch hindurchklang. Und Paul Andersens weiße, zärtliche Azaleen, seine stolzen Marschall-Niel-Rosen und lachenden Chrysanthemen wunderten sich über die seltsamen Reden, die in solcher Nacht an ihren Ohren vorüberrauschten, noch mehr aber wunderten sie sich über ihren Herrn, der aufgelöst von Weingenuß und Wohlbehagen unter den ausgelassenen Gästen saß und seinen ganzen innern Menschen in einem Strom von Lebenslust badete. Nur daß er jedesmal nach einer solchen Entladung sich auf lange Zeit um so hartnäckiger in sich selbst verbiß, wofür ihn sein Freund Neubrunn, dem ein Tag wie der andere im Genuß verging, einen Greis ohne Vergangenheit schalt.